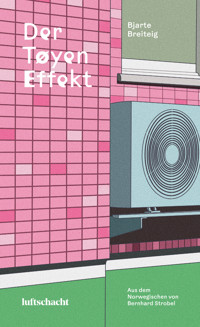Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den ersten Blick scheint Martin ein ganz normaler Vater zu sein. Er hat zwei Söhne im Kindergartenalter und ist mit der ehrgeizigen Gina verheiratet. Er ist mitfühlend, empfindsam, nachdenklich und übernimmt mehr als die von ihm erwarteten häuslichen Pflichten. In seiner Freizeit kümmert er sich auch um seine gebrochene Jugendliebe und ihre Tochter Selma. Als er eines Nachmittags Besuch von der Polizei bekommt, scheint das Bild des sorgsamen Familienvaters Risse zu bekommen. Die kleine Selma könnte Opfer eines Übergriffs gewesen sein und Martin steht plötzlich unter schwerem Verdacht. Schritt für Schritt wird ein Leben aufgedeckt, das ganz anders ist, als es an der Oberfläche bislang ausgesehen hat. Feinfühlig und sensibel untersucht Bjarte Breiteig in seinem ersten Roman die erschreckenden Abgründe in einer scheinbaren Geborgenheit. Knapp und nüchtern zeichnet er in Meine fünf Jahre als Vater das Portrait eines Mannes, der von sehr viel Liebe erfüllt ist, aber auch von sehr viel Dunkelheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
°luftschacht
Bjarte Breiteig
Meine fünf Jahre als Vater
Roman
aus dem Norwegischen vonBernhard Strobel
Luftschacht Verlag
© 2014 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, Oslo, NorwayThis translation has been published with the financial support of NORLA.
Titel der norwegischen Originalausgabe: Mine fem år som far
© Luftschacht Verlag – Wien 2016Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
www.luftschacht.com
Umschlaggrafik: Bruch—Idee&FormSatz: Luftschacht, Alexander BrauneggISBN: 978-3-902844-59-0eISBN: 9783902844828
Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien
Meinem Kollegen und FreundØyvind Ellenes
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
I
Wir saßen am Küchentisch, als die Polizei kam. Es war ein Dienstag, und wie jeden Dienstag gab es Fisch. Für gewöhnlich hielten wir es eher schlicht – ein Auflauf oder eine Packung Fischstäbchen –, doch an diesem Dienstag war mir spontan die Idee gekommen, mit den Jungs zum Fischereihafen hinunterzugehen und Makrelen zu kaufen. Zu Hause hatte ich den Fisch in reichlich Butter gebraten, hatte aber vergessen, den Dunstabzug einzuschalten, weshalb die Küche von diesem unangenehmen Qualm erfüllt war, der so schwer hinauszubekommen ist. Die Jungs wollten nicht essen. Sie waren unruhig und quengelten, weil sie lieber Eis wollten, doch als es klingelte, verstummten sie plötzlich und stürmten hintereinander die Treppe hinunter, beide in ihren Strumpfhosen, und kamen voller Erwartung wieder herauf.
»Für dich, Papa.«
»Wer ist es?«
»Keiner, den wir kennen.«
Widerwillig stand ich auf. Ich hatte mich auf einen Abend im Arbeitszimmer gefreut, und es genügte ohnehin die geringste Störung, dass meine Konzentration abriss. Am Abend davor hatte ich den Anfang einer Erzählung geschrieben – meiner ersten –, und vor Überraschung, wie richtig es sich anfühlte, war ich von einem so starken Schreibdrang übermannt worden, wie ich ihn seit meinen ersten literarischen Versuchen vor einigen Jahren nicht mehr empfunden hatte. Ich hatte auch schon Ideen zu anderen Erzählungen, und ich ahnte, dass dies der Keim für mein erstes Buch sein könnte.
Draußen auf den Steinfliesen, im Schutz vor dem Regen unter der neuen Veranda, standen ein Mann und eine Frau, die ich nie zuvor gesehen hatte, beide in modernen Allwetterjacken. Der Mann mochte um die sechzig sein. Die Frau war jünger, in meinem Alter, und hatte den Ohrhörer eines Headsets im Ohr. Hinter ihnen parkte ein dunkler Saab, auf dessen Motorhaube der Regen prasselte. So, wie er da stand, würde er den Nachbarn den Weg versperren, sollte einer von ihnen hinein- oder hinauswollen, dachte ich, sagte aber nichts.
»Sind Sie Martin Havn?«, fragte die Frau.
»Ja«, sagte ich. »Worum geht es?«
Beide zeigten mir eine Plastikkarte, auf der jeweils ein Foto sowie die Aufschrift POLIZEI zu sehen waren, und fragten, ob sie mir einige Fragen stellen dürften.
»Können wir kurz reinkommen?«, fragte die Frau.
Ich zögerte.
»Wir sitzen gerade beim Essen«, sagte ich. »Es gibt Fisch.«
Ich ärgerte mich über die unnötige Information.
»Wir können warten«, sagte die Frau. »So viel Zeit haben wir doch, Borgen?«
Der Mann sah auf die Uhr.
»Lassen Sie halt den Nachtisch aus«, sagte er.
Ich ließ sie herein. Sie zogen artig ihre Schuhe aus und folgten mir die Treppe hinauf. Sie nickten zu Gina und den Jungs in die Küche, bevor sie ins Wohnzimmer weitergingen. Gina winkte mich zu sich.
»Wer sind die?«, fragte sie.
»Sie sind von der Polizei«, sagte ich. »Sie haben irgendwelche Fragen.«
»Du meine Güte«, sagte sie. »Ist was passiert?«
»Ich weiß nicht.«
»Du müsstest ihnen fast etwas anbieten. Soll ich was bringen? Bier, vielleicht?«
»Bier?«, sagte ich, »für die Polizei?«
»Nein, nein, aber Kaffee?«
»Nicht nötig«, sagte ich. »Sie bleiben nicht lang.«
Ich schloss die Küchentür. Irgendwas aber war nach dem Umbau mit den neuen Türen geschehen; sie waren gewissermaßen in ihren Rahmen aufgequollen, und ich musste sie fest zuwerfen, damit sie richtig schlossen.
Die zwei Polizisten hatten sich an den Wohnzimmertisch gesetzt, auf dem die Zeichenutensilien der Jungs über die Wachstischdecke verstreut lagen. Buntstifte, mehr oder weniger fertige Zeichnungen, dazwischen kleine Häufchen mit den Abfällen vom Bleistiftspitzen. Sie hatten ihre Jacken über einen freien Stuhl gehängt, und ich konnte sehen, wie das Kabel des Headsets unter dem sportlichen Pullover der Frau verschwand.
»Sie können gern fertigessen«, sagte sie.
»Nein, nein«, sagte ich. »Ich wärme es nachher auf.«
»Makrelen?«, fragte er.
»Ja«, sagte ich.
»Bitte, setzen Sie sich.«
Er deutete mit einem Finger auf den Platz gegenüber der Frau. Ich wählte stattdessen den Platz ihm gegenüber, wogegen er nichts einzuwenden hatte. Es verging einige Zeit, ohne dass jemand etwas sagte. Borgen begutachtete die Kinderzeichnungen, drehte ein paar von denen, die am ehesten fertig aussahen, herum, damit er sie richtig ansehen konnte.
»Ihre Jungs zeichnen also gern?«
»Hauptsächlich wenn es regnet«, sagte ich. »Sonst spielen sie meistens draußen.«
»Aber sie sind gut«, sagte er. »Finden Sie nicht?«
Er hielt eine Zeichnung vor mir in die Höhe und ich erkannte sofort Tors unsicheren Stil. Tor fand selten eigene Motive, zeichnete lieber die von Jonas nach. Ich empfand eine gewisse Erleichterung, dass sie diesmal nur eine Gruppe von Bäumen darstellte; was sie sonst zeichneten, war oft so blutig: Schwerter, Pistolen und abgehackte Körperteile. Oft fragte ich mich, woher sie das hatten. Wir waren streng bei der Auswahl der Fernsehprogramme.
»Doch, ja«, sagte ich. »Sie zeichnen ganz gut.«
Ich fügte scherzhaft hinzu, dies sei ein Talent, das sie nicht von mir hätten, sondern von ihrer Mutter.
»Von Gina?«, sagte die Frau.
»Von Gina, ja«, sagte ich.
Sie lächelte auf eine Weise, die ich unter anderen Umständen als flirtend aufgefasst hätte, band sich das Haar zu einem straffen Pferdeschwanz, wodurch der weiche Flaum vor ihren Ohren freigelegt wurde. Ein ungewöhnliches Wort tauchte in mir auf: delikat. Denn das war sie, delikat. Sie warf einige Blicke durchs Wohnzimmer, auf die noch immer fast nackten Wände, und fragte, ob wir eben erst eingezogen wären.
»Ja, jetzt im Sommer«, sagte ich.
Und wie immer, wenn jemand auf das Haus zu sprechen kam, konnte ich mich in meinem Stolz nicht zurückhalten und erklärte, dass es das Haus meiner Kindheit sei und wir ein ganzes Jahr gebraucht hätten, um es herzurichten und den Zubau fertigzustellen. Das Ergebnis würden sie selbst sehen, sagte ich. Darunter hätten wir eine Einliegerwohnung eingerichtet – ich deutete auf den Fußboden –, dort, wo später das Jugendzimmer der Jungs entstehen sollte.
»Und jetzt haben wir uns endlich fertig eingerichtet«, sagte ich und lächelte.
»Sie haben Glück«, sagte die Frau. »Zurzeit reißen sich alle um Einfamilienhäuser.«
Borgen kreiselte einen Finger neben seinem Kopf.
»Es ist Wahnsinn, wie teuer es geworden ist«, sagte er.
»Sie arbeiten auch hier zu Hause?«, fragte die Frau.
»Ja«, sagte ich. »Ich habe ein Arbeitszimmer.«
»Und Sie schreiben?«
Ich stutzte, denn das mit dem Schreiben war nicht offiziell. Ich hatte einige Jahre zuvor Texte in einer Zeitschrift veröffentlicht. Ob ihnen das zu Ohren gekommen war?
»Ich arbeite hauptsächlich als Übersetzer«, sagte ich.
»Machen so was heutzutage nicht Maschinen?«, fragte Borgen.
»Nicht alles«, sagte ich. »Und es muss ja auch kontrolliert werden.«
Er nahm einen Wachsmalstift vom Tisch und schrieb damit etwas unter Tors Zeichnung. Dann hielt er sie erneut vor mir hoch.
SELMA STRØM, 4 JAHRE
Er hatte es mit gekünstelten Kinderbuchstaben geschrieben. Ich fühlte, wie sich etwas in mir zusammenzog.
»Ist Ihnen der Name bekannt?«, fragte die Frau.
Ich runzelte besorgt die Augenbrauen.
»Selma ist doch hoffentlich nichts passiert?«, sagte ich.
»Bitte beantworten Sie die Frage«, sagte sie.
Ich antwortete, ich wisse sehr gut, wer Selma sei, dass sie die Tochter von Ginas Freundin Lillian sei und sie oft bei uns zu Besuch seien.
»Nicht sie bei ihnen?«, fragte sie.
»Doch, natürlich, das auch«, sagte ich. »Bevor wir umgezogen sind, waren wir Nachbarn, und wir treffen uns immer noch oft.«
»Wann haben Sie Selma das letzte Mal gesehen?«
»Warum fragen Sie? Ist sie verschwunden?«
»Antworten Sie einfach.«
»Am Samstag«, sagte ich. »Da waren wir zum Pizzaessen bei ihnen.«
»Stimmt es, dass Sie und Lillian Strøm früher ein Paar waren?«, fragte Borgen.
Ich blickte von der einen zum anderen. Genauso wie bei den wenigen anderen Anlässen, bei denen ich mit der Polizei zu tun gehabt hatte, hielt ich es für wichtig, mich so normal wie möglich zu verhalten. Gerade deshalb hatte alles, was ich sagte und tat, etwas Künstliches an sich. So wie der Ellbogen, den ich jetzt wie beiläufig an die Tischkante legte: Ich zog ihn wieder zurück, was den gekünstelten Eindruck noch verstärkte.
»Das kann ich bestätigen«, sagte ich.
Sie brachten mich dazu, dass ich mich solcher Wörter bediente: bestätigen. Ich erklärte, dass Lillian und ich sehr früh zusammengekommen waren und wir viele Jahre eine Beziehung gehabt hatten. Sie war eine Stufe unter mir auf das Gymnasium gegangen, und wir waren in derselben Jungschargruppe gewesen. Ich erzählte auch, dass wir ein paar Jahre zusammengewohnt hatten, während wir beide an der Fachhochschule studierten.
»Aber dann haben Sie sich in ihre Freundin verliebt?«, sagte Borgen.
»So einfach war es nicht«, sagte ich.
»Es ist nie einfach«, sagte die Frau. »Ich bin selber geschieden.«
»Ich bin auch geschieden«, sagte Borgen. »Es ist nicht einfach.«
Draußen auf dem Gang hörte ich die Jungs flüstern. Gina musste ihnen erlaubt haben, vom Tisch aufzustehen, und nun schlichen sie herauf zur Tür und drückten Stirn und Nase flach gegen das Glas. Die Frau schrieb etwas auf einen Block. Das war mir bis dahin nicht aufgefallen: dass sie sich Notizen machte. Auch jetzt, als ich schwieg, schrieb sie. Ich konnte sehen, dass sie ganz oben auf die Seite meinen Namen und das Datum geschrieben hatte, aber die Aufzeichnungen darunter waren aus meinem Blickwinkel nicht zu lesen. Bis jetzt war es mir gelungen, eine Art vertrauenerweckende Ruhe zu bewahren, doch beim Anblick dieser gekritzelten Schrift, die sozusagen mich repräsentieren sollte, platzte etwas in mir und meine Fragen kamen wie eine Lawine, mit viel zu lauter Stimme, was denn nun mit Selma sei, ob ich verdächtigt werde, und wenn ja, worin dieser Verdacht bestehe; lägen irgendwelche Anzeigen gegen mich vor? Wieso hätten sie nicht einfach angerufen oder mich aufs Revier bestellt, anstatt hier bei mir hereinzuplatzen, vor Gina und den Kindern? Wüssten sie nicht, was für Gerüchte daraus entstehen konnten? Wüssten sie nicht, dass das eine Familie zerstören konnte? Sie ließen mich weiterreden, saßen schweigend wie zwei Psychologen, und warteten, bis ich fertig war. Als die Frau endlich wieder das Wort ergriff, lag Wärme in ihrer Stimme.
»Wir verstehen, dass das unangenehm für Sie ist«, sagte sie. »Aber solange Sie nichts zu verbergen haben, haben Sie auch nichts zu befürchten.«
»Sie vergessen die Gerüchte«, sagte ich.
»Wir haben Schweigepflicht«, sagte Borgen, indem er einen unsichtbaren Reißverschluss vor seinem Mund zuzog. Ich überlegte, ob ich ihn nicht doch schon irgendwo gesehen hatte. Könnte er Mitglied der Pfarrgemeinde gewesen sein, der ich einmal angehört hatte? Ich erinnerte mich gut an diese zuverlässigen Männer, die durch nichts herausstachen, aber an dem ihnen zugeteilten Sonntag getreulich mit einem Partner in der Tür standen und Gesangsbücher austeilten – um dann, am Ende des Gottesdienstes, mit dem Kollektenkörbchen durch die Bankreihen zu gehen. Schon damals, als ich noch Christ war, hatte ich eine große Verachtung für diese frommen, gesichtslosen Gemeindemitglieder gehegt.
»Was wollen Sie wissen?«, fragte ich.
»Erzählen Sie frei heraus, was Sie Sonntagabend getan haben.«
»Frei heraus?«
»Fangen Sie damit an, wo Sie waren.«
»Hier«, sagte ich. »Zu Hause.«
Ich dachte kurz nach. Ich sagte, dass ich Sonntagabend übrigens auch bei meiner Mutter gewesen war. Ich erklärte, dass sie pflegebedürftig sei und in dem neuen Gebäude mit den behindertengerechten Wohnungen draußen am Kulleråsen wohne. Normalerweise besuchte ich sie dort jeden Sonntag, und auch sonst häufig.
»Wann am Abend waren Sie dort?«, fragte Borgen.
»Von acht bis … elf vielleicht?«, sagte ich.
»Sind Sie mit dem Auto gefahren?«
»Oh ja, zum Gehen ist das zu weit.«
»Sie könnten mit dem Rad gefahren sein«, sagte er. »Sie fahren doch gern mit dem Rad?«
»Ich habe das Auto genommen«, sagte ich.
»Was sagen Sie dazu, dass Ihr Auto Sonntagabend um halb zehn an einem ganz anderen Ort beobachtet wurde?«
»Wo sollte das gewesen sein?«
»Vor dem Haus von Selma Strøm.«
»Nein«, sagte ich. »Das stimmt nicht.«
Borgen deutete auf seine Augen.
»Es wurde beobachtet«, sagte er.
»Dann muss es ein Auto gewesen sein, das so ähnlich aussieht«, sagte ich.
»Sie fahren einen grauen Corolla?«
»Ja, das ist ein sehr gängiges Auto.«
»Mit einem Kind-fährt-mit-Aufkleber auf der Heckscheibe?«
Ich antwortete nicht. Es war erst zwei Wochen her, dass wir diesen Aufkleber von dem Verkehrsclub, bei dem die Jungs Mitglied waren, angebracht hatten. Ich hatte ihnen erlaubt, in die Garage zu kommen und ihn selbst aufzukleben. Er war schief und voller Blasen. Die Frau fragte, ob meine Mutter den Besuch bestätigen könne.
»Meine Mutter?«, sagte ich.
»Sie werden verstehen, dass wir das mit ihr abklären müssen«, sagte sie.
»Tun Sie das nicht«, flehte ich. »Ziehen Sie sie da nicht mit rein.«
»Wieso nicht?«
Darauf konnte ich nicht gleich antworten. Ich stand auf und stellte mich vor das Fenster zur Veranda, versuchte, den Blick auf die Regentropfen zu fokussieren, die auf das frische Holz trafen, aber es war zu spät. Denn da war es bereits wieder, das altbekannte Brennen hinter den Augen – diese Schwäche, die mir all die Jahre über so viele Demütigungen eingebracht hatte und die mir auch jetzt nicht erspart bleiben sollte. Feucht und warm floss es meine Wangen und den Hals hinunter, während ich mich bemühte, meinen zitternden, stoßartigen Atem zu kontrollieren. In der Stille hinter mir hörte ich den Kugelschreiber der Frau auf dem Notizblock, und sie selbst, die flüsterte: Nicht jetzt.
Es dauerte einige Minuten, bis ich mich wieder unter Kontrolle hatte. Weder Triumph noch Schadenfreude war ihnen anzumerken, als ich mich wieder setzte. Wie immer, nachdem ich geweint hatte, empfand ich eine Art Reinigung. Es gelang mir sogar, ein kleines Lächeln hervorzuzaubern.
»Wo waren wir?«, fragte ich.
»Das alles tut uns leid«, sagte Borgen. »Wir machen nur unseren Job.«
»Ich verstehe das«, sagte ich.
»Und was Sie sagen, stimmt nicht.«
Es klopfte an der Wohnzimmertür. Gina kam mit einem Tablett herein, auf dem sich eine Stempelkanne und Kaffeetassen befanden. Sie stützte das Tablett auf der Tischkante ab und beugte sich vor, um zwischen den Zeichenutensilien der Jungs Platz zu schaffen. Ich sah den verstohlenen Blick, den Borgen in ihren Ausschnitt warf, und irgendwo in mir drin spürte ich eine alberne Genugtuung: Die Polizistin war zwar stramm und delikat, aber was die Brüste anging, konnte sie Gina nicht das Wasser reichen. Gina begegnete meinem Blick und sah, dass ich geweint hatte.
»Aber Martin«, sagte sie, »was hast du?«
»Nichts«, sagte ich.
»Es sieht ja so aus, als …«
Ich musste wegsehen. Ihre Stimme hatte etwas an sich, das ich mir so sehnlich herbeigewünscht hatte, von dem ich jetzt jedoch spürte, dass es mich wieder zum Weinen bringen könnte, und ich hoffte nur, sie würde gleich wieder gehen. Sie blieb noch kurz stehen, unschlüssig, wahrscheinlich weil sie darüber nachdachte, was sie noch tun könnte, bevor ihr klar wurde, dass es nichts gab, und sie das leere Tablett mit hinausnahm und die Tür hinter sich schloss. Zurück blieben Kaffeekanne und Tassen wie eine Aufgabe, die ich zu bewerkstelligen hatte. Ich lehnte mich in meinem Stuhl nach vorn, um den Stempel hinunterzudrücken, was mir mit Mühe gelang, und ich musste mitten in der Bewegung aufstehen. Doch als ich dann für alle einschenkte – zuerst der Frau, dann Borgen und anschließend mir selbst –, gelang es mir mit einem steten Strahl und ganz ohne Zittern, und das verlieh mir neues Selbstvertrauen. Ich sagte, dass sie offenbar eine ganze Menge über mich wüssten, eine Sache allerdings wüssten sie offenbar nicht, nämlich dass meine Mutter an Alzheimer leide. Ich warf ihnen der Reihe nach einen ernsten Blick zu und erklärte, dass meine Mutter in Stresssituationen leicht durcheinander gerate, Situationen wie die, welcher sie ausgesetzt wäre, wenn sie bei ihr auftauchten.
»Ersparen Sie ihr das!«, bat ich.
»Sie bleiben also bei Ihrer Aussage?«, fragte die Frau.
»Ja«, sagte ich.
Sie wirkte enttäuscht. Wieder hörte ich etwas aus dem Headset, eine gedämpfte Stimme, die direkt in ihr Ohr hinein sprach, und diesmal antwortete sie okay in die Grube an ihrem Hals und nickte Borgen kurz zu. Er stand auf und sagte, sie müssten jetzt weiter.
»Möchten Sie noch etwas hinzufügen, bevor wir gehen?«, fragte er.
»Ich hätte gerne gewusst, worum es hier geht?«, sagte ich.
»Wir wollen ganz ehrlich sein«, sagte er, »wir wissen es selber noch nicht genau.«
»Bald werden wir mehr wissen«, sagte die Frau. »Wir müssen jetzt weiter, aber wir werden auf Sie zurückkommen.«
»Viel zu tun zurzeit«, erklärte Borgen.
Beide legten ihre Visitenkarte vor mich auf den Tisch. Die Frau sagte, dass ich nur anzurufen bräuchte, wenn ich noch mehr zu sagen hätte, am besten jedoch zu den Bürozeiten.
»Oder schicken Sie eine E-Mail«, sagte Borgen. »E-Mail geht auch.«
Sobald sie gegangen waren, kam Gina zu mir, mit einer Glut im Blick, die ich lange nicht mehr bei ihr gesehen hatte. Sie sagte, ich müsse ihr alles erzählen. Wir setzten uns an den Küchentisch, auf dem noch immer das Essen stand, aber mit den Kindern um uns herum konnten wir nicht so gut reden. Was ich erzählen konnte, war, dass es um Selma ging, um etwas, das Sonntagabend passiert war.
»Mit Selma?«, sagte Gina. »Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht.«
»Etwas Ernstes?«
»Ich weiß nicht«, wiederholte ich. »Sie haben so gut wie nichts gesagt.«
»Das ist zwei Tage her«, sagte sie. »Wieso hat Lillian nicht angerufen?«
Ich sagte noch einmal, dass ich es nicht wisse. Ich erklärte, jemand glaube, unser Auto Sonntagabend vor Lillians Haus gesehen zu haben – sicher irgendjemand, der Samstag mit Sonntag verwechsle –, und so sei ich in diese Angelegenheit hineingezogen worden.
»Hineingezogen?«, fragte sie. »Was meinst du damit?«
»Nichts«, sagte ich. »Es ist bloß ein Missverständnis.«
Sie nahm ihr Telefon und rief Lillian an, aber Lillians Telefon war ausgeschaltet, und Gina seufzte.
»Ich brauche ein Bier«, sagte sie. »Willst du auch eins?«
»Nein, danke.«
Sie holte eine Dose aus dem Kühlschrank und reichte sie mir, damit ich sie für sie öffnete. Sie wusste, wie sehr es mir missfiel, wenn sie trank, bevor die Kinder im Bett waren, aber es war gewiss eine Ausnahme, und so brach ich den kleinen Ring für sie auf. Sie tat nichts, um die Gier zu verbergen, mit der sie die ersten Schlucke in sich hineinleerte. Ich öffnete die Küchentür zum Garten und bewegte sie mehrmals schnell hin und her, um die Reste des Fischgestanks hinauszupumpen, während ich mich darauf konzentrierte, vor den Jungs eine fröhliche Maske aufrechtzuerhalten. Sie hatten das Wort Polizei aufgeschnappt, und jetzt hingen sie an meinen Hosenzipfeln und wollten mir fiktive Handschellen anlegen.
»Könnt ihr nicht noch ein bisschen zeichnen gehen?«, sagte ich.
»Wollen wir nicht!«
Sie merkten, dass ich sie bloß loswerden wollte und klammerten sich deshalb umso fester sowohl an ihr Spiel als auch an meine Hosenzipfel. Mit ihren kleinen Zeigefingern zielten sie auf mich.
»Du kommst ins Gefängnis!«, riefen sie. »Piu, Piu!«
Natürlich hätte ich sie vorwarnen sollen, aber die Wut kam so plötzlich, dass ich nicht einmal Zeit hatte nachzudenken, schon hatte ich geschrien: Schert euch weg! Ich fächelte sie weg, so wie man Wespen verscheucht, schlug nach ihnen, und nachdem ich es geschafft hatte, auf die andere Seite der Tür zu gelangen, drückte ich sie hinter mir zu, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sich ihre Finger dazwischen befinden könnten. Dort stand ich dann, nur in Socken auf der nassen Eingangsstufe, und lauschte dem Weinen, das ich verursacht hatte. Wie immer war der Zorn ebenso schnell verflogen, wie er aufgetaucht war, und wie immer hinterließ er in mir eine schmerzvolle Zärtlichkeit für meine Jungs. Sie wollten doch nur spielen. Sie suchten doch nur meine Nähe. Diese Ausbrüche – was konnte ich tun, um sie zu verhindern? In letzter Zeit waren es so viele gewesen. Ich hätte zu ihnen sagen sollen: Ich zähle jetzt bis drei und dann zählen, damit sie wenigstens gewarnt wären. Aber meine Wut kam immer so plötzlich, und wenn sie erst einmal da war, gab es nichts in mir, das bis drei zählen wollte. Kühle Tropfen trafen mich im Gesicht, und erst jetzt fiel mir auf, wie heiß mir war. Da meine Socken ohnehin schon durchnässt waren, ging ich gleich noch ein Stück weiter hinaus auf die planierte Fläche, auf der bald unser Rasen sprießen sollte. Und auf einmal wusste ich nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich blieb still stehen, mit geschlossenen Augen und schwer an den Seiten herabhängenden Armen. Lange stand ich so da. Um mich herum hörte ich das Rauschen des Regens in der alten Hecke, die hier wuchs, seit ich ein kleiner Junge war, und ich konnte mir kein heimeligeres Geräusch vorstellen. Doch jetzt war es genau dieses Heimelige daran, das ein Gefühl an die Oberfläche beförderte, das mich wohl schon seit dem Einzug begleitet hatte, ohne dass ich mir dessen richtig bewusst gewesen war: Das Gefühl, nicht hierher zu gehören. Es mochte mit den Nachbarn zu tun gehabt haben, von denen viele gegen unseren Zubau Einspruch erhoben hatten (ohne etwas dagegen ausrichten zu können), oder schlichtweg damit, dass das Haus nicht mehr dasselbe war. Oder hatte ich damals schon eine Vorahnung, dass ich all das verlieren würde? Ich weiß nicht, aber da stand ich, in dem Garten meiner Kindheit, mit dem deutlichen Gefühl, ein Eindringling zu sein.
Gina kam heraus. Sie streifte sich die Hausschuhe am Rand der Eingangsstufe ab und trat barfuß in die nasse Erde. Sie kam direkt auf mich zu und umarmte mich. Ich war überrascht; ein warmer Strom lief durch mich hindurch und ich hielt sie fest und dachte nur: Gina, Gina. Über ihre Schulter hinweg sah ich die Jungs übers Fensterbrett schielen, sie weinten jetzt nicht mehr – auch das eine Erleichterung. Dann löste Gina die Umarmung wieder.
»Martin«, sagte sie. »Du verheimlichst mir doch nichts?« Sie blickte leicht seitlich an mir vorbei, als ob sie Angst davor hätte, was ich darauf antworten würde, aber ich entgegnete nur:
»Nein. Hast du das geglaubt?«
»Ich weiß manchmal nicht, was ich glauben soll«, sagte sie.
Wenig später sagte sie, dass es da etwas gebe, was sie mir erzählen wolle – etwas, das sie Sonntagabend erlebt hatte, während ich bei meiner Mutter war. Eigentlich habe sie es vergessen gehabt, sagte sie, doch wegen dieser Sache mit der Polizei sei es von neuem in ihr aufgetaucht. Sie erzählte, dass sie sich früh habe hinlegen wollen und in den Zubau gegangen sei, um nach den Jungs zu sehen. Sie seien so hübsch gewesen, wie sie da lagen, jeder in seinem neuen Zimmer. Sie habe so ein gutes Gefühl gehabt, endlich am richtigen Platz zu sein, endlich dort angekommen zu sein, wohin wir wollten. Doch auf dem Weg zurück durch den Gang habe sie aus meinem Arbeitszimmer ein Geräusch gehört. Sie sei sich sicher gewesen, dass es das Klappern der Tastatur war. Das habe sie beunruhigt, da es ja nicht lange her gewesen sei, dass ich gegangen war, und sie mich nicht hatte zurückkommen hören. Sie habe einen Blick hineingeworfen, aber natürlich sei niemand da gewesen. Auf dem Computer sei ein Familienfoto ins nächste übergegangen – ein Beweis dafür, dass die Tastatur schon eine Weile von niemandem benutzt worden war.
»Du hast bestimmt etwas anderes gehört«, sagte ich.
»Ja, wahrscheinlich.«
»In einem alten Haus gibt es viele Geräusche«, sagte ich. Sie nickte. Wir sahen beide zum Haus. Der Regen verlieh der frisch gestrichenen Wand einen traurigen, farblosen Charakter. Die Jungs waren jetzt nicht mehr am Fenster zu sehen. Ich merkte, dass Gina noch mehr sagen wollte. Sie sei noch eine Weile im Arbeitszimmer stehengeblieben und habe sich die zufälligen Bilder des Bildschirmschoners angesehen. Es sei so schön gewesen, sagte sie, weil sie viel Überraschendes aus unseren gemeinsamen Jahren gesehen habe, nicht zuletzt von den Kindern. Aber sie habe auch ein paar Bilder von sich selbst auf der Bühne zu sehen bekommen, aus der Zeit, bevor sie in der Band aufgehört hatte – Bilder, von denen sie nicht gewusst hätte, dass ich sie habe. Ich lächelte, weil ich mich darauf gefreut hatte, ihr diese Bilder zu zeigen, die ich selbst gerade erst in einer vergessenen Mappe entdeckt hatte.
»Ich habe es so intensiv gespürt«, sagte sie.
»Was?«
»Wie glücklich es mich macht, was wir zusammen haben.«
Sie blinzelte gegen den Regen. Ich war erleichtert, dass es nur das war, was sie erzählen wollte, etwas so Gutes, und wischte ihr ein wenig Wasser aus der Stirn. Ich sah die Falten, die sich langsam um ihre Augen herum zu bilden begannen, und bekam einen flüchtigen Eindruck davon, wie sie in einigen Jahren aussehen würde, und ich sah, dass sie immer noch schön sein würde.
»Du wirst immer schön sein, Gina«, sagte ich.
Ich schüttelte mich kurz und sagte, uff, na, jetzt würden wir aber nass werden, wir sollten zusehen, dass wir hineinkämen. Und auf dem Weg zurück zur Küchentür sagte ich wie zufällig, dass ich noch auf einen Sprung bei Mutter vorbeischauen müsse, weil ich mir solche Sorgen um sie mache. Sie sei am Sonntag ungewöhnlich abwesend gewesen, erklärte ich. Gina fragte, ob das wirklich sein müsse; es wäre so schön gewesen, diesen Abend gemeinsam zu Hause zu verbringen.
»Ich muss«, sagte ich. »Es geht um Mutter.«
Ich versprach ihr allerdings, erst zu fahren, wenn die Kinder im Bett wären, und wir gingen zusammen hinein, um uns trockene Sachen anzuziehen.
Der Verkehr aus dem Zentrum und weiter hinaus zu den neuen Wohngebieten war definitiv ruhiger geworden, als ich über die Uferstraße zum Kulleråsen fuhr. Der neue Asphalt glitzerte schwarz unter den Straßenlaternen, und eine gefühllose Ruhe sank auf mich herab. Der Besuch der Polizei fühlte sich bereits weit entfernt an, wie etwas, das vor vielen Jahren passiert war und nichts mehr mit mir zu tun hatte. Ich musste mich fast selber zwingen, den kleinen Plan umzusetzen, den ich mir zurechtgelegt hatte: auf einen Abstecher an der Tankstelle bei der Marina vorbeizuschauen und nach einer der Sonntagszeitungen zu fragen, die ich bei Mutter platzieren wollte – ein Beweis, dass ich dort gewesen war. Ich ließ den Wagen im Leerlauf, während ich in dem hellen Laden war. Der Bursche an der Kassa musste sein Telefon weglegen, um mich zu bedienen. Es tue ihm leid, aber die Sonntagszeitungen seien alle retourgegangen, sagte er. Dann fiel ihm jedoch ein, dass im Pausenraum womöglich noch eine Zeitung vom Personal liegen könnte, und wie sich herausstellte, hatten sie nicht nur eine, sondern beide, und er sagte, ich könne sie gern mitnehmen.
Wenige Minuten später bog ich auf den Parkplatz vor dem Gebäude ein, das seit anderthalb Jahren Mutters Zuhause war. Kein dunkler Saab war zwischen den anderen parkenden Autos zu sehen, und mit den in der Jackentasche zusammengerollten Zeitungen stieg ich aus. Von außen glich das Haus einem ganz normalen modernen Wohnblock, mit verglasten Balkonen und Pflanzen auf den Fensterbrettern. Einzig die hinter allen Fenstern gleichartigen Vorhänge verliehen dem Ganzen einen gewissen institutionellen Charakter. Hinter dem Gebäude lag der Steinbruch immer noch offen zutage, die Einschnitte im Berg. Ein Bagger stand dort – sicher für die Aushebungsarbeit für das geplante Grünareal. Das stimmte mich froh: Dann hätte Mutter ein hübsches Fleckchen, wo sie sich im Sommer hinsetzen könnte. Ich sah, dass ihre Fenster dunkel waren, und sie antwortete auch nicht an der Gegensprechanlage, weshalb ich davon ausging, dass sie den Bus zum Gemeindehaus genommen hatte; die vielen Autos, die ich im Vorbeifahren dort stehen gesehen hatte, ließen darauf schließen, dass an diesem Abend irgendeine Veranstaltung stattfand. Ich benützte meine eigene Schlüsselkarte, ging an der geschlossenen Kantine vorbei und nahm den Aufzug nach oben. Drinnen in Mutters Wohnung stieß ich auf Bartimeus, ihre Katze. Ich hatte Mutter auszureden versucht, sie hierher mitzunehmen, aber sie hatte mit so flehentlicher Stimme gesagt, dass sie glaube, ohne Bartimeus würde es nicht gehen. Geschmeidig rieb sich die Katze an meinem Bein hoch und begann daraufhin, an der Eingangstür zu kratzen, weil sie immer noch glaubte, auf der anderen Seite befände sich der Garten von zu Hause.
In dem verdunkelten Wohnzimmer schaltete ich eine einzelne Lampe ein, setzte mich in Mutters Lehnstuhl und begann zu tun, weswegen ich gekommen war: Ich nahm die Zeitungen zur Hand und blätterte in einer davon, bis ich das kleine Sonntags-Kreuzworträtsel fand. Ich löste es teilweise und kritzelte ein wenig auf der Seite herum, versuchte, es so aussehen zu lassen, als wäre es aus Langeweile getan worden, achtete darauf, an irgendeiner Stelle meine Initialen einzuflechten, um erst gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Danach legte ich die Zeitungen zwischen die anderen in Mutters Zeitungskorb. Eine heftige Müdigkeit brach über mich herein, und ich blieb noch ein wenig länger sitzen. Allein der Gedanke, aufstehen zu müssen, fühlte sich an wie eine unüberwindbare Herausforderung. Stattdessen löschte ich das Licht und schloss die Augen, und als kurz darauf die Katze auf meinen Schoß sprang, vergrub ich die Hände in ihrem dichten Fell und ließ meine Gedanken ihren eigenen absurden Wegen folgen. Bald fand ich mich selbst in einem grauen, stillen Schneewetter. Dicke Flocken fielen auf mich herab, aber es war nicht kalt. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich Teil einer langen Schlange war. Alle anderen in der Schlange, sowohl die vor als auch die hinter mir, waren alt. Sie klagten, litten. Ich blickte hinunter auf meine Hände, die knochig und leberfleckig waren. Da wurde mir klar, dass ich genauso alt war wie die anderen. Mein Herz hämmerte schwer vor Ungeduld in meiner Brust, weil ich in der Schlange nicht weiter nach vorn kam, und es hämmerte noch immer, als ich in Mutters Wohnzimmer zurückgeholt wurde. Die Katze war auf meinem Schoß aufgestanden, hatte gespannt die Ohren aufgestellt. Die Tür zu Mutters Schlafzimmer ging auf und kurz darauf trippelte sie vor mir durchs Dunkel, weich auf dem Teppich, tastete sich weiter zur Anrichte und beugte sich vor, um durchs Fenster nach unten zu sehen. In dem schwachen Licht, das von draußen hereindrang, sah ich, dass sie die alte Strickjacke anhatte –, die, von der ich geglaubt hatte, wir hätten sie beim Umzug weggeworfen. Es sah aus, als würde sie von ihr niedergedrückt, wie von einer Last auf ihren Schultern. Mühsam zog sie eine Schublade heraus, jedoch nur zur Hälfte; sie blieb regungslos stehen, leicht gegen die Lade gelehnt. Ich hörte ihren Atem, und auch meinen eigenen, und so verging eine Minute, vielleicht zwei. Danach schob sie die Lade wieder zu.
»Puh, was für ein Wetter«, sagte sie.
Ich antwortete nicht. Es war schwer zu sagen, ob sie zu mir sprach. Gedämpft durch die Wände hörte ich das verzweifelte Rufen einer Alt-Männer-Stimme und eine Frau, die Trost zu spenden versuchte. Mutter schaltete die alte Tischlampe auf der Anrichte ein, worauf ihr Gesicht im Fensterrahmen erschien. Sowohl die Lampe wie auch die Anrichte waren zu Hause gestanden; es war, als wäre ein kompletter kleiner Ausschnitt aus dem alten Wohnzimmer hier wiederhergestellt worden. Mutter hatte frisch gefärbtes, schwarzes Haar. Sie musste kürzlich beim Frisör gewesen sein. Als sie sich umdrehte, schaute sie mich direkt an.
»Ich setze Kaffee auf«, sagte sie.
Es vergingen einige Sekunden, ehe ich antworten konnte.
»Danke«, sagte ich. »Das wäre gut.«
Ich hörte sie in der Küche hantieren. Bald wurde das Gluckern der Kaffeemaschine lauter und sie kam mit runzligen Rosinenbrötchen in einem Korb herein. Sie erzählte, das afrikanische Mädchen aus der Kantine hätte sie ihr tagsüber gebracht – die mit dem schönen Lächeln; keiner könne lächeln wie die, sagte sie.
»Das war nett von ihr«, sagte ich.
»Ja, sie sind so freundlich hier.«
Ich fragte, ob sie heute noch anderen Besuch gehabt hätte.
»Nein«, sagte sie. »Von wem denn?«
»Niemand von der Polizei?«, fragte ich.
»Ah, doch«, sagte sie. »Doch, sie war da. Sie war so höflich, weißt du. Es ist noch nicht lang her, dass sie gegangen ist.«
»Was wollte sie?«
»Nur wissen, wie es mir geht. Nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ich glaube, das war alles.«
»Hat sie irgendwas wegen mir gefragt?«
»Ja, vielleicht hat sie das.«
»Hast du gesagt, dass ich Sonntag bei dir war?«
Mutter schaute mich an. Ihre Augen waren leer.
»Du erinnerst dich doch, dass ich Sonntag hier war?«
»Ja«, sagte Mutter. »Aber ich glaube nicht, dass sie danach gefragt hat.«
Sie ging, um den Kaffee zu holen.
»Probier die Brötchen«, sagte sie.
Ich nahm eines, es war trocken und leicht säuerlich, von der Sorte mit langem Haltbarkeitsdatum, wie sie tütenweise in den Supermarktketten verkauft wurden. Zu Mutter sagte ich, etwas Süßes zum Kaffee sei immer gut, und sie stimmte mir zu. Mit der Fernbedienung schaltete sie den Flachbild-Fernseher ein, den ich für sie montiert hatte, und es war schön mitanzusehen, wie leicht es ihr fiel. Es liefen gerade Nachrichten, und das Gesicht des Staatsministers füllte den Bildschirm. Er wurde in einem der Gänge des Parlaments interviewt.
»Aha, der schon wieder«, sagte sie.
»Ja, genau«, sagte ich.
Es hatte etwas Beruhigendes an sich, die gleichsam lustlose Stimme des Staatsministers zu hören, der die Fähigkeit besaß, wichtige Angelegenheiten so gefahrlos, beinahe bedeutungslos wirken zu lassen. Danach kamen Inlandsthemen von der eher erfreulichen Sorte. Wir sahen schweigend zu, bis der Sport kam; da schaltete Mutter ab. Wir blieben noch eine Weile sitzen und starrten auf den leeren Bildschirm; dann drehte sie sich zu mir um. Für einen Moment lag ein gequälter Zug auf ihrem Gesicht, aber gleich darauf sah sie wieder normal aus. Sie sagte, ich solle mich noch von den Brötchen bedienen.
»Mutter«, sagte ich. »Es geht dir doch gut hier, oder?«
»Mir geht es gut, solange es dir gut geht«, sagte sie.
Sie lächelte. Es war das gute, altbekannte Lächeln.
»So ist das, wenn man Mutter ist«, sagte sie.
Sie streckte sich, um mir den Oberschenkel zu tätscheln, doch dafür war der Abstand zwischen uns zu groß und sie zog ihre Hand wieder zurück. Wenig später stand ich auf, umarmte sie und wünschte ihr eine gute Nacht. Sie ließ ihre alten Hände noch kurz auf mir ruhen.
»Gute Nacht«, sagte sie. »Und lass Lillian grüßen.«
Ihr Blick flackerte.
»Lass Gina grüßen«, korrigierte sie und fügte hinzu, ich solle die Jungs ganz fest von Großmutter drücken. Ich versprach es ihr. Bevor ich sie verließ, ging ich nachsehen, ob die Schüssel in der Küche mit Katzenfutter gefüllt war, ob es Klopapier in der Halterung im Bad gab und ob das Katzenklo nicht überfüllt war, und alles war, wie es sein sollte.
Auf dem Rückweg drosselte ich das Tempo und rollte langsam am Gemeindehaus vorbei. Die Abendveranstaltung war vorbei; die Leute scharten sich unter dem Vordach, und aus alter Gewohnheit hielt ich Ausschau nach Bekannten. Natürlich entdeckte ich niemanden. Die meisten sahen aus, als wären sie entweder viel älter oder viel jünger als ich. Einen Augenblick erwog ich, den Wagen zu parken, auszusteigen und mich unter die Menge zu mischen, um zu sehen, ob ich auf jemanden stoßen würde, vielleicht auf einen der alten Jugendleiter – Syver, Oddveig oder Govertsen –, die dort wahrscheinlich immer noch ein und aus gingen. Zumindest kam es vor, dass Mutter erzählte, sie hätte sie gesehen, was gut möglich war, auch wenn ihre Angaben nicht immer zuverlässig waren. Das ärgerte mich – dass sie glaubte, dass ich immer noch zu ihnen aufblickte. Sie hätten mich aber ohnehin nicht wiedererkannt, selbst dann nicht, wenn ich ihnen meinen Namen genannt hätte. Aber Lillian, Lillian hätten sie nicht vergessen, Lillian mit ihren Solonummern in Kreuzesklang – dem Jugendchor, dem wir beide bis ins frühe Erwachsenenalter angehört hatten. Lillians Gesang wurde von uns allen bewundert. Sie war ein Jahr jünger als ich, und es wurde schon früh gemunkelt, dass ich Chancen bei ihr hätte. Deshalb durchzuckte mich jedes Mal ein heftiger Schmerz, wenn ich sah, wie sie vor uns andere hinaustrat, ihr langes Haar kurz durchschüttelte und auf ihre selbstverständliche Art das Mikrofon ergriff. Ich stand ganz hinten im Chor, zusammen mit den zwei, drei anderen Tenören, auf einer Bank, die für das Publikum nicht zu sehen war. Wir waren nie mehr als vier Tenöre; alle Burschen wollten am liebsten Bass singen. Ich erinnere mich noch, wie mein Nacken und die Kiefer sich anspannten, wenn ich die Stimme nach den hellsten Tönen ausstreckte, und wie sie mir zwischendurch versagte und ausscherte, ohne dass jemand reagierte. Aber woran ich mich in erster Linie erinnere, ist, wie weiblich ich mich immer fühlte, nicht nur beim Singen, sondern auch in den Pausen, wenn wir unter dem Vordach zusammenstanden, und auf den Reisen, die wir unternahmen: Lange Busfahrten in entfernte Kleinstädte, wo wir in einer abgelegenen Kirche oder einem Bethaus singen sollten, um danach in derselben Kirche oder demselben Bethaus zu übernachten, in Reih und Glied in unseren Schlafsäcken, wir Burschen in einer eigenen Gruppe, aber oft, später in der Nacht, hineingeschachtelt zwischen den Mädchen. Für gewöhnlich war ich Teil der großen, mädchendominierten Clique, die abends sinnlos die Straßen und Radwege entlangschlenderte, auf der Suche nach einer Kellerstube, in die wir von irgendwelchen Eltern eingelassen wurden, und dort warfen wir uns in die Sitzsäcke, schauten Musikvideos im Fernsehen und massierten uns gegenseitig, halb im Verborgenen, oder kraulten uns im Nacken. Auch im Schulhof hielt ich mich an die Chorclique. Und wofür die Mädchen sich interessierten, dafür interessierte auch ich mich, bis hin zu Make-Up, Handball und den »Freundschaftsbändern«, die wir flochten, ja, sogar für die Boygroups, die sie hörten. Alles, was ich tat, alles, was ich sagte und meinte, hatte etwas Weibliches an sich, und es fühlte sich in keiner Weise falsch an.
Ich trat fester aufs Gaspedal und sah das Pfarrhaus im Rückspiegel verschwinden. Ich fuhr nicht in Richtung nach Hause, sondern hielt mich stattdessen weiter auf dem Europaveien, wo ich mich von dem gleichmäßigen Verkehr zum Zentrum hin verschlucken ließ. In diesem Fluss von Autos, versteckt in der anonymen Dunkelheit hinter der Windschutzscheibe, fühlte ich, wie gewöhnlich ich war, ein ganz normaler Mann. Ich klappte den Innenspiegel einen Moment herunter, und der kurze Blick in meine sanften Augen flößte mir eine tiefe Ruhe ein. Am Stadtrand verließ ich den Europaveien und fuhr nach einigen Minuten die Anhöhe zu der Wohnsiedlung hinauf, aus der wir kürzlich weggezogen waren. Es regnete immer noch und auf den Straßen war niemand zu sehen, auch nicht im Schulhof oder auf den Spielplätzen, an denen ich vorbeikam. Ich bog in unsere Straße ein. Aus den Fenstern der Reihenhäuser schimmerte es behaglich in die herbstliche Düsternis, überall so geborgen und alltäglich, außer in unserem eigenen, ehemaligen Haus; dort gab es keine Vorhänge, und es war dunkel, immer noch unbewohnt. Die iranische Familie, die es gekauft hatte, war angeblich in finanziellen Nöten, und das Haus sollte vermietet oder neu verkauft werden. Ich parkte ein und trottete zu dem Spielplatz, den wir durch die Küchenfenster hatten sehen können – der, von dem wir immer gesagt hatten, er sei unserer. Eine einzelne Straßenlaterne warf einen gelben Schein auf die Schaukeln, die unbeweglich an ihren schwarzen Ketten hingen. Der Regen fiel still auf den Sand in der Sandkiste, aus dem Grasbüschel und Unkraut herauswuchsen. Niemand außer mir hatte sich dafür verantwortlich gefühlt, das Gras auszureißen und in regelmäßigen Abständen den Sand durchzumischen, sodass er für die Kinder einladend wirkte. Ich trat einen Schritt hinein und grub mit der Schuhspitze im Sand, um ein paar halb begrabene Plastikspielsachen herauszubohren. Auf einer Schaufel stand mit einem Permanentmarker: Havn, und ich musste ein paar Tränen wegblinzeln.
Lillian und Selma wohnten ein paar Reihen weiter oben, in der letzten Straße, bevor der Wald anfing. Ihr Haus war nahezu identisch mit unserem alten und lag, genau wie unseres, im Innern einer Reihe aus vier Häusern. Ich fuhr den Wagen die schmale Einfahrt hinauf und stieg aus. Vor der Treppe lag Selmas kleines Fahrrad, der rosa Plastikkorb hing lose vom Lenker. Ich sah einen Streit vor mir: Lillian, die eine hysterisch protestierende Selma hineintrug, während das Fahrrad liegenblieb, wo es hingefallen war. Ich hob es auf, klickte den Korb in die Halterung und stellte das Rad auf die überdachte Eingangsstufe. Dann versuchte ich es an der Tür: Sie war verschlossen. Weil ich Selma nicht aufwecken wollte, benutzte ich nicht die Klingel, sondern klopfte vorsichtig an. Neben der Tür hing noch immer das alte Schild, auf dem auch Sølve miteingeschlossen war.
Hier wohnen Sølve, Lillian und Selma Strøm
Mehrmals hatte ich mit dem Gedanken gespielt, ihr anzubieten, es zu entfernen und den Fleck, der darunter zum Vorschein käme, zu übermalen; solcher Dinge nahm ich mich an, während wir alle hier waren. Lillian öffnete nicht. Während ich meine Taschen nach meinem Schlüssel durchsuchte, kam eine Gestalt in Regenkleidung aus dem Wald am gegenüberliegenden Ende der Häuserreihe. Der Kopf war zum Teil unter der zusammengezurrten Kapuze versteckt, und wäre da nicht der aufgeregte Vorstehhund gewesen, der ihn fast hinter sich her zog, hätte ich Reidar Stallemo nicht wiedererkannt. Er kam mir am Straßenrand entgegen.
»Martin?«, sagte er. »Bist du das? Unterwegs auf alten Pfaden?«
»Yes«, sagte ich. »Wie geht’s?«
Er verzog die Mundwinkel zu einer Grimasse.
»Fürchterlich nass da im Wald. Das sind keine Wege, das sind Bäche.«
Der Hund wollte weiter voran und mich beschnüffeln, aber Stallemo hielt ihn mit einem Klick an der Leinenrolle zurück, worüber ich froh war; der Hund widerte mich an. Stallemo schielte nachdenklich zu meinem Auto; daraufhin ging er einige Meter zurück und fischte eine Radkappe aus dem Straßengraben.
»Die da hast bestimmt du verloren«, sagte er.
»Das glaube ich nicht«, sagte ich.
»Doch, doch, bei dir fehlt eine.«
Er deutete auf das eine Hinterrad und sagte, er hätte sie vor ein paar Wochen drüben beim Weg gefunden. Er hockte sich neben mein Auto und bemühte sich nach Kräften, den Hund unter Kontrolle zu halten, während er die Radkappe festklopfte. Hinterher richtete er sich auf und sagte, ich solle Gina grüßen lassen.
»Wir sehen sie ja jetzt nicht mehr im Wald«, sagte er. »Wahrscheinlich hat sie neue Laufstrecken gefunden.«
»Das hat sie«, sagte ich.
Ich wartete, bis er ganz außer Sicht war, dann schloss ich auf. Lillian stand direkt hinter der Tür. Sie hatte nasses Haar und nur einen Bademantel an.
»Mit wem hast du geredet?«, flüsterte sie.
»Nur mit diesem Stallemo«, sagte ich.
Sie stieß einen Seufzer aus.
»Endlich bist du da. Ich habe so auf dich gewartet.«
Sie legte ihre Arme um mich, und ich legte meine um sie, und wir drückten uns aneinander. Ich spürte, dass sie zitterte, und dass ich selbst auch zitterte.
»Die Polizei ist bei mir gewesen«, sagte ich.
»Hier waren sie auch«, sagte sie. »Sie glauben, du hättest Selma etwas getan.«
»Wieso das?«
»Ich weiß nicht. Sie war krank in dieser einen Nacht.«
»Was hast du erzählt?«
»Nichts«, sagte sie. »Komm und halt mich. Es ist nicht schlimm. Wir sprechen nachher darüber.«
Ich legte meine Jacke ab. Als ich ihr ins Schlafzimmer folgte, fühlte ich mich schwindlig. Die Luft im Haus war warm und feucht, und ich bemerkte einen leicht sauren Dunst wie von nasser Kleidung, die zu lange liegengeblieben war, und dachte: Wieso kann sie nicht besser durchlüften? Neben dem üblichen Glas Cola auf ihrem Nachttisch lag eine Packung Schmerztabletten, die foliierten Blister achtlos ausgestreut. Ich stopfte sie zurück in die Schachtel, damit sie Selma nicht in die Hände fielen, und legte die Packung ganz oben in den Kleiderschrank, wo auch die anderen gestapelt waren. Danach zog ich mich aus und kroch zu ihr ins Bett. Wir küssten uns nicht, berührten einander nicht, lagen nur still mit unseren nackten Körpern nebeneinander und zitterten. Als Lillian nach einer Weile zu reden begann, hatte sie diese leicht piepsende Mädchenstimme, mit der sie immer zu Selma gesprochen hatte, als sie noch ein Baby war. Ich hatte sie diese Stimme nie bei anderen Erwachsenen verwenden hören außer bei mir – nicht einmal bei Sølve. Aber in den ersten Jahren unserer Beziehung, als wir noch Teenager waren, war das ihre ›Schmusestimme‹ gewesen. Diese Stimme benutzte sie, wenn sie sagen wollte, wie sehr sie mich liebte oder wie schön es war, wenn wir dies oder jenes machten. Und ich selbst redete mit einer entsprechenden Stimme, genauso hell und mädchenhaft, und auch unser Wortschatz war von dieser kindischen Art beeinflusst, die es uns möglich machte, Dinge zu sagen, für die wir sonst zu schüchtern gewesen wären. Mein Schatzi. Will Bussi geben. Will dein Spatzi in mein Spalti nehmen. Du bist ja so gut. Werd dich immer lieb haben, immer. Doch während wir anfangs unsere ›Schmusestimmen‹ wie etwas Geheimes beschützt hatten, verloren wir allmählich unsere Scheu und fingen an, sie auch dann zu gebrauchen, wenn wir mit anderen zusammen waren. Wir konnten mitten zwischen anderen in einem Ecksofa sitzen oder in einer Bankreihe in unserer Schmusesprache reden, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, ob jemand zuhörte. Doch eines Abends war Schluss damit – an dem Abend, als wir nachgeahmt wurden. Es war im Bus auf dem Rückweg von einer Veranstaltung in einem Dorf nicht weit außerhalb der Stadt. Wir waren sehr viele – so viele, dass unsere Clique beim Hineinstürmen fast alle anderen Fahrgäste verdrängte, sie veranlasste aufzustehen und sich andere Plätze zu suchen. Einer der Bässe im Chor hatte sich im Gang aufgestellt und führte einen Sketch auf. Er war einer von den Lustigen, einer der Komiker. Schwankend, während der Bus zur Stadt zurückfuhr, piepste er lautstark in Babysprache. Ich lachte gemeinsam mit den anderen, lange, denn zuerst hörte ich nicht, was alle anderen hörten. Erst als ich den Druck von Lillians Hand spürte, begriff ich, dass wir es waren, die er nachäffte. Will Bussi, piepste er dort vorne. Mein Schatzi gibt so gute Bussis. Solche Sachen sagten wir nicht; wir sagten nicht gute Bussis, aber trotzdem waren es wir; ich hörte es. Und jetzt, im Bett neben Lillian, konnte ich noch immer diese alte Demütigung fühlen, ausgelöst durch ihre Schmusestimme. Aber es tat gut, sie zu hören; wir teilten die Demütigung. Hab so Angst, piepste sie, leise, direkt neben meinem Ohr. Hab so große, große Angst. Es ist schön, wenn du da bist, aber dann gehst du, und das tut weh. Tut weh im Herzen. Fühl. Sie legte meine Hand auf ihre nackte Brust, und dort lag sie dann ein bisschen, und wir drückten uns aneinander, bis ich fast übergangslos in ihr war. Wir bewegten uns gleich ruhig wie immer, eine fast unmerkliche Reibung, mein Spatzi in dein Spalti. Meine Lust war stark und schmerzhaft, dennoch wollte ich nichts lieber, als dass sie noch stärker und noch schmerzhafter würde, und ich dachte daran, wie wir als Teenager immer zusammen gebetet hatten, auch das mit Schmusestimme, fest umschlungen im Dunkeln, wie wir einander heimliche Lüste anvertrauten und zu Gott beteten, damit ER uns die Kraft verlieh zu widerstehen, nur um anschließend genau das Gegenteil dessen zu tun, wofür wir gerade gebetet hatten. Aber ich erinnerte mich auch, dass ich bisweilen ein Verlangen vorgetäuscht hatte, das ich nicht empfand. Jetzt blickte ich direkt in Lillians glänzende, aufgesperrte Augen. Eine Sekunde war sie wie tot. Und dann: alle Wärme aus mir heraus, in sie hinein. Danach überkam mich eine Angst, eine Gewissheit, mich an jenem Ort aufzuhalten, an dem ich mich unter keinen Umständen aufhalten durfte. Das Wort Tatort stand mit einem Mal in meinem Bewusstsein. Ich öffnete das Schlafzimmerfenster einen Spalt, blieb still hinter dem Vorhang stehen, damit man mich von draußen nicht sehen konnte, obwohl ich genau wusste, wie idiotisch das war, solange das Auto mit dem Kind-fährt-mit-Aufkleber in der Ein fahrt parkte. Die kühle Nachtluft sickerte herein auf meine Brust und allmählich auch auf mein Gesicht, wodurch meine Gedanken klar genug wurden, dass ich Lillian jene Fragen stellen konnte, die ich stellen musste: Worum es bei der Sache mit Selma gehe, wer die Polizei kontaktiert habe, ob sie es gewesen sei und wieso.
»Selma war also krank?«, sagte ich.
»Ja«, sagte sie. »Wir waren in der Ärzteambulanz.«
»Am Sonntag?«
Sie nickte.
»Nachdem du gefahren bist«, sagte sie. »Mitten in der Nacht.«