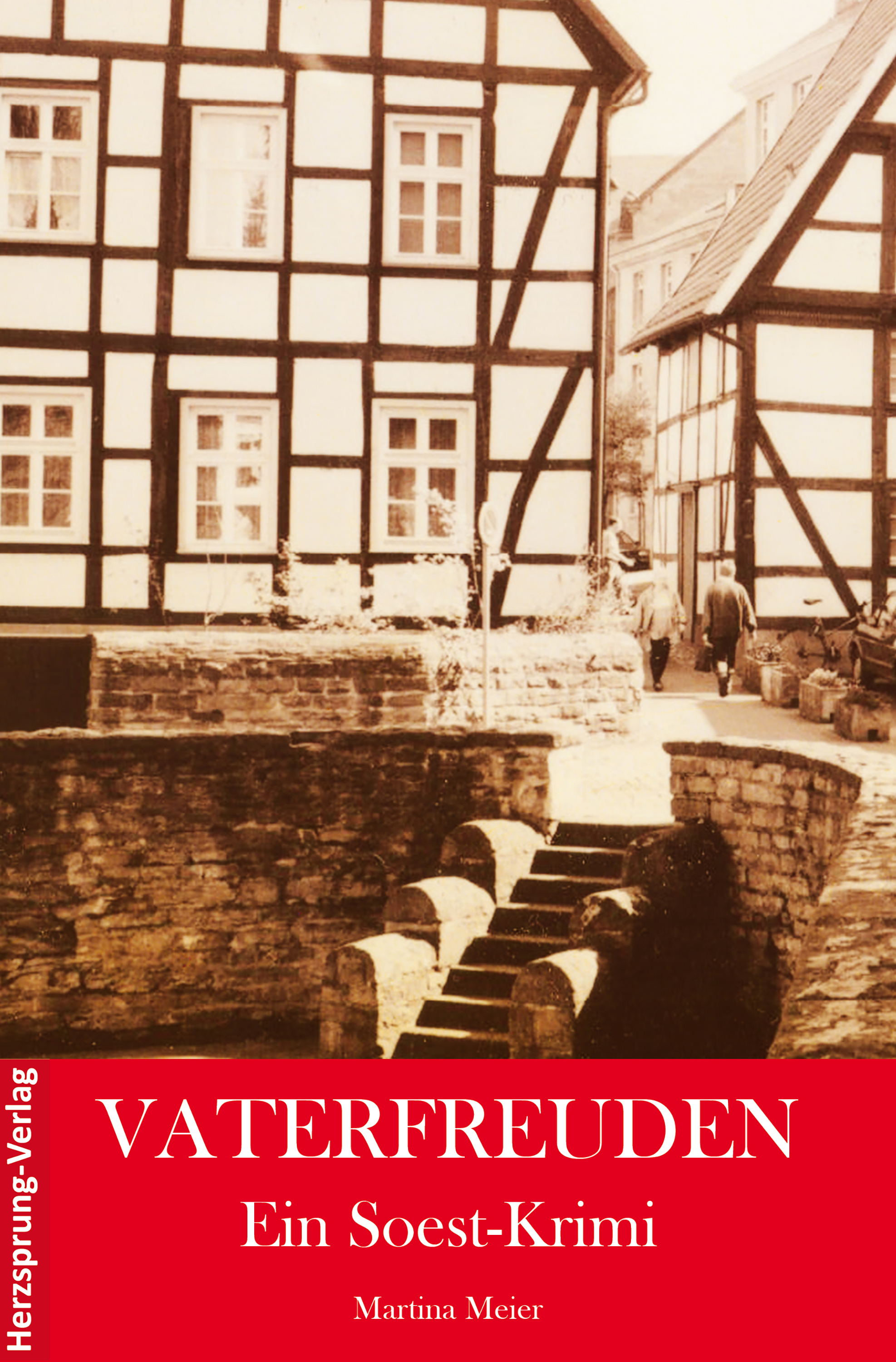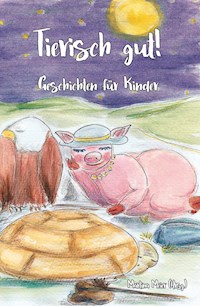9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag + CAT creativ
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Deine Pfoten so sanft ein weiches Kissen. Dein leises Schnurren möcht ich nicht missen! (Dörte Müller) Ja, sie schleichen sich mit ihrem Schnurren in unsere Herzen. Wir lieben ihre Unabhängigkeit und ihren Eigensinn – für uns Katzenliebhaber gibt es kein liebenswerteres Haustier als sie. In unserem Buch „Meine Katze ... und ich“ haben wir ihre Geschichten gesammelt und nicht nur Samtpfoten, sondern auch kleine Kratzbürsten entdeckt. Doch lesen Sie selbst ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Meine Katze ... und ich
Geschichten über Samtpfoten und Kratzbürsten
*
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Herausgegeben von CAT creativ - www.cat-creativ.at
Lektorat und Gestaltung im Auftrag von
© 2022 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
Besuchen Sie uns im Internet - www.papierfresserchen.de
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2022.
Coverbild: © Thorsten Meier
Alle anderen Katzenfotos und -illustrationen: privat.
ISBN: 978-3-99051-082-7 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-083-4 - E-Book
*
Inhalt
Madame Rosa feiert Weihnachten
Wie Don Sandro Corleone zu mir kam
Tut
Arme Katze Schnurrhaar
Kaspar und die Angst vor dem Fischbaum
Rambo
Sanfte Pfoten
Ein Strauß Rosen
Die Patchwork-Katze
Ein Hamster im Katzenpelz
Göttliche Sorgen
Gänseblümchen
Chefsache
Männertag
Ein langes Leben Ode an unsere Katze
Gestiefelter Kater Junior
Abschied eines Freundes
Kitty
Freiheit wider Willen
Wie der traurige Clown wieder fröhlich wurde
Taies und die Hofkatzen
Leben mit Katzen – Eine Momentaufnahme
Die fünf Eigenheiten meines Katers
Was will sie von mir?
Liebreiche Begegnung
Katzen sind die besseren Menschen
Beginn eines neuen Lebens
Verbotene Früchte
Holunderbusch
Lulu
Der schönste Name der Welt
Grüße aus Zeeland
Meine Katze plaudert
Das graue Loch
Eine Diva auf Samtpfoten
Shari, die Buddhakatze
Katzenaugen
Die Draußen-Katze
David gegen Goliath
Der Eindringling
Der Katzenkäfig
Heimweh
Eine Katze hat mindestens drei Leben
Die Samtpfote
Herr Pitty
Die Spinne
Bedingungslose Liebe
Polly ist verschwunden
Katzen und Krücken
Kreatives Schnurren
Warum Katzen?
Von wegen Dosenöffner!
Katerstrophe
Eine Katzenfreundschaft für ein Jahr
Winter – Henry – Katzenleben
Cleo
Azzura
Das eifersüchtige Kätzchen
Pützchen
Martha & Tilda
Revierkämpfe
Crespo
Schmusi und Wusi
Der beste Freund der Hexe
Mein Charly
Die Katze Mia
Die Catnapper
Sammy und der Kater Wolly
Dolfi, Aliza und ich
Das Kätzchen
Mia und Sophie …
Zwei wundervolle Katzen
Was macht Kater Luis denn da?
Ein Traum von Oma Grete
Frau Müller mit geheimnisvoller Katze
Auf wilder Jagd
Die Katze Otto und das Piratenschiff
Emily und die Türmer-Katze
Das außergewöhnliche Geschenk
Die falsche Katze
Die kleinen Kätzchen
Meine Katze und ich
Luna-Katzenmond
Die coole Kat
Catulia
*
Madame Rosa feiert Weihnachten
Die Tür klickt. Etwas rumpelt, gefolgt von einem saftigen Fluch. „Pass auf, Bernhard, die Nadeln landen ja überall!“
Madame Rosa öffnet träge ein Auge. Sie sind früher zurück, als erwartet, was den Tagesablauf stört. Sie scheinen sich nicht daran zu gewöhnen, dass sie Regeln einhalten müssen. Ein fremdartiger Geruch liegt in der Luft. Madame Rosa atmet tiefer ein und öffnet nun auch das andere Auge. Sie hebt den Kopf, als ihre Menschen ins Wohnzimmer gerumpelt kommen. Das heißt, etwas Großes, Grünes kommt ins Wohnzimmer gerumpelt, die Menschen hängen daran.
Madame Rosas Nackenhaare stellen sich auf. Sofortiger Rückzug! Sie springt mit einem Satz von der Heizung auf den Boden und überlegt kurz, ob sie lieber unters Sofa flüchten oder auf den Kratzbaum klettern soll. Beides ist in letzter Zeit anstrengend geworden. Das gute Futter ... der Bauch ... aber eine Dame fragt man nicht nach dem Gewicht.
Sie entscheidet sich für das Sofa. Gerade noch rechtzeitig schafft sie es, sich darunter zu quetschen. Umdrehen kann sie sich nicht mehr, weswegen sie nicht beobachten kann, was hinter ihrem Po vor sich geht. Ärgerlich.
„Vorsicht, tritt nicht auf ihren Schwanz“, hört sie die Frau sagen.
Madame Rosa hegt Sympathien für die Frau. Immerhin bemüht sie sich redlich, ihren Gaumen zu verwöhnen. Das muss man honorieren.
„Hoffentlich steckt sie gleich nicht wieder fest“, brummt der Mann zurück. „Die Katze ist zu dick, das habe ich dir schon mal gesagt.“
„Sie ist nicht dick, sie hat viel Fell“, kommt die Antwort.
Der Mann stöhnt und ächzt, es poltert.
„Vorsicht, die Vase!“
Klirren.
„Mensch, Bernhard …“
„Du hast genug Vasen.“
Madame Rosa hat ebenfalls genug. Sie muss jetzt wissen, was vor sich geht. Mit etwas Mühe legt sie den Rückwärtsgang ein und schiebt sich Stück für Stück unter dem Sofa hervor. Als sie befreit ist, ist ihr Fell völlig derangiert. Entwürdigend. Sie schüttelt sich und dreht sich mit majestätischem Blick um. Ach so, es ist einer dieser grünen Bäume, den man jedes Jahr für sie aufstellt. Das ist aber nett. Vielleicht wird sie ja etwas für ihre Fitness tun und wie in jungen Jahren bis zur Spitze hinaufklettern. Ansonsten ist es angenehm, sich darunter zu legen und das spezielle Aroma zu genießen. Was sie jetzt sofort tun wird. Mit gemessenen Schritten stelzt sie an der Frau vorbei und legt sich unter den Baum.
„Tina, nimm die Katze weg, ich muss das blöde Teil noch befestigen.“
„Komm, Madame Rosa, mein Schatz“, flötet die Frau, „Papa muss den Baum erst festzurren.“ Zwei Hände greifen nach Madame Rosa, schließen sich um ihren voluminösen Körper und zerren sie unter dem Baum hervor.
Madame Rosa, vollkommen empört über diese Frechheit, krallt sich einen Moment lang am Teppich fest, aber die Frau ist unerbittlich. Mit einem Ächzen hebt sie sie hoch. Einen Moment lang baumeln Madame Rosas Füße in der Luft, dann wird sie liebevoll in die Armbeuge gebettet wie ein zu stattlich geratenes Baby. Beschwichtigend streichelt ihr die Frau über den Kopf. „Du darfst dich gleich wieder hinlegen, meine kleine Maus.“
„Kleine Maus“, murmelt der Mann. „Die Katze ist so groß, dass du sie kaum halten kannst, und wiegt bestimmt sechs Kilo.“
Madame Rosa wirft dem Mann einen missbilligenden Blick zu.
„Jetzt müssen wir ihn schmücken.“ Die Frau klingt glücklich. „Bernhard, holst du den Weihnachtsschmuck aus dem Keller?“
„Sofort?“
„Ja, klar.“
„Muss sich der Baum nicht erst akklimatisieren?“
„Nun geh schon in den Keller.“
„Dann komm mit, ich weiß nicht, in welchen Kisten du deinen ganzen Kram verstaut hast.“
Madame Rosa wird aufs Sofa gesetzt, die Menschen verschwinden aus dem Wohnzimmer. Mit einem Hüpfer verlässt sie das Sofa wieder und stolziert zum Baum. Ein Glück, es ist keiner dieser besonders piksigen Exemplare. Von wegen Norwegische Waldkatze. Das Gen für Wald muss sich irgendwo in den Untiefen von Madame Rosas beeindruckendem Stammbaum verloren haben. Sie duckt sich und krabbelt unter den Baum. Ob es der Duft ist oder das viele Grün, plötzlich ändert sich etwas in ihr. Vielleicht meldet sich das Wald-Gen just in diesem Moment wieder. Madame Rosa setzt eine Kralle an den Stamm und zieht einmal kräftig hindurch. Es splittert unter ihren Pfoten, doch es sind jetzt keine Pfoten mehr, es sind Pranken, und es ist kein Weihnachtsbaum mehr, sondern ein gewaltiger, dichter Forst.
Ein leises Knurren ertönt aus ihrer Kehle, dann setzt sie die zweite Kralle an. Man muss dem Baum zeigen, wer die Herrin im Hause ist. Mit einem imposanten Satz springt sie am Stamm hoch, kämpft sich durch das Geäst, bis sie mit dem Kopf aus den Zweigen bricht.
Sie hat es geschafft. Sie ist ganz oben an der Spitze. Ihr liegt die Welt, vielmehr das Wohnzimmer, zu Füßen. Ihr Reich, ihr Herrschaftsgebiet. Etwas knackt, dann kommt ihr der Boden ihres Reiches plötzlich mit zunehmender Geschwindigkeit entgegen. Im letzten Augenblick rettet sich Madame Rosa mit einem beherzten Hechtsprung. Krachend fällt die 2,48 Meter hohe Nordmanntanne auf das Parkett und reißt dabei den neuen Fernseher um. Madame Rosa beschließt, dass es Zeit für einen strategischen Rückzug ist.
„Was zum ...“, donnert der Mann einige Minuten später. „Der Fernseher! Das reicht! Die Katze kommt ins Tierheim!“
„Dann lasse ich mich scheiden!“, zetert die Frau zurück.
Madame Rosa schenkt dem Treiben keine Beachtung mehr. Am Ende wird schon alles gut. Sie gähnt. Sie hat ja auch viel erlebt. Erst mal ein Schläfchen.
Sechs Monate später sitzt Madame Rosa neben der Frau auf dem neuen Sofa. Sie schnurrt, als ihr die Stelle hinter den Ohren gekrault wird. Der Mann ist weg. Verschwunden aus ihrem Leben. Wie gesagt – am Ende wird alles gut.
Nicole Hobusch,Jahrgang 1984, lebt im Bergischen Land. Sie macht beruflich „was mit Medien“. Abends erschafft sie Welten auf Papier, in denen sich das Blatt ein ums andere Mal wendet. Ihre Kurzgeschichten sind in verschiedenen Anthologien und Magazinen erschienen.
*
Wie Don Sandro Corleone zu mir kam
Ich stand in unserer Buchhandlung in einer kleinen Schlange an der Kasse. Das ist für mich kein Problem, so fing ich gleich ein bisschen in den beiden Taschenbüchern von Peter Gethers über seine Klappohrkatze Norton an zu lesen.
Plötzlich riss mich eine Stimme aus meinem stillen Lesevergnügen. Ein älterer Herr tippte mir auf die Schulter. „Auch ein bekennender Norton-Fan?“ fragte er.
Ich nickte eifrig.
„Ich habe solche Kätzchen wie Norton zu Hause“, sagte er. „Wollen Sie die mal anschauen?“
Ich verneinte. Natürlich mochte ich Katzen, zwei dieser wunderbaren Exemplare waren durch meine Wohnung gesprungen, aber seit mein Kater Osiris vor zwei Jahren gestorben war, der 19 Jahre durch mein Leben geschnurrt war, wollte ich kein Tier mehr.
Der freundliche Herr hinter mir reichte mir einen Zettel herüber mit seiner Adresse darauf. „Anschauen kostet nichts“, meinte er.
Ich nickte nachdenklich, inzwischen war ich mit Zahlen an der Reihe, verabschiedete mich höflich und schritt hinaus in einen wunderschönen Frühlingstag.
Zu Hause angekommen, kuschelte ich mich in einen warmen Schal, ging auf den Balkon und begann, gewärmt von der Frühlingssonne, zu lesen.
Aber so recht wollte mir das nicht gelingen, immer wieder musste ich an den freundlichen Herrn denken, auch andere Gedanken nisteten sich in meinem Kopf ein.
War meine Wohnung nicht irgendwie leer und kalt geworden? Fehlte da nicht irgendetwas? Wieso war mir das nicht eher aufgefallen? Warum wartete ich jetzt noch nachts auf ein zartes Miau, den Druck auf der Bettdecke, wenn mein Prinz vom Eismeer mit hoch erhobenen Schwanz zu mir schritt, mir Gute Nacht wünschte?
Auch jetzt glaubte ich, ihn leise schnurren zu hören, spürte ihn auf meinen Schoß, wie er sich in der Sonne rekelte. Das war zu viel, mit ein paar kleinen Tränen in den Augen räumte ich Buch und Schal beiseite, nahm meine Jacke, schnappte mir die Adresse und ging los.
„Da sind Sie ja.“ Der ältere Herr lächelte mich verschmitzt an und führte mich ins Wohnzimmer, wo eine entzückende Schar graublauer Kätzchen hin und her wuselte. Ein junges Mädchen mittendrin, das mit einem der Kätzchen spielte. Es betrachtete mich und meinte: „Sie wollen doch nicht etwa auch so ein Kätzchen mit geraden Ohren?“
Nein, dass wollte ich ganz und gar nicht. Wenn, dann wollte ich eine scottish fold, eine mit Klappohren – so wie Norton.
Ich ließ mich auf einem Sofa nieder, betrachtete die Kätzchen, die zu meinen Füßen herumtollten. Plötzlich bemerkte ich einen sanften Druck an meinem Oberschenkel. Langsam schaute ich hin, da saß ein kleines Kätzchen mit Klappohren und betrachtete mich ganz ernst, dann sprang es ab.
„Katze oder Kater“, fragte ich, zeigte auf den kleinen Racker.
„Kater“, sagte der Herr.
Ich wusste, es war um mich geschehen.
So bekam der Kleine ein rotes Wollfädchen als Markierung angelegt. Frohgemut eilte ich heim, inzwischen schüttete es wie aus Kübeln, aber das bemerkte ich gar nicht.
Zu Hause angekommen, brauste ich durchs Internet, suchte nach einem passenden Katzenkorb, einem Kratzbaum und die Katzentoilette. Ich triumphierte innerlich, jawohl, bald würde ein Kätzchen durch meine Wohnung springen.
Doch wie sollte das bisher noch namenlose Geschöpf heißen? Ich lud meine beste Freundin ein, bei Kaffee und Kuchen philosophierten wir über Katzennamen. „Lorcan“, schlug ich vor, „das ist Gälisch und bedeutet Elfenpfeil.“
„Nein“, beschied meine Freundin, „zu abgefahren.“
„Norton“, schlug ich vor.
„Man klaut keine Namen“, sagte meine Freundin.
So ging das hin und her.
„Alister Mac Fold.“
Meine Freundin winkte ab.
„Ich möchte was mit Alexander“, maulte ich.
Zur geistigen Erholung schauten wir uns einen Teil der genialen Verfilmung des Patens an. „Ich habs“, rief ich und lächelte triumphierend. „Don Sandro Corleone.“
Meine Freundin lächelte, sie hat ein halbes Haus in Süditalien, hatte 20 Jahre dort gelebt. „Ja“, meinte sie, „das ist gar nicht so schlecht.“
Ein paar Wochen später zog mein kleiner Liebling ein. Er erwies sich als das liebreizendste Geschöpf unter der Sonne. Alle Freunde beteten den Kleinen an, sie tun es bis heute. Ich selbst verzeihe ihm alles, auch wenn er mal wieder vom Tisch klaut und seine Beute unter den Teppich schiebt. Ich liebe meinen kleinen Mafiaboss.
Cornelia Rossberg lebt in Coburg. Don Sandro ist eine scottish fold und schnurrt schon quietschfidel acht Jahre durch ihr Leben.
*
Tut
„Mein Mensch lieb. Aber heute viele da. Gefahr? Du! Geh weg da! Mein Platz.“ Tut fixierte den Eindringling, der sich frech auf seinem Sofa breitgemacht hatte, angriffslustig. „Weg!“
Die Party war bereits fortgeschritten, schmutzige Gläser und Teller waren über Wohnzimmer, Diele und Küche verteilt. Krümel auf dem Fußboden wurden unter den Schuhsohlen zu feinem Pulver zermahlen. Grüppchen hatten sich gebildet, die sich im Bemühen, die vielen Stimmen und die Musikberieselung zu übertönen, in fast schmerzhafter Lautstärke unterhielten. Constanze redete wild gestikulierend mit Mäx – zumindest gestikulierte sie mit einer Hand, in der anderen hielt sie ein Weinglas –, sodass sie die Katze nicht sofort sah. Als sie sie bemerkte, kniff sie reflexartig die Augen zusammen und wandte sich ab.
„Mensch auch nett. Zwinkert freundlich. Will Frieden.“ Tut legte den Kopf schief und blinzelte höflich zurück. „Trotzdem mein Platz!“ Er hüpfte auf Constanzes Schoß.
Sie sprang auf, kreischte. Rotwein ergoss sich aus dem Glas auf den Boden. „Verschwinde, du Mistvieh!“
Tut landete elegant auf allen vieren. „Nanu? Zwinkert freundlich. Aber nicht Freundschaft. Mensch seltsam.“ Verwirrt schüttelte er sich.
„Seit wann hast du eine Katze, Thomas?“, fragte Constanze gepresst.
Tom antwortete mit einer entschuldigenden Geste. „Erst seit ein paar Wochen. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du gegen Katzen allergisch bist.“
„Bin ich nicht. Ersatz für Klara, wie?“
Tom atmete scharf ein und schürzte die Lippen.
Constanze wischte sich imaginäre Katzenhaare vom Rock. „Ich kann die Biester einfach nicht ausstehen.“
Mäx hob verblüfft die Brauen. „Aber die ist doch süß.“
„Sehr süß“, sagte sie ironisch. „Was glaubst du, warum es heißt, dass schwarze Katzen Pech bringen?“
„Abergläubisch bist du auch noch? Kein Wunder, denn das Christentum hat Katzen zu Hexentieren und schwarze Kater zu Geschöpfen des Satans erklärt, ein Papst wollte alle Katzen töten lassen.“ Mäx verzog das Gesicht. „Wusstest du, dass wir hier mit dir zusammen dreizehn sind?“
„Willst du damit andeuten, dass ich gehen soll?“, fauchte Constanze.
„Unsinn“, versuchte Tom, zu beschwichtigen. „So hat er das bestimmt nicht gemeint. Außerdem sind mehr als dreizehn Leute hier.“
Mäx zuckte die Schultern. „War eben schlecht geraten. Aber die Katze ist auch nicht schwarz. Nicht ganz jedenfalls.“ Er sah Tut an, machte eine lockende Handbewegung. „Na, komm her. Miez, miez.“
Tuts Hals, seine Brust, Pfötchen und Schwanzspitze leuchteten weiß in auffallendem Kontrast zu seinem samtschwarzen Fell. „Mensch gefährlich, starrt böse.“ Tut reagierte schnell. „Mensch groß, gefährlich, fliehen.“ Wie ein Fisch im Wasser flitzte er davon.
„Hm“, brummte Mäx enttäuscht. „Wie heißt sie denn?“
„Sein Name ist Tut. Eigentlich Tutanchamun – hold an Leben ist Amun, nach dem altägyptischen König – aber das ist mir zu lang.“
Auf Tom übten Mumien, Pharaonen und Sarkophage eine eigenartige, wenn auch ein wenig morbide Faszination aus und so nahm er die Gelegenheit wahr, die angespannte Situation etwas aufzulockern, indem er das Gespräch auf sein Lieblingsthema lenkte, die Bestattungsriten der Ägypter, den Versuch, durch Einbalsamieren der Leichname Unsterblichkeit zu erlangen. Aber bald fühlte Constanze sich durch einige bissige Bemerkungen, die Mäx sich nicht verkneifen konnte, und die zu treffend waren für jemanden, der sich nicht von Tatsachen verunsichern lassen wollte, in ihren religiösen Gefühlen verletzt, sodass sie unter einem fadenscheinigen Vorwand ging.
Langsam näherte die Party sich ihrem Ende. Mäx und Tom standen in der Küche am Buffet und machten sich über die Essensreste her.
Tut strich um Mäx’ Beine, um ihn mit seinen Duftdrüsen zu markieren. „Essen.“ Er ging zu seiner Essensschale, doch diese war leer. Erwartungsvoll sah er Tom an. „Essen“, wiederholte er miauend.
Tom tupfte die letzten Krümel der Walnusspastete vom Teller und leckte Daumen- und Zeigefingerspitze ab, dann ging er zum Kühlschrank, nahm eine Tupperdose heraus und füllte etwas daraus in Tuts Schale.
Tut senkte sofort seine Nase ins Essen. Endlich. Er schmatzte laut.
„Findest du es eigentlich nicht merkwürdig, dich immer nur von Salat zu ernähren und an deine Katze Fleisch zu verfüttern?“, fragte Mäx.
Tom erstarrte, aber er bemühte sich, es sich nicht anmerken zu lassen. Er warf nur einen säuerlichen Blick auf die Überbleibsel des Buffets: Die Tischdecke war mit Gazpacho bekleckert, vom Tofukäsekuchen waren nur noch Krümel übrig. „Tut bekommt Pflanzenkost, keine Leichen. Es ist tatsächlich äußerst unlogisch, wenn Leute, die sich Tierfreunde schimpfen, Tiere abschlachten lassen, um sie an ihre Hunde und Katzen zu verfüttern. Du kannst mir ja einiges nachsagen, aber dass ich unlogisch handle, wirst du wohl nicht behaupten wollen, oder?“
Mäx nahm eine Stachelbeere, warf sie in die Luft, fing sie mit dem Mund auf und schnitt eine Grimasse, als er die saure Haut durchbiss. „Aber Katzen sind doch Fleischfresser.“
„Gezwungenermaßen, es bleibt ihnen nichts anderes übrig, weil die Evolution sie nun einmal in diese Nische gedrängt hat.“ Er nahm eine Guave aus der Obstschale, legte sie aber wieder zurück und entschied sich stattdessen für eine Kiwihälfte. „Aber glaubst du, Tut würde sein Essen molekulargenetisch analysieren, um herauszufinden, was es ist und woher die Zutaten stammen? Solange es ihm schmeckt und alle benötigten Nährstoffe enthält …“
„Also ich weiß nicht. Es stinkt zwar nicht so wie normales Katzenfutter, aber das ist doch irgendwie nicht natürlich.“
„Im Gegensatz zu Dosennahrung, meinst du?“
„Ich meine, Katzen in freier Wildbahn ...“
„Katzen in freier Wildbahn würden Whiskas kaufen, nicht? Oder ein Schälchen Kuhmilch trinken, obwohl sie laktoseintolerant sind und dadurch krank werden. Schade, dass wir Tut nicht fragen können.“
„Aber ist das denn nicht schädlich?“
„Hunde vegan zu ernähren ist kein Problem, im Gegenteil, wie bei Menschen steigt sogar die Lebenserwartung deutlich an. Katzen brauchen allerdings Taurin, eine Aminosäure, und langkettige Fettsäuren, die in Pflanzen nicht vorkommen. Taurinmangel führt zur Erblindung, oft auch zum Tod.“
„Ist das dein Ernst?“
„Sicher.“ Tom tat, als wüsste er nicht, was Mäx meinte. „Weshalb fragst du?“
„Aber du kannst doch nicht ...“
Tom atmete hörbar aus. „Ich gebe Tuts Essen natürlich synthetisiertes Taurin bei, was dachtest du denn?“
Achim Stößer lebt in Bad Orb. Internet: https://achim-stoesser.de.
*
Arme Katze Schnurrhaar
Es war einmal eine Katze mit dem Namen Schnurrhaar, den ihr der Mensch gegeben hatte, in dessen Häuschen sie für lange Jahre glücklich leben durfte. Als dieser aber gestorben war, konnte sie es nur noch einen einzigen Tag und eine schlaflose Nacht dort aushalten.
Schon am nächsten Morgen lief sie tieftraurig in den nahe gelegenen Wald, wo sie zwischen den Bäumen umherschlich und sich dabei immer wieder an die Stämme drückte, fast so, wie sie sich stets an die Beine des geliebten Menschen geschmiegt hatte, wenn sie von diesem gekrault und gestreichelt werden wollte.
Ein Eichkätzchen, das Schnurrhaar von oben beobachtet hatte, kam bald auf einen unteren Ast herab und ließ sich von ihrem Leid berichten. Darauf sagte es: „Ich könnte dich ja vielleicht mit den Krallen meiner kurzen Ärmchen ein wenig kraulen. Ich habe als kleineres Tier aber doch einen etwas zu großen Respekt vor dir, um dir noch näher zu kommen. Frag doch lieber mal den Hasen, der dort gerade vorbeihoppelt! Vielleicht kann er dir eine größere Hilfe sein als ich.“
Sogleich hielt Schnurrhaar denselben an und erzählte ihm ihre traurige Geschichte. Dem Hasen ging das Vernommene zwar recht nahe, doch wusste er auch keinen Rat für sie und sagte nur: „Ich glaube, dass du dich doch an den Falschen gewandt hast und dass wir zwei wohl zu verschieden sind. Und da du ja im Grunde ein Raubtier bist, solltest du hier warten, bis der Fuchs vorbeikommt. Das kann nicht mehr allzu lange dauern.“
Als Schnurrhaar dann den Fuchs nach einer Weile kommen sah, lief sie ihm schon entgegen, um ihm sogleich ihr Leid zu klagen. Der Fuchs, der bekannt dafür war, einen klugen Kopf zu haben, aber gerade in Eile zu sein schien, entgegnete ihr ziemlich unwirsch: „Warum belästigst du mich mit deiner Kümmernis. Such dir doch lieber einen neuen Menschen, den du umschmeicheln kannst! Der wird dir dann schon so tun, wie du es dir so sehr ersehnst.“
Dies sah Schnurrhaar auch ein und lief, ihre Gedanken an diese neue Hoffnung verlierend, immer weiter in den Wald hinein, dabei ständig nur nach Menschen Ausschau haltend. So hatte sie sich schon völlig verirrt, als ihr schließlich in den Sinn kam, dass sie ja eigentlich wieder in die vertraute Gegend zurückwollte.
Während sie mit bangem Herzen vergeblich versuchte, sich zwischen all den ihr unheimlichen Baumriesen zurechtzufinden, erblickte sie auf einmal eine junge Frau, die dort gerade Beeren pflückte. Schnurrhaar sah in ihr eine Gabe des Himmels und lief hoffnungsfroh auf sie zu. Doch als sie um deren Beine streichen wollte, bemerkte die Frau sie, erschrak und trat Schnurrhaar dann gar mit Füßen, und das nicht mal völlig grundlos. Denn sie litt an einer schlimmen Katzenhaarallergie.
Wolfgang Rödiglebt in Mitterfels. Er hat seit 2003 mehr als 500 belletristische Kurztexte in Anthologien, Literaturzeitschriften und Tageszeitungen veröffentlicht.
*
Kaspar und die Angst vor dem Fischbaum
Hej hej, mein Name ist Kaspar Katersson. Heute erzähle ich euch von meiner ersten Seefahrt.
Ich war noch ein sehr junger Kater und lebte mit meiner Menschenfamilie in Schweden. Eines Tages entdeckte ich im Zweibeinerschuppen ein Gemälde in einem geschnitzten Holzrahmen. Im ersten Moment dachte ich, es wäre ein Spiegel, denn die Ähnlichkeit zwischen dem Kater, der über der Schulter eines ebenfalls rothaarigen Wikingers lag, und mir, war verblüffend. Das Tier hatte eine schneeweiße Schnauze, einen kupferfarbenen Scheitel und orangene Ohren – genau wie ich. Habt ihr schon mal mit geschlossenen Augen in die Sonne geschaut? So müsst ihr euch mein satt leuchtendes Orange vorstellen. Aufgeregt versuchte ich, die Inschrift auf dem messingfarbenen Schildchen, das auf den Rahmen genagelt war, zu entziffern. Nun ja, leider musste ich feststellen, dass ich gar nicht lesen konnte.
Ich beschloss, mir diese Fähigkeit anzueignen. Von da an saß ich jeden Tag zwischen den Kindern und schielte in ihre Bücher, während sie die Hausaufgaben erledigten. Mit der Zeit verwandelten sich die kleinen, schwarzen Ameisen in Buchstaben. Zusammengesetzte Buchstaben ergaben Worte. Aus Worten entstanden Sätze. Bald war ich in der Lage, ganze Bücher zu verschlingen. Ich entwickelte mich vom Kater zur Ratte. Zur Leseratte! Ich frage mich bis heute, wieso man Vielleser so nennt. Leseratte? Ich kenne keine einzige lesende Ratte. Das Gleiche gilt auch für Bücherwürmer.
Durch meine neue Superkraft konnte ich endlich das Rätsel des geheimnisvollen Katers auf dem Gemälde lösen. Erik der Rote stand auf dem Schildchen. Und in kleineren Buchstaben darunter Seefahrer und Entdecker von Grönland.
Stolz, so einen berühmten Vorfahren zu haben, beschloss ich, auch Seefahrer zu werden! Ich wollte Abenteuer erleben und die Weltmeere erkunden. Eine Augenklappe, Holzbein oder sonstige Albernheiten, die einem beim Stichwort Seefahrer durch den Kopf spuken, verkniff ich mir. Einen Käpten mit Boot hatte ich schon: mein Herrchen. Er fuhr jeden Tag zum Fischen aufs Meer hinaus. „Morgen werde ich mit ihm zur See fahren“, entschied ich und bekam vor Aufregung die ganze Nacht kein Auge zu.
Im Morgengrauen wartete ich am Gartentor auf meinen Käpten.
„Kaspar, was tust du denn hier?“, fragte dieser verwundert, als ich ihn miauend begrüßte. „Willst du mich begleiten? Ich könnte einen Schiffsjungen gebrauchen“, lachte er.
„Schiffsjunge? Spinnst du? Ich kapere das Boot, dann werden wir ja sehen, wer der Junge für alles ist! Ich möchte Abenteuer erleben und neue Welten entdecken!“, miaute ich empört. Doch er hatte mir gar nicht zugehört und war schon auf dem Schiff. Ich raste den Steg entlang und sprang an Bord. Okay, vorerst war er der Käpten. Er startete den Motor und wir tuckerten davon. Ein Segelboot hätte mir zwar besser gefallen, aber für die erste Fahrt war auch ein Motorboot in Ordnung. Ich war endlich auf dem Wasser, das war die Hauptsache.
Der Wind wehte durch meine Schnurrhaare und ich fühlte mich wie ein echter Seefahrer! Ich atmete die salzige Meeresluft ein, unter die sich ein Hauch Benzin und Alge gemischt hatte. So roch das Abenteuer! Der Bug teilte das Wasser und die Wellen klatschten mit weißen Schaumkronen am Schiff entlang. Wir fuhren direkt in den Sonnenaufgang hinein. Das Meer reflektierte die ersten Strahlen wie eine in Falten gelegte Glitzerfolie.
Der Käpten drosselte die Geschwindigkeit und schaltete den Motor aus. Unser Boot tanzte im Takt des Wellengangs. Dann wurde die Angel ausgeworfen und kurz darauf wackelte die Schnur. Der erste Fisch hatte angebissen. Mein Käpten zog ihn heraus und schenkte ihn mir. Ich schnupperte an dem glänzenden Hering, der mich mit weit aufgerissenen Augen anglotzte und nach Luft schnappte. Oder schnappen Fische nach Wasser? Ich packte das arme Geschöpf mit dem Maul, denn ich war mit allen vieren damit beschäftigt, beim stärker werdenden Wellengang nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Als der Käpten kurz wegschaute, warf ich den Hering zurück ins Wasser. Ich versuchte vergeblich, den Geschmack von Fisch und Salz auf der Zunge loszuwerden. Mir war ganz flau im Magen.
„Zum Klabautermann nochmal! Ich bin der Nachfahre eines Seefahrers und kein Weichei!“, schimpfte ich mit mir selbst. Meine Seefahrerehre stand auf dem Spiel. Ich kniff die Backen zusammen und versuchte, mich durch langsames Atmen zu beruhigen. „Ich bin nicht seekrank. Ich bin nicht seekrank!“, redete ich mir ein. Doch es half nichts. Mir war kalt und meine Beine fühlten sich an, als ob sie aus Wackelpudding waren.
„Kaspar, was ist los? Du zitterst ja!“ Der Käpten sah mich besorgt an. „Wir fahren zurück. Diese großen Wellen sind nichts für einen kleinen Kater.“
„Kleinen Kater? Ich bin der Nachfahre von Erik dem Roten!“, wollte ich ihm entgegenmiauen, bekam aber nur ein klägliches Fiepen heraus.
Ich war froh, als ich endlich wieder festen Boden unter den Pfoten hatte. Die Sonne hatte das Holz erwärmt und ich legte mich auf den Steg. Von da aus beobachtete ich eine Möwe, die mit einem zappelnden Fisch im Maul davonflog.
„Vielleicht bin ich doch nicht seekrank, sondern habe eine Fischallergie“, überlegte ich. „Aber die Möwe hat kein Problem, Fisch zu fressen ...“, grübelte ich. „... zu fressen!“
Jetzt fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Es widerstrebte mir, Tiere zu verspeisen! Vor Mäusen hatte ich Angst und Vögel bewunderte ich wegen ihres Gesangs. Ich war ein Vegetarier, gefangen im Körper eines Raubtiers! Endlich wusste ich, warum mir schlecht geworden war. „Dann kann ich ja doch noch Seefahrer werden!“ Ich rollte mich zufrieden ein und schloss die Augen.
Aus heiterem Himmel fing es an zu stürmen und die Wellen klatschten über mir zusammen. Ich war wieder auf dem Boot und krallte mich panisch an der Reling fest. Mein Käpten stand mit dem Rücken zu mir. Er trug einen silbrigen Regenmantel, an dem das Wasser in kleinen Bächen hinunterlief.
„Lass uns zurückfahren!“, schrie ich. Keine Reaktion – zumindest nicht vom Käpten. Stattdessen grollte der Donner und Blitze zuckten am Himmel. „Ich will sofort nach Hause!“, brüllte ich erneut. Eine Welle schwappte ins Boot, direkt in mein Gesicht. Meine Augen brannten wie Feuer. Der Käpten drehte sich um. Aber es war nicht mein Herrchen! Der Mantel hatte sich in Fischschuppen verwandelt. Ich stand einem glänzenden Riesenfisch gegenüber, der mich mit eiskalten Glupschaugen anglotzte. Er öffnete sein entenschnabelförmiges Maul und ließ die spitzen Zähne blitzen. An Stelle der rechten Schwimmflosse hatte er eine Krebsschere, mit der er nach mir schnappte.
„Auaaaaa!“ Ich sprang auf. Ich musste geträumt haben, aber der Schmerz war echt. Ein roter Krebs hing an meinem Schwanz! Zum Glück ließ er sich abschütteln.
Gegen Mittag kam mein Herrchen zurück und hielt mir schon wieder einen dicken Fisch vor die Schnauze. Andere Katzen hätten sich alle Tatzen danach geleckt. Mir aber war er ein Graus. Ich grübelte, wie ich das Geschenk unbemerkt verschwinden lassen konnte.
Nachts schlich ich in den Schuppen und schnappte mir den Spaten. Nachdem ich mir sicher war, dass mich auch wirklich niemand beobachtete, grub ich ein Loch in der hintersten Gartenecke. Mit angehaltenem Atem warf ich den armen Fisch hinein. Dann verteilte ich die Erde darauf und trat sie fest.
„Hoffentlich wächst im nächsten Frühjahr kein Fischbaum daraus.“
In Zukunft werde ich mit dem Boot der Kinder auf Entdeckungsfahrt rudern. Bleibt zu hoffen, dass der Käpten mir keine Fische mehr schenkt.
Eva Brunewurde 1974 in Donaueschingen geboren. Für ihr Grafik-Design Studium zog sie nach Hamburg. Dort arbeitete sie in verschiedenen Werbeagenturen als Art-Direktorin. Heute lebt sie mit ihrer Familie und zwei Katern in der Nähe von Heilbronn. In ihrer Freizeit schreibt die freiberufliche Grafikerin Kurzgeschichten, von denen schon einige in verschiedenen Anthologien veröffentlicht wurden. Wollt ihr mehr über Kater Kaspar erfahren? Dann folgt ihm auf Instagram unter kaspar_katersson.
*
*
Rambo
Hallo, ich bin die Rambo. Richtig gelesen, die Rambo. Eigentlich war mein Name Tommy, den gaben mir meine ersten Menschen. Als ich zu Margit kam, sagte sie, dass ich jetzt Rambo heiße. Später sagte der Doktor, dass ich nicht Rambo heißen könne, allenfalls Rambine. Margit aber sagte, ich Rambo heiße und fertig.
Die Leute hier lachen, wenn sie hören, dass die süße kleine Katze Rambo heißt. Soweit ich das verstanden habe, war Rambo ein Filmmensch, den es nicht wirklich gegeben hat. Aber der war bei Weitem nicht so lieb wie ich.
Eigentlich war ich ja eine Stadtkatze, denn ich lebte in einer Stadt. Und dachte, es ist normal, dass Katzen gelegentlich Kleidung tragen und in einem Wagen gefahren werden. Ich kannte es nicht anders.
Schon sehr bald lernte ich meine erste Lektion in Sachen Menschen. Ich sollte plötzlich verschwinden, die wollten mich nicht mehr! Deshalb haben sie mich auf einem Flohmarkt verkauft. Ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt ist, aber inzwischen habe verstanden, was das ist.
Margits Schwester war dort. Eigentlich wollte sie keine Katze kaufen. Aber als sie mein Foto an einem Stand sah, dachte sie, dass ich vielleicht ganz gut als Stallkatze mitkommen könnte, und sprach mit den Leuten. Die hatten zum Glück nur Fotos hingehängt, mir blieb der Flohmarkt erspart.
Als Dagmar kam, um mich abzuholen, hat sie sich doch sehr gewundert, weil ich Kleidung und diesen Wagen hatte.
Inzwischen weiß ich auch, dass es Puppenkleidung und ein Puppenwagen waren. Also für Spielzeuge, nicht für unsereins. Mag ja sein, dass die Kinder einfach noch zu jung und dumm waren, aber die Eltern hätten das doch wissen müssen. Ich fand das zwar nicht schlimm, aber ich wusste ja auch nicht, dass so etwas nicht normal ist.
Jetzt lebe ich hier am Dorfrand im Stall und reite auf meinen Ponys. Das ist viel toller, als im Puppenwagen zu fahren. Den Ponys gefällt es auch. Besonders, wenn ich ihnen mal wieder eine Massage verpasse. Meine Trampelmassagen sind nämlich super, das lieben sie. Da kann kein Mensch mithalten.
Margit reitet meist auf Peter und Leo darf dann immer an der Leine mitkommen, aber manchmal geht sie auch mit ihnen spazieren. Da gehe ich auch schon mal mit. Nun gibt es viele Menschen, die nicht verstehen, dass man auch mit Ponys spazieren gehen kann, nicht nur mit Hunden. Wenn dann auch noch eine Katze dabei ist, überfordert sie das dann manchmal doch.
Als ich zu Margit kam, war alles anders als vorher. Ich war eine Stadtkatze, jetzt bin ich eine Reitkatze. Musste nur erst den Ponys hier beibringen, dass sie nun Katzenspielzeuge sind. Peter musste ich nicht lange überzeugen, der ist richtig nett und für alles zu haben. Mit Leo und Anton war das schon etwas anderes. Anton und Leopold – so heißt Leo richtig – haben mich gejagt und wollten sogar in meinen Schwanz beißen. Das haben sie mit Polly, einer älteren Katze, die auch hier lebt, auch gemacht. Deshalb geht sie ihnen lieber aus dem Weg.
Aber nicht mit mir! Ich habe beide ziemlich flott um die Pfote gewickelt und konnte schon nach kurzer Zeit machen, was ich wollte. Auf dem Rücken von allen dreien sitze und liege ich ganz gerne.
So wie die Menschen hier manchmal reagieren, scheint das auch nicht so ganz der Norm zu entsprechen, aber ich weiß, dass es noch viele von uns gibt. Margit sagt, ich wäre eine Reitkatze, genauer gesagt, eine Westerwälder Reitkatze. Weil ich nämlich im Westerwald wohne. Ich jedenfalls finde es toll und werde es auch nicht aufgeben, nur weil einige Menschen zu dumm sind, das zu verstehen. Bloß, weil sie das nicht kennen.
Als ich klein war, durfte ich sogar auf Leos Kopf sitzen. Leider nur ein paar Wochen, dann ging es nicht mehr, weil ich zu groß geworden war. Leo ist ein kleines Shetlandpony, deshalb ist sein Kopf auch ziemlich klein. Außerdem sagt er, Ponyköpfe seien eigentlich nicht als Sitzplätze für Katzen gedacht. In einem Punkt waren wir uns aber einig. Damit kann man Margit so richtig ärgern. Sie hat immer versucht, das zu fotografieren, aber wir haben sie immer sabotiert. Behauptet sie. Ist doch nicht unsere Schuld, wenn da der Misthaufen im Hintergrund ist oder eine offene Tür zum Heulager. Oder der Sattel hängt über dem Zaun. Ich hänge den bestimmt nicht auf den Zaun. Und Türen öffnen wir auch nicht.
So hat sie von dieser ganzen Geschichte nur ein einziges Foto, das halbwegs gut ist. Sie ist ohnehin immer sehr kleinlich mit dem Hintergrund und beschuldigt uns dann, wir würden das extra machen. Blödsinn!
Leider fand diese Sache ja sowieso ein schnelles Ende, weil ich gewachsen bin, während Leo nicht mitgewachsen ist. Aber auf seinem Rücken ist immer noch Platz für mich.
Nur schade, dass ich nicht zu Margit nach Hause mitkommen darf. Das will sie nicht, denn da ist diese dämliche Bundesstraße. Da fahren jede Menge Autos – und die fahren ohne Rücksicht. Da sind nicht nur viele Katzen und andere Tier getötet worden, es wurden auch schon Menschen schwer verletzt. Ganz zu schweigen von den vielen Unfällen. Margit sagt, das kommt, weil die so rasen und weil da dann noch mitten im Dorf die Kreuzung ist und viele die Vorfahrt nicht beachten. Sie weiß das, weil sie ganz in der Nähe der Kreuzung wohnt und die Polizei manchmal sogar bei ihr im Hof parkt, wenn sie mal wieder kommen muss. Ich habe zwar von dem Ganzen keine Ahnung, tue aber immer so, als wüsste ich, worum es geht, wenn die Menschen sich hier am Zaun mal darüber unterhalten.
Ein bisschen Ahnung habe ich sogar wirklich. Wir können nämlich vom Stall aus diese Straße sehen, die ist ganz nahe. Und wenn dann mal wieder alle Autos stehen und gar nicht oder nur sehr langsam fahren können, dann hat es mal wieder gekracht. Manchmal kommen dann auch noch diese lärmenden und leuchtenden Autos, die Einsatzfahrzeuge genannt werden. Wenn die kommen, dann ist es schlimm. Die Polizei kommt zwar immer, aber meistens fahren die ganz normal, da erkennt man sie nur an den grün-weißen Autos.
Ich habe auch schon solche Unfälle gesehen, wir können nämlich von hier aus die Tankstelle sehen, die ist schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Manchmal sind die Menschen so dumm, dass sie sich sogar auf der Tankstelle gegenseitig rammen. Oder sie passen beim Rausfahren auf die Straße nicht auf. Manche passen sogar beim Geradeausfahren nicht auf und fahren auf die anderen Autos auf.
Wenn Margit und/oder Dagmar bei solchen Gelegenheiten hier sind, haben sie dazu manchmal ganz schön krasse Sprüche drauf. Im Gegensatz zu Fremden, die uns manchmal besuchen, erschrecken sie auch nicht, wenn es mal wieder rummst, sie kennen das schon lange. Sie erkennen sogar am Geräusch ob es richtig gekracht hat oder nur ein kleiner Bums war. Dann muss Margit sich auch schon mal anhören, dass sie ein Gemüt wie ein Fleischerhund hat. Was soll das denn schon wieder?
Die Fremden sind übrigens nicht wirklich fremd, Margit und Dagmar kennen sie und sind auch dabei, wenn die hier am Stall sind. Richtig Fremde sind ebenso unerwünscht wie die Leute, die uns füttern oder den Zaun beschädigen. Wenn sie diese Sorte erwischt, dann wird es schon mal laut. Das mag sie nämlich gar nicht, weil das ja auch gefährlich für die Ponys ist. Sie sagt, das sei ihr Eigentum hier, da haben andere Menschen grundsätzlich nichts zu suchen – und das wüssten die auch. Dann sollen sie sich gefälligst auch daran halten!
Nachtrag von Margit: Rambo wurde leider mit nur neun Monaten ein Opfer von FIP. Damals, in den frühen Neunzigern, gab es die heutigen Untersuchungsmethoden noch nicht und es wurde trotz mehrerer Tierarztbesuche zu spät erkannt, sodass ich Rambo nur noch erlösen konnte.
Margit Günster, Jahrgang 1963, ist Hauswirtschaftsmeisterin und in diesem Beruf seit über 30 Jahren tätig. Seit über 25 Jahren div. Veröffentlichungen (Gedichte, Geschichten und Fotos) in Zeitungen, Zeitschriften, Fachzeitschriften und Kalendern. Lebt in Boden, einem kleinen Ort im Westerwald.
*
*
Sanfte Pfoten
Sanfte Pfoten tapsen leise
Durch das Gras
Genießen die ersten warmen Sonnenstrahlen
Verteidigen ihr Revier gegen fauchende Rivalen
Sanfte Pfoten tapsen leise
Durch die Sonne
Ruhen auch gerne mal im kühlen Schatten
Jagen des Nachts eifrig Mäuse und Ratten
Sanfte Pfoten tapsen leise
Durch das Laub
Fangen die vielen bunten fallenden Blätter
Doch verabscheuen das kalte, nasse Wetter
Sanfte Pfoten tapsen leise
Durch den Schnee
Kratzen am geschmückten Weihnachtsbaum
Jagen leuchtende Kugeln durch den Raum
Sanfte Pfoten tapsen leise
Durch mein Leben
Ohne dich wäre mein Alltag grau und trist
Weil du meine Katze und beste Freundin bist
Annabelle Krajewskiwurde1991 in Essen geboren und studierte Rechtswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Das Gedicht „Sanfte Pfoten“ schrieb sie für ihre Katze Leni, die bereits seit zehn Jahren an ihrer Seite ist.
*
*
Ein Strauß Rosen
Mit einem Ruck fährt Anne aus dem Schlaf hoch. Endlich spürt sie, dass wir nicht alleine sind.
„Anne?“
Die Stimme lässt sie herumfahren. „Ben! Was … was tust du hier?“ Anne zieht sich die Bettdecke bis zum Hals hoch. Sie atmet schwer, ihr bricht der kalte Schweiß aus. Der Eindringling mit seiner grell leuchtenden Taschenlampe betrachtet sie aus der Ecke des Zimmers heraus. Er scheint Gefallen an ihrer Angst zu finden und grinst breit.
Mich kann er nicht sehen, ich beobachte ihn vom Flur aus. Trotzdem steigen mir die Haare zu Berge. Ich ahne nichts Gutes, halte bewusst einen Sicherheitsabstand von mehreren Metern ein.
„Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen – Markus, Kapitel zehn. Ich komme wieder“, droht der Mann jetzt. Dann schwenkt er seine Taschenlampe theatralisch hin und her. Bevor dieser Ben die Wohnung wieder über den Balkon verlässt, legt er eine Rose auf die Bettdecke. Sie hat das gleiche Dunkelrot wie die Rosen, die seit wenigen Tagen in einer Vase im Wohnzimmer stehen.
Es dauert einige Minuten, bis Anne sich aus ihrem Bett wagt. Mit schlotternden Knien schließt sie die Balkontür. In der Küche schaltet sie das Licht an und lässt sie sich auf einen Stuhl fallen. Sie trinkt zitternd ein Glas Wasser. Dann drückt sie mich an sich. Ihr Herz rast, sie spricht wirr mit sich selbst, erzählt, dass sie sich nie auf diesen Ben hätte einlassen sollen. Sie seufzt, nuschelt vor sich hin: „Deshalb also die Rosen im Fahrradkorb, Briefkasten und vor der Wohnungstür. Ich hätte es wissen müssen.“
Ab sofort bleiben die Balkontür und Fenster geschlossen, die Jalousien heruntergezogen. Tag und Nacht stickige Luft und künstliches Licht. Anne schleppt sich morgens mit dunklen Rändern unter den Augen aus der Wohnung. Sie kommt mit Tabletten zurück. Der Arzt habe sie mit ihrem Herzrasen vorerst aus dem Verkehr gezogen, sagt sie.
Wir dösen vor dem Fernseher: Serien, Talkshows, Dokus. Nur die Nachrichtensendungen mit den Katastrophenmeldungen rütteln uns zwischendurch wach. Bewegte Bilder aus anderen Welten.
Als Anne eines Abends den Müll herausbringen will, höre ich plötzlich Ben im Treppenhaus. „Kann ich behilflich sein?“, fragt er mit zuckersüßer Stimme.
Ich ahne Schreckliches, verstecke mich sofort hinter der Garderobe. Anne dagegen sucht an der Wohnungstür Halt, die Worte bleiben ihr im Hals stecken.
„Wer sein Weib liebt, der liebt sich selbst. Brief an die Epheser 5:28“, fügt dieser Ben wie ein Pastor hinzu.
Anne schüttelt den Kopf, sie wankt zurück in die Wohnung. Ihre Knie zittern, ihr Herz schlägt Alarm. Das Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür versucht sie, zu überhören. Sie stellt das Radio laut, ist leichenblass. Kein Wunder, das Tageslicht sieht Anne ja nur noch, wenn sie sich auf den Weg zum Arzt macht oder kurz einkaufen geht.
Später telefoniert Anne mit ihrer Mutter, was sie sonst nur an Geburtstagen und an Weihnachten macht. Sie lässt kein gutes Wort an Ben. „Mama! Du hast ihm meine Anschrift gegeben? Ich fasse es nicht“, brüllt sie. „Von wegen liebevoller Ehemann! Der Typ ist ein Stalker, ein schizophrener Psychopath!“ Sie fasst sich mit der Hand an die Stirn. „Oh Mann, du weißt doch, warum ich so weit weggezogen bin. Ich wollte endlich meine Ruhe vor Ben haben. Aber nein, meine Mutter gibt ihm gleich die neue Adresse. Ich glaube, ich spinne. Das darf doch alles nicht wahr sein.“
Dann schweigt sie, scheint der Mutter zuzuhören.
„Spaziergänge am Strand als Mittel gegen Winterdepressionen? Danach Thalasso-Anwendungen und Wellness? Du spinnst doch, Mama! Ben ist völlig gestört, nicht ich. Kannst oder willst du das immer noch nicht begreifen?“
Jetzt scheint die Mutter zu antworten, denn Anne schluckt nur noch.
„Zu lebhafte Fantasie? Nee, Mama, ich steigere mich da in nichts rein“, schreit sie kurz darauf in das Telefon. Ihre Stimme klingt hysterisch. „Und ich brauche auch keine Therapie, um mich von den Schatten der Vergangenheit zu befreien.“ Sie beendet das Gespräch, knallt wutentbrannt den Hörer auf die Gabel und verschwindet im Schlafzimmer.
Ich höre sie schluchzen, rieche Angstschweiß, kuschele mich trotzdem an sie. Es scheint zu wirken. Anne wird ruhiger, sie wirkt nachdenklich, in sich gekehrt.
„Für meine Mutter war ich immer eine graue Maus, die sich in Fantasiewelten flüchtet. Verstehst du das? Sie hat mich nie akzeptiert, wie ich war. Niemals …!“, stammelt sie.
Das plötzliche Klingeln des Telefons holt uns beide zurück in die Gegenwart. Anne eilt in den Flur.
„Was soll das heißen, zum Valentinstag für jedes Jahr unserer Ehe eine Rose?“, schreit sie. „Ich werde dich anzeigen, du Dreckskerl! Die Opferzeiten sind vorbei. Du wirst mich jetzt von einer ganz anderen Seite kennenlernen, Ben. Besser jetzt als nie!“
Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Als Anne am nächsten Morgen die Wohnung verlassen will, um die Polizeistation aufzusuchen, steht Ben schon vor der Wohnungstür. Er drängt sie sofort zurück, schiebt sie brutal ins Wohnzimmer. Alles geht rasend schnell, ist so anders als in den vielen Fernsehkrimis, die wir in den vergangenen Wochen zusammen angesehen haben. Anne stolpert gegen den Couchtisch, sie kämpft mit dem Gleichgewicht. Gegen das Sofakissen in ihrem Gesicht hat sie keine Chance. Sie wehrt sich nicht einmal. Ben wirkt routiniert, er braucht keine fünf Minuten, bis er die Wohnung mit gefährlich blitzenden Augen wieder verlassen hat. Ich suche sicherheitshalber hinter der Badezimmertür Schutz.
Dann ist es still, totenstill, stunden-, tagelang. Ich schreie, niemand hört mich. Ich wimmere, trauere still, verfalle in einen Dämmerzustand, in dem sich Traum und Wirklichkeit nicht länger unterscheiden und das Licht zu schwinden droht.
Annes Tod wird erst bemerkt, als es in der Wohnung bereits bestialisch stinkt. Das Katzenklo ist mittlerweile völlig verdreckt, das Geschirr in der Spüle schimmelt, Fruchtfliegen schwirren um den Obstkorb. Der Polizist, der mit dem Hausmeister hereinkommt, rümpft die Nase. Er zieht sämtliche Jalousien hoch, öffnet endlich die Balkontür. Was für eine Wohltat! Ich atme tief durch, sauge die frische Luft und das wärmende Sonnenlicht in mir auf.
Tod durch Herzversagen, stellt der Arzt nach seinen Untersuchungen fest. Er zeigt auf die Tabletten. Der verwelkten Rose neben der zierlichen Leiche schenkt niemand Beachtung.
Am Anfang stand ein Strauß Rosen, am Ende ein Rosenkrieg, so lautet ein Sprichwort. Jetzt weiß ich wieder, warum ich den süßlichen Duft von Rosen nicht mag. Ich überlege kurz, ob ich dem Polizisten, der mich jetzt mit Futter und Wasser versorgt, einen Hinweis geben und ihn auf die stachelige Rose aufmerksam machen soll, entscheide mich dann aber dagegen. Wem würde es nutzen? Anne ist mausetot. Niemand außer mir wird sie ernsthaft vermissen. Nein, ich brauche jetzt wirklich meine letzte Kraft, wenn ich im Tierheim mit all den anderen Katzen und Katern überleben will.
Ulli Krebs, geboren 1965 in Düsseldorf, Redakteurin und Hobbyautorin, Veröffentlichung mehrerer Kurzgeschichten, Gedichte und eines Regionalkrimis, wohnhaft in der Wesermarsch.
*
Die Patchwork-Katze
Lara warf wütend die Patchwork-Katze in eine Ecke ihres Zimmers. „Ich will ein richtiges Haustier“, dachte sie. „Nicht so ein blödes, selbst gemachtes Ding.“ Sie ließ sich auf ihr Bett fallen. „Überhaupt, warum hat dieses Viech zwei verschiedenfarbige Augen?“, fragte sie sich. „Das ist doch doof. Kein Tier hat ein blaues und ein grünes Auge!“ Sie schlüpfte unter ihre Decke und löschte das Licht. Langsam beruhigte sie sich. „Mit einer richtigen Katze könnte ich jetzt schmusen“, dachte sie sehnsüchtig. „Mit einem Hund könnte ich immer Gassi gehen. Kaninchen sind einfach nur süß. Ein Vogel zwitschert fröhlich und mit einem Papagei könnte ich quatschen.“
Plötzlich hörte sie kratzende Geräusche aus der Ecke, in der sie die Patchwork-Katze geworfen hatte. Ängstlich, aber auch neugierig blickte sie in die Dunkelheit. Zwei unterschiedlich farbige Punkte kamen langsam auf sie zu.
„Sind das die Augen dieser blöden Patchwork-Katze?“, fragte sich Lara und beobachtete, wie das Stofftier auf ihr Bett sprang. Das war unheimlich. Die Patchwork-Katze kletterte ihr auf die Brust. Lara spürte die Pfote trotz Decke. „Sie ist jetzt viel schwerer“, dachte Lara und traute sich nicht, sich zubewegen.
Die leuchtenden Augen näherten sich Laras Gesicht. Sie atmete flacher. „Du willst eine richtige Katze haben, stimmst?“, fragte die Patchwork-Katze.
Lara nickte nur. Sie hatte Angst und brachte keinen Ton hervor.
„Wirf mich nie wieder irgendwohin, verstanden?“, forderte die Patchwork-Katze verärgert. Wieder nickte Lara heftig. Die Patchwork-Katze machte es sich auf Laras Bett bequem und begann zu schnurren. „Gute Nacht.“
„Gute Nacht“, traute sich Lara, zu flüstern. Sie wurde von den Geräuschen der Katze müde. „Wäre es mit einer richtigen Katze genauso?“, fragte sie sich und schlief ein.
Am Morgen staunte Lara. Die Patchwork-Katze hatte sich auf der Decke zusammengerollt. Vorsichtig berührte sie sie mit dem Finger. Nicht passierte. Sie hob sie an. „Jetzt ist sie wieder nur ein Stofftier“, dachte Lara erleichtert und machte sich für die Schule fertig. „Gestern Abend war sie noch eine sitzende Katze. Jetzt liegen sie. Komisch.“
Den ganzen Tag grübelte sie über ihr nächtliches Erlebnis nach. „Geträumt habe ich das bestimmt nicht“, dachte sie überzeugt, „dann hätte die Katze keine andere Haltung annehmen können. Ist sie gefährlich?“ Es war für sie schwierig, sich auf den Unterricht zu konzentrieren.
Als Lara für die Nacht das Licht löschte, sah sie die leuchtenden Augen wieder. Sie erschrak.
„Ich beschaffe dir eine richtige Katze.“ Die Patchwork-Katze streckte sich und sprang vom Bett.
„Wie willst du das schaffen?“, wollte Lara wissen. „Mama möchte keine Tiere im Haus.“
„Auf mir liegt ein Zauber“, erklärte die Patchwork-Katze und lief zur Tür.
„Eigentlich bin ich schon zu groß, um an Magie zu glauben“, dachte Lara. „Aber ob sie das wirklich hinkriegt?“ Erstaunt beobachtete sie, wie sich die Tür wie von Geisterhand öffnete und die Patchwork-Katze das Zimmer verließ. „Das ist auch unheimlich, aber ich hätte gerne ein süßes Kätzchen.“ Sie drückte sich die Daumen, aber sie traute sich nicht, nachzusehen, warum sich die Tür von allein geöffnet hatte.
Es dauerte eine Weile, bis die Patchwork-Katze zurückkam. „Morgen nach der Schule hast du eine richtige Katze“, verkündete sie.
„Echt? Das glaube ich dir nicht“, sagte Lara.
„Warum nicht?“, wollte Patchwork-Katze wissen.
„Weil ich meine Mama kenne“, erwiderte Lara.
„Weißt du, wie das mit dem Zaubern funktioniert?“, fragte die Patchwork-Katze.
„Nö“, gab Lara zu.
„Wenn ich dir das jetzt erzähle, ist es wie mit den Wünschen beim Kerzenauspusten“, erklärte die Patchwork-Katze. „Wenn man die Wünsche jemandem verrät, werden sie nicht wahr.“
„Oh!“ Lara seufzte. Sie konnte vor Aufregung nicht einschlafen. „Wie wird meine Katze wohl aussehen?“, fragte sie sich.
Die Patchwork-Katze begann, zu schnurren. Wieder machten die Geräusche Lara müde.
„Werde ich morgen wirklich eine richtige Katze bekommen?“ Mit diesem Gedanken schlief sie ein.
In der Schule konnte sich Lara nicht konzentrieren. Die Lehrer ermahnten sie mehrmals, dass sie nicht so herumzappeln solle. Aber wie sollte sie still sitzen, wenn sie doch wusste, was sie zu Hause erwarten könnte. „Warum vergeht die Zeit so langsam?“, fragte sich Lara. „Es dauert noch ewig, bis die Schule aus ist.“ Sie atmete erleichtert auf, als sie endlich nach Hause gehen konnte.
„Hallo, Lara“, begrüßte Mama sie. „Ich habe eine Überraschung für dich. Geh doch schon mal ins Wohnzimmer.“
„Meine Katze“, dachte Lara aufgeregt.
Sie lief in den Raum. Auf der Couch lag ein kleines Pelzknäuel und schnurrte vor sich hin. „Sie hört sich wie die Patchwork-Katze an“, dachte Lara. „Wo ist die überhaupt? In meinem Zimmer?“
„Das ist eine Glückskatze“, erklärte Mama. Sie hatte nach Lara das Zimmer betreten. „Sie hat von jeder Katze ein Stück Fell. Du solltest sie Lucky nennen.“
Das Kätzchen hob den Kopf und blickte Lara aus zwei verschiedenfarbigen Augen an. Es miaute, als würde es Hallo sagen.
„Nein, ich nenne sie Patch“, rief Lara erfreut. „Wie Patchwork.“
Mama lachte. „Das pass auch gut.“
Nicole Gabrys,Jahrgang 1975 aus Duisburg. Seit 2015 veröffentlicht sie immer wieder Kurzgeschichten. Das ganzseitige Foto zeigt Marie, die Katze ihrer Tochter. Marie hat einen angeborenen Herzfehler. Das andere Bild präsentiert Flocke und Pocke. Das Geschwisterpaar wurde kurz nach der Geburt ausgesetzt und hat bei der Schwester der Autorin ein schönes Zuhause gefunden.
*
*
Ein Hamster im Katzenpelz
Alles fing an mit einem Rotkohlblatt. Einem riesengroßen Rotkohlblatt. So groß, dass der dazugehörige Rotkohlkopf sicherlich für eine Großfamilie gereicht hätte zum Sattwerden.
Dieses riesige Rotkohlblatt lag eines schönen Wintermorgens in meiner Küche. Ich hatte keinen Rotkohl eingekauft, von dem es hätte abfallen können. Ich hatte auch keinen Besuch gehabt, der einen Rotkohl eingekauft hatte, von dem es hätte abgefallen sein können.
Wie also kam dieses mysteriöse Rotkohlblatt in meine Küche?
Ein erster leiser Verdacht beschlich mich, als ich das Rotkohlblatt vom Boden aufheben wollte. Mein Kater Willi stürzte sich freudig maunzend auf das Blatt, riss es mir aus der Hand und schleppte es aus der Küche ins Wohnzimmer, wobei er weiter entzückt maunzte, was aber dank des Rotkohlblattes in seiner Schnute nun etwas gedämpft klang. Die Größe des Blattes bereitete ihm keine Probleme, schließlich war Willi ein stattlicher Norweger-Mix von knapp acht Kilo Kampfgewicht.
Bis dahin hatte ich immer gedacht, dass Katzen Jäger seien. Gut, Willi hatte mir schon des Öfteren tote – und auch lebende – Mäuse, Frösche, Fische und Vögel geschenkt. Nun aber stellte sich heraus, dass zumindest diese Katze nicht nur ein Jäger, sondern auch ein Sammler, ach was, ein wahrer Hamster war. Zum Rotkohlblatt gesellten sich über die Zeit Socken und Unterwäsche – von deren Trägern ich immer noch hoffe, dass sie nicht wissen, wo ihre privatesten Dinge gelandet sind. Auch einige Teddybärchen fanden ihren Weg in meine Küche. Auf meinen Einwand hin – ja, natürlich redete ich ständig mit meinem Kater –, dass doch jetzt bestimmt die Kinder, denen die Teddys gehörten, furchtbar traurig seien, bedachte Willi mich lediglich mit einem finster abschätzigen Blick. Kinder mochte er nicht besonders gerne.
Als der Sommer kam, war Willi wohl der Meinung, ich solle mehr Sport treiben, denn nun hielten zahllose Federbälle in meiner Küche Einzug. Die zugehörigen Schläger solle ich mir selber kaufen, meinte er – natürlich redete auch mein Kater ständig mit mir –, die passten nicht durch die Katzenklappe. Stattdessen brachte er eines Nachts einen Knieschoner mit. Was bitte schön soll ich mit zwei Knien mit nur einem Knieschoner? Willi zuckte nur mit den Achseln – auf den zweiten Knieschoner warte ich noch heute.
Die Monate gingen ins Land und in unsere Zweier-Wohngemeinschaft zog Anton ein. Anton war ein kleiner, stahlgrauer Kater von gerade einmal fünf Wochen und damit noch ein Flaschenkind. Willi liebte den kleinen Kerl abgöttisch und konnte es kaum erwarten, dass er endlich groß genug wurde, um selber die Katzenklappe zu benutzen und mit ihm die Nachbarschaft unsicher zu machen.
Eines Abends kam ich von der Arbeit nach Hause und traf meinen Nachbarn Peter, Besitzer der roten Perserkatze Milva. Willi hatte schon immer eine Schwäche für rothaarige Damen gehabt und lungerte dementsprechend häufig bei Milva und Peter herum. An diesem Abend nun fragte mich Peter, ob ich eine neue Katze hätte? Winzig klein noch, stahlgrau mit einem weißen Fleck auf der Brust?
Stimmte, ja, aber woher wusste Peter von Anton? Der war doch noch viel zu klein für selbstständige Ausflüge!
Nun, ganz einfach: Willi hatte anscheinend das Warten satt, den Kleinen am Nackenfell gepackt und durch die Katzenklappe von unserem Hochparterre-Balkon zum nachbarlichen Hochparterre-Balkon geschleppt, um ihn dort Milva und Peter vorzustellen.
Als ich in meine Wohnung kam, lagen beide Kater friedlich schlafend auf dem Sofa, als wäre nichts gewesen.
Die nächtliche Sammlung von Gegenständen in meiner Küche wurde seit Antons Einzug kleiner. Stattdessen fand ich morgens immer häufiger tote und nur halb aufgegessene Mäuse neben den Futternäpfen. Willi brachte dem Kleinen frühzeitig bei, wie richtiges Katzenessen auszusehen hat. Aber Anton war immer noch ziemlich winzig und schon nach einer halben Maus pappsatt.
Ob Willi je mit Anton geschimpft hat, dass er gefälligst die Maus aufessen solle, sonst gäbe es keinen Nachtisch, werde ich wohl nie erfahren, denn mit noch nicht einmal einem halben Jahr starb Anton. Ganz plötzlich wurde er schwer krank und wachte eines Morgens nicht mehr auf. Noch mehr als ich hat Willi getrauert, er ist noch wochenlang suchend durch die Wohnung gelaufen.
Als Willi seine Trauer überwunden hatte, widmete er sich wieder seiner Sammelleidenschaft: Unterwäsche, Tennisbälle und Spielzeug fanden sich erneut in meiner Küche ein. Fast hätte es auch ein ganzer Weihnachtsbraten geschafft. Wie Peter mir erzählte, hatte er Willi dabei erwischt, wie er den gerade dort abgestellten Braten von seinem Balkon klauen wollte.
Aber irgendwie waren die toten Gegenstände alle kein richtiger Ersatz für den kleinen, flauschigen, quicklebendigen Anton. Da ich keine Anstalten machte, uns eine neue Katze anzuschaffen, wurde Willi selber aktiv.
Eines sonnigen Sonntagmorgens saß ich in aller Herrgottsfrühe mit meiner Tasse Kaffee auf dem Balkon. Die Vögel zwitscherten, die Sommerblumen dufteten mit dem Kaffee um die Wette und Willi war irgendwo in der Nachbarschaft unterwegs.
Plötzlich höre ich vom übernächsten Hochparterre-Balkon einen alten Herrn verzweifelt rufen: „Püppi? Püppi, wo bist du denn? Püüüppiiiiii!“ Im selben Moment springt Willi auf unseren Balkon – quer vorm Maul Püppi, sicher im Nackenfell gepackt.
Nachdem ich Willi ausreichend gelobt und mit Leckerchen bestochen hatte, gab er Püppi frei und ich konnte den winzigen Chihuahua seinem Herrchen zurückbringen.
Andrea Schilken-Raulf,geboren 1964 – außen schon grau, dafür innen umso bunter. Im beschaulichen Velbert-Neviges lässt sie Tag für Tag mit fliegenden Fingern die Tasten klappern, sowohl für den Broterwerb als auch für eigene Geschichten. Oder wie ihre beste Freundin es einst treffend auf den Punkt brachte: Beruf und Berufung – Buchstabensuppenköchin.
*
Göttliche Sorgen
In meinem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr. Ah, eines meiner ergebensten Subjekte! Ich bin sicher, gleich werde ich das süße Klappern der kalten Opfergaben hören, die mir das Speisen-Subjekt entgegenbringt. Um sicherzugehen, dass er oder sie, ich bin mir nie sicher, sie sind doch so anders gebaut, perfekt zum Dienen, die mir zustehenden Gaben präsentiert, rege ich mich ein wenig. Ich rekle mich und in einer eleganten Bewegung steige ich von meinem Thron, um mich zum Altar zu begeben, wo ich mich erwartungsvoll niederlasse. Das Speisen-Subjekt schaut ehrfurchtsvoll zu mir, murmelt etwas, es drückt wohl seine Verehrung für mich aus, und eilt in die Speisekammer, wo es einige Zeit verweilt.
Gelangweilt beschließe ich, ebenfalls in die Kammer zu gehen, nicht, dass meine Opfergabe vergessen wird. Die Subjekte haben doch so kleine Gehirne, können sie mich doch nicht verstehen und erinnern sich selten an etwas, was ich ihnen gebiete. Doch da höre ich schon das Knacken der Verpackung einer Gabe und schaue ungeduldig zu dem Speisen-Subjekt auf. Meine Opferschale wird gefüllt und meine Nase erfasst den verlockenden Duft von feinsten Vögeln. Das Speisen-Subjekt macht sich daran, die Schale zu meinem Altar zu tragen und ich begebe mich schnellstens ebenfalls dorthin, um diese köstliche Speise ohne Verzögerung genießen zu können.
Ich beginne, meine Mahlzeit einzunehmen, sie ist hervorragend gelungen, und das Speisen-Subjekt zieht sich zurück, um anderen Aufgaben nachzugehen. Dies gibt mir Zeit, um über meine aktuelle Situation zu sinnieren, denn gerade in den letzten Monden haben mir die Verständnisprobleme mit den Subjekten einige Probleme bereitet. Eines meiner liebsten Subjekte war verschwunden!
Ich weiß, Götter, denn als etwas anderes kann man mich nicht bezeichnen, sollen keine Favoriten haben, doch manche Subjekte verstehen nun einmal besser als andere, was ich ihnen mitteilen will, und insbesondere dieses Subjekt ist wegen seiner Massagekünste sehr zuvorkommend und hilfreich. Und seit nun drei ganzen Mondläufen ist das Massage-Subjekt nicht hier! Es ist normal, dass es manchmal für ein paar Tage oder Wochen nicht kommt, das verstehe ich, doch so lange war es noch nie fort und ich muss gestehen, ich mache mir Sorgen. Von der Langeweile möchte ich gar nicht erst anfangen, so ist das fehlende Subjekt doch eines der einzigen, die mich zu unterhalten wissen.
Das zeigt sich inzwischen auch an meiner Stimmung. Ich will meinen Subjekten ja nicht wehtun, wirklich nicht, aber sie sind so fragil und empfindlich und bei der leichtesten Berührung meiner Samtpfoten quillt die metallisch riechende Flüssigkeit aus ihnen heraus. Die Ehrfurcht, die auf derartige Unfälle meist folgt, hat zwar manchmal mehr Opfergaben als Konsequenz, doch ich möchte meine Subjekte nicht mit Furcht regieren. Außerdem unterlassen sie nach solchen Ausbrüchen zumeist ihre Massagen.
Doch das Massage-Subjekt ist nicht hier und ich will endlich wissen, wann es in meinen Dienst zurückkehren wird. Ich werde es riskieren müssen.
Ich wende mich ein wenig widerwillig von den köstlichen Opfergaben, deren Reste noch auf meinem Schrein liegen, ab – sie werden zu einem späteren Zeitpunkt noch dort sein. Vorsichtig pirsche ich mich an das Speisen-Subjekt an, denn es ist aktuell das einzige, welches ich in diesem Raum wahrnehme, und tatze es mit eingezogenen Krallen an der gigantischen, unbehaarten Pfote. Es schaut mich verwirrt an und brabbelt etwas in den mir bekannten, aber unverständlichen Lauten. Wieder zeigt sich die Kommunikationsschwäche der Subjekte, doch ich sehe ein, dass ihre Körper zu verschieden zu dem meinen sind, um ein Lesen der Körpersprache zu ermöglichen. Sie wurden wohl nicht nach meinem Bild geschaffen, doch das ist verständlich, da sie doch mit ihren speziellen oberen Pfoten perfekt für das Bieten von Opfergaben gebaut sind.
Doch gerade, als ich noch einen Versuch unternehmen will, um verstanden zu werden, höre ich das Rumpeln des Transportmittels, das die Untertanen bevorzugt verwenden und mithilfe dessen sie meist einen Teil des Sonnenlaufs verschwinden. Das Knallen der Eingänge der Maschine hallt laut in meinen Ohren nach. Und dann höre ich die süße Stimme meines Massage-Subjekts. Aufgeregt laufe ich zu dem Haupteingang der Subjekte, meiner ist selbstverständlich auf der anderen Seite, und setze mich nervös daneben. Das Klicken des Schlosses lässt meine Ohren erwartungsvoll zucken. Der Eingang öffnet sich.
Das Massage-Subjekt ist endlich wieder zurück, genau dort, wo es hingehört, nämlich in meine Nähe. Ich streiche ihm liebevoll um die Beine, nicht, dass es noch auf die Idee kommt, es könnte wieder verschwinden, weil ich es nicht bräuchte oder meine Zuneigung nicht genug zeige. Es gibt ein glockenhelles Lachen von sich und obwohl ich das folgende Gebrabbel nicht verstehen kann, höre ich in seiner Stimme, dass es mich vermisst haben muss.
Ich schreite in meinen Thronraum und werfe zwischendurch alle paar Schritte einen Blick zurück, um sicherzugehen, dass das Lieblingssubjekt mir auch tatsächlich folgt. Mit einem schwungvollen Satz lasse ich mich auf meinem Thron nieder und recke dem Subjekt meinen Hals entgegen. Es hat meine Körpersprache zum Glück schon immer besser verstanden als die anderen Untertanen und fängt prompt an, mich zu streich … ähm ... mich zu massieren. Ich bin ja schließlich kein bloßes Tier, das gestreichelt werden könnte.
Ich zerfließe nahezu unter den rhythmischen Bewegungen auf meiner Haut und schließe die Augen. Das Subjekt scheint ein paar Grenzen neu lernen zu müssen, mein Bauch ist normalerweise nicht zum Anfassen. Doch heute bin ich zu froh, mein Lieblingssubjekt wieder um mich zu haben, um mich groß für solche Kleinigkeiten zu interessieren. Ich kann dem Subjekt die Grenzen morgen auf ein Neues beibringen, aber vielleicht würde ich ihm ein wenig mehr Freiraum lassen. Schließlich habe ich in den letzten Monden verstanden, dass die Subjekte doch so vergänglich sind und jeden Moment verschwinden können. Die Momente vor ihrer Vergänglichkeit müssen ausgekostet werden.
Jana Klöpperpieper