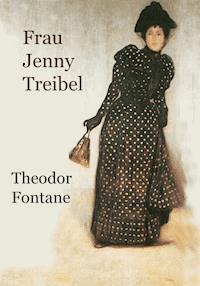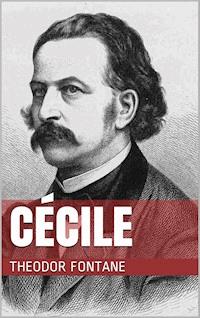Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein bewegender und anekdotischer Blick auf verträumte Kindheitsjahre in einer deutschen Kleinstadt. Als der alternde Fontane schwer erkrankte, riet ihm sein Arzt, zur Genesung seine Erinnerungen aufzuschreiben. Die vorliegenden Erzählungen sind das Ergebnis dieses Heilungsprozesses. Mit viel Freude an Details und kleinen Tragödien berichtet Fontane von seiner Kindheit in Swinemünde, von den unterschiedlichen Temperamenten seiner Eltern und den an Spielplätzen und Bandenkriegen reichen Straßen der Kleinstadt. Liebevoll und authentisch, voll kindlichem Blick und nachsichtiger Altersweisheit.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theodor Fontane
Meine Kinderjahre
Autobiographischer Roman
Saga
Meine Kinderjahre
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1894, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726997613
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Vorwort
Als mir es feststand, mein Leben zu beschreiben, stand es mir auch fest, daß ich bei meiner Vorliebe für Anekdotisches und mehr noch für eine viel Raum in Anspruch nehmende Kleinmalerei mich für einen bestimmten Abschnitt meines Lebens zu beschränken haben würde. Denn mit mehr als einem Bande herauszutreten, wollte mir nicht rätlich erscheinen. Und so blieb denn nur noch die Frage, welchen Abschnitt ich zu bevorzugen hätte.
Nach kurzem Schwanken entschied ich mich, meine Kinderjahre zu beschreiben, also »to begin with the beginning«. Ein verstorbener Freund von mir (noch dazu Schulrat) pflegte jungverheirateten Damen seiner Bekanntschaft den Rat zu geben, Aufzeichnungen über das erste Lebensjahr ihrer Kinder zu machen; in diesem ersten Lebensjahre »stecke der ganze Mensch«. Ich habe diesen Satz bestätigt gefunden, und wenn er mehr oder weniger auf Allgemeingültigkeit Anspruch hat, so darf vielleicht auch diese meine Kindheitsgeschichte als eine Lebensgeschichte gelten, Entgegengesetztenfalls verbliebe mir immer noch die Hoffnung, in diesen meinen Aufzeichnungen wenigstens etwas Zeitbildliches gegeben zu haben: das Bild einer kleinen Ostseestadt aus dem ersten Drittel des Jahrhunderts und in ihr die Schilderung einer noch ganz von Refugié-Traditionen erfüllten Franzosen-Kolonie-Familie, deren Träger und Repräsentanten meine beiden Eltern waren. Alles ist nach dem Leben gezeichnet. Wenn ich trotzdem, vorsichtigerweise, meinem Buche den Nebentitel eines »autobiographischen Romanes« gegeben habe, so hat dies darin seinen Grund, daß ich nicht von einzelnen aus jener Zeit her vielleicht noch Lebenden auf die Echtheitsfrage hin interpelliert werden möchte. Für etwaige Zweifler also sei es Roman!
Th. F.
Erstes Kapitel
Meine Eltern
An einem der letzten Märztage des Jahres 1819 hielt eine Halbchaise vor der Löwen-Apotheke in Neu-Ruppin, und ein junges Paar, von dessen gemeinschaftlichem Vermögen die Apotheke kurz vorher gekauft worden war, entstieg dem Wagen und wurde von dem Hauspersonal empfangen. Der Herr – man heiratete damals (unmittelbar nach dem Kriege) sehr früh – war erst dreiundzwanzig, die Dame einundzwanzig Jahre alt. Es waren meine Eltern.
Ich gebe zunächst eine biographische Skizze beider.
Mein Vater Louis Henri Fontane, geb. am 24. März 1796, war der Sohn des Malers und Zeichenlehrers Pierre Barthélemy Fontane. Was dieser, mein Großvater, als Maler leistete, beschränkte sich vorwiegend auf Pastell-Kopien nach englischen Vorbildern; als Zeichenlehrer aber muß er tüchtig gewesen sein, denn er kam zu Beginn des neuen Jahrhunderts an den Hof und wurde mit dem Zeichenunterricht der ältesten königlichen Prinzen betraut. Dies leitete sein Glück ein. Königin Luise wohnte gelegentlich dem Unterrichte der Kinder bei, und alsbald an dem gewandten und ein sehr gutes Französisch sprechenden Manne Gefallen findend, nahm sie denselben als Kabinettssekretär in ihren persönlichen Dienst. Vielleicht geschah es auch auf Vorschlag des um jene Zeit überaus einflußreichen Kabinettsrats Lombard, der dabei den Zweck verfolgen mochte, seine auf ein Bündnis mit Frankreich hinarbeitende Politik durch bei Hofe verkehrende Persönlichkeiten verstärkt zu sehen. Die Gegner waren von dieser Ernennung wenig erbaut, und der nationalgesinnte Gottfried Schadow, damals noch nicht der »alte Schadow«, schrieb in sein Tagebuch: »Ein Herr Fontane, seines Zeichens Maler, ist Kabinettssekretär der Königin geworden; er malt schlecht, aber er spricht gut französisch.« Ob Pierre Barthélemy, mein Großvater, in seiner Stellung Einfluß geübt oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis; jedenfalls, wenn ein solcher Einfluß da war, war er von kurzer Dauer; denn dem Sturze Lombards, der nicht lange mehr auf sich warten ließ, folgte die Katastrophe von Jena; der Hof, flüchtig werdend, ging nach Königsberg, und Pierre Barthélemy, dessen Dienste keine weitere Verwendung mehr finden konnten, erhielt, in Berlin zurückbleibend, wohl als eine Art Abfindung, das Amt eines Kastellans von Schloß Nieder-Schönhausen. Dorthin übersiedelte er nun, und von hier aus besuchte mein Vater drei Jahre lang, also wahrscheinlich bis Herbst 1809, das Gymnasium zum Grauen Kloster. Es waren harte Schuljahre, denn der weite, wenigstens anderthalb Stunden lange Weg nach Berlin erforderte, daß jeden Morgen um spätestens sechs Uhr aufgestanden werden mußte. »Winters froren wir bitterlich, und es wurde erst besser, als wir, mein älterer Bruder und ich, blaue mit postorangefarbenem Kattun gefütterte Mäntel als Weihnachtsgeschenk erhielten. Aber es erwuchs uns daraus keine reine Freude. Jedesmal wenn sich der Wind in den mit einem gleichfarbigen Kattun gefütterten großen Kragen setzte, stand uns der postorangefarbene Kragen wie ein Heiligenschein zu Häupten, und der Spott der Straßenjungen war immer hinter uns her.« Es war dies eine Lieblingsgeschichte meines Vaters, der an ihr bis in sein Alter hinein festhielt und nichts davon wissen wollte, wenn ich ihm lachend von meinen eigenen, dem Vorstehenden sehr verwandten Schicksalen erzählte. »Ja, Papa«, begann ich dann wohl, »so bin ich, als ich so alt war wie du damals, auch gequält worden. Mama ließ mir um jene Zeit, ich war eben mit ihr in Berlin angekommen, Rock, Weste und Beinkleid aus einem milchfarbenen Tuchstoff machen, es war ein billiger Rest, und in der Klödenschen Schule hieß ich dann, ein ganzes Jahr lang, der ›Antiquar aus der alten Post‹. Der trug nämlich gerade solchen milchfarbenen Anzug und war überhaupt eine Karikatur.« – »Kann schon sein«, schmunzelte mein Vater, »so was ist mitunter erblich; aber Postorange war doch schlimmer, dabei muß ich bleiben. Es schrie förmlich in die Welt hinein.«
Von guter Schülerschaft konnte bei den zwei Meilen Wegs, die jeden Tag zurückgelegt werden mußten, nach eignem Zeugnis meines Vaters, nicht wohl die Rede sein. Es darf aber aus dem Umstande, daß er zeitlebens selbst von einer mangelhaften Schulbildung sprach, nicht auf eine Trauer über diesen Tatbestand geschlossen werden. Beinah das Gegenteil. Er hielt es nämlich, wie viele zu jener Zeit, mit gesundem Menschenverstand und Lebekunst, oder, wie es in unserer Haussprache hieß, mit »bon sens« und »savoir faire« und war, ganz vereinzelte Ausnahmen abgerechnet, nie dazu zu bringen, sich zu willfähriger Anerkennung der »homines literati« aufzuraffen. Es gab das, wenn er seinen sogenannten »ehrlichen Tag« hatte, den Tag also, wo er aus seiner sonstigen Politesse herausfiel, mitunter recht verlegene Situationen für uns Kinder; im großen und ganzen aber bin ich ihm doch das Zeugnis schuldig, daß er, den ihm persönlich zu Gesichte kommenden Studierten gegenüber, in neunzehn Fällen von zwanzigen immer im Rechte war. Und es konnte dies auch kaum anders sein. Er war – weil er viel Zeit hatte, leider zu viel, was für ihn verhängnisvoll wurde – von Beginn seiner Selbständigkeit an, ein überaus fleißiger Journal- und Zeitungsleser, und weil er sich nebenher angewöhnt hatte, wegen jedes ihm unklaren Punktes in den Geschichts- und Geographiebüchern, besonders aber im Konversationslexikon nachzuschlagen, so besaß er, auf gesellschaftliche Konversation hin angesehn, eine offenbare Überlegenheit über die meisten damals in kleinen Nestern sich vorfindenden Ärzte, Stadtrichter, Bürgermeister und Syndizi, die, weil sie sich tagaus tagein in ihrem Berufe quälen mußten, sehr viel weniger Zeit zum Lesen hatten. Erlitt er mal eine Niederlage, so gab er diese freimütig zu, ja, pries sogar seinen Sieger, blieb aber dabei, daß es ein Ausnahmefall sei.
Und nun zurück zum Herbst 1809, wo mein Vater als Lehrling in die Berliner Elefanten-Apotheke eintrat. Diese Apotheke befand sich schon damals, wie heute noch, am oberen Ende der Leipziger Straße, jedoch nicht genau an gegenwärtiger Stelle, sondern eben dieser Stelle gegenüber, an der durch Leipziger und Kommandantenstraße gebildeten Ecke. Bis vor wenig Jahren sah man noch den Elefanten, in Höhe des ersten Stocks, aus dem großen Eckpfeiler heraustreten; jetzt ist er fort, und nur die zahlreich über den Parterrefenstern angebrachten und an Elefantenrüsseln hängenden Gaslaternen erinnern noch an die frühere Geschichte des Hauses.
In eben dieser Elefanten-Apotheke war mein Vater viertehalb Jahr lang und verlebte diese Zeit mutmaßlich nicht gut und nicht schlecht, was ich daraus schließe, daß er über diesen Lebensabschnitt nie sprach. Vielleicht hatte dies Schweigen aber auch seinen Grund einfach in den großen Ereignissen, die folgten, so daß ihm für die voraufgegangenen Jahre von Durchschnittscharakter kein rechtes Interesse blieb. Herbst 1813 wäre seine Lehrzeit zu Ende gewesen, indessen König Friedrich Wilhelms III. Aufruf an sein Volk kürzte diese Zeit um ein volles halbes Jahr, denn unter den sich freiwillig zum Eintritt Meldenden war auch mein Vater, damals noch nicht volle siebzehn Jahre alt. Über die nun folgende Kriegszeit habe ich ihn oft sprechen hören, meist durch mich veranlaßt, der ich nicht genug davon hören konnte. »Du warst also wohl sehr patriotisch, lieber Papa.« – »Nein, höchstens Durchschnitt. Offen gestanden, ich machte nur so mit. Wenn man siebzehn Jahre alt ist, erscheint einem ein freies Soldatenleben hübscher als ein Lehrlingsleben. Und wie's im Liede heißt: ›Eine jede Kugel trifft ja nicht.‹ Aber wenn ich auch anders hätte denken wollen, ich hatte keine rechte Wahl. In das Tuchgeschäft von Köppen und Schier, dessen du dich, weil du ja selber in der Burgstraße gewohnt hast, vielleicht noch entsinnst, trat damals eine adlige Dame ein und wurde von einem hübschen jungen Manne mit blondem Schnurrbärtchen bedient. ›Ich wundre mich, Sie hier hinter dem Ladentisch zu sehn.‹ – ›Ich nicht, meine gnädigste Frau; ich stehe hier lieber als anderswo.‹ – ›Das seh' ich‹, antwortete die Dame, und dem hübschen Blondin eine Ohrfeige gebend, verließ sie das Lokal. Das war so die Stimmung damals, und weil ich dergleichen nicht gern erleben wollte, wurd' ich als freiwilliger Jäger eingekleidet und empfing eine Büchse.« Diese sogenannte »Büchse«, die später in den Flurwinkeln unserer verschiedenen Wohnungen verrostet und verstaubt umherstand, war eine Flinte von allergewöhnlichster Beschaffenheit, was übrigens keine weitere Bedeutung hatte, da mein Vater, seinem eignen Zeugnis nach, auch mit einer gezogenen Büchse nicht getroffen haben würde. Anfang April verließ er etwa mit fünfzig anderen Freiwilligen Berlin und zog auf Sachsen zu, wo sich die kriegerischen Ereignisse bereits vorbereiteten. An Spitze dieser Fünfzig stand ein Hauptmann von Kesteloot, ein vortrefflicher Soldat aus der alten Armee. Ausbildung und Führung waren ihm anvertraut. Am ersten Tage rückte man spät nachmittags in Trebbin ein; die meisten waren fußkrank, humpelten und sahen sehr niedergedrückt aus. Kesteloot ließ sie noch einmal antreten und sagte: »Wenn unser allergnädigster König und Herr darauf angewiesen ist, mit Ihnen den Kaiser Napoleon zu schlagen, so tut er mir schon heute leid.« Der Zustand der kleinen Truppe verbesserte sich aber, und man erreichte die Umgegend von Leipzig in leidlicher Verfassung. Vier Wochen später, am 2. Mai, war die blutige Schlacht bei Groß-Görschen. Die freiwilligen Jäger wurden einem Garde-Bataillon eingereiht und machten in diesem die Schlacht mit. Mein Vater erhielt eine Kugel in den Tornister, die, nach Durchbohrung eines kleinen Wäschevorrats, in den Pergamentblättern einer dicken Brieftasche steckenblieb. Diese Brieftasche, mit der Kugel darin, hab ich mir oft zeigen lassen.
»Du mußt wissen, mein lieber Sohn, es war kein Schuß von hinten; wir stürmten einen Hohlweg, auf dessen Rändern, rechts und links, französische Voltigeurs standen. Also Seitenschuß.« Das unterließ er nie zu sagen; er war vollkommen unrenommistisch, aber darauf, daß dies ein »Seitenschuß« gewesen sei, legte er doch Gewicht.
Der Schlacht bei Groß-Görschen folgte die bei Bautzen und dieser wiederum eine Reihe kleinerer Scharmützel und Gefechte. »Die waren dir nun wohl vollkommen gleichgültig?« fragte ich. – »Kann ich durchaus nicht sagen.« – »Ich dachte, daß die Macht der Gewohnheit...« – »Diese Macht der Gewohnheit ist im Kriege, wenigstens nach meiner persönlichen Erfahrung, von keinerlei Trost und Bedeutung. Eher das Gegenteil. Man sagt sich, wer drei- oder viermal heil durchgekommen ist, hat Anspruch, das fünftemal dran glauben zu müssen. Eine Karte, die viermal gewonnen, hat immer Chance, das fünftemal zu verlieren.«
Nach dem Waffenstillstande, bei Wiederausbruch der Feindseligkeiten, hatte sich meines Vaters Stellung erheblich geändert; er war inzwischen, ich weiß nicht, ob auf seinen Betrieb oder auf Antrag seines Vaters, aus dem Heere zurückgezogen und einer Feldlazarett-Apotheke zugewiesen worden. In dieser machte er nun den Rest des Krieges mit, sprach aber nie davon.
Sommer 1814 war er wieder in Berlin und begann nun in verschiedene Stellungen einzutreten, oder wie der Fachausdruck lautet, »zu konditionieren«. Zuerst in Danzig, das er mit der damaligen Fahrpost, wie er gern erzählte, in sechs Tagen und sechs Nächten erreichte. Die dort zugebrachte Zeit blieb ihm durchs Leben eine besonders liebe Erinnerung. Seinem Danziger Engagement folgten ähnliche Stellungen in Berlin selbst, bis 1818 die Zeit für ihn da war, sich zum Staatsexamen zu melden. Als er in den Vorbereitungen dazu war, lernte er unter Verhältnissen, über die ich auf den nächsten Seiten berichten werde, meine Mutter kennen und verlobte sich mit ihr.
Meine Mutter, Emilie Labry, wurde den 21. September 1797 als älteste Tochter des Seidenkaufmanns Labry, Firma Humbert und Labry, geboren. Handelsobjekt der Firma waren nicht gewebte Seidenstoffe, sondern Seidendocken, worauf meine Mutter Gewicht legte. Sie hielt die Docken für vornehmer als Zeug nach der Elle. Ob und wieweit sie darin recht hatte, kann ich nicht sagen; aber dessen entsinne ich mich deutlich, daß sie, vielleicht weil sie in hohem Maße den Sinn für Repräsentation hatte, von den Lebensgewohnheiten ihres Vaters, und zwar viel mehr als von seinem Charakter oder sonstigem Tun, mit einem gewissen freudigen Respekte sprach. Wenn wir als Kinder, und auch später noch als Halberwachsene, mit ihr bei Josty Schokolade tranken und dabei die kleinen, bräunlich gerösteten Korianderbiskuits, die so leicht zerkrümeln und abbrechen, vorsichtig eintunkten, unterließ sie nie, uns zu sagen: »Ja, seht, Kinder, solche Korianderbiskuits, daran hing euer Großvater Labry. Aber aus Schokolade machte er sich nichts. Er trank vielmehr jeden Tag um elf und um sechs ein Glas französischen Rotwein und aß dazu nichts als zwei solcher Biskuits, immer mit den zierlichsten Handbewegungen, und war überhaupt sehr mäßig. Ihr habt nichts davon geerbt, weder die Handbewegungen noch die Mäßigkeit.« Letzteres war nun allerdings sehr richtig, denn ich berechnete, während sie so sprach, wie viele Tassen ich wohl würde trinken können.
Meine Großmutter mütterlicherseits, also die Mutter meiner Mutter, war eine geborene Mumme, von deren Familie ich nicht weiß, ob sie nicht, trotz ihres deutsch klingenden Namens, doch vielleicht mit zur Kolonie gehörte. Jedenfalls bildeten die Beziehungen zu den Mummes einen besonderen Stolz meiner Mutter, vielleicht nur deshalb, weil »Onkel Mumme« Rittergutsbesitzer auf Klein-Beeren war und unter anscheinend glänzenden Verhältnissen lebte. Ich entsinne mich, daß er, neben allerhand Chaisen und Halbchaisen, auch einen Char à banc mit langen kirschroten Sammetpolstern besaß, und in diesem weithin leuchtenden Prachtstück, wenn wir in Berlin zu Besuch waren, nach Klein-Beeren hinaus abgeholt zu werden, bedeutete uns allen, aber am meisten meiner Mutter, ein hohes Fest, nicht viel anders, wie wenn wir zu Hofe gefahren wären. Später schlief das alles ein. Ich glaube, Onkel Mummes Stern verblaßte.
Das erwähnte Seidendocken-Geschäft befand sich, wenn ich recht berichtet bin, in der Brüderstraße, und hier verblieb auch die Labrysche Familie, als das Haupt derselben, mein Großvater Labry, bei sehr jungen Jahren (kaum vierzig Jahre alt) gestorben war. Die Witwe bezog ein in der Nähe des Petriplatzes gelegenes Haus, darin sie mehrere Jahre lang die erste Etage bewohnte, denn ihre Mittel waren für damalige Zeit nicht unbedeutend. In eben dieser Wohnung erlebte meine Mutter den Brand der Petrikirche, ein Ereignis, das einen großen Eindruck auf sie machte und bis in ihre letzten Lebensjahre hinein einen bevorzugten Gesprächsstoff für sie bildete. Sie entsann sich jedes Kleinsten, das dabei vorgekommen war. Ihre damals schon kränkelnde Mutter starb wenige Jahre später, und da die von vieler Not begleiteten Kriegszeiten nicht Zeiten waren, in denen Familienangehörige sich der Verwaisten annehmen konnten, so kamen die jüngeren Kinder in das französische Waisenhaus und nur meine Mutter in ein Pensionat, wozu die Zinsen ihres Vermögens vollkommen ausreichten. Sie wurde bald ein Liebling des Kreises, den sie vorfand, und hatte den vollsten Anspruch darauf, denn sie war jederzeit gütig und hilfsbereit. Erst in meinen alten Tagen ist mir der Sinn für ihre Superiorität aufgegangen. Als ich selber noch jung war, erschien mir vieles in ihrer Haltung, besonders meinem Vater gegenüber, zu hart und zu herbe, später indes habe ich einsehen gelernt, wie richtig alles war, was sie tat, vor allem auch, was sie nicht tat, und beklage jetzt jeden gegen sie gehegten Zweifel. Sie war dem ganzen Rest der Familie, der damaligen wie der jetzigen, weit überlegen, nicht an sogenannten Gaben, aber an Charakter, auf den doch immer alles ankommt. Ihre ganz südfranzösische Heftigkeit, die mitunter geradezu ängstliche Formen annahm, war vielleicht nicht immer zu billigen, aber doch schließlich nichts anderes als eine beneidenswerte Kraft, sich über Pflichtverletzung und unsinnige Lebensführung tief empören zu können, und ich muß es als ein großes Unglück ansehen, daß diese mir jetzt klar zutage liegenden Vorzüge von uns allen zwar immer gewürdigt, aber in ihrem vollen Wert und Recht nie ganz erkannt wurden. Ich werde in weiterem vieles zu berichten haben, das diese Worte bestätigt.
Das schon erwähnte Pensionat, in das meine Mutter, achtzehn Jahre alt, eintrat, war das der Madame Lionnet, und unter den verschiedenen Freundinnen, die sie hier fand, stand Louise Rogée obenan, damals eine sehr beliebte, fast gefeierte Schauspielerin, aber wie's scheint, in der Pension verblieben. Eines Tages hieß es, Louise Rogée habe sich verlobt, und zwar mit einem jungen Architekten, dem ältesten Sohne des Kabinettssekretäts Pierre Barthélemy Fontane. Die Nachricht bestätigte sich, und auf einem der gelegentlichen Besuche, die Louise Rogée, jedesmal von einer Pensionsfreundin begleitet, im Hause ihres künftigen Schwiegervaters machte, lernte meine Mutter den zweiten Sohn Pierre Barthélemys kennen – meinen Vater. Man fand rasch Gefallen aneinander, und da die Verhältnisse glücklich lagen, kam es sehr bald zur Verlobung, und das Haus meines Großvaters sah auf kurze Zeit zwei Brautpaare unter seinem Dache.
Der Verlobung meines Vaters folgte das Staatsexamen, damals nicht viel mehr als eine Form, und an das glücklich bestandene Examen schloß sich, beinah unmittelbar, der Ankauf der Neu-Ruppiner Apotheke. Am 24. März, dem Geburtstage meines Vaters, war Hochzeit, und drei Tage später traf das junge Paar in seiner neuen Heimat ein.
Zweites Kapitel
Gascogne und Cevennen Französische Vettern Unsere Ruppiner Tage
In ihrer Ruppiner Apotheke verlebten meine Eltern die ersten sieben Jahre ihrer Ehe, vorwiegend glückliche Jahre, trotzdem sich schon damals das zeigte, was dieses Glück früher oder später gefährden mußte. Von diesen sieben Jahren werde ich hier zu berichten haben; aber ehe ich zur Darstellung des wenigen übergehe, was ich aus jener Zeit noch weiß, möchte ich, wozu mir das vorige Kapitel nicht Gelegenheit bot, hier noch einiges über den französischen Ursprung meiner Eltern, über ihre Heimat und Abstammung sagen dürfen.
Nicht weit von der Rhonemündung, auf dem etwa zwischen Toulouse und Montpellier gelegenen Gebiet, stoßen von Westen her die Vorlande der Gascogne, von Norden und Osten her die Ausläufer der Cevennen zusammen, und auf diesem verhältnismäßig kleinen Stück Erde, wahrscheinlich im jetzigen Departement Hérault oder doch an seiner Peripherie, waren meine Vorfahren, väterlicher- wie mütterlicherseits, zu Hause. Nächste Nachbarn also. Weil sich indessen auf diesem engen Raume zwei grundverschiedene Volksstämme berühren, so darf es nicht sonderlich überraschen, daß »mes ancêtres«, trotz räumlicher Nachbarschaft, dieser Stammesverschiedenheit entsprachen, eine Verschiedenheit, die, völlig unbeeinflußt durch die inzwischen erfolgte Verpflanzung ins Brandenburgische, sich auch noch in meinen Eltern zeigte: mein Vater war ein großer, stattlicher Gascogner voll Bonhomie, dabei Phantast und Humorist, Plauderer und Geschichtenerzähler, und als solcher, wenn ihm am wohlsten war, kleinen Gasconnaden nicht abhold; meine Mutter andererseits war ein Kind der südlichen Cevennen, eine schlanke, zierliche Frau von schwarzem Haar, mit Augen wie Kohlen, energisch, selbstsuchtslos und ganz Charakter, aber, wie schon in dem Einleitungskapitel erzählt, von so großer Leidenschaftlichkeit, daß mein Vater halb ernst-, halb scherzhaft von ihr zu sagen liebte: »Wäre sie im Lande geblieben, so tobten die Cevennenkriege noch.«
Dies paßte jedoch, wie gleich hier bemerkt werden mag, nur ganz allgemein auf ihr leidenschaftliches Temperament, nicht etwa auf ihren Religionseifer. Von diesem hatte sie keine Spur, war vielmehr eminent ein Kind der Aufklärungszeit, in der sie geboren, trotzdem sie, weil sie das Genfertum für vornehmer hielt, mit einem gewissen Nachdruck versicherte: »Wir sind reformiert.«
Gascogne und Cevennen lagen für meine Eltern, als sie geboren wurden, schon um mehr als hundert Jahre zurück, aber die Beziehungen zu Frankreich hatten beide, wenn nicht in ihrem Herzen, so doch in ihrer Phantasie, nie ganz aufgegeben. Sie repräsentierten noch den unverfälschten Kolonistenstolz. Weil sie aber stark empfinden mochten, daß mit ihren nachweisbaren Ahnen, die bei den Fontanes als Zinngießer, potiers d'étain, bei den Labrys als Strumpfwirker, faiseurs de bas, feststanden, nicht viel Staat zu machen sei, so ließen sie die amtlich geführte kolonistische Stammtafel fallen und suchten statt dessen, auf gut Glück, nach vornehmen französischen Vetterschaften, also nach einem wirklichen oder eingebildeten Familienanhang, der, in der alten Heimat zurückgeblieben, sich mittlerweile zu Ruhm und Ansehn emporgearbeitet hatte.
Mein Vater hatte es darin leichter als meine Mutter, weil er wenigstens innerhalb seines Namens bleiben konnte. Zu Paris lebte nämlich, bis in die zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts, Louis de Fontanes, seinerzeit Großmeister der Universität und Unterrichtsminister, der, unter Napoleon, bei den verschiedensten feierlichen Gelegenheiten immer die großen Kasualreden gehalten hatte, ein sehr kluger, sehr feiner, sehr vornehmer Herr, dessen Familie, wie man in allen Büchern nachlesen konnte, wirklich im südlichen Frankreich, wenn auch nicht zwischen Toulouse und Montpellier zu Hause war. Dieser wurde nun ohne weiteres als Vetter erklärt, wobei der Umstand, daß er sich mit einem »s« schrieb, als besonderer und ausschlaggebender Beweis der Familienzugehörigkeit angesehen wurde. Unsere Familie wußte nämlich aus Tradition, daß auch mein Großvater, der Kabinettssekretär der Königin, sich, bis etwa zu Beginn des Jahrhunderts, »Fontanes« geschrieben und dann erst, aus unaufgeklärtem Grunde, das »s« weggelassen habe. Diese Tradition wurde durch allerhand Schriftstücke bestätigt; mein Vater aber ging weiter und nahm, weil es ihm so paßte, den durch die Schriftstücke geführten Beweis des Nebensächlichen zugleich als Beweis für die Hauptsache, mit andern Worten, die bewiesene Namensvetterschaft als bewiesene Blutsverwandtschaft. Was übrigens als ein glänzender Coup gelten konnte. Denn hätten wir noch »Fontanes« geheißen, wodurch wir dem Großmeister, wenn auch nicht um viel, so doch immerhin um ein »s« näher gekommen wären, so wäre der den Rest der Sache mit einschmuggelnde Nebenbeweis von vornherein weggefallen.
Daß mein Vater solche Phantasiebeziehungen pflegte, durfte nicht wundernehmen; er war, wie schon oben kurz angedeutet, durch sein ganzes Leben hin der Typus eines humoristischen Visionärs und erging sich gern in mitunter grotesken Ausmalungen, über die er dann auch wieder zu lachen verstand. Aber daß meine ganz auf Verständigkeit und beinah Nüchternheit gestellte Mutter ihm in allem, was altfranzösische Verwandtschaft anging, nicht bloß nacheiferte, sondern ihn darin womöglich noch übertrumpfte, das durfte füglich überraschen. Es war das einer jener halb rätselhaften Widersprüche, wie sie sich in jeder Menschennatur vorfinden. Indessen, worin immer auch der Grund gesucht und gefunden werden möge, Tatsache bleibt es, daß sich meine Mutter – die, wenn dies Thema zur Verhandlung kam, selbst den sonst so gefeierten »Onkel Mumme« fallenließ – für ganz nahe verwandt mit dem Kardinal Fesch hielt, der bis zur Wiederherstellung des bourbonischen Königtums Erzbischof von Lyon war. Kardinal Fesch, geboren zu Ajaccio und erst 1839 in Rom gestorben, war der Stiefbruder der Lätitia Bonaparte, also nicht mehr und nicht weniger als der Onkel Napoleons, durch dessen Beistand er denn auch seine große Laufbahn machte. Mit Hilfe welcher Überlieferung es meiner Mutter gelungen war, diese vornehme Verwandtschaft festzustellen, habe ich nie in Erfahrung gebracht; ich weiß nur, daß es ein Schauspiel für Götter war, wenn wir, selbst noch in späteren Lebensjahren, beide Eltern, wie auf den meisten anderen Gebieten, so auch auf diesem, sich mehr oder weniger ernsthaft befehden sahen, gewöhnlich unter voraufgehender Feststellung der Rangverhältnisse zwischen einem Großmeister der Universität und einem Kardinal-Erzbischof. Daß wir Kinder dem allem sehr kritisch gegenüber standen, braucht nicht erst versichert zu werden.
Ich fahre nun in meiner eigentlichen Erzählung fort.
Am 27. März 1819 waren meine Eltern in Ruppin eingetroffen; am 30. Dezember selbigen Jahres wurde ich daselbst geboren. Es war für meine Mutter auf Leben und Sterben, weshalb sie, wenn man ihr vorwarf, sie bevorzuge mich, einfach antwortete: »Er ist mir auch am schwersten geworden.« In dieser bevorzugten Stellung blieb ich lange, bis nach achtzehn Jahren ein Spätling, meine jüngste Schwester, geboren wurde, bei der ich Pate war und sie sogar über die Taufe hielt. Das war eine große Ehre für mich, ging aber mit meiner Dethronisierung durch eben diese Schwester Hand in Hand. Als jüngstes Kind rückte sie selbstverständlich sehr bald in die Lieblingsstellung ein.
Ostern 1819 hatte mein Vater die Neu-Ruppiner Löwen-Apotheke in seinen Besitz gebracht. Ostern 1826, nachdem noch drei von meinen vier Geschwistern an eben dieser Stelle geboren waren, gab er diesen Besitz wieder auf. Dieser frühe Wiederverkauf des erst wenige Jahre zuvor unter den günstigsten Bedingungen, man konnte sagen »für ein Butterbrot«, erstandenen Geschäfts wurde später, wenn das Gespräch darauf kam, immer als verhängnisvoll für meinen Vater und die ganze Familie bezeichnet. Aber mit Unrecht. Das »Verhängnisvolle«, das sich viele Jahre danach – glücklicherweise auch da noch in erträglicher Form, denn mein Papa war eigentlich ein Glückskind – einstellte, lag nicht in dem Einzelakte dieses Verkaufs, sondern in dem Charakter meines Vaters, der immer mehr ausgab, als er einnahm, und von dieser Gewohnheit, auch wenn er in Ruppin geblieben wäre, nicht abgelassen haben würde. Das hat er mir, als er alt und ich nicht mehr jung war, mit der ihm eigenen Offenheit viele, viele Male zugestanden. »Ich war noch ein halber Junge, als ich mich verheiratete«, so hieß es dann wohl, »und aus meiner zu frühen Selbständigkeit erklärt sich alles.« Ob er darin recht hatte, mag dahingestellt sein. Er war überhaupt eine ganz ungeschäftliche Natur, nahm ihm vorschwebende Glücksfälle für Tatsachen und überließ sich, ohne seiner auch in besten Zeiten doch immer nur bescheidenen Mittel zu gedenken, der Pflege »nobler Passionen«. Er begann mit Pferd und Wagen, ging aber bald zur Spielpassion über und verspielte, während der sieben Jahre von 1819 bis 26, ein kleines Vermögen. Der Hauptgewinner war ein benachbarter Rittergutsbesitzer. Als mir dreißig Jahre später der Sohn dieses Rittergutsbesitzers eine kleine Summe Geld lieh, sagte mein Vater: »Das stecke nur ruhig ein; sein Vater hat mir ganz allmählich zehntausend Taler in Whist en trois abgenommen.« Vielleicht war diese Zahl zu hoch gegriffen, aber wie's damit auch stehen mochte, die Summe war jedenfalls bedeutend genug, um sein Credit und Debet außer Balance zu bringen, und ihn, neben andrem, auch zu einem sehr säumigen Zinszahler zu machen. Dies wäre nun, unter gewöhnlichen Verhältnissen, wo man etwa zu Hypotheken-Einschreibungen und ähnlichem hätte greifen können, eine Zeitlang ganz ertragbar gewesen; zum Unglück aber traf es sich so, daß meines Vaters Hauptgläubiger sein eigener Vater war, der nun Gelegenheit nahm, seinem nur zu berechtigten Unmute, sei's in Briefen, sei's bei persönlichen Zusammenkünften, Ausdruck zu geben. Das Bedrückliche der Situation zu steigern, sahen sich diese Vorwürfe durch meine ganz auf schwiegerväterlicher Seite stehende Mutter unterstützt, bzw. verdoppelt. Kurzum, je weiter die Sache gedieh, je mehr geriet mein Vater zwischen zwei Feuer, und lediglich um aus dieser sein Selbstgefühl beständig verletzenden Lage herauszukommen, entschloß er sich zum Verkauf seines Besitztums, dessen besondere Ertragsfähigkeit ihm, trotzdem er das Gegenteil von einem Geschäftsmann war, so gut wie jedem anderen einleuchtete. Seine ganze Rechnung dabei stellte sich überhaupt – wenigstens zunächst und von seinem Standpunkte aus angesehen – als durchaus richtig und vorteilhaft heraus. Er erhielt nämlich beim Verkauf der Apotheke das Doppelte von dem, was er seinerzeit gezahlt hatte, und sah sich dadurch mit einemmal in der Lage, seine Gläubiger, die zugleich seine Ankläger waren, zufriedenstellen zu können. Das geschah denn auch. Er zahlte seinem Vater die vorgeschossene Summe zurück, fragte seine Frau, halb scherzhaft, halb spöttisch, ob sie ihr Vermögen vielleicht »sicherer und vorteilhafter« anlegen wolle, und erreichte dadurch das, wonach er sich sieben Jahre lang gesehnt hatte: Freiheit und Selbständigkeit. Aller lästigen Bevormundung überhoben, war er plötzlich so weit, »sich nichts mehr sagen lassen zu müssen«. Und das war recht eigentlich der Punkt, um den sich's sein Lebelang für ihn handelte. Danach dürstete er von Jugend an bis in sein Alter; weil er's aber nicht gut einzurichten verstand, so ist er zu dieser ersehnten Freiheit und Selbständigkeit immer nur tag- und wochenweise gekommen. Er war, um einen seiner Lieblingsausdrücke zu gebrauchen, beständig in der »Bredouille«, sah sich finanziell immer beunruhigt und gedachte deshalb der nun anbrechenden, zwischen Ostern 1826 und Johanni 1827 liegenden kurzen Epoche bis zu seinem Lebensausgange mit besonderer Vorliebe. Denn es war die einzige Zeit für ihn gewesen, wo die »Bredouille« geruht hatte.
Über dieses fünfvierteljährige glückliche Interim habe ich zunächst zu berichten.
Wir verlebten diese Zwischenzeit in einer in Nähe des Rheinsberger Tores gelegenen Mietswohnung, einer geräumigen aus einer ganzen Flucht von Zimmern bestehenden Beletage. Beide Eltern waren denn auch, was häusliche Bequemlichkeit angeht, mit dem Tausche leidlich zufrieden, ebenso die Geschwister, die für ihre Spiele Platz die Hülle und Fülle hatten. Nur ich konnte mich nicht zufrieden fühlen und habe das Mietshaus bis diesen Tag in schlechter Erinnerung. Es war nämlich ein Schlächterhaus, was nie mein Geschmack war. Durch den langen dunklen Hof hin zog sich eine Rinne, drin immer Blut stand, während am Ende des einen Seitenflügels, an einer schräg gestellten Leiter, ein in der Nacht vorher geschlachtetes Rind hing. Glücklicherweise war ich nie Zeuge der entsprechenden Vorgänge, mit Ausnahme der Schweineschlachtung. Da ließ sich's mitunter nicht vermeiden. Ein Tag ist mir noch deutlich im Gedächtnis. Ich stand auf dem Hausflur und sah durch die offenstehende Hintertür auf den Hof hinaus, wo gerade verschiedene Personen, quer ausgestreckt, über dem schreienden Tier lagen. Ich war vor Entsetzen wie gebannt, und als die Lähmung endlich gewichen war, machte ich, daß ich fortkam und lief die Straße hinunter durch's Tor auf den »Weinberg« zu, ein bevorzugtes Vergnügungslokal der Ruppiner. Ehe ich aber daselbst ankam, nahm ich, um zu verschnaufen, eine Rast auf einem niedrigen Erdhügel. Den ganzen Vormittag war ich fort. Bei Tische hieß es dann: »Um Himmels willen, Junge, wo warst du denn so lange?« Ich erzählte nun ehrlich, daß ich vor dem Anblick unten auf dem Hofe die Flucht ergriffen und auf halbem Wege nach dem Weinberge hin auf einem Erdhügel gerastet und meinen Rücken an einen zerbröckelten Pfeiler gelehnt hätte. »Da hast du ja ganz gemütlich auf dem Galgenberge gesessen«, lachte mein Vater. Mir aber war, als lege sich mir schon der Strick um den Hals, und ich bat, von Tisch aufstehen zu dürfen.
Um eben diese Zeit kam ich in die Klippschule, was nur in der Ordnung war, denn ich ging in mein siebentes Jahr. Der Lehrer, der Gerber hieß, machte von seinem Namen weiter keinen Gebrauch und war überhaupt sehr gut. Ich zeigte mich auch gelehrig und machte Fortschritte; meine Mutter hielt es aber doch für ihre Pflicht, hier und da, namentlich im Lesen, nachzuhelfen, und so stand ich jeden Nachmittag an ihrem kleinen Nähtisch und las ihr aus dem »Brandenburgischen Kinderfreund«, einem guten Buche mit nur leider furchtbaren Bildern, allerlei kleine Geschichtchen vor. Ich machte das wahrscheinlich ganz erträglich, denn gut lesen und schreiben können, beiläufig etwas im Leben sehr Wichtiges, ist eine Art Erbgut in der Familie; meine Mutter war aber nicht leicht zufriedenzustellen und ging außerdem davon aus, daß loben und anerkennen den Charakter verdürbe, was ich übrigens auch heute noch nicht für richtig halte. Bei dem kleinsten Fehler zeigte sie die »rasche Hand«, über die sie überhaupt verfügte. Von Laune war dabei keine Rede; sie verfuhr vielmehr lediglich nach dem Prinzip: »Nur nicht weichlich.« Ein Schlag zuviel konnte nie schaden, und ergab sich, daß ich ihn eigentlich nicht verdient hatte, so galt er als Ausgleich für all die Dummheiten, die nur zufällig nicht zur Entdeckung gekommen waren. »Nur nicht weichlich.« Dies ist gewiß ein sehr guter Grundsatz, und ich mag ihn nicht tadeln, trotzdem er mir nichts geholfen und zu meiner Abhärtung nichts beigetragen hat; aber wie man sich auch dazu stellen möge, meine Mutter ging im Hartanfassen dann und wann etwas zu weit. Ich hatte lange blonde Locken, weniger zu meiner eigenen, als zu meiner Mutter Freude; denn um diese Locken in ihrer angeblichen Schönheit zu erhalten, wurde ich den andauerndsten und gelegentlich schmerzhaftesten Kämmprozeduren unterworfen, dem Kämmen mit dem sogenannten engen Kamm. Wäre ich damals aufgefordert worden, mittelalterliche Marterwerkzeuge zu nennen, so hätte der »enge Kamm« mit obenangestanden. Eh nicht Blut kam, eh, war die Sache nicht vorbei; anderen Tages wurde die kaum geheilte Stelle wieder mit verdächtigem Auge angesehen, und so folgte der einen Quälerei die andere. Freilich, wenn ich, was möglich, es dieser Prozedur verdanken sollte, daß ich immer noch einen bescheidenen Bestand von Haar habe, so habe ich nicht umsonst gelitten und bitte reumütig ab. Neben dieser sorglichen Behandlung der Kopfhaut stand eine gleich fürsorgliche Behandlung des Teint. Aber auch diese Fürsorge lief auf Anwendung zu scharf einschneidender Mittel hinaus. Wenn bei Ostwind oder starker Sonnenhitze die Haut aufsprang, hatte meine Mutter das unfehlbare Heilmittel der Zitronenscheibe zur Hand. Es half auch immer. Aber Cold Cream oder ähnliches wäre mir doch lieber gewesen und hätt' es wohl auch getan. Übrigens verfuhr die Mama mit gleicher Unerbittlichkeit gegen sich selbst, und wer mutig in die Schlacht vorangeht, darf auch Nachfolge fordern.