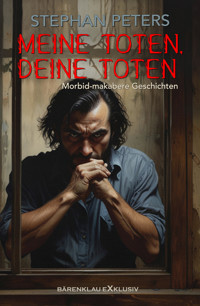
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Die verrosteten Schienen führen müde zu dem immer näherkommenden Zug, und ich werde furchtbar apathisch. Das Ganze kommt mir wie ein einziger Todesfluss vor. Und der Todesfluss heißt Styx. Ich werde den Alten vor den Zug werfen, nur noch ein paar Meter. Wenn ich ihn opfere, kann ich vielleicht auferstehen! Ich spüre die heiße, schmutzige Luft der heranrasenden Maschine, und meine Hand schiebt sich nach vorn, gleich fühlt sie den nassen Stoff, und dann wird sie stoßen. Da dreht sich der Alte blitzschnell um, vor Schreck verliere ich fast den Halt. Seine Billardkugel-Augen sehen mich an, er lacht und schüttelt den Kopf. Als der Zug bis auf ein paar Meter herangebraust ist, nickt der Alte kurz, verbeugt sich grinsend vor mir und macht eine devote Geste mit dem Arm …«
Aus der Erzählung ›Styx‹ in diesem Band – Stephan Peters war gerade in seinen Lesungen für seine kriminell-schwarzhumorigen, bitterbösen, morbiden und gruseligen Stories und Novellen bekannt. Bärenklau Exklusiv präsentiert in mehreren Bänden das ganze erzählerische Werk des Autors.
In diesem Band sind folgende Geschichten enthalten:
› Styx
› Piranha
› Katzenkrimi
› Die Tür in der Wüste
› Die Rückkehr des Magiers
› Die Brücke
› Der goldene Teppich
› SMS (Stirb mit Schmerzen)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stephan Peters
Meine Toten,
deine Toten
Morbid-makabere Geschichten
Impressum
Copyright © by Author/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer, mit einem eigenen Motiv von eedebee (KI), 2025
Korrektorat: Ilka Richter
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
www.baerenklauexklusiv.de / info.baerenklauexklusiv.de
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv. Hiermit untersagen wir ausdrücklich die Nutzung unserer Texte nach §44b Urheberrechtsgesetz Absatz 2 Satz 1 und behalten uns dieses Recht selbst vor. 13.07.2023
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Meine Toten, deine Toten
Styx
Piranha
Katzenkrimi
Die Tür in der Wüste
Die Rückkehr des Magiers
Die Brücke
Der goldene Teppich
SMS (Stirb mit Schmerzen)
Das Buch
»Die verrosteten Schienen führen müde zu dem immer näherkommenden Zug, und ich werde furchtbar apathisch. Das Ganze kommt mir wie ein einziger Todesfluss vor. Und der Todesfluss heißt Styx. Ich werde den Alten vor den Zug werfen, nur noch ein paar Meter. Wenn ich ihn opfere, kann ich vielleicht auferstehen! Ich spüre die heiße, schmutzige Luft der heranrasenden Maschine, und meine Hand schiebt sich nach vorn, gleich fühlt sie den nassen Stoff, und dann wird sie stoßen. Da dreht sich der Alte blitzschnell um, vor Schreck verliere ich fast den Halt. Seine Billardkugel-Augen sehen mich an, er lacht und schüttelt den Kopf. Als der Zug bis auf ein paar Meter herangebraust ist, nickt der Alte kurz, verbeugt sich grinsend vor mir und macht eine devote Geste mit dem Arm …«
Aus der Erzählung ›Styx‹ in diesem Band – Stephan Peters war gerade in seinen Lesungen für seine kriminell-schwarzhumorigen, bitterbösen, morbiden und gruseligen Stories und Novellen bekannt. Bärenklau Exklusiv präsentiert in mehreren Bänden das ganze erzählerische Werk des Autors.
In diesem Band sind folgende Geschichten enthalten:
› Styx
› Piranha
› Katzenkrimi
› Die Tür in der Wüste
› Die Rückkehr des Magiers
› Die Brücke
› Der goldene Teppich
› SMS (Stirb mit Schmerzen)
***
Meine Toten, deine Toten
Styx
Ich solle Kreuzworträtsel lösen und im Park spazieren gehen, riet mir der Hausarzt. Und warum ich nicht früher für Freunde und Hobbes gesorgt hätte? Dabei sah er mich strafend an, und dafür wird er auch noch von der Krankenkasse bezahlt. Aber recht hat er! Nun hänge ich in meiner Bruchbude herum, und der Staub sammelt sich auf allen Teilen. Aber für wen putzen? Seit zehn Jahren trage ich bereits die Uniform der alten Leute: braune Hose, braune Jacke, beige Socken und eine braune Kappe auf dem Kopf. Da kommt der Rollator ja wie von selbst angefahren! So habe ich begonnen, kleine Gedichte zu schreiben. Zum Beispiel diesen lauen Anfang:
›Der alte Mann sieht mich an, und irgendwann ist er dran.‹ Ob ich für dieses Gedicht wohl einen Literaturpreis bekomme? Ich glaube nicht. Es ist zu kurz, aber vielleicht als Refrain für ein Lied gar nicht mal schlecht. Hmm, tata, hmm, ta,tata … ›Der alte Mann sieht mich an, und irgendwann …‹ Ein Chanson, gesungen von Ben Becker zum Beispiel. Kurz, abgehackt müsste er es singen. ›Irgendwann ist er dran!‹ Dann ein paar harte Gitarrenriffs, die jeden einzelnen Buchstaben wie mit einem Beil zerhacken. So wie ich den alten Mann tatsächlich zerhacken könnte, ihn, der mich seit Stunden nur durch seine Anwesenheit quält, alleine schon, wie er geht, so wie ein kranker, angeschossener Vogel. Andererseits bin ich ihm sogar zu Dank verpflichtete; denn Qual bedeutet wenigstens ein Gefühl. Vorher hatte ich gar keines. In der Zeit, bevor ich seiner ansichtig wurde. Seiner ansichtig! Das sind die Worte eines alten Mannes, der ich nun mal bin, eines Mannes, der ungefähr vierzig Jahre lang immer um die gleiche Uhrzeit vom Wecker aufgescheucht worden ist. Das ist also achttausendsechshundert Mal, den Urlaub abgezogen, und das hinterlässt Spuren. Spuren, die für mich vor der runden Uhr enden, eine Art Bahnhofsuhr-Imitat, sie steht genau auf dem Fernseher, dessen Programme ich ungefiltert aufnehme, aber es bleiben ab und zu ein paar neue Namen hängen, wie die von der Meret und dem Campino. Und Begriffe wie: X-Rate
Ein paar Zinnbecher, nie benutzt, stehen neben der Uhr, auf dem Regal darüber wenige nicht gelesene Bücher, die man mir gerne in der Firma zum Geburtstag geschenkt hatte. Ich hasse Geschenke, die ich nicht will, und warum hat man mich nicht vorher gefragt? Nach der Pensionierung habe ich sechs Mal am Tag den Minutenzeiger verfolgt. Tack, tack, tack. Das wurde mir zu langweilig, und nun habe ich es mit dem Sekundenzeiger versucht, der etwas mehr Leben in meine Bude bringt. Tick, tick, tick. Ich starre ihn an. Sechs Mal am Tag, das seit Jahren, aber er weigert sich hartnäckig, schneller zu gehen. Ab und zu verkrallen sich meine Finger über ihm, verharren in der Luft, sie wollen zugreifen und ihn wild herumdrehen, damit alles schneller geht und endlich zur Ruhe kommt. Aber was eigentlich? Eigentlich ist ja alles gut, nichts tut sich bei mir zu Hause, ich könnte dankbar sein. Auch mein Arzt ist zufrieden und hat mir vor ca. zweitausendzweihundertsechsundachtzig Minuten eine Lebenszeit von einhundertsiebenundfünfzig Millionen achtundsechzigtausend Minuten verhießen - eine achtstellige Zahl! Mein Gott.
Dreißig Jahre ungefähr noch, und ich will nun richtig zugreifen und den Sekundenzeiger wie irre herumdrehen, aber ich zittere zu sehr. Eine neunstellige Zahl. Wie man die wohl ausspricht? Na, Zeit, es zu lernen, habe ich ja noch …
Zwischen meiner Zeiger-Beobachtung liegen frugale Mahlzeiten, ab und an ein Blick aus dem Fenster. Vor mir steht ein riesiger Betonklotz von Hochhaus. 70’er Jahres-Stil, alles grau, braun und ocker, das heißt, wo die Farben nicht abgeblättert sind.
Kleine, geizige Fenster, mit Gängen, die aussehen wie die Laufgitter von Raubtieren. Auf ihnen bewegen sich tatsächlich irgendwelche Wesen: Männer in Jogginganzügen, Baseballmützen auf den fetten Köpfen, verkehrt herum natürlich. Trottelmützen nenne ich sie und könnte sie ihnen auf dem Kopf festnageln. Sie tragen Plastiktüten, aus denen dicke Weinflaschen hervorlugen, ihre Frauen zerren quengelige Bälger hinter sich her – natürlich auch mit Baseballmützen. Und sie sehen alle vollkommen dumm und sinnlos aus. Ja, ist das richtig? Kann man sinnlos aussehen? Auch die Bälger werden mal andere Bälger mit sich schleifen, die vielleicht noch sinnloser in die Welt gucken.
Am liebsten hätte ich ein Gewehr und würde sie allesamt abschießen. Peng! Pitsch! Köpfe würden zerplatzen, Leiber über die Balkongitter fliegen.
Aber auch diese Regung ist mir seit Jahren abhandengekommen, und ich stelle fest, dass das Haus auch im Sommer in dunkles Licht getaucht ist, ein zutiefst deprimierender Anblick. Es steht in diesem dunklen Licht, sollte es so etwas überhaupt geben und vermittelt den Eindruck ewigen Regens.
Und manchmal scheint es mir, als dringe das Haus immer dichter an mein Fenster vor. Also, vormittags beobachte ich den Sekundenzeiger dreimal. Jeweils fünf Minuten lang. Das heißt, zirka dreihundertfünfundvierzig Minuten noch bis zum Bistro-Besuch herumzukriegen, minus zwanzig Minuten aus dem Fenster auf den Betonklotz starren, da bleiben dreihundertfünfundzwanzig Minuten Rest. Hm. Dann vorher das Frühstücksfernsehen, zehn Minuten etwa, sonntags zwei Minuten länger (das Frühstücksei), minus zwei Minuten wegräumen, bleiben noch zweihundertdreiundsiebzig Minuten.
Und die kriege ich auch noch irgendwie rum, man muss mir nur Zeit lassen, ha, ha, ha. Das ist wieder eine Minuszeit von – wie viele Sekunden?
Ich bin der Minusmann. Endlich Zeit, um ins Bistro zu gehen. Früher war es eine Kneipe, aber nur die Bezeichnung hat sich geändert. Einrichtung und Publikum sind gleichgeblieben. Bis auf einen: Den alten Mann. Er sieht mich an, und irgendwann ist er dran. Natürlich könnte ich mir mittags selber was brutzeln, aber ich glaube nicht, dass es gut für meine Minus-Psyche wäre. Und vor allem könnte ich nicht die brünette Nora sehen, die grazil und jung hinter der Theke steht. Nora, mit ihrer Pagenfrisur aus den dreißiger Jahren und einem Minirock aus den Neunzigern. Wenn sie mich gegen Eins reinkommen sieht, empfange ich dankbar ein kurzes Lächeln aus ihrem Zigarillomund. Dann wähle ich ein billiges Gericht von der Tageskarte, die seit Jahren dieselbe ist. Daneben die unvermeidlichen drei Nelken aus dem Väschen. Die Gäste wirken alle müde, nur Nora sieht aus wie eine Rose, die sich aus einem Misthaufen erhoben hat. Eine Rose aus weißem Porzellan, der Hals wie der eines jungen Schwans, um den ein billiges Kreuz hängt.
Nie weiß ich, ob ich sie ansprechen soll. Zu viele Jahre des Weckerklingelns trennen uns, und die Platituden der anwesenden Gäste erschrecken mich. Vor allem befürchte ich, dass ich auch nichts Besseres von mir geben würde.
So schweige ich auch hier, sehe Nora an und träume, das Essen ist nur Lückenfüller, von mir gar nicht richtig wahrgenommen. Das heißt, wenn ich nicht durch die Rentnerband nebenan gestört werde. Bekenntnisse, wie: »Nein, Alkoholiker bin ich nicht! Alkis fangen direkt nach dem Aufstehen an zu saufen. Und ich trinke nie vor sechszehn Uhr!« Wobei er vergisst, dass er bis mindestens drei Uhr morgens im Bistro ist. Oder: »Genau! Also, ich habe mit dem Bier ganz und völlig aufgehört!« (verschworenes Kopfnicken der übrigen). »Ich trinke nur noch Wein.«
Man nickt wieder wie beim Leichenschmaus, aus der alten Box singt Billie Holliday: ›That old Devil called Love‹.
Durchs Fenster sehe ich alte, riesige Fabrikschlote, die sich in den anthrazitgrauen Himmel schrauben. Dann ein Laden für Italienisches, der eigentlich ein alter Bunker ist, ein Obstkorb liegt umgekippt auf dem holprigen Pflaster. Daneben Lattenzäune, auf denen ein Tourneeplakat von David Bowie zerrissen weht, am Abend werfen impotente Gaslaternen ihr krankes Licht auf Mülltonnen. Die S-Bahn rauscht durch den Tunnel und lässt die Biergläser wackeln, und, wie ich meine, auch die Särge im Beerdigungsinstitut (mit sechzig Quadrat!) nebenan. Eigentlich ist es hier genauso tot wie in meinem Nachbarhaus. Dann wieder völlige Stille.
Aber da ist ja noch Nora. Sie sieht uns mit dem unpersönlichen Blick einer Tigerin an, der Oberkörper ist vornübergebeugt, ihr blasses Kinn ruht auf dem rechten Handrücken, der Qualm ihres Zigarillo erreicht das Diebes-Schild über dem Tresen, und ihr Minirock rutscht in X-Rate-Höhe. Braunverfärbte Kegelpokale auf den Regalen zeugen von vergangenen Heldentaten, ein Apothekenkalender vom letzten Jahr hängt schief an der Holzimitat-Tapete.
Schweigen. Schweigen.
Ich esse geräuschlos und die schöne Nora nimmt wortlos meine acht Euro entgegen, und ich starre sie großäugig an, wie ein Diener seine Herrin, der nicht weiß, ob er den Todesstoß bekommt oder nicht.
Dann gehe ich nach Hause, und rechne die Minuten aus, die wie Krebszellen auf mich warten: fünfhundertvierzig an der Zahl! Aber ich werde fernsehen und auf dem laufendem bleiben; vielleicht ergibt sich doch mal ein Gespräch mit Nora.
Irgendwann schalte ich dann ab und habe eigentlich gar nichts gesehen. Blicke nochmals auf den grauen Betonklotz, der bedrohlich näher gerückt ist. Dann verfolge ich noch fünf Mal den Sekundenzeiger, je fünf Minuten lang und ertappe mich wieder dabei, wie ich ihn anpuste, damit alles schneller geht. Doch er bleibt unbeeindruckt wie ein HiPo, dem ich irgendeine Ausrede wegen meiner Falschparkerei erzähle. Tick, tick, tick. Dann schlage ich mit den Fäusten gegen die Wand, einfach nur so. Erstaunt stelle ich fest, dass sich dadurch das Zittern in meinem Körper beruhigt hat, das Würgen in meinem Hals aufhört, doch der Schrei aus meiner Kehle will mir ebenso wenig gefallen wie das kalkweiße Gesicht, das sich im Badezimmerspiegel zeigt, den ich auch mal wieder putzen sollte. Dieses Gesicht soll noch eine neunstellige Minutenzahl zur Verfügung haben? Es sieht aus, als sei es schon seit zweitausendsiebenhundertsechzig Minuten tot. Mein Arzt hat sich bestimmt geirrt … Tick, tick, tick.
Dann mache ich etwas für mich Exotisches: Ich liege im Bett und stelle mir vor, wie Nora, die schöne Nora mit der Porzellanhaut und der Frisur aus den dreißiger Jahren, halb über meinem nackten Körper liegt und mein Geschlecht in ihrem Mund hat. Die Fantasie ist billig, aber schnell. Ihr Körper duftet nach ›Obsession‹, und ich kraule ihren Pagenkopf. Mit der Rechten knetet sie meine Hoden, und ich bewundere die leichenhafte Blässe ihrer Haut. Ihre Zunge ist langsam und wissend, ihre Lippen feucht und saugend. Aber mein Glied liegt weich zwischen ihren kleinen Zähnen, wie eine faule Eidechse in der Sonne. Nora verschwindet kurzzeitig aus meinem Hirn, und ich lege jetzt richtig Hand an mich. Ich schwitze, mein Becken macht die irrwitzigsten Bewegungen, doch das ficht die Eidechse nicht an. Ich überlege mir voller Panik, ob sie nicht tot ist. So bleibt mir als einziges Gefühl nur meine Hämmerorgie mit den Fäusten gegen die Wand, und ich weiß, dass ich noch lebe. Nora sitzt wieder neben mir und spielt mit ihren kleinen Brüsten, und sie lacht schallend. Meine Hände wollen wieder nach ihr greifen, aber sie erwischen nur den braunen Vorhang neben dem Schlafzimmerfenster. Wenn wenigstens mein restlicher Körper so kraftlos wäre. Und meine Fantasie. Doch er liegt unausgelastet im Bett und findet in vierhundertzwanzig Minuten kaum Schlaf.
Tick. Tick, tick. Ich wälze mich hin und her und denke an morgen. Der braune Vorhang verwandelt sich in ein lappiges Gespenst, das langsam auf mich zukommt. Die Stores sind die Arme, die nach mir greifen. Ich unterdrücke einen irren Schrei und wanke zum Fenster, um Luft hereineinzulassen. Doch das Fenster lässt sich nicht öffnen. Der Klotz aus Ocker ist nun vollends so nahegekommen, dass kein Blatt Papier mehr zwischen die Wände passt. Ich umklammere meinen Hals, weil ich ersticke, meine Augen kullern aus dem kalkweißen Kopf.
Da greift ein klebriger Gespensterarm meinen Hals und reißt mich nach hinten, und ich reiße den Vorhang runter und wälze mich schreiend mit ihm auf dem Fußboden herum. Mein Gesicht ist schweißnass, meine Schlafanzughose hängt mir über die bleichen, dürren Knie, und es sieht aus, als wolle ich den Stoff vergewaltigen. Nein, es sieht nicht nur so aus. Es ist so. Ich beiße in die Stoffbahnen und schmecke alten Staub, lecke an ihm, mein Speichel tropft darüber, und ich keuche. Meine Finger reißen an ihnen, ein ordinärer, geiler Laut poltert durchs Zimmer, ich lausche kurz, wie ein Wolf, hinter dem die Meute her ist, und dieser Wolf wird endlich hart, was der guten Nora ja nicht gelingen wollte – und der Wolf stößt in den braunen, alten Stoff, und tote Spinnen warten auf ihn. Der Wolf schreit, stöhnt und weint, aber niemand ist da, der ihn hört.
Tick. Tack. Tick, tack. Ich bin der Tick-Tack-Mann. Es ist Morgen, mein Gesicht sieht schrecklicher aus als mein Schlafzimmer. Aber es ist angenehm ruhig. Der Betonklotz von gegenüber steht wieder da, wo er hingehört. Meine Knie sind blutig. Als ich die Bettdecke aufhebe, riecht der nächtliche Schweiß nicht nur muffig – er stinkt wie eine Kloake. Aber zugleich ist es endlich friedlich in mir geworden: Ich bin eine Amöbe, ein Protoplasmaklümpchen, ein lappiges Scheinfüßchen, wie man es auch nennt. Gut so. Nichts. Höre nichts, sehe kaum was, rieche, schmecke, fühle Nada. Ich wälze mich durch die Wohnung als gallertartige Masse, und stelle fest, dass der Gedanke an ein Ich sofort Erbrechen in mir hervorruft.
So schneide ich mich, jedes Mal, wenn ich an Ich denke, mit dem Küchenmesser in den Unterarm. Das Ich verschwindet nach vielen Einkerbungen, und ich muss meinen Arm verbinden. Aber: gut, gut, gut. Tick, tack, tick … Selbst die Uhr ist mir gleichgültig geworden, nur ab und zu verfalle ich (Ich, Ich, Ich – verdammt! wo ist das Messer?!) in das alte Sekundenzeiger-Beobachtungsritual. Zack! Wieder ein Schnitt, und es ist vorbei. Seltsam. Ein Ich, das es gar nicht gibt, kämpft gegen ein Ich an, das es auch nicht gibt. Tick, tack. Leider muss ich auch sagen, dass mein Teppichboden ziemlich schlimm aussieht; einfach zu viel Blut, und den Blutverlust bekomme ich zu spüren, denn ich fühle fast gar nichts mehr vor Schwäche.
Ich muss dringend etwas essen gehen. Zum ersten Mal seit Jahren ist der Weg zu Noras Bistro leicht, frei, und ich genieße die Abendkühle. Ab und an muss ich mich an einer Mauer festhalten, um nicht vor Erschöpfung hinzufallen. Die Leute sehen mich seltsam an, tuscheln und gehen schnell fort. Ja, geht nur, ihr wunderbaren Menschen. Ich liebe euch alle! Vor allem liebe ich Nora, die heute einen engen, schwarzen Pulli trägt und mit ihren Haarsträhnen spielt. Sie blickt mich erschrocken an, warum fragt sie nichts? Hey! Warum fragt sie nichts? Die übliche Rentnerband ist wieder versammelt, man trinkt und lallt. Ich bestelle mir einen dicken Schweinebraten, mit Rotkohl und Kartoffeln, einen fetten Schnaps dazu. Und ich rieche ihr ›Obsession‹ und erwische mich dabei, wie ich rot werde (trotz des Blutverlustes!), in Anbetracht des intimen gestrigen abends. Ein klappriger Mann im schmutzigen Overall studiert die Bildzeitung so intensiv und lange, als würde er eine wissenschaftliche Abhandlung mit gefurchter Stirn studieren. Das Kinn in der Hand, einen kalten Kaffee daneben. Aber das machen die meisten. Draußen wischen Regenbahnen an der schmutzigen Scheibe vorbei, David Bowie existiert nur noch zur Hälfte. Die Schlote sind im dunklen Himmel verschwunden, wie alles beinahe verschwunden ist. Eine S-Bahn kreischt irre durch den Tunnel. Die Türe öffnet sich, und herein kommt ein alter Mann. Noch älter als ich, aber keiner sieht ihn an. Er trägt einen dunklen Fischgratanzug aus Adenauers Zeiten, der ihm um die dürren Glieder flattert. Und er setzt sich knarrend genau mir gegenüber an den Tisch, und ich muss in sein gelbliches Gesicht sehen. Seine Nase ist kurz und spitz, die wenigen, dunklen Haare hängen regennass über seiner hohen, zerfurchten Stirn. Und die Augen: Ich glaube, er ist blind, obwohl er ziemlich zügig durchs Lokal ging. Die Schultern zieht er dabei unentwegt hoch, seine Arme scheinen in der Luft zu paddeln. Er kommt mir wie ein riesiger Wasservogel vor, und ich hasse ihn! Der ganze Blutverlust, meine Schmerzen – umsonst! Eine erlösende Leere ist in meinem Kopf. Meine zitternden Finger stoßen um ein Haar die Vase um, und ich beobachte ihn weiter. Die Augäpfel treten gelblich und fett aus den Höhlen hervor, keine Iris zu sehen, und er zündet sich eine Zigarre an und beobachtet mich ununterbrochen. Ich meide seinen Nicht-Blick und konzentriere mich auf mein Essen. Der Schnaps verschafft mir kurzfristig Erleichterung. Warum kümmert sich Nora nicht um ihn? Keiner sieht ihn an. Dieser sinnlose Paddler. Mir schmeckt das Essen nicht, ich würge, als ich wieder diesem Blick aus toten Augen begegne. Augen, die nun gierig auf Nora sehen und sie ausziehen. Jetzt greift er sich zwischen die Beine, raucht dabei wie ein Schlot, und schleimiger Speichel tropft von seinen dünnen Lippen.
Nora hat es sich am Tresen bequem gemacht und raucht ein Zigarillo. Dabei glättet sie sich mit der Hand den Rock, der am Po emporgerutscht ist. Der Alte grinst. Der Schweinebraten kommt mir alt und verdorben vor, ich würge. Mein fauliges Gegenüber greift sich in die ausgebeulte Anzugtasche und holt ein langes Messer hervor, mit dem er sich die langen Fingernägel säubert. Ich könnte mich erbrechen, winke Nora zu, die mir kopfschüttelnd den halbleeren Teller abnimmt. »Bitte bringen Sie mir noch einen Jubi«, sage ich zu ihr, erschrocken, meine eigene Stimme zum ersten Mal seit langem zu hören. Sie hört sich tief und krächzend an.





























