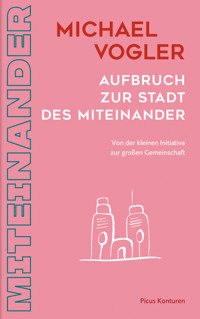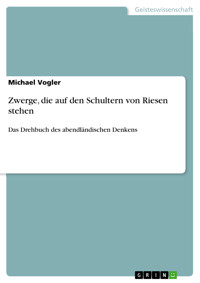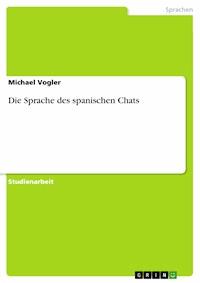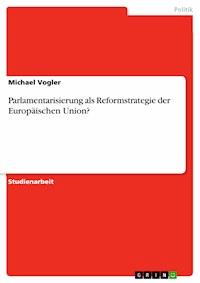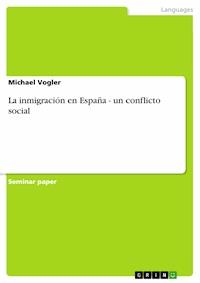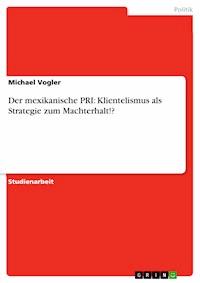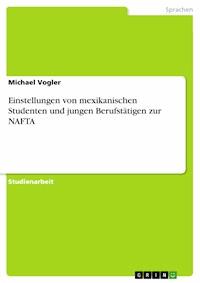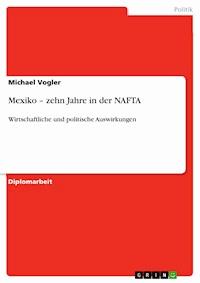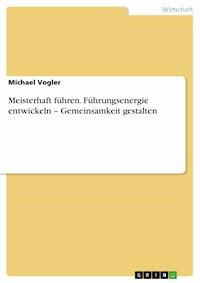
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Fachbuch aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Führung und Personal - Sonstiges, , Sprache: Deutsch, Abstract: MEISTERHAFT FÜHREN heißt zu erreichen, dass Mitarbeiter sich auf den nächsten Montag freuen. Jede Woche wieder! Diese Arbeit sieht in der Entwicklung eines konstruktiven und fruchtbringenden Organisationsklimas das Produkt guter Führungsarbeit. Nicht Theorie, sondern Umsetzung stehen im Mittelpunkt der Betrachtungen. Anhand vieler Beispiele aus der Praxis wird gezeigt, wie Führung auf der Basis unserer neurophysiologischen Ausstattung aussehen kann, wie sie funktioniert und was notwendig ist, um eine für alle förderliche Organisationskultur zu schaffen. Verdeutlicht wird auch, wie der Wirkungsgrad von Führung erhöht und gleichzeitig mit der vorhandenen Kraft ökonomischer umgegangen werden kann. Dieses Buch wendet sich an Führungskräfte und an alle, denen Begeisterung am Arbeitsplatz wichtig ist, die Gemeinsamkeit und ein inspirierendes Betriebsklima fördern, oder die einfach besser verstehen wollen, warum Menschen sich führen lassen, was gute Führung ausmacht und wie sie umgesetzt werden kann. Den Beginn machen Überlegungen über die Auswirkungn der aktuell erlebbaren Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Im richtigen Licht besehen schafft das neue Möglichketien, es anders zu machen. Im Anschluss werden Wesen und Funktionsweise von Organisationskulturen, sowie die dazu gehörigen sozialen Prozesse vorgestellt. Diese Grundüberleguingen führen zu einem veränderten und klareren Verständnis von Führung. Vieles könnte leichter sein, wenn man es richtig angehen würde! Nach Kapiteln, die sich mit der Bedeutung einer Führungskraft aus Sicht der Geführten, Bedeutung von bestehenden Narrativen für den Wirkungsgrad von Führung, der Kunst, diese bewußt und mit hoher Wirkung zu verändernen, wendet sich die Arbeit den Mitarbeitern und deren Bedürfnissen zu. Am Ende wird das älteste - und damit erprobteste - Führungsmodell vorgestellt und darauf eingegangen, wie Führungskräfte in der Praxis erfolgtreiche soziale Prozesse choreographieren können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Der Autor
Michael Vogler, Jahrgang 1954, arbeitet seit über zwanzig Jahren als Organisations-entwickler und Coach. Bereits als Student lernte der promovierte Historiker und Philosoph verschiedene Kulturen intensiv kennen. In seiner frühen Zeit widmete er sich Forschungsaufgaben und publizierte mehrere bahnbrechende Arbeiten, darunter „Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen – Das Drehbuch des abend-ländischen Denkens“ (unlängst bei GRIN erschienen) und „Der Kommunikative Imperativ - wie Zukunft entsteht“, das demnächst eine Neuauflage erfahren wird.
Sein konsequenter Fokus auf die umfassende Bedeutung von Kulturen, Narrativen und gelebter Kommunikation führte ihn über die Analyse hinaus in die Praxis der Beratung und in Design und Umsetzung von Organisationskulturen.
Erfolgreiche Führung, so seine professionelle Erfahrung, geht immer vom Bedürfnis des Geführten aus. Dieser Blickwinkel eröffnet hochwirksame und bisher kaum beachtete Steuerungsmaßnahmen. Hier stellt er sie vor.[1]
Inhalt
Der Autor
Die Feuer der Begeisterung
Kapitel 1 Wenn sich die Welt verändert
Mit einem Mal ist alles anders
Beispiel 1: Ein börsennotiertes Unternehmen
Beispiel 2: Ein liberalisiertes Unternehmen der öffentlichen Hand
Beispiel 3: Ein Unternehmen im Sozialbereich
Was wäre Ihnen eingefallen?
Der geistige Film im Hintergrund
Der langfristige historische Bogen
Der mittelfristige historische Bogen
Die Führungstheorien ändern sich
Wie man tote Pferde reitet…
Kapitel 2 Warum nicht einmal anders
Wie könnte man es denn anders machen?
Grundfragen einmal anders stellen
Worum geht es in der Wirtschaft?
Was ist der benötigte Nutzen?
Um wen geht es denn in Wirklichkeit?
Das Leben in die Arbeit bringen
Was eigentlich brauchen Menschen?
Was brauchen Unternehmen als Organismen?
Die positive Sinn-Bilanz
Die Kunst und der Geist
Duck-Hockey spielen
Raus aus der Opferhaltung: Wir werden weltberühmt
Der radikale Kulturbruch: Wo wir sind ist vorne
Stolze Ehefrauen: Wir werden die Nummer 2
Kapitel 3 Über die Veränderung von Organisationskulturen
Warum Kulturen verändern?
Welche Regeln gelten in einer Kultur?
Dynamische Wechselwirkung
Nicht-Linearität
Randbedingungen
Selbstähnlichkeit
Prozessverlauf 1: Die soziale Organisation
Wie sich Kulturen verändern
Das Scheitern üblicher Ansätze
Prozessverlauf 2: Die Gruppe in Bewegung
Phase 1: Die Kugel
Phase 2: Das Ei
Phase 3: Die Reise
Die Nachhut
Die Vorhut
Prozessverlauf 3: Der Pionier und die Gruppe
Den Prozess aufsetzen
Das Werkzeug: Kognitive Dissonanz
Die Zwischenkultur
Auf dem Weg nach Utopia
Merlin und Mim
Kapitel 4 Die tragende Säule in der Mitte
Gute Führungskräfte begeistern
Die Beurteilungsmacht
Der Mittelpfeiler des Hauses
Anerkennung ist eine „Verlustwährung“
Der Grad des Lächelns
Die Verkörperung der kollektiven Kraft
Das eigentliche Produkt von Führung
Kapitel 5 Die Alchemie der Führung
Des Kaisers neue Kleider
Ziel und Ergebnis
Wertsteigerung: die Veredelung von Materie
Problemzone
Der direkte Weg führt nicht zum Erfolg
Problemzone
Die gesuchte Energieform: Begeisterung
Problemzone
Transmutation und Transformation
Problemzone
Der Chef: Dreh- und Angelpunkt des Erfolges
Die strategische Anwendung der Beurteilungsmacht
Problemzone
Wie man das Zielfeld findet
Mentale Voraussetzungen
Problemzone
Elemente des Zielfeldes
Problemzone
Die Kunst heißer Bilder
Kapitel 6 Die Macht der Geschichten
Wer hat das Sagen?
Der Satan im Chefsessel
Führungsbilder müssen kongruent sein
Die Mütter destruktiver Geschichten
Narrative auf Organisationsebene
„Merlinmäßiges Verhalten“
Unerwünschte Nebeneffekte
„Nur ein toter Feind….“
„Streit ist leistungsfördernd“
„Professionalität“
„Loyalität und Commitment“
Warum Geschichten entstehen
Die Liturgie des Neuen
Ein Zeichen von Lebenskraft
Das Rudel entscheidet
Überlebenskampf als Großnarrativ
Kapitel 7:Hexisch denken – bewusst gestalten
Einfach hexisch denken!
Kommunikation – Datenübertragung oder Verständigung?
Zwei unvereinbare Weltsichten
Die kausale Weltsicht: Wissen oder warum die Dinge so sind, wie sie sind
Die finale Weltsicht: Weisheit oder wie man Zukunft schafft
Die Anwendung: Zerstrittene Vorstände
Die Kunst kontrolliert zu verändern
Kapitel 8 Die Weltformel und ihr Gebrauch
„Geschichte ist die Lüge, auf die wir uns geeinigt haben!“
Die Welt und das Wiener Schnitzel
Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott
Die Religion der Backstube
Wollen wir sinnstiftende Geschichten?
James Cook und die Königsmacht
Wie man Geschichten verändert
Das Ende der Pusteln
Meister mit Erfolgsintelligenz
Warum wirken solche Geschichten eigentlich?
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Die große Sehnsucht
Alle warten auf Worte
Von rechtem Handeln, Verantwortung und Ethik
Die dunkle Seite der Macht
Der Wächter von Athen
Den guten Wolf füttern
Kapitel 9 Die Entdeckung des Mitarbeiters
Individualität ist teuer
Veränderte Blickwinkel
Produktivität und Qualität
Motivation, Engagement und Bindung
Einstellung und Sozialverhalten
Das demographische Sturmtief
Neues Leben im Auge des Taifuns
Nichts wie weg
Fehlende Antworten allenthalben
Eine einmalige Chance für Unternehmen
Kapitel 10: Was Mitarbeiter brauchen
Die Suche nach der besseren Welt
Unsere stammesgeschichtliche Ausstattung
Der Kitt der Gesellschaft
Kumpel und Piraten
Die Weisheit des Teams
Das soziale Kapital
Spielen
Unser Gehirn hat andere Währungen
Ein neurologischer Paradigmenbruch
Die Säfte der Furcht
Die Säfte der Motivation
Motivationsstörungen und ihre Wirkung
Für Kooperation geschaffen
Die Apotheke der Motivation
Das Problem der Freiheit
Kapitel 11 Das Geheimnis der Dualen Führung
Die ideale Leistungskultur
Der Weg dorthin
Die Reduktion der Komplexität
Duale Führung und Aufgabenteilung
Der Aufforderungsgradient
Die Erhaltung des Stammeszaunes
Die Wahrheit über den Büffeltanz
Aus Notwendigkeit geboren
Das Tableau der dualen Führung
Weiterführende Fragen
Reicht nicht der Chef?
Brauchen mündige Menschen überhaupt Führung?
Kann der Chef denn nicht trotzdem beides erfüllen?
Gibt es Gruppen ohne arbeitsteilige Führung?
Wie ist die Rangordnung in der Dualen Führung?
Der Vorteil der Dualen Führung
Der Beweger und der Stabilisierer
Kapitel 12: Die Praxis der Dualen Führung und die Choreographie der Prozesse
Drei Fallbeispiele
Fritz: „Hier kann man nichts mehr bewegen!“
Angelika: „Wie kann ich sie integrieren?“
Siegfried: „Der traurige Rest“
Klare Entscheidung: Alle Energie auf den Unternehmenserfolg
Das Denken der Führungskraft
Wenn dir das Leben eine Zitrone bietet, mach Limonade daraus!
Der Weg der Spurbienen
Wahrnehmung und Konformität
Die Suche nach dem Glück
Wie bekommen wir das verdammte Heck vom Boden?
Machtverluste
Das Produkt von Führung
Die Medizinmänner – Strategen des Arbeitsklimas
Wie man Medizinmänner findet
Medizinmänner richtig positionieren
Die Mittel der Medizinmänner
Die Positionierung des Chefs
Lösungen der drei Fallbeispiele
Fritz und der beste Haufen
Angelika und die erlebte Gemeinschaft
Siegfried und die Suche nach dem Sinn im Alter
Nachsatz
Die Feuer der Begeisterung
Nicht weil es schwer ist,
wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen,
ist es schwer
(Seneca)
Dieses Buch wendet sich an Führungskräfte und an alle, denen Begeisterung am Arbeitsplatz wichtig ist, die Gemeinsamkeit und ein inspirierendes Betriebsklima fördern, oder die einfach besser verstehen wollen, warum Menschen sich führen lassen, was gute Führung ausmacht und wie sie umgesetzt werden kann.
In Gesprächen mit Führungskräften und ihren Mitarbeitern aus den unterschiedlichsten Unternehmen und Branchen erfuhr ich viel über deren Probleme und Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten, aber auch über ihre Erfolge. Es offenbart sich zunehmend das Bild rasenden Stillstandes: Druck, Frustration, Sinnverlust und steigendes gegenseitiges Misstrauen bestimmen nicht nur die Arbeitswelt, sondern mittlerweile auch weite Teile von Politik, Religion, Bildung, ja sogar Freizeit und Sport!
Hinzu kommt die Erosion des Vertrauens gegenüber Experten und Führungskräften, die genährt wird durch die öffentliche Diskussion über Finanzdebakel, Korruptionsskandale, Verantwortungslosigkeit und Fehlentscheidungen von Leitfiguren.
Das ist jedoch kein Grund zu resignieren!
Ganz im Gegenteil!
Denn wo herkömmliche Methoden ihre Wirksamkeit verlieren, entsteht Raum für Neues, Anderes und bisher nicht Versuchtes. Man muss es nur wagen.
Die steigende Unzufriedenheit und Orientierungslosigkeit in Unternehmen und Gesellschaft - und den überall spürbaren Energieverlust - könnte man auch als Auftrag für Führung verstehen! Man könnte den Fokus der Führungsverantwortung korrigieren und Führungsenergie positiv einsetzen. Beispielsweise für Werte, nach denen Mitarbeiter ohnehin rufen, wie Gemeinsamkeit, Würde, Freude und Stolz! Die entstehende positive Energie stünde dem wirtschaftlichen Unternehmenserfolg zur Verfügung!
Wäre es nicht eine gute Idee, all die Kräfte im Sinne des Unternehmenserfolges nutzen zu können, die sich ebenso fruchtlos - wie auch für alle frustrierend - verlieren in der Abwehr von Misstrauen und Ängsten, in versteckte Widerstände und Opferhaltungen?
In Unternehmen, die bewusst den Weg der Gemeinsamkeit und der Begeisterung eingeschlagen haben, bleibt der Erfolg nicht aus. Davon wird hier die Rede sein.
Die vorwiegend erlebbare Wirklichkeit in Unternehmen stellt sich allerdings anders dar.
Eine große Zahl von Führungskräften versucht unter steigendem Krafteinsatz ihr Schiff gegen einen Strom betriebsamer Unbeweglichkeit irgendwie auf Kurs zu halten. Andere „lösen“ das Problem, indem sie einfach die Mitarbeiter aus ihrem Fokus ausblenden und sich auf reine Geschäftszahlen konzentrieren. Wieder andere gehen in die innere Kündigung und betrachten ihren Posten fortan nur noch als ungeliebten Ort, von dem das Geld kommt.
Der Mehrzahl aller Führungskräfte ist jedoch sehr bewusst, dass alle ihre Mitarbeiter im Kern dasselbe wünschen, wie sie selbst auch, nämlich einen Arbeitsplatz, an dem Vertrauen und Anerkennung herrschen und Engagement und Loyalität belohnt werden!
Ihnen ist bewusst, dass nur motivierte Mitarbeiter in der Lage sind, echte Leistung zu erbringen.
Sie wissen, dass Verluste an Begeisterung und Vertrauen versteckte Kosten in enormer Höhe verursachen.
Sie wollen für sich selbst und für ihre Mitarbeiter Sinn in der Arbeit sehen.
Ihnen ist klar, dass abnehmende Bevölkerungszahlen das Recruiting massiv beeinflussen und gravierende Veränderungen im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden erzwingen.
Sie reflektieren darüber, dass Wirtschaft von Menschen für Menschen gemacht wird – nicht für Finanzakrobaten.
Stammesgeschichtlich gesehen sind wir Menschen Rudeltiere. Der Homo Sapiens konnte sich nur deshalb über die Welt verbreiten, weil er kooperierte. Evolutionär haben wir uns seit der Frühzeit kaum verändert. Die gleichen Regeln der Kooperation gelten damals wie heute.
Das wird im Führungsalltag aber kaum ernst genommen!
Geht man davon aus, dass Kooperation einem uns eingepflanzten Bedürfnis nach Gemeinsamkeit entspringt, dann ergeben sich für die Führung von Unternehmen neue Einsichten und Handlungsmöglichkeiten.
Die Bedürfnisse von Menschen haben sich nicht geändert. Weiterhin brauchen sie das Brot von Gemeinsamkeit, Anerkennung und Vertrauen und erwarten das von ihren Vorgesetzten als Führungsleistung. Werden sie darin enttäuscht, folgen als natürliche Reaktion der Entzug von Vertrauen und die Demontage der Autorität!
Tatsache ist, dass wir gerade einen schmerzlichen Mangel an positiven Werten und Leitbildern erleben und dass uns Menschen fehlen, die positive Werte verkörpern.
Wer diese Zeichen der Zeit versteht, für den öffnet sich ein ungeahntes Handlungsfeld. Es ist eine riesige Einflugsschneise für Führungskräfte, die wirklich etwas verändern wollen – und die wenig genutzt wird!
Wer sich auf eine Mannschaft verlassen will, die mit ihm durch Dick und Dünn geht, die für den gemeinsamen Erfolg brennt, der muss sich den Herausforderungen stellen. Es gilt zu verstehen, dass es sich bei der Führungsarbeit um einen Deal handelt, bei dem Akzeptanz, Engagement und Loyalität verhandelt werden. Die geforderten Gegenleistungen sind nicht nur klare Perspektiven und Handlungssicherheit, sondern auch die Bereitstellung und Pflege eines Umfeldes, das Gemeinschaft erleben, Freude erfahren und das Gefühl, selbst etwas bewirken zu können, spüren und wachsen lässt.
Führung, die diesen Namen auch verdient und Begeisterung bewirkt, definiert sich immer vom Mitarbeiter her. Es geht darum, was konkrete Menschen brauchen, um engagiert und eigenständig arbeiten zu können. Führung wird dadurch zur Grundlage von Interaktion, die Resonanz erzeugt und choreographiert werden kann. Das ist kein neues, sondern sehr altes – wenn auch fast in Vergessenheit geratenes - Wissen.
Verändert hat sich heute die Intensität des Rufes nach Gemeinsamkeit. Schlagworte, wie „vom-ich-zum-wir“, von der Wiederentdeckung der Kooperation oder von neuer Gemeinsamkeit machen die Runde und weisen die Richtung.
Wer zuhört, und auch hört, wird diesen Ruf ernst nehmen. Er wird ein für alle förderliches Organisationsklima als Produkt seiner Führungsarbeit verstehen.
MEISTERHAFT FÜHREN heißt zu erreichen,
dass Mitarbeiter sich auf den nächsten Montag freuen.
Jede Woche wieder.
Diese Arbeit sieht in der Entwicklung eines konstruktiven und fruchtbringenden Organisationsklimas das Produkt guter Führungsarbeit. Anhand vieler Beispiele aus der Praxis wird gezeigt, wie Führung auf der Basis unserer neurophysiologischen Ausstattung aussehen kann, wie sie funktioniert und was notwendig ist, um eine für alle förderliche Organisationskultur zu schaffen. Verdeutlicht wird auch, wie der Wirkungsgrad von Führung erhöht und gleichzeitig mit der vorhandenen Kraft ökonomischer umgegangen werden kann.
Kapitel 1 Wenn sich die Welt verändert
„Erfolgreiches Veränderungsmanagement“, „Mit Change Management den Wandel beherrschen“, so ähnlich lauten viele Angebote auf dem Buch- und Seminar- und Beratungsmarkt. In anderen Veranstaltungen werden Führungskräfte zum Klettern geschickt, um ihre lustlose Mannschaft auf imaginäre Gipfel zu treiben und in Selbstfindungsprogrammen soll man nach all dieser Hetze wieder zur Ruhe kommen, um danach umso besser voranstürmen zu können.
Hinter vorgehaltener Hand gestehen Personalentwickler, dass mittelfristig die Erfolge solcher Programme durchaus viele Fragen offen lassen.
Was aber ist denn überhaupt das Ziel solcher Aktivitäten? Auf diese Frage hört man stets Erklärungen von der Art, dass die Zeiten nun mal schneller geworden seien, dass sich die Halbwertszeiten von Produkten extrem verkürzen würden und dass man im globalen Markt einfach schneller und billiger sein müsse, als die Konkurrenz.
Die Frage nach dem Ziel dieser Aktivitäten bleibt meist unbeantwortet. Auch was diese Veränderung sei, woraus genau dieser Wandel besteht, hört man sehr selten. „Ich weiß zwar nicht wohin, aber dafür bin ich schneller dort!“ Dieser Satz des österreichischen Kabarettisten Helmut Qualtinger, aus seinem Lied „Der Wilde auf seiner Maschin“ (gemeint ist sein Motorrad) scheint zu einer kulturellen Grundhaltung geworden zu sein.
Stattdessen verbreitet sich in den Industriegesellschaften ein pervertierter olympischer Gedanke, dass nämlich der zweite auch nicht mehr sei, als der erste der verliert. So wird durch den Tag gehetzt, stets am Rande des Menschenmöglichen, um sich am Ende nicht als Zweiten sehen zu müssen – obwohl niemand wirklich weiß, auf welcher Olympiade oder in welcher Disziplin wir uns gerade befinden und was denn genau die Spielregeln sind. Fragen nach Sinn und Zweck werden nur sehr selten gestellt. Die Macht des Faktischen regiert.
Das Tour-de-France-Syndrom mit seinen Dopingskandalen, die den gesamten Spitzensport durchziehen, ist nicht mehr und nicht weniger als ein Spiegelbild dessen, was wir uns allgemein antun: rasen um zu siegen, unter skrupellosem Einsatz jeden Mittels, ohne zu wissen, warum oder wohin, worin der Sieg genau bestehen würde oder was man tun wird, wenn man denn gewonnen hat!
Hinter Orientierungsdefiziten dieser Art steht immer die Veränderung einer geistigen Welt. Alte Werte gelten nicht mehr und neue sind noch nicht deutlich erkennbar. Aus Unsicherheit wird dann einfach die Schlagzahl erhöht. Das erleben wir nicht nur im Sport wo hemmungslos getunt und gedopt wird, sondern analog auch in der Wirtschaft, der Politik, in der Diskussion über das Bildungssystem, ja teilweise auch in der Wissenschaft. Überall ersetzt Frequenz die dauerhafte Strategie und die heraushängende Zunge die Reflexion.
Dabei mag es so erscheinen, als ob keine anderen Wege existieren würden. Das ist aber ein Irrtum. Denn wo gewohnte Handlungsmöglichkeiten untergehen, entstehen im gleichen Ausmaß neue. Man muss nur genau hinsehen und sie suchen oder entwickeln.
Was bedeutet das für Unternehmen? Was tun Unternehmen, wenn sie in die Turbulenzen einer Werteveränderung gelangen, vor allem, wenn diese sich wirtschaftlich äußert? Betrachten wir einige Fälle aus dem deutschsprachigen Raum. Sie zeigen tatsächliche Situationen und die Reaktionen der Führungskräfte. Es wäre erstaunlich, wenn der geneigte Leser derartige Muster nicht in der einen oder der anderen Form kennen würde.
Mit einem Mal ist alles anders
Beispiel 1: Ein börsennotiertes Unternehmen
Ein Unternehmen der Telekommunikationsbranche, dessen Gründung am Beginn des 20 Jahrhunderts liegt, stellt plötzlich fest, dass es seinen bis dato bedeutendsten und nahezu einzigen Kunden verliert. Bisher galt eine patriarchale Kultur. Die Chefs fühlten sich in erster Linie verantwortlich für das Wohl ihrer Mitarbeiter. Die neue Situation verlangt einen rigorosen Sparkurs. Denn es geht um das Überleben des Unternehmens. Hunderte Menschen werden gekündigt. Für den Rest ändert sich alles. Es geht nicht mehr um Beziehungen zu Kollegen und Kunden, nicht mehr um Qualität und Langlebigkeit der Produkte, sondern nur noch um Zahlen und um das Gefühl des nackten Überlebens.
Unter den Mitarbeitern grassiert die Angst vor der Kündigung, denn niemand weiß, wen es wann treffen wird. Die Verbleibenden haben Angst, nehmen eine Verteidigungshaltung ein und gehen in die innere Kündigung. Sie verlieren die Identifikation mit einem Unternehmen, das sie bisher als ihre Familie betrachtet haben. Eine neue Kultur entsteht: Man versucht nicht mehr gemeinsam mit der Führung gute Arbeit zu machen, sondern man liefert nur noch einen Job ab. Das Engagement sinkt.
Die oberen Führungskräfte ihrerseits distanzieren sich immer mehr von ihren Mitarbeitern. Bald geht es um einen Börsegang, der auch gelingt. Danach richtet das Management des Unternehmens alles auf börsenwirksame Zahlen aus. Alles andere gerät in Vergessenheit. Die alte Kultur geht vollends verloren, man erinnert sich nicht mehr an sie. Der Vorstand – die Mitglieder sind ausgetauscht – hat die Steigerung der Börsenkurse im Vierteljahresrhythmus im Visier. Alles andere gerät aus der Aufmerksamkeit. An Langfristplanung wird kaum noch ein Gedanke verschwendet. Mitarbeiter, Kunden und Produkte interessieren nur, insofern sie den Börsekursen nutzen.
Es hat perfide Logik, dass eines Tages den Mitarbeitern eines Teilunternehmens verkündet wird, dass jeder Dritte von ihnen gekündigt werden wird, um den Börsenkurs zu erhöhen, immerhin 200 Menschen. Weitere Erklärungen dafür gibt es nicht, Fragen der Mitarbeiter werden nicht beantwortet. Einige Wochen später ist es mit einem Federstrich so weit.
Obwohl das Unternehmen sich in einem schwierigen Markt bewegt, werden von den Mitarbeitern ständig steigende Umsätze verlangt, um Großprojekte in der Zukunft finanzieren zu können. In den Vertriebsabteilungen macht sich die Ansicht breit, dass der Markt das nun nicht mehr hergibt. Die mittleren Führungskräfte geben entweder den Druck einfach an die Mitarbeiter weiter oder sie versuchen gemeinsam mit ihren Leuten stillen Widerstand zu organisieren. Obwohl objektiv die Produktivität sinkt, wird die Rhetorik einer Hochleistungsorganisation zum offiziellen „Unternehmenssprech“.
Kraftsprache ersetzt Kraft!
Weder die Belegschaft, noch ein großer Teil der mittleren Führungskräfte kann die Frage beantworten, wofür sie arbeiten. Wer hier arbeitet verdient nicht schlecht, solange er da ist. Er gewöhnt sich an einen gehobenen Lebensstil und arbeitet jetzt nur noch, um diesen nicht zu verlieren. Es mehren sich aber die Anzeichen von verbreiteten Burnouts. Beispielsweise beginnen Mitarbeiter unvermittelt in Seminaren und Coachings zu weinen. Angst macht sich breit, reine Existenzangst.
Auf der anderen Seite entsteht unter den Angestellten ein stillschweigender Verhaltenskodex, der besagt, dass man unter Beobachtung immer aussehen muss, als ob man extrem unter Druck stehe. Man hat keine Zeit mehr. Weder füreinander noch in der Führungsarbeit, noch für den Kunden. In den Gängen wird viel gerannt, man bekommt nur schwer Termine und den Kollegen einen Gang weiter kennt man nicht mehr. Kommunikation, ehedem eine der Stärken des alten Unternehmens, findet kaum noch statt – aus Zeitnot, wie es heißt. Sie wird durch dürre Information per Email ersetzt.
Das Unternehmen vermittelt nach außen zunehmend das Bild eines hektischen Taubenschlages.
Die Vorstände pflegen in erster Linie ihre eigene Karriere. Sie betrachten ihre Aufgabe als Job, der nur einen Zwischenschritt darstellt auf dem Weg nach irgendwohin „weiter oben“.
Es besteht die Gefahr, dass das Unternehmen von innen auseinander bricht. Wenn jeder nur dem Geld nachläuft, dann wird der Kitt brüchig, der das Unternehmen zusammenhält. Aber der Verlust von Stolz auf das eigene Werk führt auch dazu, dass man dem Kunden gegenüber an Terrain verliert, denn wer keinen Stolz hat, wird schnell zu einem katzbuckelnden Diener. Und wer sich recht tief bückt, entblößt seinen Hintern!
Als der Vorstandsvorsitzende die Bedrohungen bemerkt, versucht er gegenzusteuern, indem er ein Programm zu entwickelt, das den Namen „Stabilitätsmanagement“ trägt. Nach der Phase der Konsolidierung soll nun wieder Ruhe ins Unternehmen kommen. Aber es ist zu spät. Das Programm kommt über die Anfangsstadien nicht hinaus. Zu groß sind die Veränderungen, zu groß die allgemeine Beschleunigung. Vor allem aber: die Leute haben kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit! Die meisten sind sicher, dass er nicht die Kraft haben wird, das Programm gegen seine Vorstände durchzusetzen.
Wäre das Ihr Unternehmen und wären Sie der Vorstandsvorsitzende: was würden Sie tun, um den Geschäftserfolg nachhaltig zu sichern?
Beispiel 2: Ein liberalisiertes Unternehmen der öffentlichen Hand
Ein ehemaliger Gemeindebetrieb einer Millionenstadt wurde aus der öffentlichen Hand entlassen und liberalisiert. Es gilt das EU-Ziel, Kosten zu senken und Kostenwahrheit herzustellen. Der neue Direktor hat die Aufgabe, betriebswirtschaftliches Denken einzuführen. Dabei stößt er an eine Wand von Widerstand und der Weigerung, die neuen Gegebenheiten zu akzeptieren.
Das Unternehmen ist ein knappes Jahrhundert alt. Die Mitarbeiter verweilen sehr lange im Unternehmen und sind häufig bereits in der dritten oder gar vierten Generation hier beschäftigt.
Das Unternehmen in seiner Gesamtheit versteht die neuen Anforderungen nicht, schon allein deshalb, weil es die nötigen Kategorien nicht kennt. Sie waren bisher auch nie gefordert. Deshalb bleibt jede Initiative im Ansatz stecken. Die Führung sucht Schuldige als Erklärung: die Ebene der Abteilungsleiter behindere die Entwicklung und bilde eine „impermeable Schicht“. Von oben schimpft man auf die „unbeweglichen Beamten“, von unten auf die Direktion.
Der Direktor versucht das Unternehmen auf den neuen Weg zu zwingen. In Kraftakten ergießt sich eine Flut von Regeln über das Unternehmen. Die mittleren Führungskräfte spielen jedoch nicht mit. Die meisten gehen in Deckung und versuchen das Gewitter an sich vorbeiziehen zu lassen.
Die Direktion zieht nun mit Hilfe externer Berater die Zügel an. Diese versprechen ihm Erfolge auf allen Ebenen, können diese Versprechen aber nicht einlösen. In ihrer Not beginnen die Berater ebenfalls von den Problemen zu sprechen und der mittleren Führungsebene Schuld zuzuweisen. Sie vertiefen damit das allgemeine Misstrauen.
Nach einer Weile verlieren sie ihren Auftrag. Wegen unzureichendem Erfolg. Bald stellt sich die nächste Beraterfirma ein und beginnt mit dem nächsten Projekt. Die gekränkte mittlere Führungsebene und die Mitarbeiter tun ohne innere Beteiligung was von ihnen verlangt wird. Es herrscht die Tendenz vor, Wünsche der Direktion nur oberflächlich zu erfüllen und sie dann mit den Ergebnissen allein zu lassen. Jeder Versuch Bewegung in das Unternehmen zu bringen, wird fortan als Angriff verstanden und mit Widerstand und Korpsgeist bekämpft. Die Direktion wird zum kollektiven Feindbild der Belegschaft, die in den Beratern die Büchsenspanner des Leibhaftigen sieht.
So geben sich die Beraterfirmen die Klinke in die Hand und ein Veränderungs-Projekt folgt dem anderen. Die Belegschaft tut immer nur soweit mit, dass sie selbst nicht ins Feuer gerät. Was Direktion und Berater wirklich wollen, interessiert niemanden mehr. Man ärgert sich nur, wenn wieder ein neuer Fragebogen auszufüllen ist. Weil jeder Berater mit neuen Ansätzen und Begriffen arbeitet, steigt die Konfusion exponentiell. Die induzierte Orientierungslosigkeit wird mit Ignorieren beantwortet. Die Paralyse ist nahezu vollkommen.
Gelernt wird, wie man Wünsche der Direktion und der Berater erfolgreich aussitzt! Das Unternehmen ist antherapiert! Man weiß mittlerweile, was Berater hören wollen, also liefert man es so ab, dass sie einen möglichst in Ruhe lassen. Direktion und Berater werden damit regelmäßig in die Irre geführt. In seiner Verzweiflung versucht es der Direktor dann wieder mit neuen Beratern. Manche wittern ein Geschäft in der Not des Direktors und vermitteln ihm scheinbare Sicherheit. Unter den gegebenen Bedingungen haben sie aber keine Chance irgendwelche Probleme zu lösen, denn sie sind in ihrer Gesamtheit längst zu einem der wirkmächtigsten Teile des Problems geworden!
Den Hauptschaden hat das Unternehmen, denn der Graben zwischen Direktion und Mitarbeitern wächst. Die allgemeine Unruhe steigt. Ängste breiten sich aus. Es entsteht eine Kultur des Misstrauens, die in der perfiden Spielregel mündet, dass der jeweils andere zuerst zu beweisen hätte, dass man ihm vertrauen könne. Diese Regel bestimmt das Verhalten vertikal in beide Richtungen der Hierarchie, aber zunehmend auch horizontal auf der gleichen Ebene.
Vereinsamung breitet sich im Haus aus, was die Ängste weiter fördert. Um Problemen zu entgehen, entsteht vorauseilender Gehorsam: man interpretiert im Vorfeld, was gewünscht werden könnte und handelt im vorauseilenden Gehorsam danach. Das hat in der Praxis zur Folge, dass Führungskräfte sich häufig mit Handlungen konfrontiert sehen, die sie nie gewünscht haben. Andernorts werden Probleme mit zunehmender Raffinesse kaschiert. Strategische Abteilungen, wie etwa die Personalentwicklung, ziehen sich auf eine reine Anbieterfunktion zurück und stecken sehr viel Energie in die Vermeidung jeglicher Verantwortung für ihre Arbeit.
Die Führbarkeit dieses Organismus mit mehreren tausend Mitarbeitern schwindet in bedenklicher Weise.
Nehmen wir an, Sie sind in diesem Unternehmen ein Abteilungsleiter mit mehreren hundert Mitarbeitern. Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen, dass Ihre Abteilung die Herausforderungen annimmt und Erfolge hervorbringt. Was würden Sie tun?
Oder nehmen wir an, Sie sind ein Berater. Welchen Rat würden Sie geben? Wie würden Sie vorgehen? Wo würden Sie ansetzen und wozu würden Sie sich verpflichten?
Beispiel 3: Ein Unternehmen im Sozialbereich
Eine mittelgroße internationale Organisation arbeitet im Sozialbereich. Sie besteht seit etwa einem halben Jahrhundert und ist auf ihrem Gebiet sehr erfolgreich. Allerdings klafft ein zunehmender Riss zwischen der medial vermittelten Wirklichkeit und der Realität, die das Unternehmen mittelfristig gefährden würde. Nach außen stellt sich die Organisation als eine Familie dar, in der das Leben schön ist und alle lächelnd und zufrieden miteinander umgehen. Im Inneren ist sie zerrissen.
Tatsächlich vergeht der Organisation das Lachen. Die familiäre Struktur, einstmals die Garantie für Sicherheit des betreuten Personenkreises und der Mitarbeiter, wird zunehmend zur Belastung. Konflikte werden nicht angesprochen, sondern in Bockigkeit ausgelebt. Das vertieft die Distanz zwischen Abteilungen und Bereichen ebenso, wie unter den verschiedenen hierarchischen Ebenen. Man versteht sich nicht mehr, sondern überschüttet sich mit Vorwürfen und unerfüllbaren Wünschen.
Es herrschen Regeln, die sich als äußerst resistent erweisen. Sie stammen aus der familiären Ursprungs-Ideologie des Unternehmens. Dazu gehört die Ansicht, dass man als Mitarbeiter für das Wohlergehen der Betreuten sorge, die Verantwortung für das eigene Wohlergehen als Mitarbeiter jedoch die Verantwortung der Führung sei. Werden Wünsche nicht erfüllt, wird die Hierarchie umgangen und die eigene Führungskraft bei der Direktion in Misskredit gebracht.
Es gehört auch die stillschweigend akzeptierte Regel dazu, dass man als Mitarbeiter erst dann gut gearbeitet habe, wenn man sich selbst nahe am Zusammenbrechen befindet: nur wer ständig am Rande der körperlichen und seelischen Erschöpfung arbeitet, tut genug – so verlangt es die herrschende heimliche Spielregel! Andersherum: wem es gut geht und wer Freude hat, strengt sich offenbar nicht genug an! In der Folge versucht jeder – unabhängig von der hierarchischen Ebene – allen anderen zu beweisen, dass er am Ende ist. Das hat sehr reale Folgen: die Rate der Burnouts und psychosomatischen Beschwerden ist überdurchschnittlich hoch. Bemühungen von verantwortungsbewussten Führungskräften, daran etwas zu ändern, verpuffen wirkungslos.
Der Sozialbereich liebt Elemente der Basisdemokratie. Langfristige Strategien zu entwickeln ist kaum möglich, weil sie im Dickicht der Partikularinteressen untergehen. Dabei werden durchaus Aktivitäten in die richtige Richtung gesetzt. Es finden sich auch immer wieder Mitarbeiter, die sich mit Elan und Engagement für spezifische Verbesserungen einsetzen. Nur bleibt jede Initiative stecken, weil die Partikularinteressen jede Umsetzung so weit verzögern, dass den jeweiligen Aktivisten die Luft ausgeht.
So lösen sich die Projekte mit Regelmäßigkeit ab, ohne auch nur in die Nähe der Umsetzung zu kommen oder gar Wirkung zu entfalten.
Da das Unternehmen nicht nur sozial eingestellt ist, sondern auf der Ebene der Mitarbeiter einen großen Frauenüberhang hat, auf der Ebene der Führung aber traditionell hauptsächlich mit Männern besetzt ist, schleicht sich zudem ein stillschweigender Geschlechterkampf ein, der jede Entwicklung behindert. So gilt unausgesprochen das Böse als männlich, das Gute aber als weiblich! Es herrscht eine Art versteckter Patt-Stellung zwischen den Geschlechtern.
Nehmen wir an, Sie sind in diesem Unternehmen an strategischer Position. Ihnen ist klar, dass sich etwas ändern muss, wenn der Betrieb nicht untergehen soll. Bisher sind keine geschäftlichen Katastrophen passiert, aber Sponsoren und andere Geldgeber beginnen unangenehme Fragen zu stellen. Noch ist der hervorragende Ruf Ihres Unternehmens intakt und das Betriebsergebnis in Ordnung. Das soll so bleiben. Was werden Sie tun?
Was wäre Ihnen eingefallen?
Diese drei Beispiele mögen dem unvorbereiteten Leser erschreckend erscheinen. Aber sie beschreiben reale Fälle und sind weit davon entfernt, extrem zu sein! Aus der Nähe besehen sind sie ziemlich normal.
Erfahrene Führungskräfte hatten beim Lesen dieser Fallbeispiele möglicherweise wunderbare Ideen. Im privaten Gespräch zeigt sich immer wieder, dass engagierte Führungskräfte eine hohe Kreativität entwickeln, wenn es darum geht, das Unternehmensklima zu verbessern. Sie kennen den Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und Leistung und bemühen sich, die Dinge zu verbessern. Nicht allein wegen des Betriebsklimas, sondern durchaus ganz pragmatisch wegen des Geschäftserfolges, den eine zufriedene Belegschaft zu erzeugen imstande ist.
Geht man aber durch Unternehmen, so muss man feststellen, dass es in der Realität wenig Vertrauen und Zufriedenheit gibt. Der Grad des Lächelns ist erschreckend gering. Leben und Arbeit werden in den meisten Unternehmen als getrennte Wirklichkeiten gesehen. Die positive Kraft geht woanders hin, nämlich in die Freizeit.
Die Identifikation mit dem eigenen Produkt, mit dem eigenen Betrieb nimmt allgemein ab und wird – zumal bei höher Gebildeten – durch Job-Zentrierung ersetzt. Das bedeutet, dass man das Geld und das Ansehen liebt, welches einem der Job ermöglicht, ohne jedoch irgendwelche innere Bindungen an das Unternehmen oder gar die eigene Leistung aufzubauen.
Dafür ist der Grad an psychosomatischen Beschwerden bei Führungskräften, die daran etwas ändern wollen, hoch. Dem anfänglichen Engagement, wenn man Führungskraft geworden ist, folgt nur allzu häufig die Ernüchterung über die Trägheit des eigenen Unternehmens. Manche Führungskräfte schotten sich dann innerlich ab, um sich selbst zu schützen. Viele werden zynisch. Andere wiederum versuchen es immer wieder neu, brennen nach und nach aus.
Dass solche Zustände sich nicht dazu eignen, Menschen zu führen, sie mitzureißen und zu motivieren, liegt auf der Hand.
Betritt ein erfahrener Organisationsentwickler ein Unternehmen, so stellt er in über neun von zehn Fällen bereits im Eingangsbereich fest, dass der Grad des Lächelns niedrig ist, man grüßt sich nicht und als Besucher wird man einfach übersehen. Kommt man mit den Mitarbeitern ins Gespräch, so heben Klagen an, aus denen erkennbar wird, dass die Mitarbeiter sich als Opposition zur Führung verstehen. Sehr viel wird von Leiden gesprochen. Begriffe wie „Professionalität“ füllen den Raum, in dem der Zeitdruck geradezu greifbar wird. Identifikation mit dem Unternehmen wird wenig erkennbar.
Entgegen alle anderslautenden Behauptungen, sind unsere Unternehmen in ihrer Tiefenstruktur stark dominiert von Orientierungslosigkeit, Unklarheit und Handlungsunsicherheit.
Sucht man nach Gründen dafür und sieht genauer hin, so stellt man fest, dass die Führungsebene in solchen Unternehmen typische Verhaltensmuster aufweist. Ihre Sprache ist stark von Zahlen geprägt, seien es Stück-, Umsatz- oder Budgetzahlen. Sogenannte Sachzwänge bestimmen die Logik der Erläuterungen. Darin wird häufig ein Rückzug aus der Verantwortung erkennbar, der sich wiederum aus Unsicherheit speist.
Wird von Externen gesprochen, so zeigt sich, dass diese Aufgaben übernehmen sollen, zu denen sich das Management nicht imstande sieht, oder dass sie Schmutzarbeit erledigen sollen, wie beispielsweise Personalkürzungen. Was übersehen wird ist, dass Mitarbeiter in der Regel sehr genau wissen, welchen Auftrag diese Berater haben und die Schuld daran dem eigenen Management geben. So geraten beide in Misskredit, der Berater und die Führungsebene.
Menschen werden in solchen Unternehmen als Produktionsfaktor gesehen. Funktioniert etwas nicht, oder organisiert man um – aus welchen Gründen immer – wird gekündigt. „In Wahrheit kaufen und verkaufen wir Menschen, wenn wir Unternehmen kaufen oder verkaufen, oder wenn wir Abteilungen schließen“, sagte vor kurzem die Personalentwicklerin eines großen Baustoffhändlers und kündigte, weil sie diese Arbeit nicht mehr machen konnte.
Vor allem aber wird mit Druck gearbeitet. Der Druck, der vom Markt her wahrgenommen wird, wird einfach an die Belegschaft weitergegeben. Das fängt ganz oben an und pflanzt sich dann bis unten fort. So leiden alle unter erheblichem Druck. Nicht selten ersetzt der Erfüllungsdruck dann die Reflexion und die Kreativität.
Einmal ehrlich: wenn Sie unter Druck stehen,
- geben Sie dann den Druck weiter?
- Würden Sie ihren Mitarbeitern Seminare anbieten, damit sie endlich verstehen woher der Wind weht und wie sie sich verhalten sollen?
- Würden Sie externe Berater anstellen, die Ihnen die Büchse spannen?
- Würden Sie sich dem Sachzwang hingeben, anstatt Ziele so zu formulieren, dass Ihre Mitarbeiter überhaupt ein Ziel erkennen können?
- Verlieren Sie selbst die Identifikation mit Ihrem Unternehmen?
- Haben Sie gesundheitliche Beschwerden, die mit der Arbeit zusammenhängen?
- Verstehen Sie noch, warum Sie selbst diese Arbeit noch machen?
- Fragen Sie sich, wie es Ihnen passieren konnte, dass Sie in diese Situation kommen konnten?
Wenn Sie auf alle diese Fragen guten Gewissens mit NEIN antworten können, so dürfen Sie sich glücklich schätzen, sich zu jener handverlesenen Schar exquisiter Führungskräfte zu zählen, deren Mitarbeiter sich für ihren Chef in Stücke hauen lassen und die von einem geschäftlichen Erfolg zum anderen wandern.
Wahrscheinlicher ist, dass Ihnen das eine oder andere zumindest gelegentlich unterläuft, mit verheerenden Wirkungen auf Ihre Mitarbeiter und deren Leistung. Führungskräfte, die jederzeit und bedenkenlos über Leichen gehen sind selten. Meiner Erfahrung nach kommen Seelenverwandte von J.R. Ewing, dem Ekel der 70er Jahre Serie „Denver Clan“ so gut wie nie vor. Wohl aber gibt es Handlungen, die dem allgegenwärtig empfundenen Druck entspringen. Sie passieren Führungskräften einfach. Nicht selten machen sie sich hinterher selbst die größten Vorwürfe. Das ändert dann aber nichts mehr.
Dabei ist es nicht so, dass das quasi naturgesetzmäßigen Zwängen unterliegen würde. „In Wahrheit produzieren Unternehmen heute keine Produkte, sondern Zahlen“, sagt, Peter Kreuz, Mitautor des bemerkenswerten Buches „Different Thinking“, der sich für clevere Innovationen und Business-Querdenken stark macht. Es erscheint heute vollkommen selbstverständlich, dass Wirtschaft nur in Zahlen stattfindet. Etwas anderes können wir uns kaum noch vorstellen. Aber es geht auch um Produkte, es geht um Kunden, die diese kaufen sollen und es geht um Mitarbeiter, die sie erzeugen und verkaufen.
Auch wirtschaftliches Denken unterliegt Moden. Das lässt sich durch die gesamten fünf Jahrtausende betriebswirtschaftlichen Handelns beobachten. Die letzten sind noch nicht so lange her. Sie hießen „New Economy“ und „Share-holder-value“. Man glaubte an eine neues wirtschaftliches Paradigma: Unternehmen bräuchten keine Gewinne mehr erzielen, solange nur die Börsenkurse stiegen. Das wirkte sich katastrophal aus.
Aber es war auch faszinierend, wie einfache Glaubenssätze ein so mächtiges und fünftausend Jahre altes Konstrukt, wie das Wirtschaftssystem, ins Wanken bringen können. Und wie sie in der Lage sind, alles, was vorher gelernt wurde, scheinbar außer Kraft zu setzen, so als hätte es all das nie gegeben.
Die bis zum Platzen der Spekulationblase am 15. September 2008 gültige Mode wurde allein von Zahlen dominiert. Was sich mit Ihnen nicht darstellen ließ, das geriet aus der Aufmerksamkeit. Und das sind vor allem Menschen und die Produkte selbst. „Was im SAP nicht vorkommt, das hat bei uns aufgehört zu existieren“, bestätigte der Chefcontroller einer großen Fernsehanstalt.
Moden gewöhnen uns an etwas. Wenn man diesen Moden folgt, dann bekommt man, was man verdient. Das heißt in diesem Fall, dass die Fixierung auf Zahlen dazu führt, dass die Unternehmen Führungskräfte bekommen, die genau das können: Zahlen jonglieren! Manchmal auch nur das! Verantwortung für Menschen oder auch für das Unternehmen an sich, geraten außer acht. Mitarbeiter ihrerseits fühlen sich zu Nummern degradiert und arbeiten entsprechend unengagiert und demotiviert.
Man muss sich schon fragen, wie die Menschheit bis hierher gekommen ist, wenn das immer gewesen sein sollte. Die atemlose Jagd nach Zahlen kann nicht der Motor der menschlichen Evolution gewesen sein. Allein schon deshalb nicht, weil sich der Dauerstress nachweislich negativ auf Fertilität und Potenz auswirkt – worüber jeder Hausarzt Auskunft geben kann. Mit anderen Worten: wir wären ausgestorben!
Das ist offenbar nicht geschehen.
Ist unsere Zeit einfach komplizierter geworden, sodass wir mit ihr nicht fertig werden können? Oder sind wir unfähig geworden? Oder haben wir einfach vergessen, wie man in Zeiten der Knappheit mit sozialen Organismen umgeht?
Vieles spricht für die letzte Möglichkeit: wir waren in enorm vielen Bereichen so erfolgreich mit unseren Methoden, dass wir alles andere für überflüssig gehalten und über Bord geworfen haben. Jetzt fehlt es uns.
Bevor wir uns dem Thema zuwenden, was man denn anders machen könnte, untersuchen wir kurz die Frage, wie wir in diese Situation kommen konnten.
Der geistige Film im Hintergrund
Um unsere heutige Situation verstehen zu können, ist es notwendig, sich einmal kurz unseren historischen Standort zu vergegenwärtigen. Es gibt einen langfristigen und einen kurzfristigen Bogen, der unsere heutige Wirklichkeit beeinflusst.
Der langfristige historische Bogen
Für den langfristigen Bogen muss man weit in die Geschichte zurückblicken. Es gibt in der Geschichte Bögen, die wir Epochen nennen. Unsere Epoche nennen wir die Moderne. Man spricht auch seit einigen Jahrzehnten schon von der Postmoderne. Nur was steckt dahinter?
Gehen wir etwa acht Jahrhunderte zurück, so erblicken wir eine historische Situation, in der alles geordnet war. Nicht, dass es keine Unruhen und keine Kriege gegeben hätte. Aber es war eine Zeit in der das geistige Gebäude stabil war. Wir nennen diese Zeit das Hochmittelalter. In dieser Zeit war der höchste Wert im Abendland die Ordnung. Alles hatte seinen Platz. Die Dinge waren geordnet und machten Sinn. Jeder Mensch konnte mit allem, was er tat, seinen Ort finden in diesem Gefüge.
Wir erkennen diese Geisteshaltung beispielsweise an den hochgotischen Kathedralen. Sie sind die Darstellung dieser Ordnung. Ihre Botschaft besagt, dass das Äußere zwar zerklüftet sein mag, so wie unser Alltagsleben, im Inneren aber stets die Ruhe der Ordnung und der Stabilität zu finden ist. Das Ziel war, diese Ruhe zu erkennen und danach zu leben.
Dann aber setzten Veränderungen ein, die diese Stabilität zerstörten. Anfang des 14. Jahrhunderts begannen gewaltige Hungersnöte. Kaum waren die vorbei, überzog die Pest das Abendland. Nach einem halben Jahrhundert, so schätzen Historiker, war die Hälfte der europäischen Bevölkerung verschwunden. Hunger und Krankheit hatten das Sozialsystem aufgelöst, das menschliche Leben war kaum mehr etwas wert und sogar Kannibalismus in vielen Gegenden normal geworden. Es waren unvorstellbare Zustände, die damals getreulich von Mönchen aufgezeichnet wurden. Allein das Lesen dieser Unterlagen jagt einem Schauer über den Rücken!
Nach diesen Katastrophen begannen sich neue Ordnungen zu etablieren. Das bedeutete häufigen Krieg, deren bekanntester der Hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England gewesen ist. Aber auch sonst war das Leben überall gefährdet. Es ist sogar bezeugt, dass das Vieh in den Dörfern beim Erklingen von Waffengeklirr oder Hornsignalen, selbständig im Wald Schutz suchte.
Die alte mittelalterliche Ordnung war zerfallen. Gott, der Name und Sinnbild dieser Ordnung gewesen war, hatte seine Schwäche bewiesen und der Tod hingegen seine Stärke. Unsere Vorfahren gingen nun dazu über, angesichts der offensichtlichen Schwäche Gottes, sich auf sich selbst zu verlassen und ihre Ordnung selbst zu bauen.
Man muss klar sehen, dass es sich dabei um eine neue Idee als Antwort auf eine spezifische Situation handelte, nicht um die Entdeckung einer Wahrheit! Es ist wichtig, das zu erwähnen, denn dies ist die Grundlage für jenes Weltbild, das wir für wahr halten! Die historische Betrachtung zeigt, dass es sich nur um eine Idee handelt – die man auch wieder ändern kann, sogar muss, wenn sich die Zeiten wieder ändern.
Ein Teil der damaligen Antwort war die Entwicklung des Absolutismus als Schutz gegen die politischen Unsicherheiten und damit verbunden, die Entstehung der Nationalstaaten. Ein anderer Teil der Antwort war die Entwicklung der Naturwissenschaft, so wie wir sie heute verstehen. Es entstand das Bild des Wissenschaftlers, der die Welt erforscht, in Zahlen packt und ihr Wesen entschlüsselt. Über die Jahrhunderte verlor Gott, als Hüter der Ordnung immer mehr an Bedeutung gegenüber den Zahlenwerken, die durch Menschen beherrschbar sind. Dieses Bild gerann zu einer neuen, ebenso absoluten Wahrheit, wie sie vordem von den Predigern der Kirche in dieser Weise verbreitet worden war. Nur bezieht sich die neue Wahrheit nicht mehr auf eine transzendente Kraft, sondern auf uns selbst.
Dabei ist es uns passiert, dass wir die Zahlen und das, was aus ihnen hervorgeht, nur allzu leicht mit der Welt verwechseln. Aber unsere Zahlenwerke sind auch nur Bilder über die Welt, nicht die Welt selbst. Ebenso wenig, wie der Finger, mit dem man auf den Mond zeigt, der Mond ist.
Wichtige Meilensteine auf diesem Weg waren Johannes Kepler (1571 - 1630), der die Sonne in das Zentrum unseres Planetensystems stellte, weil es sich so leichter berechnen lässt. Ferner Galileo Galilei (1564 - 1642), der diese Sichtweise in die Volkssprache übersetzte und so allgemein zugänglich machte. Damit entstand das Problem, dass nicht ausreichend Gebildete, dieses Erklärungsmodell mit der Wahrheit geradezu verwechseln mussten. Indirekt schuf Galilei – in dem er der alten Wahrheit die Türe wies - eine neue Wahrheit und wurde eben dafür verurteilt. Ein weiterer Meilenstein war auch Isaak Newton (1643 - 1727), der Begriffe wie Naturgesetz, Naturwissenschaft und exakte Wissenschaft einführte und damit den Anschein von Objektivität weiter verstärkte. Weniger bekannt ist, dass Newton sehr wohl wusste was er tat und dass er in Wirklichkeit jeder anderen Möglichkeit, Natur zu denken, oder Mathematik zu betreiben, die Lebensgrundlage bewusst entziehen wollte. Man muss zugeben, dass er damit außerordentlich erfolgreich gewesen ist, bis heute!
So wuchs langsam die Vorstellung heran, dass wir die Natur in den Griff bekommen und zähmen können – auch unsere eigene menschliche Natur. In der französischen Revolution entstand folgerichtig die Idee, dass der Mensch sich selbst neu erfinden könne, denn die Revolution wollte einen Neuen Menschen schaffen! Unsere Natur schien in diesem Lichte gesehen nicht mehr zu sein, als eine Art Plastilin, das man beliebig in Form kneten und mit Hilfe von Sozialtechniken anpassen kann.
Es ist nur konsequent, dass wenige Jahre später Pierre Simon de Laplace (1749 - 1827) Napoleon gegenüber erklärte: Gott? Ich benötige diese Hypothese nicht! Und am Ende des 19. Jahrhunderts beklagte Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) den Tod Gottes. Er meinte damit, dass der europäische Mensch der beginnenden Industrialisierung die Fähigkeit verloren habe, etwas Größeres als sich selbst anzuerkennen.
Zu allen Zeiten gab es jedoch auch Warner, wie Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), der sagte, dass Geister, man die Türe weist, dann eben durch Fenster und Kamin kommen würden.
Genau das scheint heute der Fall zu sein! Denn wir Menschen brauchen nicht nur Brot zum Leben, sondern auch das Gefühl, sinnvoll zu leben und zu arbeiten. Der Sinn scheint uns zunehmend verloren gegangen zu sein.
Das ist kein Wunder. Denn unsere Leittheorien sind völlig sinnentleert. Das gilt sowohl für die newtonsche Mechanik, die uns zu Zahnrädchen macht, die funktionieren oder repariert und weggeworfen werden. Es gilt für die Thermodynamik, die das Leben als kurze Phase in einem sich energetisch unwiederbringlich entleerenden Kosmos sieht. Und es gilt schließlich auch für die Hydraulik, die das Grundmuster zu unseren Vorstellungen von Information liefert. Weswegen es dort auch von hydraulischen Begriffen, wie Kommunikationskanälen, -flüssen und –staus nur so wimmelt.
Es war Viktor Frankl (1905 - 1997), der gefordert hat, dass wer Leistung fordern wolle, Sinn bieten müsse. Diesem Auftrag werden wir im Weiteren folgen.
Der mittelfristige historische Bogen
Bleiben wir aber noch bei den historischen Hintergründen und rücken wir unserem aktuellen geistesgeschichtlichen Ort etwas näher:
Aus dem langsam wachsenden Gefühl der Gewissheit, die Welt selber erschaffen zu können, entstand zunächst die Industrielle Revolution und dann die Idee der Technik. Technik wird gerne als Lösungsmethode gesehen, um der Natur beizukommen. In Wahrheit handelt es sich jedoch vielmehr zuerst um die Idee, dass der Mensch in der Lage sei, die Natur zu beherrschen, wie der große österreichisch-englische Kulturwissenschaftler Ernst Gombrich (1909 - 2001) ausführte. Auch wenn man es kaum glauben kann: es gibt durchaus auch sinnvolle und erfolgreiche Formen mit der Welt anders umzugehen, und sie anders zu denken!
Kaum etwas ist so gefährlich, wie zu viel Erfolg! Der Siegeszug des wissenschaftlich-kausalen und technischen Denkens schien jede Beschäftigung mit anderen Fragen überflüssig zu machen. Nahezu sämtliche Wissenschaften kamen in den Sog mathematischer Berechenbarkeit, auch die Philosophie und die Geisteswissenschaften. Man nahm an, dass man beispielsweise psychologische und soziologische Fragen bloß „noch nicht“ berechnen könne. Kaum jemand zweifelte aber daran, dass solches prinzipiell möglich und nur eine Frage der Zeit sei.
Die allgegenwärtige Technikgläubigkeit erhielt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Schläge, die eine Identitätskrise des vor sieben Jahrhunderten eingeschlagenen Weges der Moderne auslösten.
Es begann 1973 mit dem Ölschock. Plötzlich wurde erkennbar, dass der Reichtum der Industriegesellschaft allein auf der Ausbeutung fossiler Energie beruhte und dass diese zu Ende gehen würde. Das Unglück von Tschernobyl (Mai 1986) vernichtete die Gewissheit, dass diese Rohstoffe bedenkenlos durch Atomenergie ersetzt werden könnten, aber auch die Vorstellung, dass die Natur jederzeit technisch beherrschbar sein könne. Kurz vorher hatte das Challenger-Unglück vom Februar 1986 ebenfalls gezeigt, dass kleinste Ursachen ebenso katastrophale wie unbeherrschbare Folgen generieren können.
Dieses Jahr 1986 kann mit Fug und Recht als das Ende der Epoche des bedingungslosen Glaubens an die technische Beherrschbarkeit der Natur angesehen werden. Es begann eine neue Blickrichtung zu keimen. Zwar gab es auch weiterhin die Versuche, all das beherrschbar zu machen, aber die Masse der Kritiker stieg an. Die Grundlagen waren vom Club of Rome gelegt worden, der das Ende des Wachstums publikumswirksam vertreten hatte. Die Vorkommnisse von 1986 förderten einen neuen Typus wissenschaftlicher Theoriegebäude, von denen man ohne Übertreibung sagen kann, dass sie einen Paradigmenwechsel darstellen. Dazu gehört das epochemachende Werk der Biologen Humberto Maturana und Francisco Varela, die in ihrem Buch „Der Baum der Erkenntnis“ (1087) die Ansicht vertraten, dass wir die Welt durch unsere Wahrnehmung erschaffen und nicht einfach vorfinden. Es gehört der englische Biologe und Chemiker James Lovelock (* 1919) dazu, der den Begriff des „lebenden Systems“ ausweitete und nicht von menschlichen Individuen ausging, sondern in holistischer Weise die Erde als Ganzes als lebendes System ansah. Schließlich gehört auch die Chaostheorie dazu, mit deren Hilfe nachgewiesen werden kann, dass unsere Vorhersagen immer nur über sehr kurze Strecken Gültigkeit haben. Denn jeder Prozess, sei er physikalisch oder sozial, entwickelt in der Realität Nebenwirkungen, die den weiteren Weg eines Systems beeinflussen und es über weitere Strecken völlig unvorhersagbar machen.
Die Scientific Society reagierte damals heftig, denn das bedeutete eine völlige Veränderung des Objektivitätsglaubens der Wissenschaft. Heute ist es ruhiger geworden und wir gewöhnen uns nach und nach daran, Prozesse als etwas zu sehen, das nicht determinierbar ist, als Phänomene, die grundsätzlich ein offenes Ende haben. Diese Erkenntnisse sind grundlegend für unsere Betrachtungen über die Führbarkeit von Unternehmen.
Nur ändern sich Paradigmen der Wirtschaft nicht sofort, nur weil irgendwo in der Wissenschaft anders gedacht wird. Im Gegenteil! Zwar gibt es heute eine wachsende Gruppe von Unternehmen, die nach und nach verstehen, dass man auch mit offenen Prozessen umgehen kann und deren Führungskräfte auch den Mut aufbringen sich darauf einzulassen. Durchaus mit Erfolg, wie noch zu sehen sein wird!
Aber das alte kausal-deterministische Weltbild wehrte sich heftig und erhöhte seine Schlagzahl. Seine Stunde schien gekommen, als der Ostblock Ende der 80er Jahre zusammenbrach. Es schien wie ein endgültiger Sieg des Kapitalismus über die Planwirtschaft. Nur wurde nicht deutlich genug gesehen, dass dies ein Implodieren war, nicht der Sieg des Besseren über das Schlechtere.
Am Schlimmsten wirkte sich aus, dass die sogenannte „westliche Welt“ ihr einigendes und sinnstiftendes Feindbild verloren hatte. Die Globalisierung wird gemeinhin als ein Erfolg dargestellt. In Wirklichkeit war sie nichts anderes als ein verzweifeltes Tasten nach neuem Sinn. Schiere Größe ersetzte das klare Feindbild des Ostblocks. Eine diffuse Vorstellung von „big is better“ beanspruchte immer mehr Raum.
1986 hatte der US-Ökonom Alfred Rapperport die Idee des Shareholder Value geboren. Er wollte damit ursprünglich lediglich darauf hinweisen, dass Unternehmen auch die Interessen der Kapitalgeber berücksichtigen sollten. Dazu empfahl er unter anderem die Vinkulierung der Managergehälter an den Börsenkurs.
Das neuen Sinn suchende Wirtschaftssystem stieß nun auf diese Arbeit und machte daraus eine neue Wahrheit. War es früher darum gegangen, die Sowjetunion zugrunde zu wirtschaften, so sollte es nun darum gehen, die Börsenkurse hochzujagen – koste es, was es wolle. Der Treibstoff dazu waren die an den Börsenkurs vinkulierten Einkünfte der Top-Manager. Wirtschaftliches Denken bekam die Form eines einzigen Punktes. In diesem Punkt war alles konkret messbar und in Zahlen auszudrücken. Damit entzog es sich jeder weiteren Diskussion und Überlegung.
Bald galt es als einziges Ziel, die höchsten Börsenkurse zu erzielen. Aus alten Traditionsbetrieben mit klarem Produktprofil wurden Großbanken mit einer kleinen operativen Einheit, in der man die Verluste unterbrachte. Man hörte häufig den - ohne Kenntnis dieser Zusammenhänge vollkommen sinnlosen - Satz „Wir machen Verluste im operativen Geschäft“, während gleichzeitig Gewinne ausgewiesen wurden. Diesen Weg beschritten beispielsweise viele Unternehmen der Automobilindustrie.
Dieser entfesselte Kapitalismus vergaß alles, außer den Börsekursen. Produkte, Mitarbeiter, Kunden waren Themen zweiter Ordnung. Weil Einsparungen, Rationalisierungen und Kündigungen die Börsekurse für gewöhnlich steigen lassen, wurden Menschen zu reinen Spekulationsobjekten. Hinzu kam, dass die Märkte nach der Produktknappheit des Zweiten Weltkrieges gesättigt waren und der Kampf um den Raum daher härter wurde.
Viele der größten Unternehmen entkoppelten sich völlig vom ursprünglichen Sinn jeder Wirtschaft, nämlich arbeitsteilig anderen Menschen etwas zu bieten, was diese zum Leben brauchen. Das System kippte und das erste Erwachen kam, als die sogenannte New Economy Blase im Jahr 2000 platzte.
Inzwischen sind etliche der im Steigern ihrer Börsenkurse erfolgreichsten Unternehmen untergegangen, viele Führungskräfte dieses Hype sitzen hinter Gittern oder auf der Anklagebank. Aber noch geht das taktische Einsparen und Kündigen munter weiter. Interessanterweise greift es auch in Bereiche, in denen sein Sinn zumindest fragwürdig ist, beispielsweise in das Sozial- und Bildungssystem. „Einsparen“ scheint ein geradezu protoreligiöser Wert geworden zu sein, den man nicht lange hinterfragen muss.
Als Gesellschaft und Wirtschaftssystem haben wir uns in eine Sackgasse gedacht und gehandelt. Wir zappeln wie der Fisch in einer Reuse. Wenn wir anfangs von der nahezu allgegenwärtigen Hektik gesprochen haben, dann haben wir hier dafür die Erklärung: wir wissen nicht mehr recht, was wir tun sollen. Deshalb erhöhen wir einfach die Schlagzahl – sowohl als Unternehmen, wie auch als Individuen. In Wirklichkeit quillt das uns alle belastende Gefühl von Hektik und Überforderung aus dieser Mitte.
Aber hat sich die Welt verändert?
Nein, natürlich nicht! Wir sind es, die mit den von uns selbst geschaffenen geistigen Modellen nicht mehr umzugehen wissen. Unsere Probleme machen wir uns selbst, weil wir mit Methoden einer untergehenden geistigen Welt der Beherrschung und Kontrolle in eine Zukunft wollen, die genau das nicht mehr zulassen wird! Das muss schiefgehen!
Die Führungstheorien ändern sich
Viele Unternehmen bemerken, dass sie sich um Kunden, Produkte und Mitarbeiter kümmern müssen, wenn sie nachhaltig Bestand haben wollen. Ihre Zahl wird glücklicherweise größer.
Nur wie soll man das tun? Rat ist teuer, aber nicht immer so gut, wie er tut! Denn warum sollte eine Beraterindustrie, die sich dem gleichen Goldgräber-Kapitalismus unterwirft, wie die Unternehmen, die sie beschäftigen, bessere Antworten finden? Originellere vielleicht, aber wirklich bessere wohl kaum.
Sie haben an den gleichen Universitäten studiert wie der Typus des rast- und bindungslosen Managers, leben wie sie mehr im Flugzeug, als am Schreibtisch, benutzen das gleiche Vokabular und haben die gleichen Werthaltungen, beispielsweise, dass mehr besser ist als wenig, schnell besser als langsam und linear berechenbare Effizienz besser ist als fließende Effektivität. Sie sprechen nur miteinander und sehen auf alle anderen herab. Dabei tauschen sie ihre Werthaltungen aus und bestätigen sich diese gegenseitig immer wieder aufs Neue. Sie lizitieren sich gegenseitig hoch, bis sie high sind. „Ein typisch männliches Verhalten, mit abstrakten Ideen abzuheben“, sagte eine Kollegin – im vollen Bewusstsein, dass es auch genügend Frauen gibt, die sich an diesem Spiel beteiligen.
Dabei entsteht garantiert noch mehr Hektik.
Kann aber auch mehr Qualität entstehen?
Schon Albert Einstein war der Meinung, dass die Methode, die einen in Probleme gebracht hat, nicht dieselbe sein kann, die einen wieder herausführt!
Machen wir es auf unserer Suche nach realen Möglichkeiten also anders und gönnen wir uns eine langsamere Gangart. Machen wir auch einen Blick zurück in die Entwicklung der Führungstheorien. Auch sie haben einen beachtlichen Weg durch das vergangene Jahrhundert gemacht und zunächst immer dieselbe Frage gestellt. Diese Frage lautet: was musst du als Führungskraft tun, damit du richtig führst?
Bereits an dieser Formulierung erkennt man den Grund, wie es zu diesem Zusammenspiel von Beratern und Vorständen kommt. Denn im Hauptfokus liegt die Annahme, dass nur die Besten von oben zum Besten derer unten entscheiden können.
Die Entwicklung der Führungstheorien startete am Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Industriebetriebe wuchsen und verloren ihren Charakter als Großwerkstätten. Henry Ford und Frederic Taylor fraktionierten die Arbeitsprozesse. Ford forderte, dass Arbeitsplätze so gestaltet zu sein hätten, dass ein ungelernter Bauernbursch binnen einen einzigen Tages vollwertige Arbeit verrichten könne. Das führte nicht nur zum Fließband, sondern auch zu einem exponentiell steigenden Bedarf an Führungskräften. Ihnen wurde richtigerweise das Wort „Führung“ aus der Berufsbezeichnung gestrichen und so entstand der Manager, der die Arbeit so vordachte, dass sie am Fließband durchgeführt werden konnte. Die Idee des universellen Managers war geboren. Wer am Band stand, konnte nun zwar schnell sein, hatte aber keine Ahnung mehr, was er da tat.
Erste Theorien entstanden, wie solche Manager sein müssten. Als erstes gab es die sogenannte „big-man-theory“. Es wurde tatsächlich nach körperlichen Merkmalen gesucht, etwa Körpergröße, eine tiefe Stimme, eine gerade Nase, etc.
Bald stellte sich heraus, dass zwar etwas dran war, aber auch, dass derartige Merkmale noch keinen Chef ausmachen. So kam es zu den eindimensionalen Führungstheorien. Sie sind heute besser bekannt als „Management-by-Konzepte“. Es gibt sie heute noch in großer Zahl: Management by delegation, Management by walking around, Management by Zielvereinbarung, bis hin zu Management by Attila und Management by Schach.
Sie alle liefern Einsichten, versagen aber in dem, was eigentlich gesucht wurde, nämlich ein sicheres und funktionierendes Führungskonzept, mit der man alles unter Kontrolle hat. Mit Menschen zu sprechen oder zu delegieren, ist zwar gut und hilfreich. Aber es sichert den Erfolg nicht. Also ging die Suche weiter.
Etwa in den siebziger Jahren kamen dann die zweidimensionalen Konzepte auf: Fortan sollte ein Manager immer sowohl die Sachorientierung als auch die Personenorientierung in vollkommener Weise beherrschen, das heißt Geschäftszielen und emotionalen Bedürfnissen der Mitarbeiter in gleicher Weise gerecht werden. Dazu gehört beispielsweise das bekannte GRID-Konzept. Tatsächlich wurde der Spagat für die Manager damit aber größer. Denn was tut man, wenn Sach- und Beziehungsthemen auseinanderlaufen? Im Ernstfall waren diese Konzepte nicht wirklich hilfreich.
Also wurde noch eins draufgesetzt: Zusätzlich zur Sachebene des Unternehmens und der Beziehungsebene, wurde nun noch die Beurteilung der Reife jedes Mitarbeiters in die Hand der Manager gelegt. Das waren die dreidimensionalen Modelle, zu denen Beispielsweise das „Situative Management“ gehörte.
Die Entwicklung führte nicht nur zu einer kaum noch handhabbaren Komplexität der Management-Aufgabe, sondern zeigte auch noch eine beunruhigende Tendenz zur vierten Dimension.
Da, es war Mitte der 90er Jahre, entstanden neue Ideen. Daniel Goleman veröffentlichte seine Idee zur Emotionalen Intelligenz und Howard Gardner veröffentlichte sein Buch „Leading Minds“ in dem er Unternehmer, Politiker, Wissenschaftler, usw. beschreibt, die Leitfunktionen in der Gesellschaft hatten und haben. Die Geführten traten damit immer mehr an das Zentrum der Überlegungen heran.
Eine andere Sichtweise gewann an Boden.
Ein bekanntes Fortbildungszentrum für Manager führte eine großangelegte Untersuchung unter Vorgesetzten im deutschsprachigen Raum durch und fand heraus, dass nur fünf Prozent aller Menschen in Führungspositionen irgendwann einmal den Satz gedacht hatten: Ich will Menschen führen! Der Rest war in der Karriere nach oben gestolpert, hatte die Nähe zur Macht gesucht, das Geld oder das soziale Prestige.
Seit damals hat sich dieser Prozentsatz bestimmt nicht verbessert, eher im Gegenteil. Unter Organisationsentwicklern ist es ein offenes Geheimnis, dass ein Jahrzehnt später die persönliche Karriere und das Ranking nach Gehalt in der Managementwelt die wichtigsten Ziele der Managementklasse wurden. Spätestens im Jahr 2008 wurde dieser Umstand für jeden erkennbar, als die Bank Lehman Brothers in Insolvenz ging.
Wie soll jemand, der sich selbst im Zentrum der Welt sieht, sich auf andere Menschen und ihre Bedürfnisse einlassen können? Wie soll er fähig sein, Menschen zu führen?
Im Jahr 1996 veröffentlichten Winfried Panse und Wolfgang Stegmann das Buch „Kostenfaktor Angst“, in dem sie sehr vorsichtig erhoben, dass sich die jährlichen Kosten der sichtbarsten körperlichen und geistigen Auswirkungen von Mikro- und Makroängsten in Unternehmen auf 50 Milliarden Euro beziffern lassen.
Im Jahr 2000 veröffentlichte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), dass sich die Depressionen am Arbeitsplatz seit den fünfziger Jahren verzehnfacht haben und sieben Prozent der Frühpensionierungen auf psychische Erkrankungen zurückgehen. Im selben Jahr wurde festgestellt, dass 42 % der Arbeitszeit in Österreich unproduktiv verschwendet wird. Ursache: mangelnde Führung und mangelnde Arbeitsmoral. Deutschland lag damals mit 36 % etwas besser. Die Shell-Studie des Jahres 2000 stellte eindeutig fest, dass die Ausländerfeindlichkeit zunahm. Der Grund sei in der abnehmenden Zukunftsperspektive und dem Gefühl der eigenen Ohnmacht zu sehen.
Anfang August 2007 schließlich berichteten die Medien von einer deutschen Studie, nach der Mitarbeiter am meisten unter fehlender Anerkennung und Wertschätzung in ihren Unternehmen leiden. Sie fühlten sich nicht wahrgenommen.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Untersuchungen, die seit der Mitte der 90er Jahre erschienen. Alle diese neuen Zugänge und neuen Fragen legen den Schluss nahe, dass wir am Ende einer Epoche stehen. Wir sind dabei zu bemerken, dass wir unsere Sicherheit nicht einfach mit immer mehr Technik und Sozialtechnik erzeugen können. Wir erkennen langsam, dass wir anders denken müssen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Sonst ergeht es uns wie jenem Faxgerät, das in den 80er Jahren zu einem Fernschreiber sagte „Ich bin ein intelligentes Produkt!“, während im Hintergrund schon das Email heranreifte.
Wie man tote Pferde reitet…
Wer sich der Geschichte nicht stellt, der wird Geschichte. Diese Weisheit ist der Inhalt eines Mails, das durch im Intranet eines Ministeriums kursierte:
Eine Weisheit der Lakota Sioux sagt:
„Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab!“
Im Berufsleben versuchen wir oft andere Strategien, nach denen wir in dieser Situation handeln:
1. Wir besorgen eine stärkere Peitsche.
2. Wir wechseln den Reiter.
3. Wir sagen: „So habe ich das Pferd doch immer geritten!“
4. Wir gründen einen Arbeitskreis, um das Pferd zu analysieren.
5. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet.
6. Wir erhöhen die Qualitätsstandards für den Beritt toter Pferde.
7. Wir bilden eine Task-Force, um das tote Pferd wiederzubeleben.
8. Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen.
9. Wir stellen Vergleiche unterschiedlicher toter Pferde an.
10. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist.
Kapitel 2Warum nicht einmal anders
Wie könnte man es denn anders machen?
Die Schwierigkeit, wenn man etwas anders machen will, besteht schon darin, dass wir nie so genau wissen, was eigentlich das ist, was wir gerade machen.
Das hört sich paradox an. In Wahrheit aber stecken hinter allem, was wir denken und sprechen können Wertvorstellungen und Denkvoraussetzungen, die wir einfach annehmen. Warum wir das tun, ist oft in Vergessenheit geraten. Nur einige Beispiele:
- Warum ist beispielsweise Mobilität wichtig?
- Was eigentlich ist Gesundheit?
- Warum müssen Unternehmen und die Wirtschaft als Ganzes wachsen?
- Warum sind uns Individualität so wichtig?
- Warum ist es uns wichtig Zeit zu sparen?
Das sind Fragen, deren Sinn nur mit genauer Kenntnis der historischen und kulturellen Zusammenhänge greifbar wird. Man stellt erstaunt fest, dass andere Kulturen zu anderen Lösungen gekommen sind und dass es ihnen damit auch nicht schlecht geht. Hier der Versuch von Antworten auf diese Fragen:
-Mobilität ist einer der Grundwerte der Industriellen Revolution. In nahezu sämtlichen anderen bestehenden und vergangenen Kulturen stellt eher Sesshaftigkeit einen Wert dar. Sogar die Tuareg, jene Nomaden, welche die längsten Wanderbewegungen durchführen, verwenden nur 8 % ihrer Zeit für Mobilität. Bereits in den siebziger Jahren berichtete Ivan Illich, dass der durchschnittliche amerikanische Städter nahezu die Hälfte seiner Zeit für Mobilität verwendete! Illich rechnete sowohl die Reisezeit, als auch jene Zeit, die für die Ermöglichung der Mobilität notwendig ist, mit hinein. Dazu zählt er unter anderem die Zeit, die man braucht, um den Preis für ein Auto oder ein Kamel mit all seinen Nebenkosten zu beschaffen.
-Gesund zu sein hieß im Mittelalter, sich am sozialen Prozess beteiligen zu können. Eine bettlägerige Großmutter, die ihren Kindern etwas erzählen konnte, galt nicht wirklich als krank. Gesund war, wer etwas für andere leisten konnte. Das hat sich mehrfach in den letzten Jahrzehnten geändert. War „gesund“ in den 70er Jahren noch mit „arbeitsfähig“ gleichgesetzt, so änderte sich der Begriffsinhalt in den Achtzigern zu „fit“. Damals hechelten überall Menschen durch das Gehölz und sprangen über Baumstämme, weil sie gesund sein wollten. Das entwickelte sich weiter zur „Belastungsfähigkeit“ die man nachweisen musste, indem man nach der Arbeit noch in der Lage war, Squash oder mindestens Tennis zu spielen. Herzinfarkte bei Managern während des Laufens nahmen zu und auch Bill Clinton brach beim öffentlichen Morgenjogging zusammen. Später lockerten sich die Zügel und es wurde unter dem Begriff „gesund“ so etwas wie „freizeitfähig“ verstanden, bis schließlich das „spaßfähig“ der Eventkultur daraus wurde.