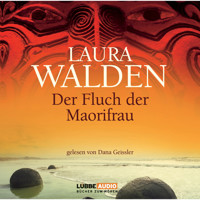9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Stella Wilson ist Muschelzüchterin auf Neuseelands Südinsel. Bei der gestandenen Geschäftsfrau bringt allein ihre Tochter eine weichere Seite hervor, denn Holly ist das Unterpfand einer unvergessenen Jugendliebe. Stella musste Oliver damals zwar gehen lassen, doch die Trennung hat sie kaum verwunden. Nun endlich ist sie bereit, dem vorsichtigen Werben ihres Nachbarn Yayden nachzugeben - da meldet sich plötzlich Oliver bei ihr. Will er sie wiedersehen? Oder ihr die Tochter nehmen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
1. Teil – Stella und die Ahnen von Taupatiti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2. Teil – Holly und ihr Vater
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
3. Teil – Stella und ihre Tochter
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Über die Autorin
Laura Walden studierte Jura und arbeitete einige Jahre als Rechtsanwältin in Hamburg. Doch auf Dauer siegte ihre Leidenschaft für das Erzählen spannender Geschichten, und so entschied sie sich, die Schriftstellerei zu ihrem Beruf zu machen. Ihr größtes Hobby, das Reisen, ist ihr dabei ebenfalls sehr nützlich: Mit Neuseeland und Schottland machte sie ihre beiden Lieblingsziele zu den Schauplätzen ihrer äußerst erfolgreichen Romane, bei denen es immer um dunkle Familiengeheimnisse vor atemberaubender Landschaft geht.
Laura Walden
MELODIEDERZAUBERBUCHT
Neuseelandroman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, KölnLektorat: Bettina SteinhageTextredaktion: Antje Steinhäuser, MünchenTitelillustration: © mauritius images/age; © Meck & Nölke FotografieUmschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4070-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Prolog
Dass der Tod bereits an ihre Tür klopfte, wusste Moana. Spätestens seit der Nacht, in der ihr ihre Mutter Pania im Traum erschienen war. In sachlichem Ton hatte sie ihr mitgeteilt, dass sie einander demnächst wiedersehen würden. Keine Träne, kein Bedauern, keine Spur von Empathie. Moana aber hatte gewusst, was nun zu tun war. Sie hatte ihr Testament aufgesetzt und Aroha zu sich gerufen. Ihre Tochter hatte dieser Erscheinung allerdings nicht jene Bedeutung zugemessen wie ihre Mutter. Wie hätte sie auch, denn ihre Mutter hatte wie das blühende Leben gewirkt. Doch bereits wenige Monate später hatte das schnelle Sterben ihrer Mutter unerbittlich eingesetzt.
Erst als Doc Stevens Aroha versichert hatte, dass gegen den Krebs, der im Körper ihrer Mutter wütete, nichts mehr helfen würde, hatte auch sie dem Spuk Bedeutung beigemessen. Trotzdem weigerte sich Aroha, den Zustand ihrer Mutter auf den Fluch zu schieben. Sehr zum Kummer Moanas. Sie war nämlich fest davon überzeugt, ihre schreckliche Krankheit wäre eine Strafe dafür, dass sie einst den Schwur gebrochen hatte. Niemals hätte sie das Besitztum ihrer Familie, die Insel Taupatiti, was übersetzt so viel hieß wie Zauberinsel, verlassen dürfen, um ihr Glück an einem anderen Ort zu suchen. Die Verpflichtung, die Insel ein Leben lang zu hüten, oblag einer alten Familientradition zufolge jedem potenziellen Erben. Und das war den Gesetzen der Ahnen entsprechend das älteste Kind. Diese Regel hatte Moana ihrer Tochter eingebläut, beim Anzeichen des geringsten Widerspruches auch hin und wieder mittels einer saftigen Ohrfeige. Infolge dieser Anordnung der Ahnen hatten sich auf der Insel in schöner Regelmäßigkeit Dramen abgespielt. In den vergangenen Generationen waren die Erben überwiegend weiblich gewesen und ihre Ehemänner dazu verdonnert, ihr Leben auf der Insel zu fristen und die zweite Geige neben den Herrinnen von Taupatiti im Paradies zu spielen. Einige waren am Suff zugrunde gegangen, Großmutter Panias Ehemann, der die Insel hinter dem Rücken seiner Frau sogar beinahe verscherbelt hätte, war bei einer Prügelei erschlagen worden, und wieder andere waren auf Nimmerwiedersehen verschwunden, so auch Moanas Ehemann.
Ungestraft konnte sich jedenfalls kein Erbe dieser Verpflichtung entziehen. Diejenigen Unglücksraben, die es je wagen sollten, Taupatiti zu verlassen, statt ihre Verpflichtung in Würde zu tragen, wurden mit einem Fluch belegt. Jedenfalls wurde Moana nicht müde, ihre Tochter mit dieser Drohung einzuschüchtern und dadurch zu verhindern, dass sie eigene Wege ging. Immer wenn Aroha den nötigen Respekt vor dieser Strafe vermissen ließ und das Ganze ins Lächerliche zu ziehen versuchte, setzte Moana nach: Diejenigen, die es wagen würden, Taupatiti in fremde Hände zu geben, waren demnach sogar zu einem qualvollen Sterben verdammt. Daran glaubte Moana jedenfalls fest. Die Krankheit, die sie mitten aus dem blühenden Leben riss, war deshalb ihrer Meinung nach die späte Rache für ihren Frevel, dass sie einst zumindest in Gedanken so weit gegangen wäre, Taupatiti zu verkaufen.
Damals, nach dem hässlichen Streit mit ihrer Mutter, als sie nach Auckland zu ihrem Geliebten, dem attraktiven Farmer Daniel Wilson, geflohen war. Dabei hatte sie es sich wirklich nicht leicht gemacht, aber die Liebe hatte schließlich über die Treue zum Erbe ihrer Ahnen und über all jene Ängste gesiegt, die ihre Mutter ihr seit Jugendtagen eingepflanzt hatte. Auf seiner Farm hatten sie sich niederlassen und eine Familie gründen wollen, denn Moana glaubte damals – jedenfalls kurzfristig –, sie könnte den Fluch besiegen, wenn sie nur weit genug vor ihm flüchtete. Sie hatte ein paar glückliche Momente fern der Heimat verbracht. Ja, sie hatte in den Northlands sogar eine Landschaft wiedergefunden, die der ihrer Heimat gar nicht so fremd war. Dann aber hatte ein Brief ihrer Mutter Pania, in dem sie ihre Tochter beschworen hatte, sofort nach Taupatiti zurückzukehren, wenn sie ihre Mutter noch einmal lebend wiedersehen wollte, all diese Pläne zunichtegemacht.
Moana hatte um keinen Preis zurück auf die Insel reisen wollen, weil sie geträumt hatte, dass Daniel sie verlassen würde, wenn sie dies täte. Doch Daniel hatte ihre Ängste als Humbug verlacht und darauf gedrungen, dass sie sich ihrem Erbe stellte. Was Moana damals für ein tiefes Verständnis seinerseits für die Gesetze ihrer Familie gehalten hatte, hatte sich schon bald als ein für ihn praktischer Ausweg aus seinen eigenen Schwierigkeiten entpuppt. Daniel war nämlich zum damaligen Zeitpunkt mit seiner Farm finanziell am Ende gewesen und hatte die Aussicht, eine Insel samt einem lukrativen Fischereigeschäft zu erben, durchaus als Verlockung empfunden. Dass er selbst bald darauf im Übermaß dem Alkohol zusprechen und seiner Frau die ganze Arbeit überlassen würde, hatte niemand ahnen können. Am wenigstens er selbst, denn er war ein dynamischer Kerl von einem Mann gewesen, der die attraktive Moana einst wirklich geliebt hatte.
Moana war damals schließlich entgegen ihrer Bedenken nach Taupatiti zurückgekehrt, um ihre Mutter noch ein letztes Mal zu sehen und ihr Erbe anzutreten. Pania hatte bei ihrer Ankunft bereits in den letzten Zügen gelegen und Moana mit schlimmen Flüchen überzogen: dass ihr einst dasselbe Schicksal widerfahren würde. Ihr einziges Kind würde Taupatiti nach Moanas Tod verraten, womit sich das untreue Mädchen der Strafe der Ahnen sicher sein konnte. Pania war gestorben, ohne ihrer Tochter die geringste Chance auf Versöhnung zu gewähren. Und Moana hatte die alleinige Schuld dafür bei Daniel gesucht. Schon bald nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter war er in ihren Augen von der großen Liebe zum Fehler ihres Lebens geworden.
Und was Aroha anging, hegte Moana inzwischen nicht mehr den geringsten Zweifel, dass sich die Prophezeiungen ihrer Mutter nun tatsächlich erfüllen sollten, denn sie war sich sicher, dass es Aroha fort von Taupatiti zog. Obwohl ihre geliebte Tochter noch kein Wort über ihre Pläne geäußert hatte, spürte Moana tief im Herzen, dass ihr einziges Kind in Gedanken längst auf einem weit entfernten Planeten lebte. Und sie ahnte, dass sie den Fehler ihrer Mutter wiederholen würde, nämlich, das Land der Ahnen zu verlassen, weil sie irrtümlich meinte, die Liebe an einem anderen Ort gefunden zu haben. Und dass Liebe eine Chimäre war, wusste keine besser als Moana. Liebe war nur eine Versuchung, eine Prüfung der Ahnen, ob sie ihrem Erbe treu bleiben oder es für ein flüchtiges und trügerisches Gefühl verraten würde.
Ja, Moana war am Ende ihres Lebens weiser als damals. Da hatte sie noch an die magische Macht der Liebe geglaubt und die Schauergeschichten um den Familienfluch, nach dem die Abtrünnigen gestraft wurden, weit von sich gewiesen. Und nun fand sie sich, vierzigjährig, in der Rolle der todgeweihten Mahnerin wieder. Und ihre Tochter war mit derselben Blindheit geschlagen wie sie damals. Natürlich entging einer Mutter weder das selige Lächeln im Gesicht ihres Kindes noch die fadenscheinigen Ausreden, warum sie manchmal tagelang nicht nach Hause kam.
Moanas hochgewachsene blonde achtzehnjährige Tochter hatte für diese Prophezeiungen der Ahnen allerdings nur ein müdes Lächeln übrig. Deshalb stand Moana eine dringende Aussprache mit ihrer Tochter bevor. Sie wusste, dass Reden allein kaum helfen würde, die lebensfrohe junge Frau von den Tücken der Liebe zu überzeugen. Nein, sie musste sich schnell etwas Überzeugenderes einfallen lassen, als bloße Drohungen von sich zu geben, wie es einst ihre Mutter getan hatte. Doch sie hatte eine Idee, wie sie das anstellen sollte. Dass ihre Tochter derart immun gegen Flüche ihrer Vorfahren war, lag nicht zuletzt daran, dass ihr Vater, so haltlos er auch ansonsten gewesen war, sich intensiv um seine Tochter gekümmert und sie mit britischem Gedankengut gefüttert hatte. Er hatte sie stets davor gewarnt, an die Geister der Maorifrauen zu glauben. Moana hatte nichts dagegen unternehmen können, denn ihre Tochter hatte dem wortgewandten Daniel geradezu an den Lippen gehangen und jedes seiner Worte kritiklos angenommen. Selbst als er eines Tages spurlos von der Insel verschwunden war, hatte ihre Tochter noch nach Entschuldigungen für sein Verhalten gesucht. Moana aber hatte ihrer Tochter strikt verboten, den Namen ihres Vaters jemals wieder zu erwähnen. Jedenfalls in Gegenwart der Mutter. Die Tochter war damals vierzehn und hin- und hergerissen gewesen zwischen der paradiesischen Welt auf der Maori-Insel und dem normalen Leben, das es auf der anderen Seite des Mahau Sounds, der zu dem großen Pelorus Sound gehörte und an dessen Ende der kleine Ort Havelock lag, gab.
Seit ihrer Kindheit spielte sich ein Teil ihres Alltags drüben, auf der anderen Seite, ab, denn die Schule befand sich in Picton. Obwohl der Schulweg von Havelock aus an die neunzehn Meilen betrug, hatte Moana darauf bestanden, dass ihre Tochter die Strecke jeden Tag mit dem Schulbus zurücklegte. Das war ungewöhnlich, denn die meisten Mädchen aus ihrer Klasse, die in den Sounds lebten, wohnten unter der Woche im Internat, um ihnen die täglichen Fahrzeiten zu ersparen. Moana aber war der Meinung, es wäre wichtiger für ihr Kind, die Nächte auf der Insel zu verbringen. Moana selbst war noch von Hauslehrern auf Taupatiti unterrichtet worden, denn ihre Familie war vermögend genug gewesen, um sich einen englischen Erzieher und eine französische Gouvernante zu leisten.
In der Schule hatte Aroha einige Freundinnen gehabt, was Moana stets kritisch beäugt hatte, weil sie sich sorgte, diese Mädchen könnten sie dem Inselleben entfremden, aber allein ihr langer Schulweg hatte ihr nie viel Gelegenheit gelassen, sich mit den anderen etwa noch in der Stadt zu vergnügen. Sie war jeden Tag gleich nach Schulschluss in einen Bus gestiegen, der sie von Picton zurück nach Havelock gebracht hatte. In Havelock war sie dann bei Wind und Wetter in ein stabiles seefestes Motorboot gestiegen, um auf ihre Insel zu gelangen. Oft war sie erst bei Dunkelheit zu Hause angekommen, aber diese Strapazen waren Moana lieber, als ihre Tochter in der Gesellschaft der anderen Mädchen und vor allem der Jungen zu wissen. Ganz selten, wenn der Sturm zu heftig tobte, durfte sie notgedrungen bei ihrer Freundin Helen übernachten, die auch jeden Tag mit ihr im Schulbus saß und die Moana ein besonderer Dorn im Auge war, weil sie Aroha dazu überreden wollte, mit ihr für ein Jahr als Austauschschülerin in die USA zu gehen. Gegen die Kräfte der Natur war dann allerdings auch Moana machtlos. Der Einfluss der Freundin war gegenüber einem qualvollen Ertrinken im Sound doch das kleinere Übel. Nach so einer Nacht in dem verschlafenen Ort Havelock war ihr Liebling dann jedes Mal mit solcher Begeisterung auf die Insel zurückgekehrt, dass Moana keinerlei Arg hegte, dieses mit Taupatiti verwurzelte Naturkind würde ihr jemals solche Sorgen bereiten. Schließlich liebte ihre Tochter jeden Flecken des Paradieses mit Inbrunst und besonders die Bucht im Süden der Insel, in der ihr Zuhause lag, ein weißes Gebäude aus Holz, das auf Pfählen gebaut war, damit auch im Winter das überschäumende Meerwasser keine Chance bekam, das Haus zu beschädigen.
Natürlich ahnte Moana, was ihre Tochter über ihre todbringende Krankheit dachte. Dass es nicht der Fluch war, der ihre Mutter umbrachte, sondern die filterlosen Zigaretten, die sie pausenlos rauchte.
Selbst in diesem Augenblick, in dem Moana mit eingefallenen Wangen in ihren Kissen lag und der Tod bereits ungeduldig vor ihrem Bett auf den letzten Atemzug wartete, flehte sie ihre Tochter an, ihr eine Zigarette zu drehen, obwohl sie wusste, wie abgrundtief diese Tabak verabscheute. Doch ohne eine Miene zu verziehen, kam ihre Tochter dem Ansinnen nach, was ihrer Mutter ein leichtes Grinsen auf das gequälte Gesicht zauberte. »Danke!«, hauchte sie, bevor sie von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt wurde, doch kaum war das letzte Keuchen verklungen, griff sie nach dem Glimmstängel und nahm einen kräftigen Zug, woraufhin sich ihre Gesichtszüge entspannten.
»Aroha, ich muss mit dir sprechen«, verkündete Moana in scharfem Ton.
Die Angesprochene zuckte zusammen. Wie lange hatte ihre Mutter sie nicht mehr bei ihrem Maori-Namen genannt? Spätestens, seit sie im Alter von zwölf Jahren verlangt hatte, bei ihrem Taufnamen Stella gerufen zu werden. Ihr Taufname war auch so ein Vermächtnis ihres geliebten Vaters. Daniel hatte darauf bestanden, dass seine Tochter einen englischen Namen erhielt. Ihre Mutter hatte das pro forma mitgemacht und Stella stets unbeirrt weiterhin Aroha genannt, wenn der Vater nicht in der Nähe gewesen war. Bis Stella ihr das verboten hatte. Und nun tat sie es wieder. Aber an diesem Tag hätte Stella ihr alles nachgesehen, denn sie war untröstlich. Ihre Mutter war stets ein Fels in der Brandung gewesen, hatte die Muschelfarm im Griff und galt in der Gegend als ernst zu nehmende Geschäftspartnerin. Bis auf ihre vom übermäßigen Rauchen frühzeitig gealterte Haut schien sie unsterblich, und nun war sie nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Aber es gab noch einen anderen Grund, warum Stella der strenge Ton in der Stimme ihrer Mutter erschreckte. So, als ob Moana etwas wüsste. Dabei hatte Stella sich doch gar nichts von ihren Plänen anmerken lassen. Jedenfalls hatte sie das bis zu diesem Moment geglaubt. Jetzt war sie nicht mehr so sicher, obwohl sie extrem vorsichtig gewesen war. Sie hatte weder seinen Namen erwähnt noch ihn außer dem einen Mal heimlich mit nach Taupatiti genommen. Dabei hatte er darauf gebrannt, ihre Insel näher kennenzulernen und sie noch einmal an dem einsamen Strand zu lieben, den man nur vom Wasser aus mit einem Boot erreichen konnte. Doch nun war er weit fort, und sie konnte sich nicht einmal Trost bei ihm holen. Sie hatte ihn darum gebeten, ihr ein wenig Zeit zu lassen, um ihre Mutter schonend auf die Wahrheit vorzubereiten, doch das würde sie nun nicht mehr übers Herz bringen. Sollte ihre Mutter ruhig in dem Glauben sterben, ihre Tochter würde ihr Leben auf der Insel fristen und Muscheln züchten. Niemals würde Stella ihr auf dem Totenbett schonungslos alle Illusionen nehmen. Der Tod ihrer Mutter brachte ihre Zukunftspläne ohnehin völlig durcheinander, weil sie natürlich davon ausgegangen war, dass Moana noch lange die Herrin von Taupatiti bleiben und damit die Frage nach dem Schicksal der abtrünnigen Erbin Zukunftsmusik sein würde. Nein, Stella mochte sich beileibe nicht vorstellen, was für Konsequenzen es nach dem Tod ihrer Mutter haben mochte, wenn sie ihrem Liebsten nach London folgte. Da gab es wohl nur eines: den Verkauf der Insel. Ein Gedanke, der ihre Mutter, wäre sie nicht schon sterbenskrank, schier umbringen würde. Was hatte Moana schon für Angebote ausgeschlagen. Millionen hatte man ihr für Taupatiti geboten …
Ihre Mutter blickte sie einen Augenblick schweigend an. Ihre blasse Haut, die sie von ihrem Vater geerbt hatte, hatte einen kalkigen Weißton angenommen und ihr schönes schwarzes Haar, ein Erbe der Mutter, war stumpf und glanzlos. Dieser desolate Zustand ihrer Mutter verbunden mit dem quälenden Schweigen ließ Stella für einen Augenblick hoffen, dass sie nichts von ihren Absichten ahnte und in Frieden sterben würde.
»Wer ist der Bursche?« Mit dieser Frage machte ihre Mutter diese Hoffnungen zunichte.
»Welcher Bursche?«, versuchte sich Stella herauszureden.
»Der, der dich dazu zwingen will, das Erbe deiner Väter zu verraten!«, entgegnete Moana mit einer derart klaren Stimme, dass man meinen konnte, sie wäre kerngesund.
Stella wurde in schnellem Wechsel heiß und kalt. Sollte sie versuchen zu lügen?
»Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst«, sagte sie mit belegter Stimme, aber es klang wenig überzeugend.
»Schwöre mir, dass du nach meinem Tod auf Taupatiti bleibst und die Hüterin unserer Insel und der Muscheln wirst!«
»Ich … Mutter, alles wird gut, du musst dich jetzt schonen«, stammelte Stella.
»Schwöre!«
»Ich … nein, das möchte ich nicht. Zwinge mich nicht dazu«, flehte Stella, aber ihre Mutter kannte kein Erbarmen.
»Wer ist der Kerl? Ich will es aus deinem Mund hören …« Ein entsetzlicher Hustenfall hinderte sie am Weitersprechen.
Stella nahm ein feuchtes Tuch, das sie bereits auf dem Nachttisch bereitgelegt hatte, zur Hand und wischte ihrer Mutter den Schweiß, der ihr aus allen Poren tropfte, aus dem Gesicht. »Mutter, bitte, bitte reg dich nicht auf. Bitte. Es ist alles gut.«
Kaum war der Anfall vorüber, richtete sich ihre Mutter ächzend auf.
»Soll ich Doc Stevens holen? Oder wir fahren gleich ins Krankenhaus«, stieß Stella panisch hervor.
»Kein Doktor und kein steriles Krankenzimmer. Ich will in meinem Bett sterben, ohne dass unser Doc vorwurfsvoll auf meinen Tabak starrt. Und außerdem wird das jetzt fix gehen, nachdem du mir die Wahrheit gesagt hast.«
»Sag doch nicht so was!«
»Schwöre, dass du dein Erbe antreten wirst. Ich habe ein Recht, in Frieden zu gehen«, entgegnete ihre Mutter kämpferisch. »Ich höre!«
In Stellas Kopf ging alles durcheinander. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Schwören, lügen oder die Wahrheit sagen, wohl wissend, dass sie ihre Mutter damit entsetzlich quälen würde?
»Aroha, du weißt, was dein Name bedeutet, oder? Großmutter Pania hat ihn dir gegeben.«
Stella nickte schwach und zuckte bei Nennung des Namens ihrer Großmutter leicht zusammen. Sie hatte sie zwar nicht persönlich kennengelernt, aber die Geschichten, die ihre Mutter ihr stets voller Bewunderung für diese in Arohas Augen herzlose und strenge Frau erzählte, erzeugten ein unangenehmes Schaudern bei ihr. Es ging ständig um Flüche, Schwüre, Treue zu Taupatiti und Tod. Wie hatte ihr Vater ihr immer geraten? Nimm diesen Spuk bloß nicht ernst! Bei dem Gedanken an ihren Vater wurde sie traurig. Was hätte sie darum gegeben, wenn er in diesem Moment an ihrer Seite wäre, aber er war ja vor vielen Jahren auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
»Es heißt Liebe. Aber es meint die Liebe zu deinen Wurzeln und nicht zu einem Mann. Du weißt, wohin mich dieser Irrtum gebracht hat. Hätte ich bloß auf meine Mutter gehört, aber ich habe ihr ins Gesicht geschleudert, dass ich zu diesem Kerl gehöre und lieber auf seiner Farm schufte als in den Muschelbänken.« Ihre Mutter griff so überraschend nach ihrer Hand und hielt sie mit einer Kraft fest, die sie der Sterbenden nicht zugetraut hätte, dass sie vor Schreck erstarrte.
»Was du auch immer vorhast, lass es sein! Du gehörst hierher! Du bist die Erbin von Taupatiti und hast kein Recht, dein Erbe und damit dein Leben wegzuwerfen«, zischte ihre Mutter und presste ihre Hand noch heftiger zusammen. Stella hatte das Gefühl, sie wäre in einem Schraubstock eingeklemmt, und stöhnte laut auf.
»Mutter, bitte, lass es gut sein. Ich, ich … es fällt mir doch auch nicht leicht, aber ich habe keine Wahl«, brachte sie schließlich verzweifelt hervor.
Der Blick, den ihre Mutter ihr nun zuwarf, ließ Stella förmlich das Blut in den Adern gefrieren. Als hätte der Tod den Wahnsinn gleich mitgebracht. Das ist kein menschliches Antlitz mehr, durchfuhr es Stella eiskalt, und sie schloss die Augen, doch das brachte ihr keine Erleichterung, denn nun erschien ihr vor dem inneren Auge der Sensenmann mit einer grinsenden Maske. Erschrocken öffnete sie die Augen wieder. Ihre Mutter starrte sie immer noch auf eine Weise an, dass es zum Fürchten war.
»Wer kann es wert sein, dass du dein Leben aufs Spiel setzt?«
Stella atmete ein paarmal tief durch, bevor sie den Blick ihrer Mutter suchte und ihm standhielt.
»Mutter, er ist Pianist und braucht die internationalen Bühnen der Welt, um sein Talent auszuleben. Er kann nicht auf unserer abgeschiedenen Insel leben. Ich werde ihm nach London folgen«, sagte sie mit fester Stimme, was sie selbst am meisten verwunderte, denn sie war doch selbst innerlich tausend Tode gestorben, bevor sie die Zusage gegeben hatte, ihm zu folgen. Er hatte reichlich Überzeugungsarbeit leisten müssen. Er hatte ihr unendlich viele Bilder von dem Herrenhaus gezeigt, das er jüngst von seinen Eltern geerbt hatte. Es lag direkt an einem See, und das hatte sie schließlich davon überzeugt, ihre Insel zu verlassen. Ohne Wasser konnte sie nicht leben und … nicht ohne Oliver. Nicht mehr jedenfalls! Das Anwesen in Kingsley sollte ihr gemeinsames Zuhause sein. Von dieser Basis aus würde er seine Konzertreisen unternehmen und sie sich ihren Traum von einem Studium der Kunstgeschichte erfüllen. Das war der Plan, dessen Umsetzung sie einander immer wieder liebestrunken versichert hatten. Sie wusste sehr wohl, dass Kunstgeschichte ein absonderliches Interesse für ein Inselmädchen aus den abgelegenen Marlborough Sounds war, aber auch in ihrer Schule in Picton gab es Lehrer, die ihre Schülerinnen für die Werke der alten europäischen Meister zu begeistern verstanden. Und Stella war die beste Schülerin von Mr Blake gewesen.
»Aroha, nein, das kannst du nicht tun. Siehst du denn nicht, was mit mir geschehen ist, weil ich den Schwur gebrochen habe? Ich werde von innen aufgefressen. Mein ganzer Körper ist ein einziger Tumor. Verstehst du nicht, dass du sterben musst, sobald du unsere Insel an Fremde verkaufst?« Die Stimme ihrer Mutter bekam jetzt einen flehenden Klang.
»Wenn es sein muss, dann … dann, verschenke ich sie oder … oder ich finde jemanden, der hier leben und die Muscheln züchten möchte«, erwiderte Stella verzweifelt.
»Das wird dich nicht retten, mein Kind. Ich bin sogar zurückgekehrt, aber die Ahnen wissen, dass es nicht aus freiem Willen geschehen ist …«
Stella spürte, wie ihre Finger unter dem eisernen Griff, mit dem ihre Mutter ihre Hand immer noch festhielt, langsam taub wurden, aber sie traute sich nicht, ihre Mutter zu bitten, sie freizugeben.
»Mein Kind, du bist eine begnadete Muschelzüchterin, du darfst das alles nicht hinter dir lassen«, beschwor ihre Mutter sie. Stellas Atem beschleunigte sich. Das allerdings entsprach der Wahrheit, was ihre Mutter da sagte. Schon als Kind hatte sie sich voller Inbrunst um die Aufzucht der Muscheln gekümmert, aber das war doch nur eine Seite von ihr. Warum wollte ihre Mutter nicht sehen, dass so viel mehr in ihr steckte? Dass ihr die Bücher über die Maler aus aller Welt und ihre Werke, die sie an stürmischen Winterabenden am kuscheligen Ofen verschlungen hatte, ihr nicht mehr genügten? Wie oft hatte Mrs Pritches, die Schul-Bibliothekarin, nur für sie Kunstbücher bestellt? Nein, sie wollte etwas anderes erleben. Hinaus in die Welt! In die europäische Welt, aus der die Familie ihres Vaters einst auf einem Auswandererschiff in das Land der langen weißen Wolke gekommen war.
»Glaubst du, es fällt mir leicht, Taupatiti gegen London einzutauschen? Aber ich kann nicht mehr ohne Oliver leben«, gab sie stöhnend zu bedenken.
»Unsinn, du bist achtzehn. Du bist noch ein Kind. Sei doch vernünftig. In London wirst du eingehen. Du gehörst hierher!« Ihre Mutter schlug sich die Hände vors Gesicht und brach abrupt in ein lautes Schluchzen aus.
Stella musste erst einmal ihre Hände aneinanderreiben, um ihre Fingerkuppen wieder zu spüren. Ach, es war wirklich verhext, dass ihre Mutter viel zu früh gehen musste. Es wäre schwierig genug gewesen, ihr zu offenbaren, dass sie mit Oliver auf Probe nach England gehen und sofort nach Hause zurückkehren würde, wenn sie es nicht ohne ihre Insel aushielt. Aber nun war alles so endgültig, weil von ihr erwartet wurde, ihr Erbe unverzüglich anzutreten. Und wenn sie ehrlich war, kannte sie keinen, der besser geeignet war als sie, das Geschäft ihrer Mutter fortzuführen. Es sei denn, sie wollte die Muschelzucht einem Konkurrenten überlassen. Diesen Gedanken traute sie sich in dem Augenblick gar nicht zu Ende zu denken, geschweige denn auszusprechen. Sie befürchtete, dann würde ihre Mutter auf der Stelle ihren letzten Seufzer tun.
Aber konnte ihre Mutter wirklich verlangen, dass sie darauf verzichtete, Oliver zu folgen? Natürlich hatten die beiden Liebenden die Problematik ihrer zwei unterschiedlichen und kaum zu vereinbarenden Welten in langen Nächten diskutiert. Ja, Oliver hatte sogar vorgeschlagen, dass er dann wohl bei ihr bleiben müsste. Dass das von Herzen so gemeint war, hatte Stella nie bezweifelt. Aber das atemberaubende Angebot seiner Agentur, das ihn am nächsten Tag aus London erreicht hatte, hatte diese Pläne ad absurdum geführt. Man hatte ihm, dem Nachwuchstalent, eine Konzertreise durch ganz Europa angeboten. Ein alter Meister der Tastenkunst war schwer erkrankt, und die Wahl, die Tournee zu retten, war auf ihn gefallen. Eine große Ehre. Keine Frage. In der Agentur hätte man ihn für geisteskrank erklärt, wenn er dieses Angebot abgelehnt hätte. Oliver hatte trotzdem gezögert, weil das bedeutete, dass er seine Neuseelandreise sofort abbrechen und Stella verlassen musste. Sie aber hatte ihm keine Wahl gelassen und auf ihn eingewirkt, diese Chance nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Das war jetzt genau zwei Monate her. Jeden Tag war ein schmachtender Brief von ihm gekommen, den die Postbotin Lucie, die mit ihrem Boot die Inselbewohner mit den Briefen und Paketen belieferte, ihr auf Stellas ausdrücklichen Wunsch nur persönlich ausgehändigt hatte. Ihre Bitte war bei Lucie auf volles Verständnis gestoßen. Man kannte sich in den Sounds, und jedermann wusste um das Schicksal der Taupatiti-Mädchen, wie die Erbinnen der Insel bezeichnet wurden. Die tragischen Geschichten um ihre verlorenen Lieben gehörten am Pelorus Sound zum Allgemeinwissen. Und dass Moana mit Sicherheit nicht guthieß, dass ihre Tochter täglich Post aus dem fernen London bekam, ahnte die Postbotin.
Stella war so tief in Gedanken versunken, dass sie gar nicht gemerkt hatte, wie die Mutter ein vergilbtes Heft aus der Nachttischschublade hervorgezogen hatte. Erst als sie es ihr mit den Worten reichte: »Das hat meine Großmutter Manuka einst aufgeschrieben. Es gibt nicht nur den einen Fluch, der die abtrünnigen Erben betrifft, sondern auch einen anderen, der die weiblichen Erben betrifft. Ausgesprochen von der Frau ihres älteren Bruders, Rere. Als nach dem Willen seines Vaters ihre ältere Schwester Marama Herrin von Taupatiti wurde, hat Rere alle Frauen verflucht, die jemals …«
Während Stella das Büchlein entgegennahm, spürte sie plötzlich eine unbestimmte Angst, die ihr durch den ganzen Körper rieselte. »Mutter, bitte, das ist doch alles bloß Panikmacherei«, sagte sie mit bebender Stimme.
»Ich schweige gleich, und zwar für immer. Keine Sorge!«, entgegnete Moana mit dem Anflug eines Lächelns auf den Lippen.
Stella spürte in diesem Augenblick etwas von dem Flair durchblitzen, das ihre Mutter in allen Lebenslagen ausgezeichnet hatte. Moana war nämlich eine Frau von ausgesprochen trockenem Humor, der in den Sounds gleichermaßen beliebt wie gefürchtet war.
»Mutter, du wirst nicht gleich sterben!«, log Stella in ihrer Verzweiflung und kam sich schon in demselben Augenblick wie eine Heuchlerin vor. Ihre Mutter aber ignorierte diesen hilflosen Versuch ihrer Tochter, das Unabänderliche schönzureden.
»Und wenn du es gelesen hast, wirst du wissen, die Liebe ist nicht für die Taupatiti-Frauen geschaffen. Die Männer, die mit uns auf der Insel leben, drehen früher oder später durch oder sterben früh. Und wenn wir wiederum den Männern folgen, statt unser Erbe anzutreten, sind wir dem Tod geweiht. Bitte, Stella, tu, was die Ahnen von dir erwarten. Bekomme von einem Mann einen Erben, und mehr verlange nicht von ihm!«, erklärte sie ihrer verdutzten Tochter, die das zum ersten Mal in ihrem Leben hörte, mit Nachdruck.
»Ich soll mich von einem Kerl schwängern lassen, den ich nicht mal liebe, nur um unsere Insel an mein Kind zu vererben? Das kann nicht dein Ernst sein!«, stieß Stella empört hervor.
»Ich möchte dir doch nur das Schicksal der Taupatiti-Frauen ersparen. Bleib hier, lebe und bekomme ein Kind. Das ist dein Schicksal. Schwöre, dass du nicht mit ihm fortgehst.«
Ihre Mutter krallte sich bei diesen Worten erneut mit den Fingern in Stellas Arm. Es hätte nicht viel gefehlt und Stella hätte vor Schmerz aufgeschrien, aber etwas im Gesicht ihrer Mutter hielt sie davon ab. Ihre Augen und Wangen waren mit einem Mal krankhaft eingesunken, die Nase erschien spitz, das Kinn und die Nasenspitze schimmerten weißlich bis gelb. Stella wusste, was das zu bedeuten hatte. Als »Todesdreieck« hatte ihre Biologielehrerin dieses typische Zeichen des nahen Todes einst bezeichnet. Der Schreck fuhr ihr durch alle Glieder. Würde ihre Mutter doch bloß in Frieden sterben, statt weiter in sie zu dringen, hoffte Stella inständig, aber der Schmerz der sich in ihren nackten Arm bohrenden Fingernägel verstärkte sich nur noch.
»Ich schwöre es«, seufzte Stella, die sich in ihrer Not von den moralischen Bedenken, etwas zu beschwören, das sie niemals einzuhalten gedachte, verabschiedete.
»Sieh mir in die Augen!«, krächzte ihre Mutter, deren Stimme ihr offenbar langsam den Dienst versagte. Ihr Atem ging flacher und unregelmäßiger als zuvor.
Stella tat, was sie verlangte, aber sie konnte dem prüfenden und zugleich erlöschenden Blick ihrer Mutter nicht länger standhalten, sondern wandte sich hastig ab und rieb den schmerzenden Arm, in dem sie die Fingernägel noch immer wie Nägel in der Haut spürte.
Zu ihrem großen Entsetzen richtete ihre Mutter plötzlich den Oberkörper auf und forderte Stella auf, ihr als Stütze die Kissen im Kreuz zu richten. Stella, die mit einem Ableben ihrer Mutter binnen der nächsten Minuten gerechnet hatte, kam ihrer Bitte mit gemischten Gefühlen nach. Natürlich genoss sie jede Sekunde, die ihre Mutter noch am Leben war, aber sie fürchtete auch, dass sie bis zum letzten Atemzug vehement auf sie einreden würde. Und langsam wusste sie nicht mehr, was sie erwidern sollte. Schlimm genug, dass sie gelogen hatte. Aber Stella, die sonst völlig immun gegen die Flüche der Ahnen war, bebte schon jetzt vor Angst, es könnte doch ein Fünkchen Wahrheit in der einen oder anderen Prophezeiung liegen.
»Du lügst!«, keuchte ihre Mutter zwischen zwei rasselnden Atemzügen. Auch das hatte Stella im Biologieunterricht gelernt: Im finalen Stadium rasselte der Atem, weil die Sterbenden weder schlucken noch husten konnten. In diesem Moment bedauerte sie, in allen Fächern eine derart aufmerksame Schülerin gewesen zu sein.
Was sollte sie dazu sagen? Ihre Entscheidung war doch längst gefallen, auf das ganze Brimborium der Ahnen samt ihren bösen Flüchen zu pfeifen, und doch lähmte sie das, was ihre Mutter da alles von sich gab. Außerdem lag das vergilbte Heft wie Blei in ihrer Hand. Und warum bebte sie innerlich bei der Vorstellung, dass irgendwann Ahnen beschlossen hatten, alle Erbinnen der Taupatiti-Insel in die Hölle zu schicken? So oder so! Stella schob ihre Ängste auf die spezielle Situation, in der sie sich befand. Schließlich war es alles andere als normal, die eigene Mutter im Alter von achtzehn Jahren loszulassen, zumal es keinen Vater gab, der sie trösten konnte.
Stella straffte die Schultern. Nein, sie war nicht irgendwer, sondern die Nachfahrin eines stolzen Maorihäuptlings, den die Pakeha mit keinem Trick zum Verkauf seines heiligen Landes hatten bewegen können. Er hatte damals den britischen General ausgetrickst, der glaubte, ihn betrunken gemacht zu haben, um ihn zur Unterschrift über den Verkauf von Taupatiti zu nötigen. Doch der kluge Häuptling hatte den Schnaps unauffällig in eine Palme geschüttet, sodass es schließlich der Brite gewesen war, der torkelnd und unverrichteter Dinge die Vertragsverhandlungen über die Insel verlassen musste.
Natürlich war Stella stolz auf ihre unbeugsamen Vorfahren, wenngleich sie äußerlich rein gar nichts mit den Ureinwohnern Neuseelands verband. Sie kam völlig nach ihren Großvätern. Sowohl Panias Ehemann als auch ihr Vater Daniel waren große, schlanke blonde Kerle gewesen. Wo ihre Mutter wenigstens noch das dunkle Haar ihrer Maori-Vorfahren geerbt hatte, war bei Stella rein äußerlich vom Erbe der Maori nichts zu erkennen. Sie sah aus wie eine waschechte Pakeha. Und das Schlimme war, sie fühlte sich auch wie eine Weiße und hatte große Mühe, das Erbe der Maori als Bestandteil ihrer Geschichte anzunehmen. Ihr Vater hatte sie so intensiv auf das britische Gedankengut eingestimmt, dass ihr die Werte der Maori stets fremd geblieben waren.
Vor diesem Hintergrund verunsicherten sie die Prophezeiungen ihrer Mutter umso mehr. Doch wo war ihre legendäre Abgegrenztheit gegen diese Familiengeschichten? Im Angesicht des Todes ihrer Mutter war Stella plötzlich so empfänglich für diese alten Geschichten wie nie zuvor. Sie spürte beinahe körperlich den Fluch der Ahnen. Ihr wurde entsetzlich schlecht, und alles drehte sich um sie her. Sie fühlte sich wie in einem Karussell gefangen. Sie wollte aussteigen, aber man ließ sie nicht. Ob es doch unsichtbare Kräfte gibt, die mich bestimmen?, fragte sich Stella, während ihre Mutter sie mit einem Mal mit weichem Blick musterte.
»Versprichst du mir, dass du mit deiner Entscheidung wartest?«, fragte sie mit schwacher Stimme.
Stella stutzte. Das waren ganz neue Töne. Eben gerade noch hatte sie schwören sollen, und nun riet ihre Mutter ihr dazu, sich die Zeit zu lassen, die sie brauchte. Dabei waren die Würfel gefallen. Es gab kein Zurück mehr!
»Natürlich, Mutter«, entgegnete sie aufrichtig. »Aber worauf soll ich warten?«
»Du glaubst nicht an den Fluch der Ahnen, oder?«, fragte Moana, wobei ihre Worte kaum mehr zu verstehen waren. Ihre Stimme klang verwaschen und schwach, doch Stella wusste genau, was ihre Mutter von sich gab.
»Mutter, bitte lass dieses Thema. Ich habe eine andere Ansicht zu den Dingen des Glaubens.«
»Ich weiß«, seufzte ihre Mutter resigniert, doch dann funkelte sie ihre Tochter plötzlich aus unternehmungslustigen Augen an. Vergessen waren das sogenannte Todesdreieck und alle anderen Vorboten des nahenden Todes.
»Aroha, ich habe eine Idee, wie ich dich vom Erbe der Ahnen überzeugen kann!«
Stella atmete ein paarmal tief durch. »Und wie?«, fragte sie wenig ambitioniert.
Aus den Augen ihrer Mutter aber strahlte es förmlich, etwas, das partout nicht zu ihrem Zustand passen wollte. Sie lag im Sterben, und alle Merkmale hatten darauf hingedeutet, dass es nicht mehr lange dauerte, und nun dieses Aufflackern von Leben. Stella hatte gemischte Gefühle. Natürlich wünschte sie sich sehnlichst, dass ihre Mutter noch länger leben würde, aber angesichts der deutlichen körperlichen Zeichen schien das doch eher eine Illusion zu sein.
»Ich mache dir einen Vorschlag«, sagte ihre Mutter mit einer so klaren Stimme, als wäre sie komplett gesund. »Schlägst du ein?«
»Klar«, erwiderte Stella schwach. Sie war es so leid, irgendwelche Vereinbarungen zu treffen, die sie doch nach dem Tod ihrer Mutter niemals einhalten würde. Sie kam sich wie eine verlogene Heuchlerin vor. Etwas, was ihrem gradlinigen Charakter völlig widersprach.
»Gut, mein Kind, du bleibst auf Taupatiti, wenn dir mein Geist, sobald ich tot bin, im Traum erscheint und dich dazu ermutigt, die Verantwortung für Taupatiti zu übernehmen. Wenn nicht, dann gehe, und gehe in Frieden.«
Stella hatte Schlimmeres erwartet und ergriff die knochige Hand, die ihr die Mutter mit letzter Kraft entgegenstreckte.
»Einverstanden. Solltest du mir erscheinen, dann bleibe ich hier«, versicherte Stella, während sie keinen Gedanken daran verschwendete, dass ihr der Geist ihrer toten Mutter tatsächlich im Traum erscheinen könnte. Das Ganze hielt Stella Wilson in diesem Augenblick für so unwahrscheinlich, dass sie leichten Herzens die Hand zum Schwur erhob, wie ihre Mutter es nun von ihr verlangte, bevor Moana in die Kissen zurücksank und ihren letzten Atemzug tat.
1. TEILStella und die Ahnenvon Taupatiti
1.
Stella Wilson kletterte wie jeden Morgen in Jeans, Gummistiefeln und einem schlabberigen Rollkragenpullover unter der Wetterjacke bereits kurz nach sieben Uhr morgens an Deck ihres Motorboots und wollte gerade die Leinen losmachen. Obwohl die noch junge Januarsonne einen warmen Sommertag im Norden der Südinsel Neuseelands versprach, bot ihr die Kleidung den nötigen Schutz vor dem frischen Wind, der an diesem Morgen durch den Pelorus Sound fegte.
In dem Augenblick ertönte lautes Gebell. Stella drehte sich um und beobachtete amüsiert, wie Cora, ihre neuseeländische Huntaway-Hündin, hechelnd den Anleger erreichte und deutlich machte, dass sie mitfahren wollte. Zu diesem Zweck hatte Stella eine Art Einstiegshilfe wie eine Leiter ohne Stufen gebaut. Seufzend kletterte sie noch einmal von Bord und stellte das Gerät für den Hund bereit. Schwanzwedelnd und wie der Blitz huschte Cora an Bord. Sie begleitete Stella meistens, wenn sie am frühen Morgen die tägliche Tour zu ihrer Muschelfarm unternahm, die nur eine Seemeile entfernt von Taupatiti im Pelorus Sound lag. Heute Morgen aber war der Hund nicht an seinem Schlafplatz gewesen, als Stella das Haus verlassen hatte. Cora schmiegte sich an Stellas Bein, als wollte sie sich dafür entschuldigen.
»Ist ja gut alles, mein Mädchen. Wo warst du denn heute Morgen?«, redete sie sanft auf die Hundedame ein und ahnte bereits, dass Cora sich von den »Paua-Kriegerinnen« hatte verwöhnen lassen. So nannte Stella die jungen Maorifrauen, denen sie auf der anderen Seite der Insel ein neues Zuhause geboten hatte. Dort wurde Cora gern mit allen nur erdenklichen Leckereien gefüttert und durfte sogar mit in die Schafzimmer, etwas, das Stella ihrer Hündin nicht erlaubte. So begab sich Cora hin und wieder auf eigene Faust in das Hundeparadies. Die jungen Maori-Frauen, die dort lebten, teilten alle ein und dasselbe Schicksal: Sie waren von Männern, meist ihren Ehepartnern, aber auch von ihren Vätern, geschlagen und misshandelt worden und hatten in dem Frauenhaus auf Taupatiti Zuflucht gefunden. Es galt als eines der sichersten auf der neuseeländischen Südinsel, weil sich kaum ein Peiniger der Frauen, selbst wenn er ihren Aufenthaltsort ausfindig machte, auf die Insel traute. Das lag nicht zuletzt an den Gerüchten, die Frauen würden hier zu Kämpferinnen ausgebildet, und die Anführerin, die Herrin von Taupatiti, würde notfalls von der Schusswaffe Gebrauch machen.
Solche Räuberpistolen amüsierten Stella immer wieder aufs Neue, und sie streute in Havelock gern weitere Gerüchte, wie militant die Frauen wären und dass es den Männern da draußen nicht anzuraten wäre, sich ihnen je wieder zu nähern. Sie hatte die jungen Frauen nach dem neuseeländischen Spielfilm »Die letzte Kriegerin« benannt, in dem die Protagonistin nach schier unerträglichen Gewaltattacken ihres Mannes schließlich mitsamt ihren Kindern in den sicheren Familienverbund ihrer Maori-Verwandten auf eine Insel zurückgekehrt war. Stella liebte diesen Film und zeigte ihn regelmäßig den Neuankömmlingen. Die Kapazität dieses Hauses war zurzeit auf sechs Frauen beschränkt. Finanziert wurde die Einrichtung von staatlicher Seite, und obwohl Stella nur ihren Privatgrund für den Bau des Hauses zur Verfügung gestellt hatte und keine offizielle Stellung innehatte, galt sie als Herzstück des Ganzen. Sie gab den Frauen überdies bezahlte Jobs in der Paua-Zucht. Und weil die jungen Frauen besonders engagiert arbeiteten, hatte Stella ihnen den Namen »Paua-Kriegerinnen« gegeben.
Sich auf der Insel zusätzlich zu der Grünlippmuschel-Farm noch an einer Zucht von Seeohren, wie die Paua-Muscheln oder -Schnecken auch genannt wurden, zu versuchen, war allein ihre Idee gewesen. Auf den Gedanken wären ihre Vorfahren beileibe nicht gekommen, hatten sie mit den Grünschalmuscheln, mit deren Zucht Stellas Großmutter Pania in den Sechzigerjahren begonnen hatte, schon genügend zu tun gehabt. Dass Stella unbedingt noch die Paua mit der Innenschale aus Perlmutt züchten wollte, lag schlichtweg an ihrer Liebe zu diesen schillernden Haliotis, die, obwohl sie von den meisten Menschen für Muscheln gehalten wurden, biologisch zu den Schnecken zählten. Jeder Neuseeländer war im Laufe seines Leben schon einmal mit der Schale der Paua-Schnecke in Berührung gekommen, ob zum Schmuckstück verarbeitet oder über die so geheimnisvoll funkelnden Augen in Maorikunstwerken.
Stellas Motivation war aber noch eine ganz andere: Sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, ihre eigenen Perlen zu züchten. Dazu hatte sie in einem eigens dafür gebauten Schuppen in der Bucht an Land eine Extra-Anlage mit speziellen Tanks anlegen lassen. Hier lebten nur die Paua-Schnecken, die zur Perlenzucht vorgesehen waren, denn diese Tiere bedurften einer besonders sorgfältigen Behandlung. Im Gegensatz zu den Grünlippmuscheln, die an Hängeleinen im Meer gezüchtet wurden, hatte sie für die Paua-Schnecken, die nicht zur Perlenzucht verwendet wurden, Außentanks bauen lassen, die ins Meer gelassen wurden, weil sie sonst Gefahr liefen, von den räuberischen Seesternen gefressen zu werden. Manchmal reichte ein einziger Seestern, um eine ganze Paua-Kolonie zu vernichten, denn die Seesterne besaßen durch ihre Arme eine perfide Möglichkeit, Paua-Schnecken schachmatt zu setzen. Sie legten ihnen einfach einen Arm auf ihr Atemloch und erstickten sie.
Die zur Perlenzucht ausgewählten Schnecken wurden etwa im Alter von vier Jahren den Tanks im Schuppen entnommen und in ein spezielles Desinfektions- und Betäubungsmittel-Bad verbracht, um eine möglichst keimfreie Anbringung von kleinen Halbkugeln aus Perlmutt, den sogenannten Mabe-Kernen, ohne Verletzungsgefahr für die Tiere zu gewährleisten. Abalonen waren nämlich Bluter, was bedeutete, dass bereits kleinste Verletzungen zum Tod der Schnecke führen konnten. Deshalb beschäftigte Stella für diesen Schritt eine versierte Spezialistin, die dafür jedes Mal, wenn eine neue Generation von Schnecken diese Prozedur durchlaufen musste, extra nach Taupatiti anreiste. An Kunststoffschnüren zog sie die Mabe-Kerne in das Muschelinnere und schnitt die Schnüre anschließend an der Außenseite der Schale ab. Sobald die Tiere sich von dieser Prozedur erholt hatten, wurden sie in die Tanks zurückbefördert, wo sie in den folgenden zwei bis drei Jahren eine Perlmuttschicht um den Fremdkörper bildeten. Dann erst wurden die Schnecken aus ihrer Schale herausgelöst, die dann gereinigt und von der Außenseite her so weit abgeschliffen wurde, bis die Mabe-Perlen herausfielen. Die Kerne wurden schließlich entfernt und durch eine Kunststofffüllung ersetzt. Die Perle wurde anschließend mit runden Perlmutt-Plättchen verschlossen.
Diese Arbeit ließ Stella von Susan, einer befreundeten Goldschmiedin, ausführen, die ihr auch einen Großteil der fertigen Perlen abkaufte. Doch von jeder neuen Generation Perlen behielt Stella eine gewisse Anzahl, um sie eines Tages ihrer Tochter zu einem besonderen Anlass zu schenken. Sie hegte zwar ihre Zweifel, ob Holly ein solches Geschenk überhaupt würdigen konnte, hatte ihre Tochter doch nicht den geringsten Bezug dazu: weder zu Taupatiti noch zu dem Geschäft ihrer Mutter mit Muscheln und Schnecken. Jedes Mal, wenn Stella an ihre Tochter dachte, legte sich ein Schatten über ihr Gesicht. Sie fragte sich dann stets, ob es richtig gewesen war, ihrer Tochter all diese Freiheiten zu lassen, nach denen sie sich einst gesehnt hatte. Stella hatte Holly ferngehalten von den Zwängen, die ihre Herkunft der Tradition nach eigentlich mit sich brachte. Niemals hatte sie ihrer Tochter das Herz mit den alten Maori-Geschichten von Flüchen, Strafe und Rache beschwert, die angeblich jene treffen sollten, die ihr Erbe nicht antreten würden. Sie hatte ihr gegenüber auch niemals das Heft, das ihre Mutter ihr einst überlassen hatte, erwähnt, zumal sie es selbst nach dem Tod ihrer Mutter ungelesen in die hinterste Ecke ihres Schreibtischs gestopft hatte. Die Erscheinung ihrer toten Mutter war für sie Grund genug gewesen, ihrer Bestimmung zu folgen. Dazu brauchte sie keine Schauergeschichten der Ahnen zu studieren.
Nein, sie hatte ihrer Tochter sogar schweren Herzens erlaubt, die Insel schon mit zwölf Jahren zu verlassen, um auf ein Internat in das fast fünfhundert Meilen entfernte Dunedin zu gehen. Wegen der großen Entfernung war Holly nur in den großen Ferien nach Hause gekommen und an den übrigen Festtagen hatte sich Stella stets bemüht, zu ihrer Tochter zu fliegen. Diese Besuche waren zwischen Mutter und Tochter meist harmonischer verlaufen als Hollys Aufenthalte in Taupatiti, anlässlich derer Stella ständig mit ihrem Schmerz konfrontiert gewesen war, dass ihre Tochter niemals Herrin der Insel sein würde. In der schönen Stadt, in der Holly inzwischen an der Musikakademie studierte, hingegen genossen sie die Kulturangebote in vollen Zügen, und Holly war jedes Mal wieder erneut überrascht von den vielfältigen Interessen, die ihre Mutter über die Insel und ihre Muscheln hinaus besaß.
Stellas Miene erhellte sich bei dem Gedanken an einen ihrer letzten Besuche in Dunedin. Nicht Holly hatte ihre Mutter zu der Sonderausstellung zeitgenössischer europäischer Maler in die Dunedin Public Art Gallery eingeladen, sondern Stella ihre Tochter. Ihre Besuche in das heimische Taupatiti hatte Holly nun schon seit Studienbeginn vor zwei Jahren auf ein Minimum reduziert. Nur für die Weihnachtswoche kam sie ihrer Mutter zuliebe noch immer nach Hause. Doch das letzte Mal hatte sie kurzfristig abgesagt, obwohl sie im letzten Semester überraschend an die Musikhochschule nach Wellington gewechselt war. Nun trennte sie nur die Cook Strait, jene Meerenge zwischen der Süd- und der Nordinsel. Die Fähre von Picton nach Wellington benötigte drei Stunden, sodass sie einander auch nur mal für ein Wochenende hätten treffen können. Jedenfalls theoretisch, denn merkwürdigerweise hatte Holly ihre Mutter noch nicht einmal dazu eingeladen, ihre neue Wohnung zu besichtigen, und hatte sie auch noch nicht auf Taupatiti besucht.
Stella war allerdings nicht der Mensch, der ohne ausdrückliche Einladung bei ihrer Tochter vor der Tür stand. Immer wenn sie sich insgeheim fragte, warum ihr Kontakt trotz der Nähe weniger statt mehr geworden war, schob sie das auf die Umstellung, die ein Hochschulwechsel für Holly mit sich brachte. Je mehr sich ihre geliebte Tochter in ihrem Leben rarmachte, desto enger wurde Stellas Verhältnis zu ihren »Kriegerinnen«. Die jungen Frauen sahen ein positives Mutterbild in ihr, denn bei Sorgen und Problemen aller Art konnten sie sich an Stella wenden, die ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stand.
Stellas liebste Kriegerin Ani, die ihr wegen ihrer außergewöhnlich brutalen Vorgeschichte besonders ans Herz gewachsen und für sie zu einer Ersatztochter geworden war, hatte zu Stellas großer Freude das Angebot, als ihre Haushaltshilfe zu arbeiten, angenommen. Besonders zum Kochen reichte Stellas Kapazität nämlich nicht aus. Sie hatte sich vornehmlich von Sandwiches und Süßigkeiten ernährt, die sie nebenbei hatte verzehren können. Dass das nicht gesund war, wusste sie, und als Ani ihr vorgeschlagen hatte, ihr täglich ein warmes spätes Mittagessen zuzubereiten, hatte sie erst zögernd zugestimmt, konnte sich dieses Ritual aber inzwischen kaum mehr aus ihrem Alltag wegdenken. Weil sie nun mit dem Essen und einer kleinen Auszeit auf ihrer Terrasse am Tag eine Stunde Pause machte, hatte sie das Gefühl, mehr Kraft als vorher zu besitzen, und die benötigte sie dringend. Sie war unermüdlich mit ihren Geschäften um Muscheln oder Schnecken beschäftigt, denn der Export ihrer Produkte florierte.
Sie hatte diverse hochkarätige Partner, die ihr die Grünlippmuscheln abnahmen. Nicht nur Großmärkte oder Restaurants gehörten zu ihren Kunden, auch die Hersteller von Pulvern, die aus der neuseeländischen Miesmuschel gewonnen wurden, rissen sich um ihre Produkte. Inzwischen wurden die Grünschalmuscheln nicht nur für Menschen zu diversen Ernährungszusatzstoffen verarbeitet, sondern auch Haustierbesitzer schworen auf die positive Wirkung des Pulvers für den Bewegungsapparat ihrer Lieblinge. Auch die prächtigen Abalonen oder Seeopale, wie die Paua-Schnecken ebenfalls genannt wurden, fanden reißenden Absatz. Neben Goldschmieden und Kunsthandwerker-Manufakturen verlangten auch spezielle Restaurants nur nach Meerohren von der Insel Taupatiti. Stella war unter den Betreibern der Paua-Muschel-Aquakulturen ein Unikum. Die Konkurrenten arbeiteten in industriellen Ausmaßen, weil sich die teuren Anlagen sonst gar nicht lohnten und die Nachfrage nach dem Fleisch der Schnecke auf dem ostasiatischen Markt dramatisch gestiegen war. Bis vor nicht allzu langer Zeit hatten nur wenige Neuseeländer überhaupt jemals von diesem Exportschlager gekostet, weil die Schmackhaftigkeit besonders der großen weißen Füße der Schnecken ihnen nicht bekannt war. Da Paua-Schnecken in freier Wildbahn Gefahr liefen, überfischt zu werden, herrschten diesbezüglich strenge Regeln und es waren immer mehr dieser industriellen Exportfarmen entstanden.
Diesem Trend, die Schnecken nach Asien zu exportieren, widersetzte sich Stella hartnäckig. Sie belieferte ausschließlich einheimische Großhandelsunternehmen und Restaurants, die das Fleisch der Paua-Schnecke neuerdings als Delikatesse auf ihre Speisekarten genommen hatten. Auf diese Weise machte sie zwar nicht solch lukrative Massengeschäfte wie ihre Konkurrenten, aber im Inland wurde für ihre exquisite Ware auch gern mal mehr gezahlt, sodass sich dieser Alleingang für Stella allemal auszahlte, zumal sie nicht zuletzt dadurch immer wieder lobend in der Presse erwähnt wurde. Als lokale Berühmtheit musste sie häufig Interviews geben, auch in diversen Talkshows, was ihr allerdings nicht sonderlich schwerfiel. Sie war kein weltfremder, eigenbrötlerischer weiblicher Inselschrat, wie die Leute, die sie zum ersten Mal sahen, schnell irrtümlich vermuteten. Nein, sie hatte nie aufgehört, sich nach getaner Arbeit weiterzubilden. Ihre Bibliothek war legendär. Und wenn sie wollte, konnte sie sich sogar in eine äußerst elegante Erscheinung verwandeln. Das Problem war nur, dass ihr nach dieser Verkleidung kaum je der Sinn stand.
Stella hatte jedenfalls alle Hände voll zu tun, und der Gedanke daran, wie sie dem früher vorwiegend lokal bekannten und geschätzten Unternehmen ein gewisses internationales Flair verschafft hatte, erfüllte sie mit Stolz, denn so klar ihr Verkaufskonzept bei den Paua-Schnecken auf Neuseeland bezogen war, lieferte sie Mengen an Grünschalmuscheln in alle Welt.
Das alles ging Stella durch den Kopf, nachdem sie vom Steg abgelegt hatte und die Insel an Steuerbord umrundete. Sie hatte nun schon ihr gesamtes bisheriges Leben auf dieser Insel verbracht, aber sie konnte sich immer noch wie ein Kind freuen, wenn sie ihren Blick auf die weißen Sandstrände und das dahinter beginnende, dichte und undurchdringliche Grün des Regenwaldes richtete. Dabei ging ihr jedes Mal das Herz auf, und ein Gefühl von tiefer Zufriedenheit durchströmte sie. Immer wenn sie daran dachte, dass sie einst ernsthaft mit dem Gedanken gespielt hatte, ihr Land für immer zu verlassen, schob sie das auf ihr damals noch jugendliches Alter, denn sie gehörte zu dieser Insel wie die üppige grüne Vegetation, die malerischen Badebuchten, das weiße Herrenhaus und das türkisfarbige Wasser, das die Insel umgab.
2.
Als Stella die andere Seite der Insel mit der Bucht, in der sich das noch im Tiefschlaf liegende Frauenhaus befand, erreicht hatte, waren es nur noch weniger als zehn Minuten Fahrt zur Muschelfarm, die sie bereits an Backbord in der Sonne aufblitzen sah. Aufgeregt näherte sie sich ihrer »Muschelplantage«, wie sie die Aquakultur bisweilen zu bezeichnen pflegte, denn in ein paar Wochen stand der Erntetag bevor, an dem sie die Muscheln, die nun fünfzehn bis achtzehn Monate lang gereift waren, ernten konnte. Dazu sollten sie aber mindestens 10 Zentimeter groß sein. Besser noch waren die Prachtexemplare von 25 Zentimetern. Stella wusste, dass es völlig unnötig war, die Muscheln jeden Morgen so gründlich zu überprüfen, denn was sollte ihnen schon geschehen, außer dass sie nicht jene Größe erreichten, die zum erfolgreichen Verkauf erforderlich war? Und auch das war höchst unwahrscheinlich, denn Stellas Muscheln sprengten eher die Norm, als dass sie zu winzig blieben. Stella war sehr stolz darauf, dass ihre Muscheln unter allen Produkten der Konkurrenz als die schmackhaftesten und reinsten galten. Dabei arbeitete auch keiner der anderen Züchter mit künstlichen Futterstoffen oder gar Pestiziden, denn die Marlborough Sounds genossen den Ruf, das sauberste Wasser überhaupt zu besitzen. Nein, diese Inspektion war nicht unbedingt notwendig, aber Stella liebte dieses Ritual. Andere gingen morgens joggen, sie machte einen Ausflug zu ihrer Muschelzucht.
Am liebsten hätte sie nach getaner Arbeit auch noch am Steg der »Paua-Bucht« angelegt, aber ihre »Kriegerinnen« hatten eines Tages dagegen aufbegehrt, dass der Boss jeden Tag zu nachtschlafender Zeit mit Getöse auf der Anlage einfiel und jede Schnecke kontrollierte. Das wäre ihr Job, hatten sie ihrer übereifrigen Chefin vorgehalten und mit ihr ausgehandelt, dass es völlig ausreichen würde, wenn sie nur einmal die Woche vorbeikäme oder falls die Mitarbeiterinnen sie ausdrücklich um Hilfe baten. Stella hatte sich widerwillig auf diesen Deal eingelassen. Trotzdem konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, mit dem Boot ganz nahe an die Außentanks heranzufahren, um einen flüchtigen Blick zu riskieren, auch wenn sie sich auf diese Weise nicht wirklich von dem aktuellen Zustand der Schnecken würde überzeugen können. Sie konnte auch nicht umhin, neugierig zum Haus zu schielen, ob sich da nicht endlich etwas rührte. Wenn sie es richtig erinnerte, stand an diesem Tag eine wichtige Lieferung nach Auckland an.
Seufzend steuerte sie nun auf die Grünlippmuschel-Zucht zu, bis diese zum Greifen nahe war. Dort angekommen, stoppte sie das Boot und setzte den Anker. Als das Boot fest war, ging sie nach vorne zum Bug, setzte sich und genoss den malerischen Blick, den sie von hier auf Taupatiti hatte.
Obwohl Stella jeden entlegenen Flecken ihrer Insel kannte, beinahe jeden Baum und jeden Strauch, betrachtete sie ihre Insel immer wieder mit verwundertem Blick. Wer sich wohl so viel Schönheit ausgedacht haben mochte, fragte sich Stella und war überzeugt, dass sie in dem malerischsten Ort der Welt zu Hause war. Dass der Pelorus Sound ein unwirkliches Paradies war, hatte sie häufig aus den Mündern der begeisterten Touristen aus aller Welt gehört, die sich ihrer ganz speziellen Führung anvertraut hatten. Als Schülerin hatte sie sich nämlich das Geld für einen Führerschein durch Touristentörns auf ihrem Segelboot verdient. Sie hatte jeweils über ein Wochenende sechs Gäste an Bord genommen und sie durch die Meeresarme geschippert. Höhepunkt war dann stets das Übernachten in Zelten an dem einsamsten Strand von Taupatiti, zu dem man nur von der Wasserseite gelangen konnte, gewesen. Dort hatte sie jedes Mal ein feines Barbecue gezaubert. Ihre Gäste waren stets so begeistert gewesen, dass sie allein von den Trinkgeldern ihren Führerschein hätte bezahlen können. Aber ihr hatte es auch selbst großes Vergnügen bereitet, mit interessanten Menschen aus aller Welt zusammenzukommen und ihnen voller Stolz ihre Welt zu präsentieren.
Sie hatte immer Glück gehabt mit den Touristen. Wenn sie da nur an den Kunstgeschichteprofessor aus Paris dachte. Bis zu seinem Tod vor ein paar Jahren hatte er ihr jedes Jahr ein besonderes Buch geschickt. Und dann war da der Spross einer reichen englischen Kaufhauskette, der sich geweigert hatte, sein Erbe anzutreten, sondern seiner Leidenschaft, der Musik, gefolgt war. Ach, Oliver, durchzuckte es Stella kurz, und sie bemühte sich, wie immer, wenn ihr der Mann ihres Lebens in den Sinn kam, schnell an etwas anderes zu denken. Ja, ihre Führungen durch die Marlborough Sounds waren schon etwas ganz Besonderes gewesen. Ihre Mutter hatte diese Touren mit den Fremden an Bord gar nicht gern gesehen, aber sie hatte ihren Protest auf ein Minimum beschränkt, weil sie geahnt hatte, dass es sinnlos gewesen wäre, Stella davon abzuhalten. Stella hatte schon damals ihren eigenen Kopf gehabt. Nur die Macht der Ahnen war einst stärker als ihr unbeugsamer Willen gewesen.
Ein Schatten fiel über Stellas sonnengebräuntes Gesicht, das trotz ihrer Antipathie gegen Faltencremes und des ständigen Einflusses von Wind, Salzwasser und Sonne nicht gegerbt wirkte. Im Gegenteil, sie hatte die zugleich feinporige und widerstandsfähige Haut ihres Vaters geerbt, der kaum eine Falte besessen hatte. Jedenfalls bis zu dem Tag, an dem Stella ihn zum letzten Mal gesehen hatte. In ihrer Erinnerung würde er immer ein junger, attraktiver blonder Hüne bleiben. Sie dachte auch heute noch mit einer gewissen Zärtlichkeit an ihn, obwohl er die Insel kurz nach Stellas vierzehntem Geburtstag ohne Abschied auf Nimmerwiedersehen verlassen hatte. Sie würde nie vergessen, wie er ihr damals noch eine neue Jolle geschenkt und sie gebeten hatte, das Boot »Daniel« zu nennen. Stella hatte das ein wenig albern gefunden, denn das war der Name ihres Vaters. Doch in seinem Blick hatte so etwas Flehendes gelegen, dass sie seinem Wunsch schließlich nachgekommen war. Ihre Mutter hatte das mit einem verächtlichen Naserümpfen kommentiert und ihren Mann einen »eitlen Pfau« genannt. Komisch, daran erinnerte Stella sich heute noch wörtlich und auch an den waidwunden Blick ihres Vaters, der auch an jenem Tag garantiert schon morgens an der Whiskyflasche genippt hatte. Das jedenfalls warf ihm ihre Mutter stets derart lauthals vor, dass es jeder mitbekam.
Stella hätte sich jedes Mal vor Peinlichkeit winden mögen, wenn ihre Mutter diese Schwäche des Vaters so öffentlich verhandelt hatte. Der Mutter war es jedenfalls völlig gleichgültig gewesen, ob Stella oder eine der Hausangestellten in der Nähe gewesen waren. Ihr Vater war dann stets wie ein geprügelter Hund im Dickicht des Inseldschungels verschwunden, während ihre Mutter ihm so etwas Gemeines wie »Versager!« hinterhergerufen hatte.
Obwohl sich Stella schon als Kind keine Illusionen darüber gemacht hatte, dass ihr Vater womöglich das Zeug zu einem Helden haben könnte, hatte sie ihn von ganzem Herzen geliebt. Vielleicht war diese Liebe auch mit einer gewissen Portion Mitleid vermischt gewesen, denn ihre Empathie hatte immer ihm gegolten, nie ihrer Mutter, die bis zum Umfallen geschuftet hatte, weil sie alle geschäftlichen Dinge allein bewerkstelligen musste. Dass ihre Mutter die Familie in Wirklichkeit zusammengehalten hatte, war Stella viel später bewusst worden, aber da war die Mutter längst tot gewesen, sodass sie sie nicht mehr um Verzeihung für ihre kritiklose Parteinahme zugunsten des Vaters hatte bitten können. Aber als Vierzehnjährige hatte sie nur Augen für sein Wohl gehabt, wohingegen die ständige Gereiztheit und Erschöpfung ihrer Mutter sie kaltgelassen hatte. Ihr war nur wichtig gewesen, ob es dem Vater gut ging. Wie erleichtert war sie gewesen, dass er sich, jedes Mal, wenn er zu später Stunde von seinem Inselgang zurückgekehrt war, in wesentlich beschwingterer Stimmung befunden hatte als zuvor. Stella hatte dabei nichts beschönigt, sondern schon als Kind vermutet, dass er in einer der Hütten ein Depot an Whiskyflaschen hortete. Doch sie hatte es ihm nicht übel nehmen können, erlebte sie doch hautnah mit, wie er ständig von ihrer Mutter gedemütigt wurde.
Das mit dem Whisky-Vorrat war eine Vermutung, die sich Jahre später bewahrheiten sollte, als Stella die Hütten hatte abreißen lassen, um für den Bau des Frauenhauses Platz zu schaffen. Aber nicht nur einen Vorrat an Alkohol hatte Stella dort vorgefunden, sondern auch Reste eines Matratzenlagers am Boden, bei dessen Anblick sich Stella die Frage aufgedrängt hatte, ob es nur der Whisky gewesen war, der bei ihrem Vater damals derart stimmungsaufhellend gewirkt hatte, oder auch die heimliche Gesellschaft von Marike, dem bildhübschen Hausmädchen ihrer Mutter. Denn ganz dunkel nur entsann sie sich, dass ihre Mutter die junge Frau einen Tag, bevor ihr Vater verschwunden war, mit Schimpf und Schande an die Luft gesetzt hatte. Als Moana bemerkt hatte, dass ihre Tochter dem Streit lauschte, hatte sie die Tür geschlossen und die Stimme gesenkt.
Damals hatte Stella keinen Zusammenhang zwischen Marikes Rauswurf und dem Verschwinden ihres Vaters hergestellt. Dazu war sie viel zu entsetzt über den Fortgang ihres heiß geliebten Vaters gewesen und wäre nicht im Traum darauf gekommen, auch nur einen Gedanken an die Frage zu verschwenden, warum ihre Mutter Marike noch laut brüllend mit den Worten: »Verschwinde und lass dich nie wieder hier sehen!« ein Bündel Kleider hinterhergeworfen hatte. Jedenfalls hatte Stella nie aufgehört, ihre Boote »Daniel« zu nennen. Bis jetzt.
Zurzeit besaß sie nur eine ebenfalls nach ihrem geliebten Vater benannte Zehn-Meter-Motorjacht von Alloy Cats, die eigentlich viel zu groß war für ihre Zwecke, aber dafür hatte sie ihr Segelboot abgeschafft, weil sie nicht mehr dazu kam, entsprechende Touren zum reinen Vergnügen zu machen. Früher hatte sie in ihrer Freizeit gern abenteuerliche Törns unternommen und unter anderem auch die Cook Strait bis Wellington durchsegelt, aber für solche Unternehmungen fehlte ihr schon lange die Zeit.
Wie oft hatte Stella nach seiner Flucht wartend am Strand vor dem Haus gesessen und auf die andere Seite des Sounds gestarrt in der Hoffnung, ihr Vater würde gleich auf einer Jacht mit schneeweißen Segeln zurückkehren. Und später dann hatte sich diese Hoffnung auf ihren Liebsten übertragen. Es hatten im Laufe der folgenden Jahre viele Boote am Steg von Taupatiti angelegt, aber ihr Vater war niemals an Bord gewesen … und auch nicht ihr Geliebter.
Gedankenverloren zog Stella eine Leine aus dem Wasser, an der die Muscheln wie Perlen auf einer Schnur befestigt waren. Sie brauchte kein Zentimetermaß, um die Größe der Prachtstücke zu bestimmen. Es gab kaum eine Muschel, die nicht weit über 20 Zentimeter groß war. Zeit zum Abernten, dachte sie und nahm sich vor, diese Arbeit am Wochenende zu erledigen. Dazu würde sie sich ein paar Helfer aus Havelock besorgen.
Dann holte sie sich aus einer Tasche im Cockpit ihre mitgebrachte Thermoskanne mit Kaffee und ein mit Tomate belegtes Toastbrot und ließ sich wieder auf ihrem Lieblingsplatz am Bug nieder. Cora legte sich neben sie. Auch dieses Ritual hatte seine Tradition. Stella liebte es, an Bord ihres Bootes einen Kaffee zu trinken und sich zu stärken. Und das mit einem Blick über ihre Muschelfarm auf der einen Seite und die Rückseite ihrer Insel auf der anderen. Das war ein Luxus, der unbezahlbar war. Coras gieriger Blick störte sie zwar ein wenig beim Essen, aber auch für den Hund war gesorgt. Sie gab ihr ein Leckerli, während sie bereits wieder an ihre Zeit als viel beschäftigte Reiseführerin dachte.