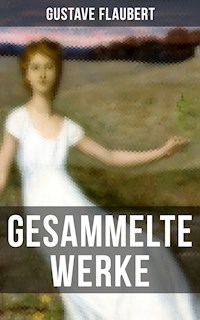Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Witzig, romantisch, bösartig – Gustave Flauberts erster Roman in neuer Übersetzung Ein junger Bursche beobachtet unter den Sommergästen in Trouville eine Frau, die ihn fasziniert. Als er ihren Bademantel vor der Flut rettet und zurückbringt, verliebt er sich auf der Stelle. Maria jedoch ist zehn Jahre älter als er, hat einen Mann und eine kleine Tochter. Mit ungeheurer Leidenschaft erzählt der junge Flaubert in seinem ersten Roman die eigene Geschichte, die ihn für ein Leben geprägt hat. In der Neuübersetzung von Elisabeth Edl, mit Jugendbriefen und einem Kommentar, der den biografischen Hintergrund farbig sichtbar macht, sind die „Memoiren eines Irren“ das Selbstporträt eines Künstlers als junger Mann, der zu seinem 200. Geburtstag als einer der Größten gefeiert wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn einer sich mit fünfzehn in eine erwachsene Frau verliebt, dann wird die Liebe nur umso größer, denn sie ist vollkommen aussichtslos. Davon erzählt Gustave Flaubert in den Memoiren eines Irren: »Sie enthalten eine ganze Seele – ist es die meine, ist es die eines anderen? Ich wollte zunächst einen intimen Roman schreiben, in dem die Skepsis vorangetrieben sein sollte bis an die äußersten Grenzen der Verzweiflung, doch allmählich, beim Schreiben, drang das persönliche Gefühl durch die Geschichte hindurch, die Seele bewegte die Feder und zermalmte sie.«
Der junge Flaubert wird zum Autor, er verwandelt seine romantische Verzweiflung in diesen ersten Roman, doch dann hält er das Manuskript das ganze Leben lang versteckt. In der Neuübersetzung von Elisabeth Edl, mit Jugendbriefen und einem Kommentar, der den biografischen Hintergrund farbig sichtbar macht, liest man die Memoiren eines Irren als das früheste Werk eines Schriftstellers, der dann mit Madame Bovary den Roman revolutionieren wird.
Gustave Flaubert
MEMOIREN EINES IRREN
Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl
Mit einem Nachwort von Wolfgang Matz
Carl Hanser Verlag
INHALT
MEMOIREN EINES IRREN
BRIEFE DES JUNGEN FLAUBERT
ANHANG
Nachwort
Zur Ausgabe
Zeittafel
Anmerkungen
MEMOIREN EINES IRREN
In dieser Jahreszeit, da man sich Geschenke zu machen pflegt, gibt man Gold, drückt einander die Hände. – Ich aber gebe dir meine Gedanken; trauriges Geschenk! Nimm sie – sie gehören dir wie mein Herz.
GVE FLAUBERT.
4. Januar 1839.
Dir, lieber Alfred, sind diese Seiten gewidmet und geschenkt.
Sie enthalten eine ganze Seele – ist es die meine, ist es die eines anderen? Ich wollte zunächst einen intimen Roman schreiben, in dem die Skepsis vorangetrieben sein sollte bis an die äußersten Grenzen der Verzweiflung, doch allmählich, beim Schreiben, drang das persönliche Gefühl durch die Geschichte hindurch, die Seele bewegte die Feder und zermalmte sie.
Also belasse ich das alles lieber im Geheimnis der Mutmaßungen – du allerdings wirst keine anstellen.
Bloß magst du vielleicht an so mancher Stelle glauben, die Ausdrucksweise sei erkünstelt und das Bild nach Lust und Laune verdüstert. Vergiss nicht, ein Irrer hat diese Seiten geschrieben, und scheint das Wort das Gefühl, das es ausdrückt, häufig zu übersteigen, dann nur, weil es anderswo einknickte unter dem Gewicht des Herzens.
*
Adieu, denk an mich und für mich.
I.
Warum diese Seiten schreiben? – Wozu sind sie gut? – Was weiß ich selbst davon? Meines Erachtens ist es ziemlich dumm, die Menschen nach dem Beweggrund für ihr Handeln und ihr Schreiben zu fragen. – Wissen Sie’s denn selbst, warum haben Sie diese lumpigen Blätter aufgeschlagen, die eines Irren Hand füllen wird?
Ein Irrer. Das macht schaudern. Wer sind Sie, Sie, Leser? in welche Kategorie gehörst du, in die der Dummköpfe oder die der Irren? Wenn du die Wahl hättest, deine Eitelkeit entschiede sich doch für letzteren Zustand. Ja, noch einmal, wozu ist es gut, das frage ich wahrhaftig, ein Buch, das weder lehrreich ist noch amüsant, noch chemisch, noch philosophisch, noch agrikulturell, noch elegisch, ein Buch, das kein Mittel enthält, weder gegen Pickel noch gegen Flöhe, das weder von der Eisenbahn erzählt noch von der Börse, noch von den verborgensten Winkeln des menschlichen Herzens, noch von den Kleidern des Mittelalters, noch von Gott oder Teufel, sondern von einem Irren, das heißt von der Welt, diesem großen Einfaltspinsel, der sich seit so vielen Jahrhunderten dreht im Weltraum, ohne einen Schritt vorwärtszukommen, und der kreischt und der sabbert und der sich selbst zerfleischt.
Ich weiß nicht besser als Sie, was Sie lesen werden. Denn das hier ist weder ein Roman noch ein Drama mit festem Plan, oder einer einzigen wohlüberlegten Idee, mit Richtpunkten, damit das Denken sich auf schnurgeraden Wegen dahinschlängelt.
Aber ich will alles auf Papier bringen, was mir durch den Kopf geht, meine Ideen und meine Erinnerungen, meine Eindrücke meine Träume meine Launen, alles, was im Denken oder in der Seele auftaucht – Lachen und Weinen, Weiß und Schwarz, Schluchzer, zunächst dem Herzen entsprungen, dann ausgerollt wie Teig in klangvolle Perioden; – und Tränen, aufgelöst in romantischen Metaphern. Es bedrückt mich jedoch, wenn ich daran denke, ich werde einem Packen Federn die Spitze zerquetschen, ich werde ein Fläschchen Tinte verbrauchen, ich werde den Leser langweilen, und langweilen werde ich mich selbst. Ich habe mich so sehr ans Lachen gewöhnt und an die Skepsis, dass man von Anfang bis Ende beständig Spott finden wird; und fröhliche Leute, die gern lachen, können zu guter Letzt über den Autor lachen und über sich selbst.
Man wird hier sehen, wie an den Plan des Universums zu glauben ist, an die moralischen Pflichten des Menschen, an die Tugend und an die Philanthropie, ein Wort, das ich gern auf meine Stiefel schreiben lassen würde, wenn ich einmal welche habe, dann können es alle Leute lesen und auswendig lernen, selbst die kurzsichtigsten Augen, die kleinsten Leiber, die kriecherischsten, ganz nah an der Gosse.
Es wäre ein Fehler, in all dem hier etwas anderes zu sehen als die Nörgeleien eines armen Irren. Ein Irrer!
Und Sie, Leser – Sie haben vielleicht vor kurzem geheiratet oder Ihre Schulden bezahlt?
II.
Ich will also die Geschichte meines Lebens schreiben – was für ein Leben! Aber habe ich gelebt? ich bin jung, mein Gesicht hat keine einzige Falte – und mein Herz keine Leidenschaft. – Oh! wie ruhig war es, wie angenehm und glücklich scheint es, still und rein! Oh! ja, friedlich und verschwiegen wie ein Grab, dessen Seele der Leichnam wäre.
Kaum dass ich gelebt habe: ich habe die Welt noch gar nicht kennengelernt – das heißt, ich habe keine Geliebte, keine Schmeichler, keine Dienstboten, keine Equipagen – ich bin nicht (wie man so schön sagt) in die Gesellschaft eingetreten, denn sie dünkte mich immer falsch und laut und mit Flitter bedeckt, langweilig und aufgeblasen.
Nun, mein Leben, das sind nicht die Ereignisse. Mein Leben, das ist mein Denken.
Und wie sieht es aus, dieses Denken, das mich jetzt dazu bringt, in dem Alter, wo alle lächeln, sich glücklich fühlen, wo man heiratet, wo man liebt, in dem Alter, wo so viele andere sich berauschen an allen möglichen Liebschaften und allem möglichen Ruhm, während so viele Lichter glänzen und die Gläser angefüllt sind zum Fest, mich jetzt dazu bringt, dass ich allein bin und nackt, kalt gegenüber jeder Inspiration, jeder Poesie, mich sterben fühle und grausam lache über meine langsame Agonie, wie jener Epikureer, der sich die Adern öffnen ließ, sich in ein duftendes Bad legte und lachend starb wie ein Mann, der betrunken eine Orgie verlässt, die ihn erschöpft hat.
Oh! wie lang hat es gedauert, dieses Denken! Wie eine Hydra verschlang es mich mit jedem einzelnen Haupt.
Denken voll Trauer und voll Bitterkeit, Denken eines Narren, der weint, Denken eines Philosophen, der meditiert …
Oh! ja, wie viele Stunden sind verstrichen in meinem Leben, lang und eintönig, mit Denken, mit Zweifeln! Wie viele Wintertage, mit gesenktem Kopf vor meinen im fahlen Glanz der untergehenden Sonne weiß gewordenen Holzscheiten, wie viele Sommerabende auf den dämmrigen Feldern in Betrachtung der Wolken, die dahinflogen und sich entfalteten, der Ähren, die sich beugten unterm Wind, im Horchen auf die säuselnden Wälder und im Lauschen auf die Natur, die seufzt in den Nächten.
Oh! wie verträumt war meine Kindheit, was war ich für ein armer Irrer, ohne feste Ideen, ohne fassbare Anschauungen! Ich betrachtete das Wasser, wie es dahinfließt zwischen Baumgruppen, die ihr Blätterhaar neigen und Blüten herabfallen lassen, ich beobachtete aus meiner Wiege heraus den Mond vor seinem azurnen Hintergrund, der in mein Zimmer schien und wunderliche Formen an die Wände zeichnete, ich geriet in Verzückung vor einer schönen Sonne oder einem Frühlingsmorgen mit seinem weißen Nebel, seinen in Blüte stehenden Bäumen, seinen blühenden Margeriten.
Gern betrachtete ich auch, und das ist eine meiner süßesten und köstlichsten Erinnerungen, das Meer, die Wellen, wenn sie übereinanderschäumten, die Woge, wenn sie heranbrandete als Gischt, über den Strand lief und kreischte bei ihrem Rückzug über Kieselsteine und Muscheln.
Ich rannte über die Felsen, ich nahm den Sand des Ozeans und ließ ihn verrinnen im Wind zwischen meinen Fingern, ich warf Seetang ins Wasser, ich atmete in vollen Zügen diese salzige und frische Luft des Ozeans, der in deine Seele dringt mit so viel Energie, Poetik und weiten Gedanken.
Ich betrachtete die Unermesslichkeit, den Raum, das Unendliche, und meine Seele versank im Angesicht dieses grenzenlosen Horizonts.
Oh! aber das ist er nicht, der grenzenlose Horizont! Der unermessliche Schlund. Oh! nein, ein breiterer und tieferer Abgrund tat sich vor mir auf. Dieser Schlund kennt keinen Sturm: Gäbe es einen Sturm, dann wäre er voll – und er ist leer!
Ich war fröhlich und heiter, liebte das Leben und meine Mutter, arme Mutter!
Ich erinnere mich noch an meine kleinen Freuden, wenn ich die Pferde auf der Straße dahinlaufen sah, wenn ich den Dampf ihres Atems sah und den Schweiß über ihr Geschirr tropfen, ich liebte den gleichförmigen und rhythmischen Trab, der die Hängeriemen schwingen lässt; und dann, wenn wir anhielten – alles war still auf den Feldern. Man sah den Dampf aus ihren Nüstern strömen, der durchgerüttelte Wagen kam auf seiner Federung wieder zur Ruhe, der Wind pfiff gegen die Scheiben, und das war alles …
Oh! wie weit habe ich die Augen aufgerissen angesichts der Menge in Festkleidern, fröhlich, lärmend mit ihrem Geschrei, stürmisches Menschenmeer, wütender noch als das Unwetter und dümmer als sein Toben.
Ich liebte die Karren die Pferde die Armeen die Kriegsgewänder den Trommelwirbel, den Lärm das Pulver und die Kanonen, die über das Pflaster der Städte ratterten.
Als Kind liebte ich, was man sieht, als Heranwachsender, was man spürt, als Mann liebe ich gar nichts mehr. Und dennoch, wie viele Dinge habe ich in der Seele, wie viele innere Kräfte und wie viele Ozeane der Wut und der Liebe prallen aufeinander, branden gegeneinander in diesem Herzen, das so schwach ist, so lahm so tief gestürzt so überdrüssig so erschöpft!
Man sagt mir, ich solle mich wieder dem Leben zuwenden, mich unter die Menge mischen! … doch wie kann der abgebrochene Ast Früchte tragen, das von den Winden losgerissene und durch den Staub getriebene Blatt erneut grünen? und warum, so jung, so viel Bitterkeit? Was weiß ich? Es war vielleicht in meinem Schicksal bestimmt, so zu leben, überdrüssig, bevor ich die Last trug, außer Atem, bevor ich gerannt war. ...........
Ich habe gelesen, ich habe gelernt in der Hitze der Begeisterung … ich habe geschrieben … Oh! wie glücklich war ich damals, wie hoch hinaus entschwebte in seinem Wahn mein Denken in jene den Menschen unbekannten Gefilde, wo es weder Welt gibt noch Planeten, noch Sonnen! Ich hatte eine unermesslichere Unendlichkeit, wenn das möglich ist, als die Unendlichkeit Gottes, wo die Poesie sich wiegte und ihre Flügel ausspannte in einer Atmosphäre der Liebe und der Verzückung, und dann musste ich aus diesen erhabnen Gefilden wieder herabsteigen zu den Wörtern, und wie soll man durch Sprache diese Harmonie wiedergeben, die aufsteigt im Herzen des Dichters, und die Gedanken eines Riesen, die alle Sätze verbiegen, so, wie eine starke und kraftstrotzende Hand den Handschuh sprengt, der sie umschließt?
Auch hier wieder Enttäuschung, denn wir berühren die Erde, jene Erde aus Eis, wo jedes Feuer stirbt, wo jede Energie erschlafft. Über welche Sprossen hinabsteigen aus dem Unendlichen ins Tatsächliche? Über welche Stufen gleitet das Denken herab, ohne dass es zerbricht? Wie macht man diesen Riesen klein, der die Unendlichkeit überschaut?
Da hatte ich Augenblicke der Traurigkeit und der Verzweiflung, ich spürte meine Kraft, die mich zerbrach, und diese Schwäche, für die ich mich schämte – denn die Sprache ist nur fernes und abgeschwächtes Echo des Denkens. Ich verfluchte meine teuersten Träume und meine stillen Stunden, verbracht an der Grenze zur Schöpfung. Ich spürte etwas Leeres und Unersättliches, das mich verzehrte.
Der Poesie überdrüssig, stürzte ich mich ins Feld der Meditation.
Ich entflammte zunächst für jenes beeindruckende Studium, das sich den Menschen zum Ziel setzt und ihn sich erklären will, das sogar Hypothesen zerlegt und über die abstraktesten Vermutungen diskutiert und die leersten Wörter geometrisch betrachtet.
Der Mensch, von unbekannter Hand in die Unendlichkeit geworfenes Sandkorn, armes Insekt mit schwachen Beinchen, das sich, dem Abgrund nah, an jedem Zweig festhalten will, das sich an die Tugend hängt, an die Liebe, an den Egoismus, an den Ehrgeiz, und das aus alledem Tugenden macht, um sich besser daran festhalten zu können, das sich an Gott klammert und das immer schwächer wird, loslässt und fällt. .............
Mensch, der verstehen will, was nicht ist, und eine Wissenschaft machen will aus dem Nichts; Mensch, nach dem Abbild Gottes geschaffene Seele, deren erhabenes Genie bei einem Grashalm verweilt und das Problem eines Sandkorns nicht zu überwinden vermag.
Und mich packte der Überdruss, ich zweifelte schließlich an allem. Obwohl jung, war ich alt, mein Herz hatte Runzeln, und sah ich noch lebhafte Greise, voll Begeisterung und Zuversicht, dann lachte ich bitter über mich selbst, so jung, so enttäuscht vom Leben, von der Liebe, vom Ruhm, von Gott, von allem, was ist, von allem, was sein kann. Mich überkam jedoch ein natürliches Grauen, bevor ich diesen Glauben ans Nichts wählte. Am Rande des Abgrunds schloss ich die Augen – ich fiel.
Ich war froh, den Sturz musste ich nun nicht mehr machen, ich war kühl und ruhig wie der Stein auf einem Grab – ich glaubte das Glück zu finden im Zweifel, verrückt wie ich war! Man rollt dort in unfassbarer Leere.
Diese Leere ist unermesslich, und es stehen einem vor Grauen die Haare zu Berge, wenn man sich dem Rand nähert.
Vom Zweifel an Gott kam ich schließlich zum Zweifel an der Tugend, eine zerbrechliche Idee, die jedes Jahrhundert, so gut es konnte, auf das Gerüst der Gesetze stellte, aber das ist noch wackliger.
Ich werde Ihnen später alle Phasen dieses trübsinnigen und meditativen Lebens erzählen, das ich mit verschränkten Armen neben dem Kaminfeuer verbrachte, mit einem ewigen Gähnen der Langeweile – allein, einen ganzen Tag lang – und von Zeit zu Zeit einen Blick werfend auf den Schnee der Nachbardächer, auf die untergehende Sonne mit ihren bleichen Lichtstrahlen, auf die Fliesen meines Zimmers oder auf einen vergilbten Totenkopf, zahnlückig und unaufhörlich grimassierend auf meinem Kamin, Symbol des Lebens und wie dieses kalt und spöttisch.
Später werden Sie vielleicht etwas lesen von all den Ängsten dieses Herzens, so geschlagen, so betrübt durch Bitterkeit. Sie werden von den Abenteuern dieses Lebens erfahren, so friedlich und so banal, so voll mit Gefühlen, so leer an Ereignissen.
Und dann werden Sie mir sagen, ob nicht alles Hohn und Spott ist, ob nicht alles, was man in den Schulen singt, alles, was man in Büchern ausbreitet, alles, was man sieht, spürt, erzählt, ob alles, was existiert...................................................
Ich fahre nicht fort, zu groß ist die Bitterkeit, es auszusprechen – na gut! wenn all das zuletzt nicht bloß Mitleid ist, blauer Dunst, Nichts!
III.
Ich war bereits mit zehn Jahren im Collège und bekam dort frühzeitig eine tiefe Abneigung gegen die Menschen – diese Gesellschaft von Kindern ist genauso grausam zu ihren Opfern wie die andere kleine Gesellschaft – die der Menschen. –
Dieselbe Ungerechtigkeit der Menge, dieselbe Tyrannei der Vorurteile und der Stärke, derselbe Egoismus, was auch immer gesagt wurde über Selbstlosigkeit und Treue der Jugend. Jugend – Alter von Irrsinn und Träumen, von Poesie und Dummheit, Synonyme im Mund der Leute, die in gesunder Weise urteilen über die Welt. Ich wurde dort in all meinen Vorlieben verletzt – im Unterricht wegen meiner Ideen, in der Pause wegen meiner Neigung zu ungeselliger Einsamkeit.
Von da an war ich ein Irrer.
Ich lebte dort also allein und gelangweilt, schikaniert von meinen Lehrern, verspottet von meinen Kameraden. Ich hatte einen spöttischen und unabhängigen Charakter, und meine ätzende und zynische Ironie verschonte die Laune eines Einzelnen genauso wenig wie den Despotismus aller.
Ich sehe mich noch auf der Schulbank sitzen, versunken in meine Zukunftsträume, mit den Gedanken beim Erhabensten, das sich die Phantasie eines Dichters und eines Kindes erträumen kann, während der Pädagoge sich lustig machte über meine lateinischen Verse, meine Kameraden mich feixend beobachteten. Diese Einfaltspinsel, über mich lachten sie! sie, so schwach, so gewöhnlich, mit ihrem so kleinen Hirn – ich, dessen Geist sich verlor an den Grenzen zur Schöpfung, ich, der hinabtauchte in alle Welten der Poesie, der sich größer fühlte als sie alle, der maßlose Freuden empfing und himmlische Verzückungen genoss angesichts all der geheimen Offenbarungen meiner Seele.
Ich, der sich groß fühlte wie die Welt und den ein einziger meiner Gedanken, wäre er aus Feuer gewesen wie der Blitz, zu Staub gemacht hätte. Armer Irrer!
Ich sah mich als jungen Mann, mit zwanzig, in Ruhm gehüllt, ich träumte von fernen Reisen in südliche Landstriche, ich sah den Orient und seine unermesslichen Sandwüsten, seine Paläste, die Kamele darin mit ihren bronzenen Glöckchen, ich sah edle Stuten davonstürmen in Richtung des sonnengeröteten Horizonts, ich sah blaue Wogen, einen klaren Himmel, silbrigen Sand, ich roch den Duft dieser lauen Ozeane des Südens, und dann, neben mir, unter einem Zelt im Schatten einer breitblättrigen Aloe, eine Frau mit bräunlicher Haut, feurigem Blick, die mich umschlang mit beiden Armen und in der Sprache der Huris zu mir redete.
Die Sonne sank herab in den Sand, Kamel- und Pferdestuten schliefen, das Insekt schwirrte um ihre Zitzen, der Abendwind streifte uns – und nach Einbruch der Nacht, als der Silbermond seine fahlen Blicke auf die Wüste warf, als die Sterne funkelten in diesem azurnen Himmel, da träumte mir in der Stille dieser warmen, duftenden Nacht von endloser Seligkeit, von himmlischen Wonnen.
Und wieder war es der Ruhm mit seinem Applaus, seinen Fanfaren hinauf zum Himmel, seinen Lorbeerkränzen, seinem in die Winde geworfenen Goldstaub – es war ein gleißendes Theater mit festlich geschmückten Frauen, Diamanten im Licht, schwüler Luft, keuchenden Brüsten –, dann andächtiges Schweigen, Worte, verschlingend wie Feuer, Weinen, Lachen, Schluchzer, der Rausch des Ruhms – Begeisterungsschreie, das Scharren der Menge. Was! – Eitelkeit, Lärm, Nichts.
Als Kind träumte ich von der Liebe – als junger Mann vom Ruhm – als Mann vom Grab, der letzten Liebe all jener, die keine mehr haben.
Ich erblickte auch die uralte Epoche der Jahrhunderte, die nicht mehr sind, und der Geschlechter, die unterm Gras liegen, ich sah die Schar der Pilger und Krieger in Richtung Kalvarienberg ziehen, in der Wüste haltmachen, vor Hunger sterben, diesen Gott anflehen, nach dem sie suchten, und ihrer Blasphemien überdrüssig, immer weiterziehen in Richtung jenes grenzenlosen Horizonts, – dann erschöpft, keuchend, endlich ankommen am Ende ihrer Reise, verzweifelt und alt, bloß um dann ein paar dürre Steine zu küssen, Huldigung der ganzen Welt; – ich sah die Reiter dahinsprengen auf Pferden, eisenbedeckt wie sie, und die Lanzenstöße in den Turnieren, und die Zugbrücke herabsinken, um den Lehnsherrn zu empfangen, der heimkehrt mit seinem geröteten Schwert und Gefangenen auf den Kruppen seiner Pferde; nachts wiederum in der dunklen Kathedrale, das ganze Kirchenschiff geschmückt mit einer Girlande von Völkern, die emporsteigen zum Gewölbe auf den Galerien, mit Gesängen, Lichtern, die schimmern auf den bunten Fenstern, und in der Christnacht die ganze Altstadt mit ihren schneebedeckten Spitzdächern erstrahlen und singen. –
Doch vor allem liebte ich Rom – das kaiserliche Rom, diese schöne Königin, die sich in Orgien wälzt, ihre edlen Kleider beschmutzt mit dem Wein der Ausschweifung, stolzer auf ihre Laster als auf ihre Tugenden, – Nero – Nero mit seinen diamantenen Streitwagen, die durch die Arena fliegen, mit seinen tausend Wagen, seinen Liebschaften eines Tigers und seinen Festmahlen eines Riesen. – Fern des klassisch-humanistischen Unterrichts versetzte ich mich zurück in deine maßlosen Begierden, deine blutigen Illuminationen, deine Vergnügungen, die Rom niederbrennen.
Und eingelullt in diese diffusen Phantastereien, diese Träumereien über die Zukunft, hinfortgetragen von diesem abenteuerlichen Denken, das ausbrach gleich einer zügellosen Rassestute, die über Bäche springt, Berge erklimmt und durch den Raum fliegt – so verharrte ich stundenlang, den Kopf in die Hände gestützt, und starrte auf den Fußboden meines Arbeitssaals oder auf eine Spinne, die ihr Netz webte über dem Katheder unseres Lehrers – und wenn ich mit weit aufgerissenen Augen erwachte, dann lachten sie über mich – den Faulsten von allen, der niemals eine fassbare Idee haben würde, der keinerlei Neigung zeigte zu irgendeinem Beruf, der nutzlos sein würde in dieser Welt, wo jeder sich seinen Anteil vom Kuchen holen muss, und der niemals zu irgendwas taugen würde, allerhöchstens zum Narren, zum Bärenführer oder Büchermacher.
(Obwohl von ausgezeichneter Gesundheit, hatte meine durch das Leben, das ich führte, und durch den Umgang mit den anderen ständig verletzte Geisteshaltung in mir eine nervöse Reizung hervorgerufen, die mich jähzornig und aufbrausend machte wie den Stier, krank von Insektenstichen. – Ich hatte grässliche Träume, Alpträume.)
Oh! diese traurige und verdrießliche Zeit! Ich sehe mich noch allein durch die langen geweißten Flure meines Collèges irren und schauen, und schauen, wie die Eulen und Krähen davonflogen aus dem Dachgestühl der Kapelle; oder ich lauschte, in diesen trübsinnigen Schlafsälen liegend, erleuchtet von einer Lampe, deren Öl nachts gefror, ganz lange dem Wind, der unheimlich durch die endlosen leeren Gemächer heulte und in den Türschlössern pfiff, die Glasscheiben in ihren Rahmen zum Zittern brachte, ich hörte die Schritte des Nachtwächters, der gemächlich mit seiner Laterne die Kontrollrunde ging, und wenn er in meine Nähe kam, stellte ich mich schlafend, und tatsächlich, ich schlief ein, halb in Träumen, halb in Tränen.
(............
.................)
IV.
Es waren schauerliche Visionen, die irre machten vor Angst.
Ich lag im Haus meines Vaters, alle Möbel waren erhalten, doch alles, was mich umgab, hatte eine schwarze Tönung; es war eine Winternacht, und der Schnee warf weißes Licht in mein Zimmer – plötzlich schmolz der Schnee, und das Gras und die Bäume bekamen eine rostrote und verbrannte Tönung, als erhellte ein Feuer meine Fenster. Ich hörte das Geräusch von Schritten – jemand kam die Treppe hoch – heiße Luft, ekliger Dunst drang bis zu mir – meine Tür öffnete sich ganz von allein. Sie kamen herein, es waren viele – vielleicht sieben bis acht, ich hatte keine Zeit, sie zu zählen. Sie waren klein oder groß, bedeckt mit struppigen schwarzen Bärten – ohne Waffen, doch alle hatten sie eine Stahlklinge zwischen den Zähnen, und als sie im Kreis näher an meine Wiege herankamen, klapperten ihre Zähne, und das war schaurig; sie zogen meine weißen Vorhänge beiseite, und jeder Finger hinterließ eine Blutspur; sie betrachteten mich mit großen starren und lidlosen Augen. Ich betrachtete sie ebenfalls, – ich konnte mich kein bisschen rühren – ich wollte schreien.
Dann war mir, als würde sich das Haus aus seinen Grundmauern lösen, als hätte ein Hebel es hochgehoben.
So betrachteten sie mich lange, dann traten sie zurück, und ich sah, dass bei allen eine Gesichtshälfte keine Haut hatte und langsam blutete. –
Sie hoben alle meine Kleider hoch, und auf allen war Blut. – Sie begannen zu essen, und aus dem Brot, das sie brachen, rann Blut, das Tropfen um Tropfen herabfiel; und nun lachten sie, wie das Röcheln eines Sterbenden.
Dann, als sie nicht mehr da waren, trug alles, was sie berührt hatten, Wandtäfelung, Treppe, Fußboden, ihre roten Spuren.
Ich hatte einen bitteren Geschmack im Herzen. Mir war, als hätte ich Fleisch gegessen. Und ich hörte einen langgezogenen Schrei, heiser, gellend, und die Fenster und Türen öffneten sich langsam, und der Wind machte sie schlagen und kreischen, wie ein seltsames Lied, und jeder einzelne Laut zerfetzte mir die Brust mit einem Stilett.
Anderswo, da war eine grüne Landschaft, blumengeschmückt, entlang eines Flusses; ich war in Begleitung meiner Mutter, die auf der Uferseite ging – sie fiel. – Ich sah das Wasser schäumen, Kreise immer größer werden und plötzlich verschwinden. – Das Wasser strömte weiter, und dann hörte ich nur noch das Rauschen des Wassers, das hindurchfloss zwischen den Binsen und die Schilfrohre bog.
Plötzlich rief meine Mutter nach mir: »Zu Hilfe, zu Hilfe! o mein armes Kind, zu Hilfe, hilf mir!«
Ich beugte mich, im Gras auf dem Bauch liegend, um nachzuschauen, ich sah nichts; die Schreie erklangen weiter. –
Eine unbezwingbare Kraft hielt mich fest – auf der Erde – und ich hörte die Schreie: »Ich ertrinke, ich ertrinke, zu Hilfe!«
Das Wasser strömte, strömte klar dahin, und diese Stimme, die ich hörte, vom Grund des Flusses, stürzte mich in Verzweiflung und Zorn …
V.
So also war ich – ein sorgloser Träumer mit eigenwilligem und spöttischem Wesen, erbaute mir ein Schicksal und träumte von der ganzen Poesie eines Lebens voller Liebe; – zehrte auch von meinen Erinnerungen, soweit man mit sechzehn welche haben kann.
Das Collège war mir unsympathisch. Man könnte eine interessante Untersuchung anstellen über die tiefe Abneigung, die edle und erhabene Seelen sogleich zu erkennen geben im Umgang und in der Berührung mit Menschen. Stets verhasst war mir ein geregeltes Leben, festgelegte Stunden, ein Leben nach der Uhr, wo das Denken aufhört mit der Glocke, wo alles im voraus arrangiert ist für Jahrhunderte und Generationen. Diese Regelmäßigkeit mag den meisten zusagen, doch für das arme Kind, das sich von Poesie ernährt, von Träumen und Schimären, das an die Liebe denkt und all die Albernheiten, heißt das, es ständig aufwecken aus diesem erlesenen Traum, ihm keinen Augenblick der Ruhe gönnen, ihm den Atem nehmen, indem man es zurückholt in unser Klima des Materialismus und gesunden Hausverstands, vor dem ihm graut und ekelt.
Ich stellte mich abseits mit einem Gedichtband, einem Roman – Poesie, irgendetwas, das dieses Herz eines jungen Mannes aufwühlen sollte, unberührt von Gefühlen und so gierig danach.
Ich erinnere mich, mit welchem Genuss ich damals die Seiten von Byron verschlang und den Werther, mit welcher Begeisterung las ich Hamlet, Romeo und die leidenschaftlichsten Schriften unserer Zeit, all jene Werke schließlich, welche die Seele vor Wonne zum Schmelzen bringen oder sie verbrennen in lauter Entzücken.
Ich ernährte mich also von dieser herben Poesie des Nordens, die so schön widerhallt, gleich den Wellen des Meeres, in den Werken Byrons. Oft merkte ich mir ganze Passagen beim ersten Lesen und wiederholte sie mir wie ein Lied, das einen bezaubert hat und dessen Melodie einen nicht mehr loslässt. Wie oft habe ich mir nicht den Anfang des Giaur vorgesagt: »Kein Hauch der Lüfte« … oder aus Childe Harold: »Einst in Albions Land« und »Ich liebte dich, o Meer«. Die Schalheit der französischen Übersetzung verschwand angesichts der bloßen Gedanken, als hätten diese einen eigenen Stil, ohne die Worte dazu.
Die glühende Leidenschaft, verbunden mit so tiefer Ironie, musste stark einwirken auf einen unberührten und feurigen Charakter. All diese der prunkvollen Würde klassischer Literaturen unbekannten Echos hatten für mich einen Duft der Neuheit, einen Reiz, der mich beständig hinzog zu dieser gewaltigen Poesie, die einen schwindeln macht und abstürzen lässt in den bodenlosen Schlund des Unendlichen.
Ich hatte mir also den Geschmack und das Herz verdorben, wie meine Lehrer sagten, und unter all den Gestalten mit so schändlichen Neigungen hatte meine geistige Unabhängigkeit mich als den Wüstesten von allen erachten lassen, ich war herabgesetzt auf die niedrigste Stufe durch die Überlegenheit selbst. Kaum dass man mir Phantasie zugestand, das heißt, ihrer Auffassung nach, eine Überspanntheit des Gehirns, verwandt mit dem Irrsinn.
Dergestalt war mein Eintritt in die Gesellschaft, und die Achtung, die ich mir dort zuzog.
VI.
Wenn man meinen Verstand und meine Grundsätze auch verleumdete, so sagte man doch nichts gegen mein Herz, denn damals war ich gut, und das Elend andrer rührte mich zu Tränen.
Ich erinnere mich, als kleines Kind gefiel es mir, meine Taschen zu leeren in die eines Armen, mit welchem Lächeln erwarteten sie mein Erscheinen, und welche Freude empfand ich meinerseits, ihnen Gutes zu tun. Dieses Wonnegefühl ist mir lange schon unbekannt – denn jetzt habe ich ein trockenes Herz, die Tränen sind vertrocknet. Doch wehe den Menschen, die mich verdorben und böse gemacht haben, obwohl ich einmal gut und rein war! Wehe dieser Dürre der Zivilisation, die alles austrocknet und auszehrt, was sich emporschwingt zur Sonne der Poesie und des Herzens! Diese alte, verdorbene Gesellschaft, die so viel verführt hat und so viel getrickst, dieser alte habgierige Jude wird an Marasmus und Erschöpfung sterben auf diesem Misthaufen, den er seine Schätze nennt, ohne Dichter, der seinen Tod besingt, ohne Priester, der ihm die Augen schließt, ohne Gold für sein Mausoleum, denn er wird alles aufgebraucht haben für seine Laster.
VII.
Wann endlich nimmt diese durch alle Ausschweifungen bastardierte Gesellschaft ein Ende, Ausschweifung des Geistes, des Körpers und der Seele?
Dann wird es gewiss eine Freude geben auf Erden, weil dieser verlogene und verheuchelte Vampir, den man Zivilisation nennt, nämlich stirbt. Ablegen wird man den Königsmantel, das Zepter, die Diamanten, verlassen den einstürzenden Palast, die fallende Stadt und sich zur Stute gesellen und zur Wölfin. Nachdem er sein Leben in Palästen verbracht und seine Füße auf dem Pflaster der Großstädte abgenutzt hat, wird der Mensch in den Wäldern sterben.
Die Erde wird ausgetrocknet sein durch die Feuersbrünste, die sie verbrannt haben, und ganz voll mit dem Staub der Kämpfe, der Hauch der Verwüstung, der über die Menschen geweht ist, wird über sie geweht sein, und sie wird nur noch bittere Früchte hergeben und dornige Rosen.
Und die Geschlechter werden erlöschen in der Wiege gleich vom Wind umgeworfenen Pflanzen, die sterben, bevor sie in Blüte standen.
Denn es wird wohl alles enden müssen und die Erde sich abnutzen, weil allzu viel herumgetrampelt wird auf ihr. Denn die Unermesslichkeit wird zuletzt dieses Sandkorns überdrüssig sein, das so viel Lärm macht und die Herrlichkeit des Nichts stört. Das Gold muss sich erschöpfen, weil es durch allzu viele Hände geht und alles verdirbt. Dieser Blutdunst muss doch abflauen, der Palast einstürzen unterm Gewicht der Reichtümer, die er birgt, die Orgie zu Ende gehen und alle Welt erwachen.
Geben wird es dann ein ungeheures Gelächter der Verzweiflung, wenn die Menschen diese Leere sehen, wenn es heißt, das Leben zu verlassen, für den Tod – für den Tod, der frisst, der stets Hunger hat. Und alles wird bersten, um zusammenzustürzen im Nichts – und der tugendhafte Mensch wird seine Tugend verfluchen, und das Laster wird in die Hände klatschen.
Ein paar auf dürrer Erde noch umherirrende Menschen werden sich gegenseitig rufen, sie werden aufeinander zugehen, und sie werden zurückweichen vor Grauen, entsetzt über sich selbst, und sie werden sterben. Was wird der Mensch dann sein, er, der jetzt schon blutdürstiger ist als die wilden Tiere und ruchloser als die Reptilien?
Jetzt ist es auf immer vorbei mit den Prachtwagen, mit Fanfaren und Posaunen, vorbei mit der Welt, mit diesen Palästen, mit diesen Mausoleen, mit den Wonnen des Verbrechens und den Freuden der Verderbnis; – der Stein wird plötzlich fallen, zermalmt von sich selbst, und darüber wird Gras wachsen. – Und die Paläste, die Tempel, die Pyramiden, die Säulen, Mausoleen des Königs, Sarg des Armen, Aas eines Hundes, alles wird auf gleicher Höhe sein unterm Rasen der Erde.
Dann wird das Meer ohne Dämme ruhig gegen die Ufer branden und seine Fluten ergießen über die noch rauchende Asche der Städte, die Bäume werden wachsen und grünen, ohne Hand, die sie bricht und zerschlägt, die Flüsse werden durch blumengeschmückte Wiesen strömen, die Natur wird frei sein, ohne Mensch, der sie bezwingt, und dieses Geschlecht wird erloschen sein, denn es war verflucht von Kindheit an.
.................................................................................................................................................................................... Traurige und seltsame Zeit, unsere Zeit, zu welchem Ozean fließt dieser Sturzbach aus Greueln? Wohin gehen wir in so tiefer Nacht? – Wer immer diese kranke Welt abtasten will, weicht rasch zurück, entsetzt über die Verderbnis, die wütet in ihrem Schoß.
Als Rom sich in Agonie liegen fühlte, hatte es wenigstens eine Hoffnung, es erahnte hinter dem Leichentuch das auf die Ewigkeit strahlende glanzvolle Kreuz. Diese Religion hat zweitausend Jahre durchgehalten, und nun ist sie erschöpft, genügt nicht mehr und wird verspottet; – nun verfallen ihre Kirchen, ihre Friedhöfe sind vollgestopft mit Toten und quellen über.
Und wir, welche Religion werden wir haben?
So alt sein, wie wir es sind, und noch immer durch die Wüste gehen, den Hebräern gleich, die aus Ägypten flohen!
Wo wird es sein, das Verheißene Land?