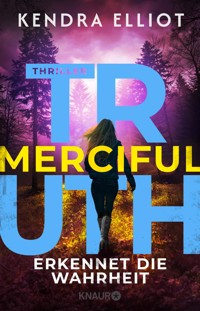
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Mercy Kilpatrick Serie
- Sprache: Deutsch
»Merciful Truth – Erkennet die Wahrheit« ist der 2. Romantik-Thriller um die toughe und erfahrene Überlebenskünstlerin Mercy Kilpatrick und den charmanten Polizeichef Truman Daly. Feuerprobe für FBI-Agentin Mercy Kilpatrick: Ihre Kindheit bei einer Prepper-Familie im ländlichen Oregon hat Mercy Kilpatrick auf jede Herausforderung vorbereitet – selbst auf den feindseligen Empfang bei ihrer Heimkehr. Aber die FBI-Agentin ist nicht die Einzige, die in Eagle's Nest für Unruhe sorgt: Eine ganze Reihe von Brandstiftungen endet schließlich tödlich, als zwei Sheriffs ermordet werden. Mercy unterstützt Polizeichef Truman Daly bei der Suche nach dem Brandstifter, der zum Mörder geworden ist. Dabei stoßen sie auf eine regierungsfeindliche Miliz, die dem Verdächtigen möglicherweise Unterschlupf gewährt. Jetzt sind Mercy und Truman erst recht fest entschlossen, den Killer auszuräuchern. Doch dann bringen ihre Ermittlungen ein schockierendes Geheimnis ans Licht. Wird die Jagd auf einen Wahnsinnigen zu ihrer eigenen Feuerprobe? Thriller meets Romance: eine echte Kämpferin mit geheimnisvoller Vergangenheit und ein Cop, der sie unbedingt beschützen will … Auch im 2. Band ihrer Thriller-Serie um Prepperin Mercy Kilpatrick begeistert Bestseller-Autorin Kendra Elliot mit spannenden Twists und einer Liebesgeschichte, die ihre ganz eigenen Tücken hat. Wie sich Mercy und Truman bei der Jagd auf einen Serienkiller kennenlernen, erfährst du im ersten Romantik-Thriller der Reihe, »Merciful Death – Erbarme dich ihrer«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kendra Elliot
Merciful Truth
Erkennet die Wahrheit
Thriller
Aus dem Englischen von Kerstin Fricke
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
FBI-Agentin Mercy Kilpatrick kann sich jeder Herausforderung stellen – sogar dem feindseligen Empfang in ihrer Heimatstadt Eagle's Nest. Als bei einer Reihe von Bränden zwei Sheriffs gezielt getötet werden, muss sie sich aber mit Polizeichef Truman Daly auf die Suche nach einem Brandstifter konzentrieren, der zum Mörder geworden ist.
Bald erfahren sie, dass der Täter sich möglicherweise bei einer regierungsfeindlichen Miliz versteckt, und sie sind fest entschlossen, ihn auszuräuchern. Doch ihre Ermittlungen bringen ein schockierendes Geheimnis ans Licht, und die Jagd nach dem Wahnsinnigen wird zu ihrer eigenen Feuerprobe ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreissig
Einunddreissig
Zweiunddreissig
Dank
Für Amelia.
Alles liegt in deiner Macht.
Eins
Polizeichef Truman Daly schlug die Tür seines Chevrolet Tahoe zu und hob eine Hand, um sein Gesicht vor der Hitze des Feuers zu schützen. Er machte einen halben Schritt nach hinten und stieß gegen seinen Wagen. Die alte Scheune war in Flammen gehüllt, die hoch in den schwarzen Nachthimmel aufloderten.
Da ist nichts mehr zu retten.
Er hatte geglaubt, in sicherer Entfernung vom Feuer geparkt zu haben, doch dass seine Wangen förmlich verbrannten, gab ihm zu denken.
Rasch zog er die Krempe seines Cowboyhuts herunter, um sein Gesicht zu schützen, ignorierte die in ihm aufkommenden Erinnerungen an ein früheres tödliches Feuer und lief auf die beiden Streifenwagen des Deschutes County-Sheriffs zu, die vor ihm eingetroffen waren. Die beiden Deputys standen hinter ihren Autos, sprachen in ihre Funkgeräte und beäugten die hoch aufragenden Flammen.
Es gab nichts, was sie tun konnten. In der Ferne jaulte leise eine Sirene, aber Truman wusste, dass die Feuerwehr zu spät kam. Ihr Ziel war es, ein Übergreifen des Feuers auf den Wald und die benachbarten Ranches zu verhindern.
»Hey, Chief«, rief einer der Deputys über das Getöse des Feuers hinweg und trat näher.
Truman erkannte den älteren Deputy. Ralph irgendwas. Den anderen Mann kannte er nicht.
»Haben Sie hier jemanden gesehen?«, fragte Truman, der wusste, dass sie die Scheune auf keinen Fall betreten konnten.
»Nein«, antwortete Ralph. »Wir sind seit fünfzehn Sekunden hier und hatten nicht die geringste Chance, einen Blick hineinzuwerfen.« Der junge Deputy neben ihm nickte nachdrücklich.
»Suchen wir die Umgebung ab«, sagte Truman.
»Sie gehen rechts um die Scheune herum und wir links«, schlug Ralph vor.
Truman nickte und näherte sich der Rückseite der brennenden Scheune, wobei er viel Platz zwischen sich und dem heißen Inferno ließ und die frische Novemberluft begrüßte. Das Feuer ist in den wenigen Sekunden, die ich hier bin, sehr viel größer geworden. In den letzten zwei Wochen hatte es in der Nähe seiner kleinen Stadt Eagle’s Nest in Central Oregon drei weitere Brände gegeben. Weder die Polizei noch die Feuerwehr hatten den Serienbrandstifter bisher erwischen können, und dies war das bisher verheerendste Feuer. Zuerst hatte ein verlassenes Auto gebrannt, danach eine Mülltonne. Zuletzt war es ein kleiner Schuppen gewesen.
Er eskaliert.
Der Schweiß lief ihm den Rücken hinunter, und das nicht nur vom Feuer. Ich hasse Brände. Er eilte zwischen den Salbeibüschen und Felsen hindurch und suchte auf dem gut beleuchteten Boden nach Hinweisen auf mögliche Opfer oder Brandbeschleuniger. Etwa fünfzig Meter entfernt ragten mehrere Gelbkiefern in die Höhe, und Truman war sehr dankbar dafür, dass es in unmittelbarer Umgebung der Scheune nichts Brennbares gab. Früher hatten dort ein paar kleine Gehege gestanden, deren Zäune jedoch im Laufe der Zeit zusammengebrochen und fast vollständig verrottet waren. Er bezweifelte, dass die alte Scheune in den letzten zehn Jahren benutzt worden war.
Dieses vierte Feuer brannte mehrere Kilometer außerhalb der Stadtgrenze, aber sobald man ihn benachrichtigt hatte, war er aus dem Bett gesprungen und hatte sich angezogen. Der Brandstifter machte ihn wütend, und Truman nahm nun jedes Feuer persönlich. Er konnte sich die Freude dieses Mistkerls überdeutlich vorstellen, der immer wieder die Polizei und Feuerwehr auf den Plan rief, um sein Werk zu löschen.
Eines Tages wird er jemanden verletzen.
Die Sirenen der Feuerwehrautos wurden lauter, und auf einmal übertönten zwei Schüsse das Getöse der Flammen.
Truman ließ sich auf den Bauch fallen und rollte sich hinter einen Felsen, zog dabei auch gleich seine Waffe. Wer schießt denn da? Er erstarrte, lauschte und versuchte, das Dröhnen in seinen Ohren zu ignorieren.
Zwei weitere Schüsse.
War das ein Schrei?
Mit rasendem Herzen wählte er den Notruf, meldete Schüsse und wies die Zentrale an, sofort die näher kommenden Feuerwehrfahrzeuge zu verständigen. Er beendete den Anruf und bewegte sich langsam aus seinem Versteck hinter dem Felsen heraus, hielt dabei allerdings die Augen nach dem Schützen offen. Wer hat da eben geschossen?
Die Officers aus Eagle’s Nest hatten bei den vorherigen Bränden nie jemanden am Tatort angetroffen. Warum ist es diesmal anders?
Truman setzte den Rundgang um die Scheune fort und behielt die Waffe im Anschlag und den Blick auf die Schatten des Geländes hinter der Scheune gerichtet. Das Licht der Flammen reichte noch einige Meter in die Dunkelheit hinein, aber jenseits davon war es stockdunkel. Dort konnte durchaus jemand unbemerkt lauern. Truman schlug einen etwas größeren Bogen, um die Schatten als Deckung zu nutzen.
Sein Hemd war schweißgetränkt, und seine Sinne waren in höchster Alarmbereitschaft, als er die Rückseite der Scheune umrundete und zwei reglose Gestalten auf dem Boden entdeckte.
Im flackernden Licht erkannte er die Uniformen des Deschutes County.
Bei Gott, bitte nicht!
Er verschmolz noch mehr mit der Dunkelheit und suchte überall angestrengt nach dem Schützen. Die Flammen ließen in alle Richtungen zuckende Schatten entstehen, und sein Blick huschte von einer falschen Bewegung zum nächsten irritierenden Schatten. Er verdrängte seine Angst, da er wusste, dass er nachsehen musste, ob die Officers noch am Leben waren, selbst wenn er sich dadurch in Gefahr brachte.
»Scheiß drauf.« Truman rannte über die freie Fläche, spürte, wie die Hitze sein Hemd versengte, und landete neben dem nächsten Körper auf den Knien. Er rüttelte an Ralphs Schulter, schrie und tastete an seinem Hals nach dem Puls. Der Officer hatte einen Kopfschuss erlitten, und Truman wandte den Blick ab, nachdem er die klaffende Austrittswunde an der Wange bemerkt hatte.
Ich sollte keine Zähne sehen können.
Er konnte keinen Puls finden.
Geduckt eilte er zum nächsten Officer. Aus dem Hals des jungen Deputys floss Blut, und sein verzweifelter Blick begegnete Trumans. Er hatte die Augen weit aufgerissen und bewegte hektisch die Lippen, ohne einen Ton von sich zu geben, während seine Arme und Beine ruhig dalagen. Anscheinend konnte der Deputy nur mit den Augen kommunizieren, und er war eindeutig verängstigt.
Eine Wirbelsäulenverletzung?
Er weiß, dass es schlecht um ihn steht.
Truman riss sich den Mantel vom Leib und drückte ihn auf die Wunde am Hals des Deputys. Die Feuerwehrfahrzeuge mit den großen Wassertanks kamen über die lange, zerfurchte Straße auf die Scheune zu, und Truman suchte seine Umgebung abermals nach dem Schützen ab.
Ich sitze hier wie auf dem Präsentierteller.
Aber er konnte den Deputy nicht einfach hier liegen lassen. Er schaute dem Mann direkt in die Augen. »Sie werden wieder gesund. Eben ist Hilfe eingetroffen.«
Der Mann blinzelte ihn an, hielt seinen Blick und schnappte nach Luft. Truman entdeckte sein Namensschild an seiner Uniformjacke. »Halten Sie durch, Deputy Sanderson. Sie schaffen das.«
Die Lippen des Mannes bewegten sich, und Truman beugte sich weiter zu ihm herunter, aber aus Sandersons Mund drang kein Laut. Truman ignorierte die zunehmende Hitze in seinem Rücken und zwang sich zu einem beruhigenden Lächeln. »Es wird alles gut.« Er blickte auf und war dankbar, dass sich zwei Feuerwehrmänner vorsichtig näherten, einen großen Bogen um das Feuer machten und die Umgebung sorgfältig absuchten.
Sie haben von dem Schützen erfahren.
Ein gewaltiger Luftstoß traf ihn von hinten, hob ihn hoch und schleuderte ihn an Deputy Sanderson vorbei. Er schlug mit dem Gesicht voran auf dem Boden auf, wobei ihm die Wucht den Atem raubte und sich Kies in seine Wange und seine Lippen bohrte. Erst dann erreichte ihn das Geräusch der Explosion und raubte ihm fünf Sekunden lang das Gehör. Er lag im Dreck, und seine Ohren klingelten, während er verzweifelt versuchte, sich zu orientieren. Ein alter Schrecken stieg aus den Tiefen seines Unterbewusstseins empor. Mühsam kämpfte er ihn nieder und machte eine mentale Bestandsaufnahme seines Körpers, wobei er den Sand ausspuckte.
Ich bin am Leben.
Sanderson.
Er stemmte sich auf die Hände und zitternden Knie und drehte sich um, damit er den verletzten Mann sehen konnte, über den er hinweggesegelt war.
Leere Augen starrten an ihm vorbei. Die Lippen bewegten sich nicht länger.
»Neiiiin!« Truman stürzte sich auf den Deputy und schüttelte ihn, doch der Mann hatte sein Leben ausgehaucht.
Das Feuer wütete weiter.
Am Morgen nach dem Brand starrte Special Agent Mercy Kilpatrick auf den rauchenden Haufen aus verbrannten Brettern. Die alte Scheune hatte keine Chance gehabt. Sie war schon zu Mercys Kindheit uralt, brüchig und trocken gewesen. Demzufolge wunderte es kaum, dass sie jetzt, zwei Jahrzehnte später, in Flammen aufgegangen war, als hätte man sie mit Benzin getränkt.
Eine Freundin aus Kindertagen hatte einst auf dieser Farm gelebt, und Mercy hatte viele Stunden damit verbracht, in der Scheune und auf dem umliegenden Gelände herumzustöbern, nach kleinen Tieren zu suchen und so zu tun, als sei die Scheune ihr Schloss. Nachdem ihre Freundin weggezogen war, hatte Mercy diesen Ort bis zum heutigen Tag nicht wieder aufgesucht.
Jetzt war sie FBI-Agentin und untersuchte den Mord an den beiden Officers. Und sie war eine sehr wütende FBI-Agentin. Dafür hatte die kaltblütige Ermordung ihrer in Blau gekleideten Kollegen gesorgt – und ebenso wie ihr ging es jeder anderen Person bei den Strafverfolgungsbehörden.
Wie gern hätte sie jetzt einfach wieder Prinzessin gespielt.
Wurde das Feuer bewusst gelegt, um die Deputys herzulocken?
Es gefiel ihr ganz und gar nicht, dass so etwas in ihrer Gemeinde passiert war.
Truman wäre beinahe getötet worden.
Sie erschauderte und verdrängte das Bild aus ihren Gedanken.
Unsere Beziehung hätte nach nur zwei Monaten abrupt enden können.
Mercy hatte Truman noch immer nicht gesehen. Sie hatte kurz mit ihm telefoniert und war erleichtert gewesen, seine Stimme zu hören, aber seit er um Mitternacht am Tatort eingetroffen war, hatte er eine Menge um die Ohren gehabt. Glücklicherweise hatte er nur einige leichte Verbrennungen erlitten. Am Vorabend war sie nach zwei Wochen Spezialtraining in Quantico um 22 Uhr auf dem Flughafen von Portland gelandet. Da sie nicht mitten in der Nacht nach Bend zurückfahren wollte, nachdem sie den ganzen Tag im Flieger gesessen hatte, war sie in ihrer Wohnung in Portland geblieben, die seit fast einem Monat zum Verkauf stand, ohne dass es bisher auch nur einen einzigen Interessenten gegeben hatte.
Verkäufermarkt, dass ich nicht lache!
Nach Trumans Anruf um 3 Uhr nachts war sie sofort aus dem Bett gesprungen und hatte die dreistündige Heimfahrt nach Central Oregon angetreten, denn die Nachrichten über das Feuer, die Schießerei und die Explosionen hatten sie jeglichen Gedanken an Schlaf vergessen lassen. Als sie in ihrer Wohnung ankam, rief auch schon ihr Chef aus dem kleinen FBI-Büro in Bend an.
Die beiden ermordeten County-Deputys hatten für sie nun oberste Priorität.
Während sie vor den Überresten des verheerenden Feuers stand, wehte ihr ein eisiger Wind unter den Kragen ihres schweren Mantels. Thanksgiving stand kurz bevor, und in Central Oregon lag schon seit einigen Wochen ein Hauch von Winter in der Luft. Sie hatte die ersten achtzehn Jahre ihres Lebens in der winzigen Gemeinde Eagle’s Nest verbracht, war aber erst hierher zurückgekehrt, als sie vorübergehend ins Büro in Bend versetzt und mit einem Fall von Inlandsterrorismus betraut worden war, nur um daraufhin festzustellen, dass sie das Leben auf der Ostseite der Cascade Mountains vermisst hatte. Vor weniger als zwei Monaten hatte sie beschlossen, aus dem feuchten Portland in die Hochwüste von Bend zu ziehen.
Das Leben in Central Oregon war anders als das Leben in Portland. Die Luft roch sauberer, es gab weitaus mehr schneebedeckte Berggipfel, dafür jedoch deutlich weniger Verkehr, auch wenn die Einheimischen das vielleicht anders sahen. Hier bewegte sich alles langsamer. Die Einwohner stellten eine bunte Mischung aus Familien, Rentnern, Ranchern, Farmern, Cowboys, Millennials und Geschäftsleuten dar. Je weiter man sich von der Hauptstadt Bend entfernte, desto dünner wurde die Besiedelung und auf desto mehr Rancher und Farmer traf man.
Manche Menschen zogen nach Central Oregon, um die Gesellschaft hinter sich zu lassen. Wenn man nicht wählerisch war, was die Lage anging, konnte man ein Stück abgelegenes Land zu einem sehr günstigen Preis erwerben. Einige wollten nach ihren eigenen Bedingungen leben, ohne sich in Bezug auf ihre Sicherheit oder ihre Lebensmittelversorgung auf die Regierung verlassen zu müssen. Manchmal wurden sie »Prepper« genannt oder mit schlimmeren Namen belegt. Mercy war in einer solchen Familie aufgewachsen. Ihre Eltern hatten sich einen autarken Lebensstil aufgebaut und sich die Bezeichnung Prepper zu eigen gemacht. Es war bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag ein gutes, bodenständiges Leben gewesen.
Nachdem Mercy Eagle’s Nest verlassen hatte, stellte sie fest, dass sie sich nicht völlig vom Prepper-Lebensstil lösen konnte, daher schuf sie sich einen Ausgleich, um sich ihre innere Ruhe zu bewahren. Während sie in Portland lebte und arbeitete, behielt sie einen abgelegenen, geheimen Rückzugsort bei und verbrachte die Wochenenden damit, ihre Hütte in Central Oregon einzurichten und aufzurüsten. Falls eine Katastrophe eintreten sollte, wäre sie vorbereitet.
Sie war immer vorbereitet.
Aber das ging niemanden etwas an. Nur Truman und einige ihrer Familienangehörigen wussten, dass sie in ihrer Freizeit wie eine Verrückte schuftete, um sich wegen möglicher zukünftiger Desaster keine Sorgen machen zu müssen. Ihre neuen Kollegen und sogar ihr engster Arbeitskollege Eddie hatten keine Ahnung, dass sie das vor ihnen verbarg, was sie als ihre »geheime Obsession« bezeichnete.
Es war ganz allein ihre Sache. Andere Menschen waren immer so voreingenommen. Sie hatte das ihr Leben lang erlebt und wollte nicht, dass man ihr so begegnete.
Außerdem konnte sie nicht allen aus ihrem Büro helfen, falls es zur Katastrophe kam und man sich an sie wandte, weil man von ihren Ressourcen wusste. Sie hielt es für schlauer, ihren »Reichtum« vor anderen zu verbergen. Ihre harte Arbeit war für sie selbst und ihre Familie bestimmt.
Sie bohrte die Stiefelspitze in den nassen Boden, der von den Tausenden Litern Wasser der Feuerwehr getränkt war, die sie hatte herbeischaffen müssen. In dieser ländlichen Gegend gab es nicht alle hundert Meter einen Hydranten, doch das Feuer hatte sich glücklicherweise nicht ausgebreitet. Hinter dem rauchenden Trümmerhaufen standen noch immer stolze Kiefern. Der normalerweise braune Boden sah schwarz und grau aus, weil das niedrige Gestrüpp verbrannt und eine dicke Schicht aus Ruß und Asche entstanden war.
Vor ihr arbeitete sich das Beweissicherungsteam des Countys unter den wachsamen Augen des Brandinspektors durch die Überreste der Scheune und suchte auch das umliegende Gelände gründlich ab. Bislang waren vier Gewehrpatronenhülsen gefunden worden, die Mercys Vorgesetzter Jeff Garrison sofort ans FBI-Labor anstatt an die überlasteten örtlichen Labore geschickt hatte.
Mercy hatte noch nie einen Fall bearbeitet, bei dem es um Brandermittlungen ging, und sie fühlte sich leicht fehl am Platze. Truman hatte mehrere Brandstiftungen in der Umgebung von Eagle’s Nest untersucht, wobei sich die erste ereignet hatte, kurz bevor sie wegen des Trainings zurück in den Osten geflogen war. Jemand hatte ein altes verlassenes Oldsmobile am Ende der Robinson Street in Brand gesteckt. Vor dem Feuer hatten die Anwohner nicht versucht, den Wagen abschleppen zu lassen, weil sie davon ausgingen, dass ihn irgendwann schon jemand abholen würde.
Truman hatte gelacht, als er Mercy gegenüber die Worte eines älteren Zeugen wiederholt hatte. »Ich möchte auf gar keinen Fall den Wagen von jemandem beschädigen. Das ist sein Transportmittel … vielleicht sogar sein Lebensunterhalt … Und ich will nicht, dass derjenige Ärger bekommt, weil ich den Abschleppdienst angerufen habe.«
Aus diesem Grund hatte der Wagen sechs Monate dort gestanden.
Auf dieser Seite der Bergkette bewiesen die Menschen weitaus mehr Geduld.
Truman war davon ausgegangen, dass gelangweilte Teenager den Wagen angesteckt hatten. Aber dann folgten zwei weitere Feuer, während Mercy im Osten weilte. Trumans Stimme hatte während ihrer nächtlichen Telefonate immer angespannter geklungen. Beim zweiten Mal brannte eine Mülltonne, und dann hatte der Brandstifter einen Schuppen voller Vorräte angezündet.
Mercy war sehr betrübt gewesen, als sie davon erfahren hatte. Der Schuppen gehörte einer jungen Familie, die sich große Mühe gegeben hatte, um Lebensmittel und Vorräte für die Zukunft zu lagern. Mercy wusste, wie viel Arbeit und Opfer es kostete, gut vorbereitet zu sein. Die Vorstellung, ein Feuer könnte die jahrelange Arbeit zerstören, ließ ein unangenehmes Gefühl in ihrer Magengrube entstehen. Jetzt fiel es der Familie schwer, sich in ihrem Haus sicher zu fühlen, denn sie fragte sich, ob man es gezielt auf sie abgesehen hatte.
»Bei den ersten beiden Vorfällen brannten Dinge, die nicht länger benötigt wurden«, hatte Truman zu ihr gesagt. »Aber dieses dritte Feuer galt der harten Arbeit einer Familie. Hoffentlich ist das nicht der Beginn eines neuen Trends.« In den letzten zwei Wochen hatte er sich in seiner gesamten Freizeit mit den Brandstiftungen befasst.
Niemand hatte erwartet, dass der Brandstifter bei seiner vierten Tat plötzlich einen Mord begehen würde. Nun hatte sich alles geändert.
Mercy starrte den aufgewühlten Boden an, auf dem die Leichen der Deputys gelegen hatten, und die dunklen Flecken, die sich dort weiterhin abzeichneten. Hat der Brandstifter geplant, jeden zu erschießen, der hier auftauchte? Oder hat er einfach nur die Flammen beobachtet und aus einer Laune heraus beschlossen zu schießen?
Ein Schuss konnte aus der Situation heraus fallen. Vier gezielte Schüsse waren hingegen geplant gewesen.
Jede seiner Kugeln hatte ihr Ziel getroffen.
Sie schluckte schwer und kämpfte gegen eine weitere Woge kochender Wut an. Beide Deputys hatten Familie. Deputy Sandersons Baby war gerade mal drei Monate alt.
Seine arme Frau. Ein Baby, das seinen Vater nie kennenlernen wird.
Sie beobachtete, wie sich der Brandinspektor über die Schulter eines Kriminaltechnikers beugte und auf etwas in dem Trümmerhaufen deutete. Die Holzteile sahen für Mercy alle gleich aus. Nass und verbrannt.
»Ich wünschte, ich wüsste, was er da sieht«, sagte Special Agent Eddie Peterson. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie er neben ihr stehen blieb, und die Anwesenheit ihres Lieblingsagenten hob ihre Stimmung sofort. Eddie hatte sich für die andere offene Stelle im FBI-Büro in Bend beworben und damit alle außer Darby Cowan überrascht, die als Intelligence Analyst bei ihnen arbeitete.
»Ich wusste, dass es Eddie hier gefällt«, hatte Darby selbstbewusst zu Mercy gesagt. »Ich habe gesehen, wie seine Augen geleuchtet haben, als er das erste Mal zum Fliegenfischen an den Fluss gefahren ist, und ich habe es in seiner Stimme gehört, als er über das Skifahren am Mount Bachelor sprach. Diese Gegend zieht Naturliebhaber in ihren Bann. Selbst wenn sie vorher nicht wussten, dass sie Naturliebhaber sind.«
Mercy wäre nie auf die Idee gekommen, Eddie als Naturliebhaber zu bezeichnen. Er war ein Stadtmensch, der ein bisschen zu sehr darauf achtete, wie er sich kleidete und frisierte. Aber seit er nach Bend gezogen war, hatte sie eine Seite an ihm entdeckt, die die Schönheit der Gegend zu schätzen wusste, und sie war froh, dass er hergezogen war. Für sie war er ein Stück Portland in Central Oregon. Ein kleines Bindeglied zu den guten Erinnerungen an die Großstadt. Er hatte scherzhaft vorgeschlagen, zusammen eine Wohnung zu mieten, aber Mercy brauchte ein eigenes Zuhause, schließlich musste sie sich um ihre Nichte im Teenageralter kümmern.
Kaylie war siebzehn und in ihrem letzten Jahr an der Highschool. Sie war ein Jahr alt gewesen, als ihre Mutter sie verließ, und ihr Vater war vor Kurzem gestorben. Es war sein letzter Wunsch gewesen, dass Mercy seine Tochter großzog. Mercy hatte dies nur widerwillig akzeptiert und sich wie in eine fremde Welt versetzt gefühlt. Teenagerangst, Freundinnendramen, Internetgefahren, Energydrinks und Promischwärmereien. Mercys Teenagerjahre hingegen waren von Rancharbeit und Seconhandklamotten geprägt gewesen.
»Wissen wir, wo der Schütze gestanden hat, als er auf die Officers schoss?«, fragte Eddie. Sein Blick war hart, seine sonst so heitere Miene spiegelte die Wut auf den Mörder wider.
»Sie haben die Patronenhülsen dort drüben gefunden.« Mercy zeigte auf eine Gruppe von Kiefern, die links der Scheune standen.
»Ist nicht wahr. Da kann aber jemand verdammt gut schießen.« Eddie fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Der Gedanke gefällt mir überhaupt nicht«, fügte er leise hinzu.
»So geht es wohl allen«, erwiderte Mercy. »Ich könnte das nicht, dabei bin ich eine ziemlich gute Schützin.«
»Du bist viel besser als ich«, gab Eddie zu.
»Ich bin mit Waffen aufgewachsen.« Mercy hatte das Kompliment schon von mehreren Agenten gehört, mit denen sie zusammenarbeitete. Doch das Schießen war nicht ihre Lieblingsbeschäftigung. Die meisten Agenten verbrachten sehr viel Zeit am Schreibtisch.
»Jeder hier draußen ist mit Waffen aufgewachsen«, stellte Eddie mit mürrischem Blick fest, und Mercy fragte sich, ob er seine Entscheidung, in diese Gegend zu ziehen, noch einmal überdachte. Der Agent war ihr enger Freund, aber er traf oft vorschnelle Entscheidungen. Seine Verdrießlichkeit erweckte in ihr häufig den Wunsch, ihm den Kopf zu tätscheln und ihm einen Cappuccino mit extra viel Schaum zu besorgen.
»Aber warum auf Leute schießen, die herkommen, um das Feuer zu löschen?«, fragte Mercy leise.
»Das ist es, was ich nicht verstehe.« Eddie wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Haufen aus verbranntem Holz zu. »Einige Bretter sehen aus wie Alligatorenhaut«, bemerkte er. »Ich habe mal irgendwo gelesen, dass eine entzündliche Flüssigkeit verwendet wurde, wenn diese Flecken groß und glänzend aussehen.«
»Das stimmt nicht«, widersprach der Brandinspektor, der sich zu den beiden Agents gesellte. »Das wird oft als Tatsache wiederholt, dabei ist dieses Aussehen nicht weiter von Bedeutung.« Er schüttelte den beiden Agents die Hand, die sich vorstellten. Bill Trek war mit seinen nicht einmal eins siebzig ein eher kleiner Mann, hatte jedoch eine breite Brust, und seine Stimme klang, als hätte er tausend Zigaretten geraucht. Oder als wäre er tausend Bränden ausgesetzt gewesen. Seine Augen waren von einem klaren Blau, und über den Ohren färbten sich seine Haare bereits grau. Truman hatte Mercy erzählt, dass Bill seit über vierzig Jahren in der Brandbekämpfung tätig war.
Sie mochte ihn auf Anhieb. »Was haben Sie für einen Ersteindruck?«
»Das war ein heißes Feuer«, antwortete er mit angedeutetem Lächeln. »Und ich konnte das Benzin riechen, sobald ich die Wagentür geöffnet hatte.«
Mercy und Eddie schnupperten sogleich, aber Mercy roch es nicht.
»Also definitiv Brandstiftung«, schlussfolgerte Eddie.
»Auf jeden Fall. Jemand hat verdammt viel Benzin benutzt. Es ist jetzt schon offensichtlich, dass mehrere Bereiche der Scheune damit getränkt wurden, und ich habe gerade erst mit den Ermittlungen angefangen.«
»Haben Sie die Ursache der Explosion gefunden?«, fragte Eddie.
»Ich kann Reste eines Propantanks sehen. Er ist unter den Trümmern begraben, aber das passt zur Beschreibung der Explosion.« Er blickte bedauernd auf den Holzstapel hinab. »Mir wurde mitgeteilt, dass der Besitzer keine Fotos vom vorherigen Zustand hat. Ich werde wohl nie erfahren, wie die Scheune mal aussah.«
Mercy schaute an dem rauchenden Haufen vorbei und konzentrierte sich auf das Bild in ihrem Kopf. »Sie war zweistöckig. Oben befand sich ein niedriger Speicher. Man konnte nur in der Mitte aufrecht stehen. Direkt über dem Doppeltor gab es eine riesige Öffnung. Und sie hatte Flügeltüren auf der Rückseite.«
Bill musterte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Dann waren Sie schon mal hier?«
»Ich habe als Kind darin gespielt, als sie noch jemandem gehörte.« Sie hielt inne. »Truman, der Polizeichef, sagte, dass das gesamte Gebäude in Flammen stand, als er hier ankam.« Sie ignorierte Eddies hochgezogene Augenbraue und versuchte, die richtigen Worte zu finden. »Können Sie abschätzen, wie lange die Scheune da schon gebrannt hat?«
Bill strich sich über das Kinn und dachte über ihre Frage nach. »Es gibt viele Faktoren, die da mit hineinspielen. Im Moment kann ich nicht einmal raten. Warum wollen Sie das wissen?«
»Ich musste an den anonymen Anrufer denken, der den Brand gemeldet hat«, erklärte Mercy. »Der Anruf kam von einem Münztelefon an einer Tankstelle, die sieben Kilometer von hier entfernt liegt. Ist jemand zufällig hier vorbeigekommen und hat den Brand gesehen, oder hat der Brandstifter das Feuer gelegt und vor dem Anruf so lange gewartet, bis es sich ausgebreitet hatte? Kam er dann zurück und wartete auf das Eintreffen der Officers? Ich denke hier nur laut, aber er könnte auch einfach nur zugesehen haben, wie es brannte, ohne sich darum zu kümmern, ob hier jemand auftaucht.«
»Feuerteufel beobachten gern die Reaktion der Einsatzkräfte«, erklärte Bill. »Ich habe im Laufe der Jahre genug von ihnen getroffen. Sie wirken wie ganz normale Leute, aber wenn man sie auf die Brände anspricht, bekommen sie ganz glasige Augen … als hätten sie gerade eine Glückspille geschluckt.«
»Haben Sie auch die letzten Brandstiftungen in Eagle’s Nest untersucht?«, erkundigte sich Mercy.
»Ich habe den abgebrannten Schuppen kurz gesehen.« Bill schüttelte den Kopf und schnalzte mitleidig mit der Zunge. »Das Paar tat mir leid, aber sie sind jung und werden bald wieder aufbauen, was sie verloren haben. Bedauerlicherweise hatten sie keine Versicherung abgeschlossen. Von dem verbrannten Oldsmobile und dem Feuer in der Mülltonne habe ich Fotos gesehen. Mein erster Gedanke waren die Kinder, aber man weiß nie.« Er drehte sich um und blickte zurück auf den rauchenden Trümmerhaufen. »Das hier war etwas anderes«, ergänzte er leise. »Vermutlich werden wir herausfinden, dass die Brandstiftung nur einen Teil seines Plans darstellte.«
Zwei
Truman fand Tilda Brass faszinierend. Er saß zusammen mit Special Agent Jeff Garrison im Wohnzimmer der Frau, um sie zu dem Brand zu befragen, da dieser auf ihrem Grundstück stattgefunden hatte. Die achtzigjährige Frau hatte ihnen in einer ausgeblichenen Herrenjeans und einem Jeanshemd, das mit einem halben Dutzend Sicherheitsnadeln geschlossen war, die Tür geöffnet. Ihre Gummistiefel sahen viel zu groß aus, um ihr richtig zu passen, dennoch bewegte sie sich würdevoll darin. Sie hatte langes graues Haar, und ihr Auftreten war das einer Dame aus der gehobenen Gesellschaft – was nicht zu ihrer Kleidung und ihren Stiefeln passen wollte.
Da er nur zwei Stunden geschlafen hatte, war Trumans frühmorgendlicher Adrenalinrausch schon vor Stunden abgeebbt. Die Sanitäter hatten ihm eine beruhigende Salbe auf die Verbrennungen an seinem Hals aufgetragen und sie dann verbunden, ihn vor einer Infektion gewarnt und ihm geraten, so bald wie möglich seinen Arzt aufzusuchen. Truman hatte keine Zeit. Er nahm ein paar Schmerztabletten und arbeitete weiter. Der Arztbesuch musste warten.
Jetzt setzte er einfach einen Fuß vor den anderen und war fest entschlossen, dem Geheimnis dieser Brandstiftungen auf den Grund zu gehen.
Mord.
Was mit lästigen Brandstiftungen angefangen hatte, war plötzlich zu einem Mord an zwei Polizisten geworden.
Deputy Damon Sanderson vom Deschutes County war sechsundzwanzig Jahre alt und seit zwei Jahren verheiratet. Seine Frau war zusammengebrochen, als sie von seinem Tod erfahren hatte. Seine drei Monate alte Tochter würde ihren Vater nur auf Fotos zu sehen bekommen.
Deputy Ralph Long vom Deschutes County war einundfünfzig und geschieden, hatte drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Truman hatte ihm einmal auf der Bowlingbahn ein Bier spendiert, nachdem seine Mannschaft gegen Ralphs verloren hatte.
Sobald am Vorabend gemeldet worden war, dass jemand am Brandort auf Polizisten geschossen hatte, machte sich jeder diensthabende Officer in einem Umkreis von fünfzig Kilometern auf den Weg zum Tatort. Da es sich um eine ländliche Gemeinde handelte, waren das zwei Trooper der Oregon State Police, drei weitere County-Deputys und zwei von Trumans Officers, die sich aus dem Bett schälten. Sie errichteten eine Absperrung, während die Feuerwehr das einstürzende Gebäude und das umliegende Gestrüpp mit dem Wasser aus ihren Fahrzeugen tränkte, und kümmerten sich dann um die ermordeten Männer.
Von dem Schützen gab es keine Spur.
Als die Sonne aufging, war Truman bereits vom County-Sheriff und von Jeff Garrison, dem leitenden FBI-Agenten aus Bend, befragt worden. Die ganze Nacht über hatte die Frustration unter seiner Haut gebrodelt. Er war ganz in der Nähe der Morde gewesen und hatte nichts gesehen, was den Ermittlern bei der Suche nach dem Schützen hätte helfen können.
Truman nahm benommen eine Tasse heißen Kaffee entgegen, auf dem Tilda bestanden hatte. Er trank einen Schluck und spürte, wie das heiße Getränk den Weg seine Speiseröhre hinab nahm, was ihn für einen Moment von dem Brennen an seinem Hals ablenkte. Seine Schmerzmittel gingen langsam zur Neige.
Er wusste nur dank Ina Smythe, die früher am Empfang des Polizeireviers gesessen hatte, überhaupt von Tilda, hatte die Frau allerdings nie getroffen oder gesehen. Ina sagte, Tilda käme nicht mehr so oft in die Stadt, aber sie würde sich per Telefon über das örtliche Geschehen auf dem Laufenden halten. Truman schloss daraus, dass Ina und Tilda häufiger Klatsch und Tratsch teilten.
»Sie wussten nichts von dem Feuer, bis einer der County-Deputys bei Ihnen vorbeikam?«, fragte Jeff die Frau.
»So ist es«, bestätigte Tilda und nahm einen Schluck Kaffee aus ihrer eleganten kleinen Tasse. Auf jeder ihrer Tassen prangte ein anderes Blumenbild, und die Ränder schienen einmal mit Gold … oder Goldfarbe bemalt gewesen zu sein. Truman hätte den Inhalt seiner winzigen Tasse in drei Schlucken austrinken können, aber er nahm noch einen kleinen Schluck, um sich nicht die Kehle zu verbrennen.
»Ich habe die Sirenen gehört«, fügte sie hinzu. »Aber ich habe sie nicht weiter beachtet. Die Scheune liegt nicht in der Nähe des Hauses. Ich hatte keine Ahnung, dass die Feuerwehrwagen dorthin unterwegs waren.«
»Wurde die Scheune für irgendetwas benutzt?«, erkundigte sich Jeff.
»Nein. Sie stand schon seit Jahren leer. Wir haben das Grundstück vor fast zwanzig Jahren gekauft. Mein verstorbener Mann«, sie bekreuzigte sich, »hat dort ein paar Dinge gelagert, aber es wurde nie Vieh darin gehalten. Außerdem war es aufgrund der Entfernung zum Haus sowieso nicht besonders praktisch. Heute bezahle ich nur noch dafür, dass das Gestrüpp rings um alle Nebengebäude beseitigt wird, falls es zu Waldbränden kommt.« Sie schüttelte ernst den Kopf. »Ich hätte mir nie träumen lassen, dass jemand absichtlich eins davon in Brand stecken würde.«
»Wissen Sie, ob in der Scheune ein Propantank gelagert wurde?«, fragte Jeff.
Tilda überlegte kurz. »Es würde mich nicht überraschen, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.«
»Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche Fremden auf Ihrem Grundstück gesehen, die dort nichts zu suchen hatten?«
»Nein, natürlich nicht. Charlie hält alle Eindringlinge fern. Sobald jemand das Grundstück betritt, bellt er wie ein Verrückter, und wenn das noch nicht reicht, hilft ein Blick auf seine Zähne.«
Truman schaute sich nach einem Hund um. »Hunde sind ausgezeichnete Alarmanlagen. Ist in der letzten Woche jemand an Ihre Tür gekommen? Wollte man Ihnen vielleicht etwas verkaufen?«
»Nein, das hat schon lange niemand mehr versucht. Früher kam regelmäßig eine Avon-Beraterin vorbei, aber sie ist vor einigen Jahren gestorben. Oh! Vor Kurzem war ein Mann hier und fragte, ob ich seinen Hund gesehen hätte. Er sagte, er sei weggelaufen, als sein Sohn die Tür offen ließ.«
»Und Ihr Hund hat ihn nicht verscheucht?«, fragte Jeff verwundert.
Tilda warf ihm einen irritierten Blick zu. »Ich habe seit Jahren keinen Hund mehr. Mein letzter Hund war Charlie. Das da drüben ist er.« Sie zeigte zum Kamin.
Truman entdeckte das Foto eines Deutschen Schäferhunds auf dem Kaminsims, und ein flaues Gefühl machte sich in seiner Magengrube breit. Vor einer Minute hat sie noch behauptet, der Hund wäre am Leben. Er stand auf und trat näher heran, um sich das Foto genauer anzusehen. Es war ziemlich verblasst, und Truman erkannte, dass es sich bei dem Auto im Hintergrund um einen Ford Mustang aus den Achtzigerjahren handelte. »Das ist ein schöner Hund«, sagte er und tauschte Blicke mit Jeff. Der FBI-Agent machte ein grimmiges Gesicht. Ihre Zeugin hatte gerade einen Großteil ihrer Glaubwürdigkeit eingebüßt.
»Ist das Haus noch auf andere Weise geschützt?« Truman warf einen langen Blick auf die Frau und fragte sich, ob sie wohl unter Demenz litt. Haben wir hier nur Zeit vergeudet? Erschöpfung kroch seine Wirbelsäule hinauf, und ihm drohten die Augen zuzufallen, während er Tildas Stimme lauschte.
»Ich habe noch die alten Gewehre meines Mannes. Ab und zu übe ich ein wenig damit, aber in letzter Zeit habe ich sie nicht benutzt.« Sie legte den Kopf schief. »Wenn diese lauten Teenager mit ihren Quads über mein Grundstück fahren, bin ich mit einem Gewehr in der Hand rausgegangen. Aber ich habe nie auf sie geschossen«, fügte sie schnell hinzu. »Sobald sie mich und das Gewehr sehen, drehen sie sofort wieder um.« Sie schniefte. »Sie haben überall Reifenspuren hinterlassen.«
»Wie lange ist das her?« Truman fragte sich, ob irgendeine ihrer Antworten zuverlässig war.
Tilda seufzte und trank einen Schluck. »Lassen Sie mich überlegen. Es war auf jeden Fall heiß, daher muss es Sommer gewesen sein.«
»Letzten Sommer?«, hakte er leise nach, war sich in Bezug auf ihr Zeitgefühl jedoch alles andere als sicher.
»Ja.« Sie nickte zuversichtlich.
»Ich würde mir Ihre Gewehre gern mal ansehen«, bat Jeff und erhob sich mit einem freundlichen Lächeln auf den Lippen.
Tilda stand sofort auf und führte sie durch einen schmalen Flur in ein Schlafzimmer. Sie bewegte sich flink, sodass Truman abermals Zweifel kamen, ob er sie richtig eingeschätzt hatte. Das Schlafzimmer duftete nach Lavendel, und er entdeckte einen getrockneten Strauß mit violetten Blüten neben dem Bett. Der Raum war sauber und luftig, aber eine dünne Staubschicht bedeckte die Nachttische und das Bettgestell. Tilda öffnete einen Schrank und zeigte ihnen ein Gestell mit fünf Waffen, die ebenfalls eingestaubt waren.
Truman schnüffelte und versuchte, den Geruch einer kürzlich abgefeuerten Waffe wahrzunehmen, doch ihm drang nur Lavendelduft in die Nase. Wenn eine von Tildas Waffen benutzt worden war, befand sie sich nicht in diesem Schrank. »Haben Sie noch andere?«, erkundigte er sich.
»Ich habe eine Pistole in der Nachttischschublade«, antwortete sie. »Man weiß ja nie, wer mitten in der Nacht auf einmal am Bett einer alten Dame auftaucht. Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt, aber manche Leute kommen nun mal auf dumme Ideen. Vor allem solche, die Drogen nehmen.« Das Wort »Drogen«flüsterte sie, während sie sich zu Truman und Jeff vorbeugte und sie mit ihren blassblauen Augen todernst ansah.
Truman musste sich ein Grinsen verkneifen und wünschte sich im Stillen mehr Schmerzmittel. Und sein Bett.
Mercy warf einen Blick auf die Uhr auf dem Armaturenbrett ihres Wagens und drückte das Gaspedal weiter durch.
Sie hatte ihren Chef um eine Stunde Zeit für eine persönliche Angelegenheit gebeten, denn sie musste ihre Nichte abholen. Kaylie hatte zwei Wochen bei ihrer Tante Pearl und einem Cousin verbracht, während Mercy das Training im Osten absolvierte. Mercy wusste durch häufige Telefonate, dass Kaylie am Ende war. Kaylie hatte jahrelang als Einzelkind bei ihrem Vater gelebt, und in der Zeit bei diesem lebhaften Cousin und der übermäßig fürsorglichen Tante war ihre Welt auf den Kopf gestellt worden. »Ich komme einfach nicht zur Ruhe«, hatte sie sich beschwert. »Jedes Mal, wenn ich Tante Pearl sage, dass ich allein sein möchte, fragt sie mich eine Stunde lang, ob es mir auch wirklich gut geht.«
Mercy hatte dafür vollstes Verständnis. Sie war ebenfalls gern allein. Aber Kaylies Vater war gerade erst ermordet worden, daher wollte Mercy die Siebzehnjährige nur ungern allein lassen. Pearl hatte ihr berichtet, dass das Mädchen zwar mehrmals geweint habe, es um die mentale Gesundheit des Teenagers ihrer Meinung nach aber gut bestellt war. Mercy hatte ihre Nichte nach Levis Tod zu einem Therapeuten geschickt und war froh darüber, dass Kaylie weiterhin alle zwei Wochen hinging.
Sie parkte vor dem ländlichen Haus ihrer Schwester und stieg aus ihrem Tahoe. Der Geruch aus den Schweineställen war nicht annähernd so intensiv wie zu Herbstanfang. Kaylie kam aus dem Haus und hatte sich einen Rucksack über eine Schulter gehängt. Sie umarmte ihre Tante und stürzte die Verandastufen hinunter. »Na, dann los«, sagte sie, während sie Mercy kurz umarmte und dann auf den Beifahrersitz hüpfte, offensichtlich begierig darauf, schnellstmöglich hier wegzukommen. Mercy blickte zurück zu Pearl, die sie von der Veranda aus beobachtete. Ihre Schwester hob grüßend eine Hand.
Mercys Beine waren wie erstarrt. Sie wollte auf ihre Schwester zugehen, um wenigstens kurz mit ihr zu sprechen, aber Pearls Handbewegung gab ihr zu verstehen, dass das nicht nötig war. Dann bin ich hier wohl fertig.
Es war nicht leicht gewesen, ihre Geschwister nach fünfzehn Jahren Abwesenheit neu kennenzulernen. Nachdem sich Mercy mit achtzehn mit ihrem Vater zerstritten hatte, war auch der Kontakt zum Rest ihrer Familie abgebrochen. Mercy hatte ihre Haltung bei diesem Streit nie bereut, es jedoch bedauert, so vieles im Leben ihrer Geschwister verpasst zu haben. Als sie vor zwei Monaten vorübergehend einen Fall in Eagle’s Nest übernehmen musste, war sie sehr besorgt gewesen, auf Menschen aus ihrer Vergangenheit zu treffen. Heute betrachtete sie diesen Fall vielmehr als Eingreifen des Schicksals, das ihr eine zweite Chance bei ihrer Familie geben wollte.
Nicht jedes Familienmitglied hatte ihre Rückkehr akzeptiert, aber Mercy war überzeugt davon, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickelten.
Pearl hatte sie am ersten Tag umarmt, danach aber Abstand gehalten. Telefonate waren die beste Möglichkeit, mit Pearl zu kommunizieren. Am Telefon wurde sie beinahe gesprächig. Owen, der Älteste von ihnen, weigerte sich immer noch, mit Mercy zu reden, und hielt seine Frau und seine Kinder ebenfalls davon ab.
Ihre andere Schwester Rose war so, wie Mercy sie immer gekannt hatte. Offen, herzlich und verständnisvoll. Ihre Liebe hielt Mercy bei Verstand und gab ihr die Hoffnung auf eine Art Beziehung zu ihren anderen Geschwistern. Mercy war noch keine Woche in der Stadt gewesen, als ein Serienmörder Rose entführte und folterte, und die Narben in ihrem Gesicht erinnerten sie nun ständig an diese Misshandlungen. Der Mörder war nach einer Reihe von Prepper-Morden in Central Oregon ins Visier des FBI geraten. Darüber hinaus war die blinde Rose nun im zweiten Monat schwanger mit dem Baby des Mannes, der bei der Festnahme erschossen worden war.
Levi. Wie immer beim Gedanken an ihren ermordeten Bruder schlug Mercys Herz schneller. Rose hatte überlebt, Levi jedoch nicht. Mercy würde sich wegen des Mordes an Levi immer ein bisschen mitschuldig fühlen. Der Tod seines Mörders durch ihre und Trumans Hand hatte ihr nicht viel Frieden geschenkt, den sie allerdings durch das Zusammenleben mit seiner Tochter fand. Sie hatte gelernt, für jeden Tag, den sie mit dieser lebendigen Erinnerung an Levi verbrachte, dankbar zu sein. Zu ihrer eigenen Überraschung hatte Mercy den Teenager während ihrer Abwesenheit sehr vermisst.
Sie wandte Pearl den Rücken zu und stieg in den Wagen. Kaylie schaltete sofort das Radio ein, sobald Mercy den Motor anließ. Das Mädchen drückte auf den Knöpfen herum, bis sie einen Song fand, der ihr gefiel. Mercy schnitt eine Grimasse und drehte die Musik leiser. Sie hatten eine Abmachung in Bezug auf das Autoradio getroffen und es so geregelt, dass Kaylie zwar den Sender auswählte, Mercy aber über die Lautstärke entscheiden konnte. Das war einer der vielen kleinen Kompromisse, die sie in ihrem ersten Monat des Zusammenlebens hatten finden müssen.
»Bereit, nach Hause zu fahren?«, fragte Mercy.
»Mehr als bereit.« Die Teenagerin umgriff ihr langes Haar und fasste es mit einem Band, das sie um ihr Handgelenk getragen hatte, oben auf dem Kopf zu einem Knoten zusammen. Ihr roter Nasenstecker funkelte im Sonnenlicht. »Ich glaube, das Café wird ganz gut laufen. Tante Pearl scheint Spaß daran zu haben.«
Mercy atmete erleichtert auf. Das Schicksal des Coffee Café ihres Bruders in Eagle’s Nest war Anlass für viele lange Gespräche zwischen ihr, Kaylie, Pearl und Truman gewesen. Mercy war davon ausgegangen, dass sie den niedlichen Laden verkaufen würden, aber Kaylies emotionale Bindung an das Café ihres Vaters, in dem sie seit ihrem zehnten Lebensjahr mitgearbeitet hatte, sorgte dafür, dass sie diese Pläne aufgaben. Dann war die Diskussion darüber aufgekommen, wer es leiten sollte. Kaylie hatte darauf bestanden, dass sie es allein machen konnte, was jedoch keinerlei Zustimmung fand. Schließlich hatte Pearl erklärt, durchaus Zeit dafür zu haben.
»Sie kann nun endlich die meisten Getränke zubereiten«, fügte Kaylie hinzu. »Und sie überlässt mir das Backen, so wie es sein sollte. Sie wollte diesen Teil echt gern übernehmen, aber das mache ich«, beharrte Kaylie. »Ich habe schließlich die meisten Rezepte selbst kreiert und die Speisekarte zusammengestellt. Da darf sie mir nicht reinpfuschen. Ich glaube, sie genießt auch den sozialen Teil des Cafés. Die meisten Kunden kannte sie schon, und sie unterhalten sich gerne mit ihr. Das ist wichtig.«
Mercy musterte ihre Nichte und freute sich über den zufriedenen Tonfall des Mädchens. Kaylie war pessimistisch gewesen, was die Beteiligung ihrer Tante am Erbe ihres Vaters anging, aber es schien, als hätten die beiden ein System gefunden, bei dem sie beide bekamen, was sie brauchten. »Ist Samuel im Laden eine große Hilfe?«
Kaylie seufzte laut bei der Erwähnung ihres Cousins. »Er ist in Ordnung. Allerdings muss man ihm ständig sagen, was er zu tun hat. Von allein sieht er es einfach nicht.«
Liegt das daran, dass er ein Junge oder dass er ein Teenager ist?
Mercy dachte daran, wie sie Kaylie dazu bringen musste, in der Wohnung Ordnung zu halten, also lag es wohl eher an Letzterem. Zum Glück war Kaylie ein Mädchen. Damit kannte sich Mercy aus, da sie ja selbst mal eins gewesen war und eine Vorstellung davon hatte, wie das Gehirn eines Mädchens funktionierte. Bei einem Jungen im Teenageralter hätte sie keine Ahnung gehabt, denn sie wusste nur, dass er ständig Essen benötigen würde. Daran erinnerte sie sich, weil sie zwei Brüder hatte.
Bitte lass mich das mit Kaylie nicht vermasseln.
Sie wollte es ihrem Bruder und Kaylie zuliebe richtig machen. Dies war eine harte Welt für einen Teenager ohne Familie. Kaylie sollte sich niemals so verlassen fühlen, wie Mercy es mit achtzehn getan hatte, als sie auf sich allein gestellt gewesen war. Zumindest sollte Kaylie wissen, dass Mercy immer für sie da sein würde.
Übertreibe ich es als leicht paranoide, arbeitswütige Tante?
Es war besser als die völlige Abwesenheit von Familie, die sie erlebt hatte.
»Ich setze dich an der Wohnung ab, dann muss ich zurück zur Arbeit«, teilte sie dem Mädchen mit. »Ich habe noch nicht einmal meinen Koffer ausgepackt.«
»Ich habe von dem Feuer und den toten Officers gehört. Das ist ja furchtbar. Tante Pearl sagte, Truman wäre auch dort gewesen. Geht es ihm gut?«
»Ich habe mit ihm telefoniert. Er hat sich den Kopf angestoßen und ein paar leichte Verbrennungen, aber es geht ihm gut.«
Stimmt das wirklich?
Mercy kannte seine Vorgeschichte mit Feuer und Verbrennungen. Vor etwas mehr als einem Jahr war er zu spät gekommen, um eine Kollegin und eine Zivilistin aus einem brennenden Auto zu retten, bevor es explodierte. Er hatte bei der Explosion schwere Verbrennungen erlitten, und der Stress und die seelische Belastung hatten fast dazu geführt, dass er seinen Job bei der Polizei aufgeben wollte. Bis heute hatte er deswegen Albträume. Beim Gedanken an ihn konnte sie es kaum erwarten, ihn endlich wiederzusehen. Die kurzen Telefonate im Verlauf des Vormittags hatten ihr nur zu verstehen gegeben, dass er noch laufen und arbeiten konnte. Er wird heute Abend zusammenbrechen. Möglicherweise auf mehr als nur eine Weise.
Mercy war zwei Wochen lang von ihm getrennt gewesen. Ihre Beziehung befand sich noch in einem sehr frühen Stadium. Zudem wollte sie die Dinge langsam angehen … sozusagen im Schneckentempo. Wenn es nach Truman gegangen wäre, würde sie längst mit ihm zusammenwohnen. Genau wie Kaylie. Er mochte das Mädchen und neckte es wie ein liebevoller Onkel. Aber Mercy war noch nicht bereit für das Zusammenleben. Verdammt, sie kannten sich doch erst seit zwei Monaten.
»Was?«, brüllte Kaylie.
Mercy kam fast von der Straße ab, als sie verzweifelt den Kopf hin und her drehte und nach dem Grund für den Schrei ihrer Nichte suchte. »Was ist passiert?«, keuchte sie.
»Hast du das gehört?« Kaylie starrte zum Autoradio. »Was der Kerl gerade gesagt hat?«
»Nein.« Mercy holte tief Luft und konzentrierte sich darauf, ihren Herzschlag zu verlangsamen. »Bitte schrei nicht so, während ich fahre.«
»Entschuldige. Aber er sagte gerade, dass einige Idioten hier behaupten würden, die Schießerei letzte Nacht wäre gerechtfertigt gewesen und die Deputys hätten das verdient.«
Mercy traute ihren Ohren kaum. Nein. Nicht hier. Nicht in meinem Staat.
»Das ist doch bescheuert.« Kaylie lehnte sich in ihrem Sitz zurück und verschränkte die Arme. »Die Leute sind dumm. Wer denkt denn so was?«
»Leider ziemlich viele Leute.« Mercy wusste nur zu gut, dass es einige Bewohner gab, denen es lieber war, wenn sich die Regierung aus ihrem Leben heraushielt. Aber normalerweise setzten sie ihre Überzeugungen nicht derart gewaltsam in die Tat um.
»Glaubst du, dass sie auf die Deputys geschossen haben?« Fragende Augen richteten sich auf Mercy. »Das ist doch dein Fall, oder nicht? Wirst du die Typen finden, die diesen Mist gesagt haben?«
»Hör mit dem Fluchen auf.«
»Tut mir leid. Aber das macht mich wütend.«
»Es macht mich auch wütend. Und ja, jemand wird sich der Sache annehmen.«
Drei
Truman konnte kaum noch die Augen offen halten, als er an Mercys Tür klingelte.
Er war seit fast vierundzwanzig Stunden auf den Beinen. Er hatte Verbrennungen erlitten, sich den Kopf angeschlagen und wäre beinahe bei einer Explosion ums Leben gekommen, und er hatte Mercy seit zwei Wochen nicht gesehen. Daher war es ihm scheißegal, ob Kaylie hier war. Er musste Mercy in den Armen halten. Sein Herz und seine Seele lagen brach, und er fühlte sich wund und verletzlich. Sie wäre der Balsam für seine zerbrochenen Teile, von denen er an diesem Abend verdammt viele hatte.
Leicht schwankend wartete er vor der Tür und sehnte sich danach, sie als Licht am Ende dieses sehr langen Tunnels eines Tages zu sehen.
Die Tür ging auf, und schon lagen sie einander in den Armen.
Er liebte sie, hatte es ihr aber nie gesagt. Die Angst, die gelegentlich in ihren Augen aufflackerte, ließ ihn diese Worte für sich behalten. Ihre Unruhe erinnerte ihn an ein nervöses Reh, das zitternd vor ihm stand, bereit, bei der kleinsten falschen Bewegung davonzurennen. Daher bewegte er sich sacht und langsam, denn er wusste, dass er sie mit der Zeit für sich gewinnen würde.
Er schmiegte sich an sie und genoss es, dass sie fast so groß war wie er.
»Du riechst immer noch nach Rauch«, flüsterte sie an seinem Ohr.
»Tut mir leid, ich hatte noch keine Zeit zum Duschen.«
»Das ist mir egal.« Sie lehnte sich zurück und musterte sein Gesicht, ihr Blick aus ihren grünen Augen war prüfend und einschätzend. »Du siehst beschissen aus.«
»So fühle ich mich auch.«
Sie zog ihn in ihr Wohnzimmer und drückte ihn auf die Couch. Als sein Nacken die Kissen berührte, zischte er vor Schmerz.
»Lass mich mal sehen.«
Er beugte sich vor und senkte den Kopf, um seinen Hals zu entblößen. »Ich brauche einen neuen Hut. Er hat die Explosion nicht überstanden.«
Sie lugte vorsichtig unter einen der Verbände. »Wir besorgen dir einen Hut. Tut das weh?«
»Als ob der Teufel auf meinem Hals sitzen würde.«
»Ich glaube, dagegen hab ich etwas. Es sind kaum Blasen zu sehen. Das ist gut, denn dann wirst du dich nicht mit einem Haufen nässender Wunden herumschlagen müssen. Warte kurz.« Sie verschwand im Flur.
Truman seufzte, als eine ganze Wagenladung Stress von ihm abfiel, und spürte, wie seine Kräfte langsam schwanden. Wenn sie nicht bald zurückkam, wäre er in weniger als einer Minute eingeschlafen. Doch dann tauchte sie wieder auf und sprühte ihm etwas Kühles auf den Hals. Es fühlte sich an, als würde Eis seinen Schmerz auflösen, und am liebsten wollte er die Dose küssen.
Doch stattdessen entschied er sich dafür, Mercy zu küssen.
Eine Minute später entwand sie sich ihm. »Das Spray wirkt nur vorübergehend. Nimm die hier.« Sie drückte ihm zwei weiße Tabletten und ein Glas Wasser in die Hand. Er stellte keine Fragen und nahm die Medizin. Im Grunde genommen war ihm gerade alles egal. Sie legte ein weißes Kissen am Ende der Couch zurecht und befahl ihm, sich hinzulegen.
»Ich will nicht hier schlafen«, protestierte er leise.
»Leg dich nur kurz hin. Ich ziehe dir die Stiefel aus.«
Er kam der Aufforderung nach und schloss die Augen. Noch mehr wohltuende Kühle. Er hätte schwören können, dass er nie zuvor auf einem so bequemen Kissen gelegen hatte. Dabei spürte er, wie sie nacheinander seine Beine anhob und ihm die Stiefel auszog.
Sie presste die Lippen auf seine Stirn, und dann schlief er auch schon tief und fest.
Mercy sah Truman beim Schlafen zu. Sie hätte ihn auf keinen Fall in ihr Schlafzimmer bringen können. Er war schon beim Betreten ihrer Wohnung fast umgefallen. Wie um alles in der Welt hat er es überhaupt bis zu mir geschafft?
Das war nur seiner Dickköpfigkeit und Entschlossenheit zu verdanken.
Was sie nachvollziehen konnte. Dies war ein Teil von dem, was ihre gegenseitige Anziehungskraft ausmachte. Sie erkannten Charaktereigenschaften von sich selbst in der anderen Person wieder. Er war alles, was sie zu sein anstrebte. Stark, loyal, aufrichtig. Und sie bewunderte ihn dafür, dass er diese Eigenschaften ohne jegliches Ego in sich trug. Er war anders als alle Männer, die sie bisher getroffen hatte.
Truman hatte sich unbemerkt in ihr Herz geschlichen. In der einen Minute war sie auf der Suche nach einem Mörder gewesen und in der nächsten hatte sie sich gefragt, wie sie dabei auch gleich ihr Herz verloren hatte.
Auch wenn Truman Daly nicht der bestaussehende Mann war, dem sie je begegnet war, liebte sie alles an seinem Gesicht. Die kleine Narbe an seinem Kinn und den Bartschatten, der in den letzten zwei Monaten gerötete Stellen auf ihren Wangen und Brüsten hinterlassen hatte. Es war, als wäre er für sie geschaffen. Alles an ihm stimmte mit ihren Bedürfnissen überein. Ihr Herz machte immer noch einen Sprung beim Anblick seines umwerfenden Lächelns, und seine natürliche Energie schenkte ihr Auftrieb, wenn sie ins Stocken geriet. Sie fühlte sich einfach besser, wenn sie in seiner Nähe war. So viel besser, dass sie eine Versetzung beantragt hatte und umgezogen war. Eine spontane Entscheidung. Normalerweise traf sie keine spontanen Entscheidungen, vielmehr zog sie es vor, zu analysieren und abzuwägen, bevor sie sich entschied.
Doch bis jetzt war dies die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen.
Sie fuhr ihm mit den Fingern durchs Haar. Es musste geschnitten werden. Zweifellos war er zu beschäftigt gewesen, um sich zehn Minuten Zeit auf einem Friseurstuhl zu nehmen.
Er hat einen höllischen Tag hinter sich.
Morgen würden sie sich wieder kopfüber in die Ermittlungen stürzen. Aber an diesem Abend musste er sich ausruhen. Dieser sture Mann. Er hätte sich so lange zum Durchhalten gezwungen, bis er an seinem Schreibtisch eingeschlafen wäre.
Ein Gefühl, das sie nur zu gut kannte.
Sie stand auf und streckte sich. Kaylie war schon vor einer Stunde ins Bett gegangen, und jetzt war sie an der Reihe. Sie blickte auf den schlafenden Mann auf ihrer Couch hinunter. Er war so groß, dass seine Füße auf einer Armlehne lagen, aber das schien ihn nicht zu stören. Ihr ging das Herz über, und sie wischte sich über die Augen.
»Was in aller Welt …?«, murmelte sie und griff nach einem Taschentuch. Woher kommen denn diese Tränen? Sie zog es vor, ihre Gefühle fest im Griff zu haben. Eigentlich war sie ziemlich gut darin, sie im Zaum zu halten, aber das Wissen, dass Truman letzte Nacht beinahe ums Leben gekommen wäre, ließ sie innerlich zusammenbrechen und zittern. »Ich bin müde«, sagte sie laut, aber sie konnte den Blick nicht von seinen schwarzen Wimpern abwenden, die auf seinen Wangen ruhten. Sie streckte die Hand aus und berührte sein Gesicht, spürte seine Bartstoppeln unter ihren Fingerspitzen. Weitere Tränen liefen ihr über die Wangen, und sie rieb sich schniefend die Nase.
Was hätte ich getan, wenn er bei diesem Feuer gestorben wäre?
Sie weigerte sich, diese Frage zu beantworten. Es war nicht passiert. Es war nicht relevant.
Oder etwa doch?
Truman war schlagartig wach, sprang von der Couch auf und stolperte gegen den Wohnzimmertisch, während sein Herz allem Anschein nach versuchte, aus seiner Brust zu springen. Er stützte sich mit einer Hand an der Wand ab und versuchte in der Dunkelheit, das Gleichgewicht zu finden. Sein Nacken brannte vor Schmerz, und er berührte vorsichtig die Mullbinden, während er sich umschaute und nach etwas Vertrautem suchte.
Mercys Wohnung.
Nach und nach fiel es ihm wieder ein. Er war zu ihrer Wohnung gefahren, weil er sie unbedingt sehen wollte, und dann war er eingeschlafen. Er stand in der Dunkelheit und atmete ein paar Sekunden lang tief durch, bevor er zum Fenster ging und die Vorhänge aufzog. Vom Parkplatz strömte sanftes Licht in den Raum. Draußen war es stockdunkel. Wie lange habe ich geschlafen?
Das leise Klicken der Uhr über dem Kaminsims erregte seine Aufmerksamkeit. Es war fast 4 Uhr.
Nicht lange genug.
Er konnte sich nicht an das erinnern, was passiert war, nachdem er sie an der Tür umarmt hatte. Zwar trug er keine Stiefel mehr, jedoch noch den Rest seiner Kleidung, die genau wie seine Haut nach Rauch roch.
Die Ereignisse des Tages überfluteten ihn. Feuer. Die Explosion. Das Loch in Ralphs Gesicht. Sein Herzschlag beschleunigte sich erneut. Er ging in Mercys Küche, holte sich ein Glas Wasser und leerte es am Waschbecken, wobei seine Schlucke in der Dunkelheit unnatürlich laut klangen.
Der Schweiß stand ihm auf der Stirn, und er beugte sich über das Waschbecken, um sich Wasser ins Gesicht zu spritzen.
Mir geht es gut. Ich habe das Feuer überlebt.
Was jedoch nicht für andere galt. Er wusch sich mit dem Geschirrtuch, das an der Ofentür hing, Gesicht und Hals. Das raue Handtuch streifte eine seiner verbundenen Brandwunden, und er stieß einen Schmerzenslaut aus, begrüßte aber gleichzeitig diese Ablenkung. Er würde nicht wieder einschlafen können, so viel war ihm klar.
Soll ich nach Hause fahren?
Der Gedanke an Mercy, die in ihrem Bett lag, führte ihn den Flur hinunter in das kleine Schlafzimmer, das er inzwischen gut kannte. Ein Lichtstrahl fiel durch das offene Fenster aufs Bett, und er konnte ihr Gesicht erkennen. Sie hatte den Mund im Schlaf leicht geöffnet und eine Hand unter das Kinn gestützt. Im Zimmer war es wie immer eiskalt. Sie mochte es so.
Er berührte sie am Arm. »Mercy?« Schuldgefühle überkamen ihn, weil er sie weckte, aber er wollte plötzlich unbedingt ihre Stimme hören.
Sie wachte sofort auf und setzte sich hin. »Truman? Geht es dir gut? Brauchst du mehr Schmerzmittel?« Schon schob sie die Bettdecke beiseite und schwang die Beine aus dem Bett.
»Nein, es geht mir gut«, log er und legte ihr eine Hand auf die Schulter, um sie vom Aufstehen abzuhalten. »Ich muss nur mit dir reden.«
»Worüber?«
Das Licht von draußen fing ihr Profil ein, als sie ihn ansah. Er konnte ihre Augen nicht sehen, aber ihren Blick auf sich spüren. Endlich verlangsamte sich sein Herzschlag. »Nichts. Alles. Es waren zwei schwierige Wochen … und gestern …«
Sie schwieg, und er spürte ihren Blick, mit dem sie ihn im Dunkeln musterte. »Was ist los?«
Er ließ sich neben ihr aufs Bett sinken. »Ich hätte früher da sein sollen.«
»Gestern Abend? Bei der brennenden Scheune? Was wäre anders gewesen, wenn du früher da gewesen wärst?«
»Ich hätte ihn vielleicht aufgehalten.«
Kurz stockte ihr der Atem. »Du glaubst also, du hättest den Schützen aufhalten können.«
»Vielleicht. Dann wären diese beiden Männer nicht tot.« Die Worte kamen ihm nur schwer über die Lippen, als er endlich laut aussprach, was er den ganzen Tag über gedacht hatte. Wenn ich dort gewesen wäre, wo ich hätte sein sollen …
»Wärst du als Erster dort gewesen, dann wärst du jetzt vermutlich ebenfalls tot«, widersprach sie entschieden. »Und damit wäre ich nicht einverstanden.«
»Aber …«
»Kein Aber. Du darfst dieses Was-wäre-wenn-Spiel gar nicht erst anfangen, Truman. Dadurch machst du dich nur verrückt. Was geschehen ist, ist geschehen. Du kannst diese Officers nicht zurückholen.«
Er sah sie im schummrigen Licht an. »Ich hätte gut zehn Minuten früher dort sein sollen. Das hätte einen Unterschied ausmachen können.«
»Soll das etwa heißen, dass es einen guten Grund für dein verspätetes Eintreffen gab? Du willst mir doch nicht erzählen, dass um diese Zeit viel Verkehr herrschte.«
»Ich war nicht zu Hause.«
Einen Moment lang herrschte Schweigen. »Wo warst du?« Panik schwang in ihrer Stimme mit.
»Ich habe in deiner Hütte geschlafen.«
Sie atmete aus und entspannte sich. »Wieso das?«
»Ich habe in letzter Zeit oft dort übernachtet. Das Feuer im Schuppen der Prepper hat mich beunruhigt, und ich habe befürchtet, dass vielleicht noch andere Häuser von Preppern angegriffen werden.«
Sie schlang einen Arm um ihn und legte den Kopf auf seine Schulter. »Du hast beschützt, was ich unter großer Mühe aufgebaut habe. Ist es seltsam, dass ich das für das Schönste halte, was je ein Mensch für mich getan hat?«, fragte sie leise und mit einem Hauch von Unsicherheit in der Stimme.
Truman antwortete nicht. Tatsächlich hatte er das nicht aus Freundlichkeit getan, sondern weil ihm etwas daran lag. Abgesehen davon, dass jahrelange harte Arbeit darin steckte, wusste er auch, dass die abgelegene Hütte und ihr Inhalt ein Teil von Mercy waren. Sie hielten sie bei Verstand und im Gleichgewicht. Seiner Meinung nach war es keine große Sache, dort ein paar Nächte zu verbringen. Vor ihrer Reise hatten sie damit angefangen, einen Teil der Vorräte aus dem alten Haus seines Onkels dorthin zu schaffen. Trumans Onkel Jefferson hatte ihm eine Fülle von Vorräten hinterlassen, aber er und Mercy waren sich einig gewesen, dass der Standort ihrer Hütte besser war, da sie abgelegen und unauffällig war.
In einem durchschnittlichen Haushalt reichten die gelagerten Lebensmittel etwa für eine Woche. In Mercys Hütte gab es genug, um sie monatelang mit Essen und Wärme zu versorgen.
Pflaumen, Patronen und Pflaster.
Die drei Ps des Preppens.
Aber Mercy hatte noch mehr zu bieten. Sie glaubte auch an Nächstenliebe und half jenen, die weniger Glück gehabt hatten. Viele der Vorräte seines Onkels waren an Familien in der Stadt gegangen. Mercy konnte einen Zaun flicken, einen Schuppen bauen und sogar einen Motor reparieren. Ihre Hütte war vollgestopft mit Büchern, in denen medizinische Kenntnisse, Elektronik und taktische Fähigkeiten gelehrt wurden … Themen, von denen er annahm, dass man sie jederzeit im Internet finden konnte. Aber wie informierte man sich, wenn das Internet ausfiel?
Er hat jetzt sogar eine Fluchttasche in seinem Truck, um jederzeit schnell verschwinden zu können.
Kleine Veränderungen.





























