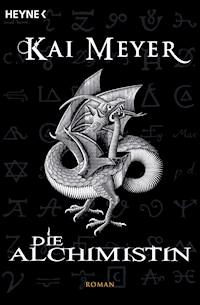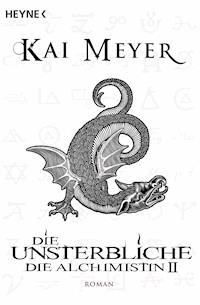10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Merle-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Merle ist zurück... Merles Venedig ist voller Magie. Zauberspiegelmacher und geflügelte Löwen, Meisterdiebe und Meerjungfrauen bevölkern die Gassen und Kanäle. Über sie alle wacht die Fließende Königin, ein geisterhaftes Wesen der Lagune, unsichtbar und unnahbar – einzig Merle gewinnt ihre Freundschaft. Als übermächtige Feinde die Stadt belagern und die Fließende Königin in ihre Gewalt bringen wollen, beginnt für Merle ein atemberaubendes Abenteuer, das sie bis zum Rand ihrer Welt führen wird ... Erstes Buch des Merle-Zyklus Der Klassiker der deutschen Phantastik in opulenter Neuausgabe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Kai Meyer
Merle
Die fließende Königin
Inhalt
Meerjungfrauen
Spiegelaugen
Unkes Geschichte
Schemen
Der Verrat
Ende und Anfang
Durch die Kanäle
Bote des Feuers
Der Uralte Feind
Sonnenbarken
Es geht weiter mit [...]
Merles Geschichte geht weiter [...]
Leseprobe aus Buch 4 des [...]
Merle folgte Junipa hinaus [...]
Ein anderes Venedig, ein [...]
1. Kapitel
Meerjungfrauen
Die Gondel mit den beiden Mädchen kam aus einem der Seitenkanäle. Sie mussten warten, bis die Rennboote auf dem Canal Grande vorüber waren, und selbst Minuten danach herrschte noch immer ein solches Durcheinander von Kähnen und Dampfbooten, dass der Gondoliere es vorzog, sich zu gedulden.
»Es geht gleich weiter«, rief er den Mädchen zu und umklammerte mit beiden Händen sein Ruder. »Ihr habt es nicht eilig, oder?«
»Nein«, antwortete Merle, die Ältere der beiden. Tatsächlich aber war sie aufgeregt wie noch nie in ihrem Leben.
Seit Tagen sprach man in Venedig von nichts anderem als der Bootsregatta auf dem Canal Grande. Die Veranstalter hatten angekündigt, nie zuvor seien die Boote von so vielen Meerjungfrauen auf einmal gezogen worden.
»Fischweiber« nannten manche die Meerjungfrauen abfällig. Das war nur eines von unzähligen Schimpfwörtern, mit denen man sie bedachte, vor allem seit behauptet wurde, sie paktierten mit den Ägyptern. Nicht, dass jemand ernsthaft solch einen Unsinn glaubte; schließlich hatten die Armeen des Pharaos zahllosen Meerjungfrauen im Mittelmeer den Garaus gemacht.
Bei der heutigen Regatta waren zehn Boote an den Start gegangen, am Südende des Canal Grande, auf Höhe der Casa Stecchini. Jedes wurde von zehn Meerjungfrauen gezogen.
Zehn Meerjungfrauen! Das war rekordverdächtig, nie da gewesen. La Serenissima, die Erhabene, wie die Venezianer ihre Stadt gern nannten, hatte dergleichen noch nicht erlebt.
Fächerförmig hatte man sie vor die Boote gespannt, an langen Tauen, die selbst den nadelspitzen Zähnen einer Meerjungfrau standhielten. Rechts und links des Kanals, dort, wo sein Ufer begehbar war, und natürlich auf allen Balkonen und an den Fenstern der Paläste hatte sich das Volk versammelt, um dem Schauspiel zuzusehen.
Merles Aufregung aber hatte nichts mit der Regatta zu tun. Sie hatte einen anderen Grund. Einen besseren, fand sie.
Der Gondoliere wartete weitere zwei, drei Minuten, ehe er die schlanke schwarze Gondel hinaus auf den Canal Grande lenkte, quer darüber hinweg und in eine gegenüberliegende Mündung. Beinahe wurden sie dabei von dem Boot einiger Wichtigtuer gerammt, die ihre eigenen Meerjungfrauen vor den Bug gespannt hatten und unter Gegröle versuchten, es den Teilnehmern der Regatta gleichzutun.
Merle strich ihr langes dunkles Haar zurück. Der Wind trieb ihr immer wieder Strähnen vor die Augen. Sie war vierzehn Jahre alt, nicht groß, nicht klein, allerdings ein wenig dünn geraten. Aber das waren fast alle Kinder im Waisenhaus, außer dem dicken Ruggero natürlich, doch der war krank – sagten zumindest die Aufseherinnen. Aber war es wirklich ein Zeichen von Krankheit, sich nachts in die Küche zu schleichen und den Nachtisch aller Bewohner aufzuessen?
Merle atmete tief durch. Der Anblick der gefangenen Meerjungfrauen machte sie traurig. Sie besaßen menschliche Oberkörper, mit heller, glatter Haut, um die gewiss so manche Dame allabendlich in ihren Gebeten flehte. Ihr Haar war lang, denn unter Meerweibern galt es als Schande, es abzuschneiden – sogar ihre menschlichen Meister respektierten diese Sitte.
Was die Meerjungfrauen von gewöhnlichen Frauen unterschied, war zum einen ihr mächtiger Fischschwanz. Selten kürzer als zwei Meter, entspross er auf Höhe ihrer Hüften. Er war so flink wie eine Peitsche, so stark wie eine Raubkatze und so silbern wie das Geschmeide in den Schatzkammern des Stadtrats.
Der zweite große Unterschied aber – und er war es, den die Menschen am meisten fürchteten – war das grässliche Maul, das ihre Gesichter spaltete wie eine klaffende Wunde. Mochte auch der Rest ihrer Züge menschlich sein, und wunderschön dazu – zahllose Gedichte waren über ihre Augen verfasst worden, und nicht wenige verliebte Jünglinge stiegen für sie freiwillig in ein nasses Grab –, so waren es doch ihre Mäuler, die viele überzeugten, es mit Tieren und nicht mit Menschen zu tun zu haben. Der Schlund einer Meerjungfrau reicht von einem Ohr zum anderen, und wenn sie ihn öffnet, ist es, als klappe ihr gesamter Schädel entzwei. Aus den Kiefern ragen mehrere Reihen scharfer Zähne, so schmal und spitz wie Nägel aus Elfenbein. Wer behauptet, es gebe kein schlimmeres Gebiss als das eines Hais, der hat noch nie einer Meerjungfrau ins Maul geschaut.
Im Grunde wusste man wenig über sie. Fest stand, dass Meerjungfrauen die Menschen mieden. Für viele Bewohner der Stadt war das Grund genug, sie zu jagen. Junge Männer machten sich oft einen Spaß daraus, unerfahrene Meermädchen, die sich im Labyrinth der venezianischen Kanäle verirrt hatten, in die Enge zu treiben; wenn eines dabei zu Tode kam, fand man das schade, gewiss, doch niemand machte den Jägern einen Vorwurf.
Meist aber wurden die Meerjungfrauen gefangen und in Bassins im Arsenal gesperrt, bis sich ein Grund fand, sie durchzufüttern. Häufig waren dies Bootsrennen, seltener Fischsuppe – auch wenn der Geschmack ihrer langen Schuppenschwänze Legende war. Er übertraf gar Delikatessen wie Sirene und Leviathan.
»Sie tun mir leid«, sagte das zweite Mädchen, das neben Merle in der Gondel saß. Es war ebenso ausgehungert und noch knochiger. Sein hellblondes, fast weißes Haar fiel ihm weit über den Rücken. Merle wusste nichts über ihre Begleiterin, nur dass sie ebenfalls aus einem Waisenhaus stammte, wenn auch aus einem anderen Viertel Venedigs. Sie war ein Jahr jünger als Merle, dreizehn, hatte sie gesagt. Ihr Name war Junipa.
Junipa war blind.
»Die Meerjungfrauen tun dir leid?«, fragte Merle.
Das blinde Mädchen nickte. »Ich konnte vorhin ihre Stimmen hören.«
»Aber sie haben gar nichts gesagt.«
»Unter Wasser schon«, widersprach Junipa. »Sie haben gesungen, die ganze Zeit über. Ich hab ziemlich gute Ohren, weißt du. Viele Blinde haben das.«
Merle schaute Junipa entgeistert an, ehe ihr bewusst wurde, wie unhöflich das war, ganz gleich, ob das Mädchen es nun sehen konnte oder nicht.
»Ja«, sagte Merle schließlich, »mir geht’s genauso. Ich finde, sie wirken immer ein wenig … ich weiß nicht, irgendwie wehmütig. So als hätten sie etwas verloren, das ihnen viel bedeutet hat.«
»Ihre Freiheit?«, schlug der Gondoliere vor.
»Mehr als das«, entgegnete Merle. Ihr fehlten die Worte, um zu beschreiben, was sie meinte. »Vielleicht die Fähigkeit, sich zu freuen.« Das traf es immer noch nicht ganz genau, kam dem aber nahe.
Sie war überzeugt, dass die Meerjungfrauen ebenso menschlich waren wie sie selbst. Sie waren intelligenter als manch einer, den sie im Waisenhaus kennengelernt hatte, und sie besaßen Gefühle. Sie waren anders, gewiss, aber das gab niemandem das Recht, sie wie Tiere zu halten, sie vor Boote zu spannen oder nach Belieben durch die Lagune zu scheuchen. Das Verhalten der Venezianer ihnen gegenüber war grausam und ganz und gar unmenschlich. Alles Dinge, die man eigentlich den Meerjungfrauen nachsagte.
Merle seufzte und blickte aufs Wasser. Der Bug der Gondel schnitt wie eine Messerklinge durch die smaragdgrüne Oberfläche. In den schmalen Seitenkanälen war das Wasser sehr ruhig, nur am Canal Grande kamen manchmal stärkere Wellen auf. Hier aber, drei, vier Ecken von Venedigs Hauptschlagader entfernt, herrschte völlige Stille.
Die Gondel glitt lautlos unter gewölbten Brücken hindurch. Manche waren mit grinsenden Steinfratzen verziert; auf ihren Köpfen wuchs buschiges Unkraut wie grüne Haarbüschel.
Zu beiden Seiten des Kanals reichten die Fassaden der Häuser geradewegs ins Wasser hinab. Keines war niedriger als vier Stockwerke. Vor ein paar hundert Jahren, als Venedig noch eine starke Handelsmacht gewesen war, hatte man von den Kanälen aus die Ware direkt in die Paläste der reichen Händlerfamilien verladen. Heute aber standen viele der alten Gemäuer leer, die meisten Fenster waren dunkel und die Holztore auf Höhe der Wasseroberfläche morsch und von Feuchtigkeit zerfressen – und das nicht erst, seit sich der Belagerungsring der ägyptischen Armee um die Stadt geschlossen hatte. Nicht an allem trugen der wiedergeborene Pharao und seine Sphinx-Kommandanten die Schuld.
»Löwen!«, entfuhr es Junipa.
Merle schaute am Ufer entlang zur nächsten Brücke. Sie entdeckte nirgends eine Menschenseele, geschweige denn die steinernen Löwen der Stadtgarde.
»Wo denn? Ich sehe keinen.«
»Ich kann sie riechen«, sagte Junipa. Sie schnupperte lautlos in die Luft, und Merle bemerkte aus dem Augenwinkel, wie der Gondoliere hinter ihnen den Kopf schüttelte.
Sie versuchte es Junipa gleichzutun, doch die Gondel musste fast fünfzig Meter weitergleiten, ehe Merles Nasenflügel etwas auffingen. Den Geruch von feuchtem Gestein, muffig und ein wenig modrig, so stark, dass er selbst den Odem der versinkenden Stadt überdeckte.
»Du hast recht.« Es war unzweifelhaft der Gestank der Steinlöwen, die von den venezianischen Stadtgardisten als Reittiere und Kampfgefährten eingesetzt wurden.
Im selben Augenblick trat eines der mächtigen Tiere vor ihnen auf eine Brücke. Es war aus Granit, eine der häufigsten Rassen unter den steinernen Löwen der Lagune. Es gab andere, stärkere, doch das machte letztlich keinen Unterschied. Wer einem Granitlöwen in die Klauen fiel, war so gut wie verloren. Die Löwen waren von alters her das Wahrzeichen der Stadt, schon zu der Zeit, als ein jeder von ihnen geflügelt und in der Lage gewesen war, sich in die Luft zu erheben. Heute gab es nur noch wenige, die das vermochten; eine streng regulierte Zahl von Einzeltieren, die zum persönlichen Schutz der Stadträte abgestellt waren. Allen anderen hatten die Zuchtmeister auf der Löweninsel, oben im Norden der Lagune, das Fliegen ausgetrieben. Sie kamen mit verkümmerten Schwingen zur Welt, die sie als traurige Anhängsel auf ihren Rücken trugen. Die Soldaten der Stadtgarde befestigten daran ihre Sättel.
Auch der Granitlöwe auf der Brücke war nur ein gewöhnliches Tier aus Stein. Sein Reiter trug die bunte Uniform der Gardisten. Ein Gewehr baumelte an einem Lederriemen über seiner Schulter, betont lässig, ein Zeichen militärischer Arroganz. Die Soldaten hatten die Stadt nicht vor dem Ägyptischen Imperium schützen können – das hatte die Fließende Königin an ihrer statt getan –, doch seit Ausrufung des Belagerungszustands vor über dreißig Jahren hatte die Garde beständig an Macht gewonnen. Mittlerweile wurde sie in ihrer Überheblichkeit nur noch von ihren Befehlsgebern, den Stadträten, übertroffen, die in der gebeutelten Stadt nach Gutdünken schalteten und walteten. Möglicherweise versuchten die Räte und ihre Soldaten, sich selbst etwas zu beweisen – schließlich wusste jeder, dass sie im Ernstfall nicht in der Lage waren, Venedig zu verteidigen. Doch solange die Fließende Königin die Feinde von der Lagune fernhielt, konnten sie sich selbst in ihrer Allmacht feiern.
Der Gardist auf der Brücke blickte mit einem Grinsen zur Gondel herab, zwinkerte Merle zu und gab dann dem Löwen die Sporen. Mit einem Schnauben schob das Tier sich vorwärts. Merle hörte überdeutlich das Scharren seiner steinernen Krallen auf dem Pflaster. Junipa hielt sich die Ohren zu. Die Brücke bebte und zitterte unter den Pranken der Raubkatze, und der Hall schien zwischen den hohen Fassaden umherzuhüpfen wie ein Springball. Sogar das stille Wasser geriet in Bewegung, und die Gondel schaukelte leicht.
Der Gondoliere wartete, bis der Soldat im Gewirr der Gassen verschwunden war, dann spuckte er ins Wasser und murmelte: »Hol dich der Uralte Verräter!«
Merle schaute sich zu ihm um, doch der Mann blickte mit starrer Miene über sie hinweg den Kanal entlang. Langsam ließ er die Gondel weitergleiten.
»Weißt du, wie weit es noch ist?«, erkundigte sich Junipa bei Merle.
Der Gondoliere kam ihr zuvor. »Wir sind gleich da. Da vorne, hinter der Ecke.« Dann wurde ihm bewusst, dass »da vorne« kein Hinweis war, mit dem das blinde Mädchen etwas anfangen konnte. Deshalb fügte er rasch hinzu: »Nur noch ein paar Minuten, dann sind wir am Kanal der Ausgestoßenen.«
Enge und Düsternis – das waren die beiden Eindrücke, die sich Merle am stärksten einprägten.
Der Kanal der Ausgestoßenen war von hohen Häusern flankiert, eines so finster wie das andere. Fast alle waren verlassen. Die Fensteröffnungen klafften leer und schwarz in den grauen Fassaden, viele Scheiben waren zersplittert, und die hölzernen Läden hingen schief in ihren Angeln wie Flügel an Vogelgerippen. Aus einer aufgebrochenen Tür drang das Kreischen kämpfender Kater, nichts Ungewöhnliches in einer Stadt mit zigtausend streunenden Katzen. Tauben gurrten auf den Fensterbänken, und die schmalen, geländerlosen Wege zu beiden Seiten des Wassers waren mit Moos und Vogelkot bedeckt.
Einzig zwei bewohnte Häuser hoben sich deutlich von den verfallenen Gemäuern ringsum ab. Sie lagen einander genau gegenüber und starrten sich über den Kanal hinweg an wie zwei Schachspieler mit zerfurchtem Gesicht und gerunzelter Stirn. Rund hundert Meter trennten sie von der Mündung des Kanals und seinem schattigen Sackgassenende. Jedes der Häuser besaß einen Balkon. Der linke war aus Stein, der rechte aus verschlungenem Metall gefertigt worden. Die Balustraden hoch über dem Wasser berührten sich fast.
Der Kanal maß eine Breite von drei Schritten. Das Wasser, eben noch leuchtend grün, wirkte hier dunkler und tiefer. Die Kluft zwischen den alten Häusern war so eng, dass kaum Tageslicht bis zur Wasseroberfläche drang. Auf den Wellen, die die Gondel verursachte, schaukelten träge ein paar Vogelfedern.
Merle hatte eine vage Vorstellung von dem, was sie erwartete. Man hatte es ihr im Waisenhaus erklärt und dabei immer wieder erwähnt, wie dankbar sie sich schätzen durfte, dass man sie hierher in die Lehre schickte. An diesem Kanal, in diesem Schacht aus grüngrauem Halblicht, würde sie die nächsten Jahre verbringen.
Die Gondel näherte sich den bewohnten Häusern. Merle lauschte angespannt, konnte aber nichts hören außer einem entfernten Rumoren unverständlicher Stimmen. Als sie zu Junipa hinüberschaute, sah sie, dass jeder Muskel im Körper des blinden Mädchens angespannt war; sie hatte die Augen geschlossen, ihre Lippen formten stumme Worte – vielleicht jene, die sie mit ihrem feinen Gehör aus dem Wirrwarr heraushörte. Wie die Bewegungen eines Teppichknüpfers, der mit spitzer Nadel gezielt einen einzigen Faden zwischen tausend anderen hervorfischt. Junipa war in der Tat ein ungewöhnliches Mädchen.
Das Gebäude zur Linken beherbergte die Weberei des berühmten Umberto. Es galt als gottlos, Kleidung zu tragen, die er und seine Schüler gefertigt hatten; zu schlecht war sein Ruf, zu bekannt sein Zwist mit der Kirche. Jene Damen aber, die sich heimlich Mieder und Kleider von ihm herstellen ließen, schworen hinter vorgehaltener Hand auf deren magische Wirkung. »Umbertos Kleider machen schlank«, erzählte man sich in Venedigs Salons und Gassen. Wirklich schlank. Denn wer sie trug, sah nicht nur dünner aus – er war es tatsächlich, so als zehrten die magischen Fäden des Webermeisters vom Fett all jener, die von ihnen umhüllt wurden. Die Priester in Venedigs Kirchen hatten mehr als einmal gegen das unheilige Treiben des Webers gewettert, so laut und hasserfüllt, dass die Handwerksgilde Umberto schließlich aus ihren Reihen verstieß.
Doch nicht allein Umberto hatte den Zorn der Gilde zu spüren bekommen. Gleiches galt für den Herrn des gegenüberliegenden Hauses. Auch darin war eine Werkstatt untergebracht, und auch sie stand auf ihre Art im Dienste der Schönheit. Allerdings wurden hier keine Kleider gewebt, und ihr Meister, der ehrenwerte Arcimboldo, hätte wohl lautstark protestiert, wäre er offen mit seinem Erzfeind Umberto verglichen worden.
Arcimboldos Götterglas stand in goldenen Lettern über der Tür, und gleich daneben hing ein Schild:
Zauberspiegel
für gute und böse Stiefmütter,
für schöne und hässliche Hexen
und jederlei lauteren Zweck
»Wir sind da«, sagte Merle zu Junipa, während ihr Blick zum zweiten Mal über die Worte strich. »Arcimboldos Zauberspiegelwerkstatt.«
»Wie sieht sie aus?«, fragte Junipa.
Merle zögerte. Es fiel ihr nicht ganz leicht, ihren ersten Eindruck zu schildern. Düster war das Haus, gewiss, wie der ganze Kanal und seine Umgebung, doch neben der Tür stand ein Kübel mit bunten Blumen, ein freundlicher Klecks im grauen Zwielicht. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte Merle, dass die Blüten aus Glas waren.
»Besser als das Waisenhaus«, sagte sie unentschlossen.
Die Stufen, die von der Wasseroberfläche zum Gehweg führten, waren glitschig. Der Gondoliere half ihnen beim Aussteigen. Sein Geld hatte er bereits erhalten, als er die Mädchen in Empfang genommen hatte. Ehe er mit seiner Gondel langsam davonglitt, wünschte er den beiden Glück.
Ein wenig verloren standen sie da, jede mit einem halbvollen Bündel in der Hand, gleich unter dem Schild, das Zauberspiegel für böse Stiefmütter feilbot. Merle war unschlüssig, ob sie dies für einen guten oder einen schlechten Auftakt ihrer Lehrzeit halten sollte. Vermutlich lag die Wahrheit irgendwo dazwischen. Hinter einem Fenster der Weberwerkstatt am anderen Ufer huschte ein Gesicht vorüber, dann ein zweites. Neugierige Lehrlinge, die einen Blick auf die Ankömmlinge warfen, vermutete Merle. Feindliche Lehrlinge, so man den Gerüchten Glauben schenkte. Arcimboldo und Umberto mochten sich nicht, das war kein Geheimnis, und auch ihr zeitgleicher Ausschluss aus der Handwerksgilde hatte daran nichts geändert. Ein jeder gab dem anderen die Schuld. »Was werft ihr mich heraus und nicht diesen verrückten Spiegelmacher?«, hatte Umberto Arcimboldo zufolge gefragt, während der Weber wiederum behauptete, Arcimboldo habe bei seinem Ausschluss gerufen: »Ich gehe, aber ihr tätet gut daran, wenn ihr auch diesem Fadenflicker den Prozess machen würdet.« Was davon der Wahrheit entsprach, wusste niemand mit Gewissheit. Fest stand nur, dass man beide wegen verbotenen Umgangs mit Magie aus der Gilde geworfen hatte.
Ein Zauberer, durchfuhr es Merle. Seit Tagen dachte sie an kaum etwas anderes. Arcimboldo ist ein echter Zauberer!
Mit einem Knirschen wurde die Tür der Spiegelwerkstatt geöffnet, und eine wunderliche Frau erschien auf dem Gehweg. Ihr langes Haar war zu einem Knoten hochgesteckt. Sie trug lederne Hosen, die ihre schlanken Beine betonten. Darüber schlackerte eine weite Bluse, durchzogen von silbernen Fäden – ein solch feines Stück hätte Merle eher am gegenüberliegenden Kanalufer in der Weberwerkstatt erwartet, nicht aber im Hause Arcimboldos.
Das Ungewöhnlichste aber war die Maske, hinter der die Frau einen Teil ihres Gesichts verbarg. Der letzte Karneval von Venedig – früher weltberühmt – hatte vor fast vier Jahrzehnten stattgefunden. Das war 1854 gewesen, drei Jahre nachdem Pharao Amenophis in der Stufenpyramide von Amun-Ka-Re zu neuem Leben erwacht war. Heute, in Zeiten des Krieges, der Not und der Belagerung, gab es keinen Anlass zur Verkleidung.
Und dennoch trug die Frau eine Maske, geformt aus Papier, glasiert und kunstvoll verziert. Zweifellos die Arbeit eines venezianischen Künstlers. Sie bedeckte ihre untere Gesichtshälfte bis hinauf zum Nasenrücken. Ihre Oberfläche war schneeweiß und glänzte wie Porzellan. Der Maskenmacher hatte einen kleinen, fein geschwungenen Mund mit dunkelroten Lippen daraufgemalt.
»Unke«, sagte die Frau und fuhr mit fast unmerklichem Lispeln fort: »Das ist mein Name.«
»Merle. Und das ist Junipa. Wir sind die neuen Lehrlinge.«
»Natürlich, wer sonst?« Unkes Augen verrieten, dass sie lächelte. Merle überlegte, ob eine Krankheit das Gesicht der Frau entstellt haben könnte.
Unke ließ die Mädchen eintreten. Hinter der Tür lag eine weite Eingangshalle, wie in den meisten Häusern der Stadt. Sie war nur spärlich möbliert, die Wände verputzt und ohne Tapete – Vorsichtsmaßnahmen wegen des Hochwassers, das Venedig in manchen Wintern heimsuchte. Das häusliche Leben der Venezianer spielte sich im ersten und zweiten Stock ab, die Erdgeschosse blieben karg und ungemütlich.
»Es ist spät«, sagte Unke, als wäre ihr Blick auf eine Uhr gefallen. Doch Merle konnte nirgends eine entdecken. »Arcimboldo und die älteren Schüler sind um diese Zeit in der Werkstatt und dürfen nicht gestört werden. Ihr werdet sie morgen kennenlernen. Ich zeige euch euer Zimmer.«
Merle konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Sie hatte gehofft, dass sie und Junipa sich ein Zimmer teilen würden. Auch das blinde Mädchen freute sich über Unkes Worte.
Die maskierte Frau führte sie die Stufen einer geschwungenen Freitreppe empor. »Ich bin die Haushälterin der Werkstatt. Ich koche für euch und wasche eure Sachen. Vermutlich werdet ihr mir in den ersten Monaten dabei zur Hand gehen, das verlangt der Meister oft von den Neuankömmlingen – zumal ihr die einzigen Mädchen im Haus seid.«
Die einzigen Mädchen? Dass alle anderen Lehrlinge Jungen sein könnten, war Merle bislang nicht in den Sinn gekommen. Umso erleichterter war sie, dass sie ihre Lehrzeit gemeinsam mit Junipa begann.
Das blinde Mädchen war nicht allzu gesprächig, und Merle vermutete, dass sie es im Waisenhaus nicht leicht gehabt hatte. Merle hatte zu oft miterlebt, wie grausam Kinder sein können, vor allem zu jenen, die sie für schwächer halten. Junipas Blindheit war sicherlich nicht selten Anlass für gemeine Streiche gewesen.
Die Mädchen folgten Unke einen langen Gang hinunter. An den Wänden hingen zahllose Spiegel. Die meisten waren aufeinander gerichtet: Spiegel in Spiegeln in Spiegeln. Merle bezweifelte, dass es sich dabei um Arcimboldos berühmte Zauberspiegel handelte, denn sie konnte nichts Ungewöhnliches daran entdecken.
Nachdem Unke ihnen allerlei über Essenszeiten, Ausgang und Verhalten im Haus erklärt hatte, fragte Merle:
»Wer kauft eigentlich Arcimboldos Zauberspiegel?«
»Du bist neugierig«, stellte Unke fest und ließ offen, ob ihr diese Erkenntnis missfiel.
»Reiche Leute?«, hakte Junipa nach und strich sich gedankenverloren über das glatte Haar.
»Vielleicht«, sagte Unke. »Wer weiß?«
Damit ließ sie das Thema fallen, und die Mädchen bohrten nicht nach. Sie würden noch genug Zeit haben, alles Wichtige über die Werkstatt und ihre Kundschaft herauszufinden. Gute und böse Stiefmütter, wiederholte Merle in Gedanken. Schöne und hässliche Hexen. Das klang aufregend.
Das Zimmer, das Unke ihnen zuwies, war nicht groß. Es roch muffig, war aber erfreulich hell, da es im dritten Stock des Gebäudes lag. In Venedig bekommt man das Tageslicht, geschweige denn den Sonnenschein, erst ab der zweiten Etage zu Gesicht – wenn man Glück hat. Das Fenster dieses Zimmers jedoch blickte über ein Meer rotgelber Schindeln. Nachts würden sie den Sternenhimmel, tagsüber die Sonne sehen können – vorausgesetzt, ihre Arbeit ließ ihnen Zeit dafür.
Der Raum lag an der Rückseite der Werkstatt. Weit unter dem Fenster erkannte Merle einen kleinen Hof mit einer runden Zisterne. Die gegenüberliegenden Häuser schienen alle leer zu stehen. Zu Beginn des Kriegs mit dem Pharaonenreich hatten viele Venezianer die Stadt verlassen und waren aufs Festland geflohen – ein verhängnisvoller Fehler, wie sich später herausgestellt hatte.
Unke verließ die Mädchen mit dem Hinweis, dass sie ihnen in einer Stunde etwas zu essen bringen würde. Anschließend sollten sich die beiden schlafen legen, damit sie an ihrem ersten Arbeitstag ausgeruht sein würden.
Junipa tastete sich am Bettpfosten entlang und ließ sich sanft auf der Matratze nieder. Vorsichtig strich sie mit beiden Händen über die Bettdecke.
»Hast du die Decke bemerkt? So flauschig!«
Merle setzte sich neben sie. »Sie muss teuer gewesen sein«, sagte sie versonnen. Im Waisenhaus waren die Decken dünn und kratzig, und es gab allerlei Ungeziefer, das einem im Schlaf die Haut zerbiss.
»Scheint so, als hätten wir Glück gehabt«, sagte Junipa.
»Noch haben wir Arcimboldo nicht getroffen.«
Junipa hob eine Augenbraue. »Wer ein blindes Mädchen aus einem Waisenhaus holt, um ihm etwas beizubringen, kann kein schlechter Mensch sein.«
Merle blieb argwöhnisch. »Arcimboldo ist bekannt dafür, dass er Waisen als Schüler annimmt. Welche Eltern würden ihr Kind auch schon an einem Ort in die Lehre schicken, der sich Kanal der Ausgestoßenen nennt?«
»Aber ich kann nicht sehen, Merle! Ich war mein ganzes Leben lang allen nur ein Klotz am Bein.«
»Haben sie dir das im Heim eingeredet?« Merle sah Junipa forschend an. Dann ergriff sie die schmale weiße Hand des Mädchens. »Ich bin jedenfalls froh, dass du hier bist.«
Junipa lächelte verlegen. »Meine Eltern haben mich ausgesetzt, als ich gerade ein Jahr alt war. Sie haben mir einen Brief ins Kleid gesteckt. Darin stand, dass sie keinen Krüppel großziehen wollen.«
»Das ist abscheulich.«
»Wie bist du ins Heim gekommen?«
Merle seufzte. »Ein Aufseher im Waisenhaus hat einmal erzählt, dass man mich in einem Weidenkorb gefunden hat, der auf dem großen Kanal trieb.« Sie zuckte mit den Schultern. »Klingt wie im Märchen, was?«
»Wie in einem traurigen.«
»Ich war damals erst ein paar Tage alt.«
»Wer wirft denn ein Kind in den Kanal?«
»Und wer setzt es aus, weil es nicht sehen kann?«
Die beiden lächelten sich an. Auch wenn Junipas weiße Augäpfel durch sie hindurchschauten, hatte Merle das Gefühl, dass ihre Blicke mehr als leere Gesten waren. Durch Horchen und Tasten nahm Junipa vermutlich mehr wahr als die meisten anderen Menschen.
»Deine Eltern wollten nicht, dass du ertrinkst«, stellte Junipa fest. »Sonst hätten sie sich nicht die Mühe gemacht, dich in einen Weidenkorb zu legen.«
Merle blickte zu Boden. »Sie haben noch etwas mit in den Korb gelegt. Willst du es –« Sie verstummte.
»Sehen?«, führte Junipa den Satz mit einem Grinsen zu Ende.
»Tut mir leid.«
»Das muss es nicht. Ich kann es ja anfassen. Hast du es dabei?«
»Immer, egal wohin ich gehe. Einmal hat ein Mädchen im Waisenhaus versucht, es zu stehlen. Ich hab ihr fast alle Haare ausgerissen.« Sie lachte ein wenig verschämt. »Na ja, damals war ich erst acht.«
Auch Junipa lachte. »Dann werde ich meine in der Nacht wohl lieber zu einem Knoten binden.«
Merle berührte sanft Junipas Haar. Es war dick und so hell wie das einer Schneekönigin.
»Also?«, fragte Junipa. »Was lag noch in deinem Weidenkorb?«
Merle stand auf, öffnete ihr Bündel und zog ihren kostbarsten Besitz hervor – genau genommen war es ihr einziger, abgesehen von dem schlichten, geflickten Kleid, das sie zum Wechseln dabeihatte.
Es war ein Handspiegel, ungefähr so groß wie ihr Gesicht, oval und mit einem kurzen Griff. Der Rahmen war aus einer dunklen Legierung gefertigt, die so mancher im Waisenhaus mit gierigen Augen für angelaufenes Gold gehalten hatte. In Wahrheit war es weder Gold noch ein anderes Metall, von dem irgendwer jemals gehört hatte, denn es war so hart wie Diamant.
Das Ungewöhnlichste an diesem Spiegel aber war seine Spiegelfläche. Sie bestand nicht aus Glas, sondern aus Wasser. Man konnte hineingreifen und kleine Wellen erzeugen, doch egal wie man den Spiegel drehte, nie lief auch nur ein einziger Tropfen heraus.
Merle legte Junipa den Griff in die offene Hand, und sogleich schlossen sich die Finger des blinden Mädchens darum. Statt den Gegenstand zu betasten, führte sie ihn erst einmal ans Ohr.
»Es flüstert«, sagte sie leise.
Merle war überrascht. »Flüstert? Ich hab nie etwas gehört.«
»Du bist ja auch nicht blind.« Eine kleine, senkrechte Falte erschien auf Junipas Stirn. Sie konzentrierte sich. »Es sind mehrere. Ich kann die Worte nicht verstehen, es sind zu viele Stimmen, und sie sind zu weit entfernt. Aber sie flüstern miteinander.« Junipa senkte den Spiegel und fuhr mit ihrer Linken um den ovalen Rahmen. »Ist es ein Bild?«
»Ein Spiegel«, erwiderte Merle. »Aber erschrick nicht, er ist aus Wasser.«
Junipa verriet durch nichts ihr Erstaunen, so als sei dies etwas ganz Alltägliches. Erst als sie eine Fingerspitze ausstreckte und die Wasseroberfläche berührte, zuckte sie zusammen.
»Es ist kalt«, stellte sie fest.
»Nein, überhaupt nicht. Das Wasser im Spiegel ist immer warm. Und man kann etwas hineinstecken, aber wenn man es wieder herauszieht, ist es trocken.«
Junipa berührte das Wasser noch einmal. »Für mich fühlt es sich eiskalt an.«
Merle nahm ihr den Spiegel aus der Hand und streckte Zeige- und Mittelfinger hinein. »Warm«, sagte sie ein wenig trotzig. »Es war noch nie kalt, soweit ich mich zurückerinnern kann.«
»Hat es mal jemand außer dir berührt?«
»Noch keiner. Nur einmal wollte ich es einer Nonne erlauben, die zu uns ins Waisenhaus kam, aber sie hatte schreckliche Angst davor und hat gesagt, es sei ein Werk des Teufels.«
Junipa überlegte. »Vielleicht fühlt sich das Wasser für jeden außer der Besitzerin kalt an.«
Merle runzelte die Stirn. »Mag schon sein.« Sie schaute auf die Oberfläche, die noch immer in leichter Bewegung war. Verzerrt und zitternd blickte ihr Spiegelbild zurück.
»Hast du vor, ihn Arcimboldo zu zeigen?«, fragte Junipa. »Er kennt sich aus mit Zauberspiegeln.«
»Ich glaube, nicht. Zumindest nicht sofort. Vielleicht später mal.«
»Du hast Angst, dass er ihn dir abnimmt.«
»Hättest du das nicht?« Merle seufzte. »Es ist das Einzige, was mir von meinen Eltern geblieben ist.«
»Du bist ein Teil deiner Eltern, vergiss das nicht.«
Merle verstummte für einen Moment. Sie dachte nach, ob sie Junipa vertrauen konnte, ob sie dem blinden Mädchen die ganze Wahrheit sagen sollte. Schließlich schaute sie sich sichernd zur Tür um und flüsterte: »Das Wasser ist noch nicht alles.«
»Wie meinst du das?«
»Ich kann meinen ganzen Arm in den Spiegel stecken, und er kommt nicht auf der anderen Seite heraus.« Tatsächlich war die Rückseite des Ovals aus demselben harten Metall wie der Rahmen.
»Tust du es gerade?«, fragte Junipa staunend. »Ich meine, jetzt im Moment?«
»Wenn du möchtest.« Merle ließ erst ihre Finger in das Innere des Wasserspiegels gleiten, dann ihre Hand, schließlich den ganzen Arm. Es war, als wäre er völlig aus dieser Welt verschwunden.
Junipa streckte ihre Hand aus und tastete sich von Merles Schulter bis zum Spiegelrahmen. »Wie fühlt es sich an?«
»Sehr warm«, beschrieb Merle. »Angenehm, aber nicht heiß.« Sie senkte ihre Stimme. »Und manchmal spüre ich noch etwas anderes.«
»Was denn?«
»Eine Hand.«
»Eine … Hand?«
»Ja. Sie greift nach meiner, ganz sanft, und hält sie.«
»Sie hält dich fest?«
»Nicht fest. Einfach nur … na ja, sie hält eben meine Hand. So wie Freundinnen das tun. Oder –«
»Oder Eltern?« Junipa sah sie gespannt an. »Glaubst du, dass dein Vater oder deine Mutter da drinnen deine Hand hält?«
Merle war es unangenehm, darüber zu sprechen. Nach kurzem Zögern überwand sie ihre Scheu.
»Es wäre doch möglich, oder? Immerhin waren sie es, die mir den Spiegel in den Korb gelegt haben. Vielleicht haben sie das getan, um irgendwie Kontakt mit mir zu halten, damit ich weiß, dass sie noch da sind … irgendwo.«
Junipa nickte langsam, aber sie wirkte nicht überzeugt. Eher verständnisvoll. Ein wenig traurig sagte sie: »Ich hab mir lange Zeit vorgestellt, dass mein Vater ein Gondoliere ist. Ich weiß, dass die Gondolieri die schönsten Männer Venedigs sind … Ich meine, jeder weiß das … auch wenn ich sie nicht sehen kann.«
»Sie sind nicht alle schön«, wandte Merle ein.
Junipas Stimme klang verträumt. »Und ich hab mir ausgemalt, dass meine Mutter eine Wasserträgerin vom Festland ist.«
Von den Wasserträgerinnen, die auf den Straßen aus großen Krügen Trinkwasser verkauften, behauptete man, sie seien die anmutigsten Frauen weit und breit. Und wie im Fall der Gondolieri galt, dass auch diese Erzählungen einen wahren Kern besaßen.
Junipa fuhr fort: »Ich hab mir also vorgestellt, dass meine Eltern diese beiden wunderschönen Menschen sind, so als würde das irgendetwas über mich aussagen. Über mein wahres Ich. Ich habe sogar versucht, sie zu entschuldigen: Zwei so perfekte Geschöpfe, habe ich mir gesagt, können sich nicht mit einem kranken Kind sehen lassen. Ich hab mir eingeredet, dass es ihr gutes Recht war, mich auszusetzen.« Sie schüttelte den Kopf, so heftig, dass ihr weißblondes Haar wild umherflog. »Heute weiß ich, dass das alles Unsinn ist. Vielleicht sind meine Eltern schön, oder vielleicht sind sie hässlich. Vielleicht sind sie auch gar nicht mehr am Leben. Aber das hat nichts mit mir zu tun, verstehst du? Ich bin ich, das ist alles, was zählt. Und meine Eltern haben unrecht getan, weil sie ein hilfloses Kind einfach auf die Straße geworfen haben.«
Merle hörte betroffen zu. Sie wusste, was Junipa meinte, auch wenn sie nicht verstand, was das mit ihr und der Hand in ihrem Spiegel zu tun hatte.
»Du darfst dir nichts vormachen, Merle«, sagte das blinde Mädchen und klang dabei viel weiser, als sie es in Anbetracht ihrer Jugend hätte sein dürfen. »Deine Eltern wollten dich nicht. Deshalb haben sie dich in diesen Weidenkorb gelegt. Und wenn dir jemand in deinem Spiegel die Hand reicht, dann muss das nicht zwangsläufig deine Mutter oder dein Vater sein. Das, was du fühlst, ist magisch, Merle. Und mit Magie muss man vorsichtig sein.«
Einen kurzen Moment lang spürte Merle Wut in sich aufsteigen. Junipa stand es nicht zu, so etwas zu behaupten, sie ihrer Hoffnungen zu berauben, all der Träume, die sie hatte, wenn der oder die andere im Spiegel ihre Hand hielt. Doch dann verstand sie, dass Junipa nur ehrlich war und dass Ehrlichkeit das schönste Geschenk ist, das man einem anderen zu Beginn einer Freundschaft machen kann.
Merle schob den Spiegel unter ihr Kopfkissen. Sie wusste, dass er nicht zerbrechen würde und dass sich der Stoff in die Wasseroberfläche pressen konnte, ohne dabei nass zu werden oder die Flüssigkeit aufzusaugen. Dann setzte sie sich zurück zu Junipa und legte den Arm um sie. Das blinde Mädchen erwiderte die Umarmung, und so hielten sie einander wie Schwestern, wie zwei Menschen, die keine Geheimnisse voreinander haben. Es war ein so überwältigendes Gefühl der Nähe und des Einverständnisses, dass es für eine Weile sogar die Wärme der Hand im Spiegel übertraf, ihre Ruhe und Stärke, mit der sie Merles Vertrauen gewonnen hatte.
Als die Mädchen sich voneinander lösten, sagte Merle: »Du kannst ihn einmal ausprobieren, wenn du magst.«
»Den Spiegel?« Junipa schüttelte den Kopf. »Es ist deiner. Würde er wollen, dass ich meine Hand hineinstecke, würde das Wasser auch für mich warm sein.«
Merle spürte, dass Junipa recht hatte. Ob es nun eine Hand ihrer Eltern war, die sie dort drinnen berührte, oder die Finger von jemand völlig anderem – fest stand, sie akzeptierten nur Merle. Es mochte sogar gefährlich sein, wenn ein anderer so tief in den Raum hinter dem Spiegel vordrang.
Die Mädchen saßen noch zusammen auf dem Bett, als die Tür aufging und Unke eintrat. Auf einem Holztablett brachte sie das Abendessen, deftige Brühe mit Gemüse und Basilikum, dazu weißes Brot und einen Krug mit Wasser aus der Zisterne im Hof.
»Geht schlafen, wenn ihr ausgepackt habt«, lispelte die Frau hinter der Maske, bevor sie das Zimmer verließ. »Ihr habt noch alle Zeit der Welt, um miteinander zu reden.«
Ob Unke sie belauscht hatte und von dem Spiegel unter Merles Kissen wusste? Doch Merle sagte sich, dass sie keinen Grund hatte, der Haushälterin zu misstrauen, ja, dass Unke bisher doch sehr freundlich und großzügig gewesen war. Allein die Tatsache, dass sie die Hälfte ihres Gesichts hinter einer Maske verbarg, machte sie nicht zu einem üblen Menschen.
Sie dachte noch an Unkes Maske, als sie einschlief, und im Halbschlaf fragte sie sich, ob nicht jedermann bisweilen eine Maske trug.
Eine Maske der Freude, eine Maske der Trauer, eine Maske der Gleichgültigkeit.
Eine Maske aus Ihr-seht-mich-nicht.