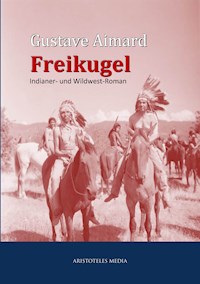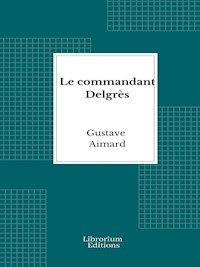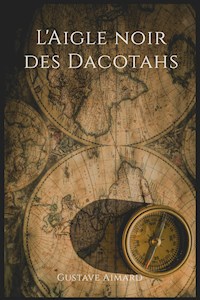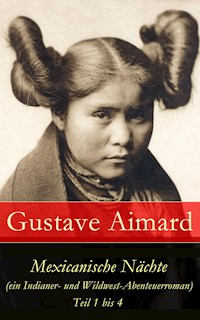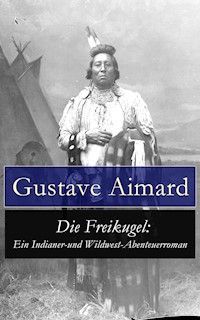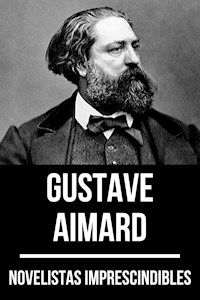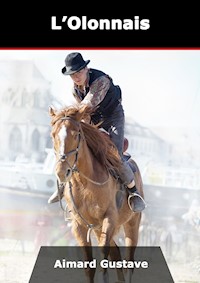0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Dieses eBook wurde mit einem funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Die Ausgabe ist mit interaktiven Inhalt und Begleitinformationen versehen, einfach zu navigieren und gut gegliedert. Gustave Aimard (1818/1883) war ein französischer Autor von Abenteuerromanen, der ähnlich wie der Deutsche Karl May oder der Italiener Emilio Salgari durch seine Bücher das Bild der Indianer und des Wilden Westens maßgeblich beeinflusste. Aus dem Buch: "Am 2. Juli 18.., kamen gegen vier Uhr Nachmittags, in dem Augenblicke, wo die schon tief am Horizonte stehende Sonne nur noch schräge Strahlen auf die von der Hitze durchdrungene Erde wirft und die sich erhebende Brise die glühende Atmosphäre zu erfrischen beginnt, zwei gut berittene Reisende aus einem dichten Jucca-, Bananen- und Bambusgehölz und schlugen einen staubigen Weg ein, der in ununterbrochenen Stufenreihen zu einem Thale führte, worin ein klarer, durch das Grün sich hinschlängelnder Bach eine sanfte Kühlung unterhielt..."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mexicanische Nächte
Books
Inhaltsverzeichnis
Mexicanische Nächte – Erster Theil
Inhaltsverzeichnis
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
I.
Las-Cumbres.
Keine Gegend der Welt bietet dem geblendeten Auge des Reisenden entzückendere Landschaften dar, als Mexiko; unter allen aber ist die von Las-Cumbres unstreitig eine der anmuthigsten.
Las-Cumbres bildet eine Reihe von Bergpässen, durch welche in unendlichen Krümmungen der Weg nach Puebla de-los-Angeles (die Stadt der Engel) führt, – also genannt, weil, der Sage nach, die Engel dort die Kirche erbauten. Der durch die Spanier errichtete Weg, von dem wir sprechen, erstreckt sich in steiler, schwindelerregender Absenkung, während eine ununterbrochene, in bläuliche Dünste getauchte Bergkette sich zu beiden Seiten hinzieht. Bei jeder Wendung dieses gleichsam über Abgründe voll üppiger Vegetation schwebenden Pfades, wechselt das Schauspiel und wird malerischer; die Gipfel der Berge erheben sich, stufenweise abfallend, einer hinter dem andern, während die, welche man überschritten hat, senkrecht hinter Einem aufsteigen.
Am 2. Juli 18.., kamen gegen vier Uhr Nachmittags, in dem Augenblicke, wo die schon tief am Horizonte stehende Sonne nur noch schräge Strahlen auf die von der Hitze durchdrungene Erde wirft und die sich erhebende Brise die glühende Atmosphäre zu erfrischen beginnt, zwei gut berittene Reisende aus einem dichten Jucca-, Bananen- und Bambusgehölz und schlugen einen staubigen Weg ein, der in ununterbrochenen Stufenreihen zu einem Thale führte, worin ein klarer, durch das Grün sich hinschlängelnder Bach eine sanfte Kühlung unterhielt.
Die durch den unvermutheten Anblick dieser vor ihren Blicken sich entrollenden, grandiosen Landschaft überraschten Reisenden machten Halt, und nachdem sie einige Minuten lang die malerischen Ausläufer der Berge betrachtet hatten, stiegen sie von ihren Pferden, nahmen denselben die Zügel ab und setzten sich am Ufer des Baches nieder, offenbar zu dem Zweck, die Wirkungen dieses bewunderungswürdigen, einzig in der Welt dastehenden Kaleidoscopes noch einige Minuten länger zu genießen.
Der Richtung nach, der sie folgten, schienen diese Reiter von Orizaba zu kommen und nach Puebla-de-los-Angeles zu gehen, von welchem Orte sie übrigens in diesem Augenblicks nicht mehr weit entfernt waren.
Beide Reiter trugen die reiche Tracht der Hacienda-Besitzer, eine Tracht, die wir schon zu oft beschrieben haben, als daß wir dieselbe hier noch einmal wiederholen sollten; wir wollen nur einen characteristischen Umstand berichten, welcher die geringe Sicherheit der Wege zu der Zeit, wo sich unsere Geschichte ereignet, bestätigte Beide waren bis an die Zähne bewaffnet und führten ein vollständiges Arsenal mit sich; außer den in ihren Halftern steckenden sechsläufigen Revolvern befanden sich eben solche in ihren Gürteln. In der Hand hatten sie eine vortreffliche Doppelflinte, aus dem Atelier von Dèvisme, einem berühmten Pariser Büchsenmacher, was Jedem nicht weniger als sechsundzwanzig Schüsse zu thun erlaubte, ohne die Machete oder den geraden Säbel zu rechnen, der an ihrer linken Seite hing, das mit dreischneidiger Klinge versehene Messer, welches sie in ihrem rechten Stiefel trugen und den zusammengerollten ledernen, auf dem Sattel an einem sorgfältig genieteten Ringe befestigten Lazzo.
Sicherlich konnten also bewaffnete Männer, wenn sie mit einem gewissen Muth begabt waren, leicht einer selbst bedeutenden Anzahl Feinde ohne Schaden die Stirn bieten.
Uebrigens schienen sie keineswegs durch den Anblick des wilden und einsamen Ortes, am dem sie sich befanden, beunruhigt und plauderten, halb auf dem grünen Grase ausgestreckt, heiter mit einander, indem sie nachlässig ihre wirklich echten Havannacigarren rauchten. Der älteste der beiden Reiter war ein Mann von vierzig bis fünfundvierzig Jahren, der indessen höchstens sechsunddreißig zu sein schien; seine Gestalt von etwas über Mittelgröße war, wenngleich elegant, doch stark gebaut, seine untersetzten Gliedmaßen zeugten von einer großen körperlichen Kraft, seine markirten Züge, trugen einen energischen und intelligenten Ausdruck; seine schwarzen und lebhaften Augen, die stets in Bewegung waren, erschienen sanft, aber sie schleuderten, sobald sie sich belebten, zuweilen flammende Blitze und verliehen dann seinem Gesicht einen harten und unmöglich zu beschreibenden wilden Ausdruck. Die Stirn war hoch und breit, der Mund sinnlich, ein schwarzer und dichter Bart, wie der eines Aethiopiers, mit einigen Silberfäden gemischt, fiel auf seine Brust, üppiges, zurückgeworfenes Haar floß auf seine Schultern herab, sein gebräunter Teint hatte die Farbe von Ziegelsteinen; kurz, wenn man den Mann dem Anscheine nach beurtheilen wollte, so war er einer jener entschlossenen Männer, die in gewissen kritischen Momenten höchst kostbar sind, da man von ihnen verlassen zu werden nicht zu fürchten braucht. Obwohl es unmöglich war, seine Nationalität zu erkennen, so schienen doch seine raschen Bewegungen, seine lebhafte, kurze und bilderreiche Sprache einen südlichen Ursprung anzudeuten.
Sein Gefährte, viel jünger als er, denn er schien höchstens fünf- bis achtundzwanzig Jahr alt zu sein, war groß, etwas mager, und wenn auch dem Anschein nach nicht kränklich, so doch zart; seine elegante, schlanke und wohlgebaute Gestalt, seine Füße und Hände von außerordentlicher Kleinheit zeigten die Race an; seine schönen Züge, seine ansprechende und intelligente Physiognomie schienen von Sanftmuth durchdrungen, seine blauen Augen, sein blondes Haar und vor Allem die Weiße seiner Hautfarbe, ließen ihn augenblicklich einen Europäer der gemäßigten Zone erkennen, der erst neuerdings nach Amerika gekommen.
Wir haben bereits gesagt, daß die beiden Reisenden mit einander plauderten; sie sprachen französisch; ihre Redeweise und der gänzliche Mangel jedes Accents ließ vermuthen, daß sie sich in ihrer Muttersprache ausdrückten.
»Nun, Herr Graf,« sagte der Aeltere, »bedauert Ihr noch, meinen Rath befolgt zu haben und anstatt auf den abscheulichen Wegen im Wagen daherzurütteln, diese Reise zu Pferde in Gesellschaft Eures Führers unternommen zu haben?«
»Da müßte ich wahrlich sehr schwer zu befriedigen sein,« antwortete Der, welchem man den Titel Graf beigelegt hatte; »ich habe die Schweiz, Italien, die Ufer des Rheins wie Jedermann bereist, und ich gestehe Euch, daß ich noch niemals den Anblick köstlicherer Landschaften genossen habe, als die, welche ich, Dank Euch, seit einigen Tagen zu sehen, das Vergnügen habe.«
»Ihr seid sehr gütig; die Landschaft ist in der That schön, überdies ist sie sehr romantisch,« setzte er mit boshaftem Ausdruck hinzu, der seinem Gefährten entging, »und dennoch,« fuhr er mit einem unterdrückten Seufzer fort, »habe ich deren noch schönere gesehen.«
»Schönere als diese hier?« rief der Graf, indem er den Arm ausstreckte und einen Halbkreis in der Luft beschrieb; »oh! das ist nicht möglich, Herr.«
»Ihr seid jung, Herr Graf,« erwiderte der Erste mit trübem Lächeln, »Eure Touristenreisen sind nur Kinderspiel gewesen. Diese hier überwältigt Euch, durch den Contrast, welchen sie mit den anderen bildet, das ist Alles; da Ihr niemals die Natur anders studirt habt, als in einer Opernloge, so vermuthetet Ihr nicht, daß sie Euch solche Ueberraschungen aufbewahren könnte. Euer Enthusiasmus hat sich plötzlich durch die Seltsamkeit der Contraste, die sich unaufhörlich Euren Blicken darbieten, zu einem Rausche gesteigert, aber wenn Ihr wie ich die hohen Savannen und die unendlichen Prairien des Innern durchreist hättet, wo in Freiheit die wilden Kinder dieser Erde umherirren, welche die Civilisation aus ihrem Besitz getrieben hat, so würdet Ihr wie ich nur noch ein verächtliches Lächeln über die Gegenden haben, die uns umgeben und die Ihr in diesem Augenblick so aufrichtig bewundert.«
»Was Ihr mir da sagt, kann die Wahrheit sein, Herr Olivier; leider aber kenne ich diese Savannen und Prairien, von denen Ihr sprecht, nicht und werde sie ohne Zweifel niemals kennen lernen.«
»Weshalb denn nicht?« warf der erste Sprecher lebhaft ein; »Ihr seid jung, reich, kräftig, frei, soviel ich voraussetzen kann. Wer könnte sich Euch widersetzen, wenn Ihr einen Ausflug in die große amerikanische Wildniß machen wolltet? Ihr seid gerade in diesem Augenblick ganz geneigt, diesen Plan in Ausführung zu bringen; es ist eine jener für unmöglich gehaltenen Reisen, von der Ihr später mit Stolz sprechen könnt, sobald Ihr in Euer Vaterland zurückgekehrt sein werdet.«
»Ich wünschte es,« antwortete der Graf mit einem Schatten von Traurigkeit; »leider aber ist es mir unmöglich; meine Reise wird in Mexiko beendet sein.«
»In Mexiko!« meinte Olivier erstaunt.
»Leider ja! Herr, es ist so; ich gehöre nicht mir an, sondern unterliege in diesem Augenblicke dem Einfluß eines fremden Willens. Ich bin ganz einfach in dieses Land gekommen, um mich zu verheirathen.«
»Euch zu verheirathen? In Mexiko? Ihr, Herr Graf!« rief Olivier überrascht.
»Mein Gott ja, ganz prosaisch, mit einer Frau, die ich nicht kenne und die mich eben so wenig kennt, und welche ohne Zweifel nicht mehr Liebe für mich empfindet, als ich für sie. Wir sind Verwandte und wurden schon in der Wiege verlobt, und jetzt ist der Augenblick gekommen, das in unserm Namen von den Vätern gegebene Versprechen zu halten; das ist sehr einfach.«
»So ist diese junge Dame also eine Französin?«
»Durchaus nicht, sie ist im Gegentheil eine Spanierin, ich glaube sogar etwas Mexikanerin.«
»Ihr aber seid Franzose, Herr Graf?«
»Gewiß und noch dazu Franzose aus der Touraine,« erwiderte er lächelnd.
»Aber, Herr Graf, gestattet mir die Frage, wie geht das zu, daß ...?«
»Oh! sehr natürlich,« unterbrach ihn der Graf. »Die Geschichte ist nicht lang, und da Ihr aufgelegt seid, sie zu hören, so will ich sie Euch in wenigen Worten mittheilen. Meinen Namen kennt Ihr, ich bin der Graf Ludovic Mahiet-de-la-Saulay; meine Familie, aus der Touraine gebürtig, ist eine der ältesten dieser Provinz, sie führt auf die ersten Franken zurück: einer meiner Ahnen, sagt man, sei einer der größten Vasallen des Königs Chlodwig gewesen, der ihm für seine treuen Dienste große, mit Weiden besetzte Wiesen zum Geschenk machte, wovon später meine Familie ihren Namen erhalten hat. Ich erwähne diesen Ursprung nicht aus einem übel angebrachten Gefühle des Stolzes. Obwohl adelig nach Thaten und Wappen, bin ich, Gott sei Dank, in solchen Fortschrittsideen erzogen, um zu wissen, was ein Titel in der Zeit, in der wir leben, gilt und um zu erkennen, daß der wahre Adel nur allein in edlen Gesinnungen wohnt; allein ich mußte Euch diese besondern Umstände mittheilen, welche meine Familie berühren, um Euch klar zu machen, wie meine Ahnen, die stets hohe Aemter unter den verschiedenen Dynastien, welche in Frankreich aufeinander gefolgt sind, bekleideten, dahin gelangten, einen jüngeren, spanischen Familienzweig zu haben, während der ältere Zweig französisch blieb. Zur Zeit der Ligue lagen die von den Guisen herbeigerufenen Spanier, mit denen die Ersteren eine Alliance gegen den König Heinrich den IV., den man noch heute den König von Navarra nennt, geschlossen hatten, eine Zeit lang in Paris in Garnison. Ich bitte um Verzeihung, lieber Herr Olivier, daß ich in solche Details eingehe, die Euch höchst unnütz scheinen werden.«
»Im Gegentheil, Herr Graf, sie interessiren mich vielmehr sehr; fahrt fort, ich bitte.«
Der junge Mann verneigte sich und begann von Neuem:
»Nun aber war der damalige Graf de-la-Saulay ein eifriger Parteigänger der Guisen und ein sehr intimer Freund des Herzogs von Mayenne. Der Graf hatte drei Kinder, zwei Söhne, die in den Reihen der Liguearmee kämpften, und eine Tochter, Ehrendame bei der Herzogin von Montpensier, Schwester des Herzogs von Mayenne. Die Belagerung von Paris dauerte lange Zeit, und als Heinrich IV. endlich daran verzweifelte, sich der Stadt wieder zu bemächtigen, kaufte er sie von dem Herzog von Brissac, Gouverneur der Bastille für die Ligue, in baarem Silbergelde. Viele Officiere des Herzogs von Mendoça, dem Commandanten der spanischen Truppen, und dieser General selbst, hatten ihre Familien bei sich. Kurz, der jüngste Sohn meines Ahnherrn verliebte sich in eine der Nichten des spanischen Generals, bat um ihre Hand und erhielt sie, während seine Schwester auf die Bitten der Herzogin Montpensier einwilligte, die ihrige einem Flügeladjutanten des Generals zu reichen. Die schlaue und politische Herzogin glaubte durch diese Verbindungen den französischen Adel von Dem zu entfernen, den sie den Bearner und Hugenotten nannte, und seinen Triumph, wenn nicht unmöglich zu machen, so doch zu verzögern. Aber wie dies in solchen Fällen immer geschieht, erwiesen sich diese Berechnungen als falsch, der König eroberte sein Königreich wieder und die am Meisten in dem Aufstand der Ligue verwickelten Edelleute sahen sich gezwungen, die Spanier auf ihrem Rückzuge zu begleiten und mit ihnen Frankreich zu verlassen. Mein Ahnherr erhielt leicht Verzeihung vom Könige, der ihm später sogar ein wichtiges Commando anvertraute und seinen ältesten Sohn in seine Dienste nahm; der Jüngste aber widerstand allen Bitten und Einwendungen seines Vaters, nach Frankreich zurückzukehren, sondern ließ sich für immer in Spanien nieder.
»Die beiden Familienzweige fuhren indessen, obwohl getrennt, fort, Verbindungen unter sich zu unterhalten und sich unter einander zu verehelichen. Mein Großvater heirathete während seiner Verbannung eine Tochter des spanischen Zweiges; und jetzt bin ich im Begriff, eine ähnliche Verbindung zu schließen. Ihr seht, lieber Herr, daß dies Alles sehr prosaisch und sehr wenig interessant ist.«
»Also Ihr würdet darein willigen, so zu sagen blindlings eine Dame zu heirathen, die Ihr noch niemals gesehen habt, und die Ihr nicht einmal kennt?«
»Was wollt Ihr, es ist einmal so, meine Einwilligung ist unnütz bei dieser Sache, die Verbindlichkeit ist feierlich durch meinen Vater angenommen, ich muß also seinem Worte nachkommen. Uebrigens,« setzte er lächelnd hinzu, »beweist Euch meine Gegenwart hier, daß ich nicht gezögert habe zu gehorchen. Vielleicht würde ich, wenn mein Wille frei gewesen wäre, diese Verbindung nicht eingegangen sein; leider hing dies jedoch nicht von mir ab, ich habe mich dem Willen meines Vaters fügen müssen. Ueberdies gestehe ich Euch, daß ich mich, in dem fortwährenden Hinblick auf diese Heirath erzogen und sie unvermeidlich wissend, allmählich an den Gedanken gewöhnt habe, und dieses Opfer für mich nicht so groß ist, als Ihr vielleicht vermuthet.«
»Das thut nichts,« antwortete Olivier mit einer gewissen Rauhheit, »zum Teufel mit dem Adel und dem Vermögen, wenn sie solche Verbindlichkeiten auferlegen; da ist das Abenteurerleben in der Wildniß und die armselige Unabhängigkeit mehr werth; wenigstens ist man immer Herr seiner selbst.«
»Ich bin vollkommen Eurer Meinung; dessen ungeachtet muß ich mein Haupt beugen. Jetzt gestattet mir, eine Frage an Euch zu richten.«
»Von ganzem Herzen zwei, wenn 's Euch beliebt.«
»Wie kommt es, daß wir uns zufällig in dem französischen Hôtel in Vera-Cruz, im Augenblicke meiner Ankunft begegneten und so schnell vertraut mit einander geworden sind?«
»Was das anbetrifft, so werde ich außer Stande sein, diese Frage zu beantworten; Ihr habt mir auf den ersten Blick gefallen. Euer Benehmen hat mich angezogen; ich habe Euch meine Dienste angeboten, die Ihr angenommen habt, und so sind wir zusammen nach Mexiko aufgebrochen: das ist die ganze Geschichte, einmal dort – werden wir uns trennen, um uns wahrscheinlich nie wieder zu sehen, damit ist Alles gesagt.«
»Oh! oh! Herr Olivier, laßt mich glauben, daß Ihr im Irrthum seid, daß wir uns im Gegentheil oft wieder sehen werden, und daß unsere Bekanntschaft bald zu einer festen Freundschaft werden wird.«
Der Andere schüttelte wiederholt mit dem Kopfe.
»Herr Graf,« sagte er endlich, »Ihr seid Edelmann, reich und in guter Lebensstellung, ich bin nur ein Abenteurer, dessen vergangenes Leben Ihr nicht kennt und von dem Ihr kaum den Namen wißt, da Ihr voraussetzet, daß der, welchen ich in diesem Augenblick trage, der wirkliche sei. Unsere Stellungen sind zu verschieden, es giebt zwischen uns eine zu scharfe Scheidelinie, als daß wir auf dem Fuße schicklicher Gleichheit einander gegenüber stehen könnten. Sobald wir in die Anforderungen der civilisirten Welt zurückgetreten sein würden, müßte ich Euch bald, da ich älter als Ihr bin und eine größere Welterfahrung besitze, zur Last fallen; bestehet also nicht darauf und bleiben wir jedes an unserem Platze. Dies, das seid überzeugt, wird für Euch und für mich besser sein: ich bin in diesem Augenblick viel mehr Euer Führer als Euer Freund, diese Stellung ist die einzige, welche mir geziemt; laßt mich also an diesem Platze.«
Der Graf wollte etwas erwidern, aber Olivier ergriff rasch seinen Arm.
»Still,« sagte er, »hört ...«
»Ich höre nichts,« versetzte nach einem Augenblick der junge Mann.
»In der That,« erwiderte der Andere lächelnd, »Eure Ohren sind nicht wie die meinigen für jedes Geräusch, welches die Stille der Wildniß unterbricht, empfänglich: ein Wagen nähert sich im raschen Lauf von Orizaba her, er verfolgt sogar denselben Weg wie wir; bald wird er Euren Blicken sichtbar werden, ich unterscheide ganz deutlich das Schellengeläute der Maulesel.«
»Das ist ohne Zweifel die Post von Vera-Cruz, in welcher sich meine Diener und mein Gepäck befinden, und welcher wir um einige Stunden voraus sind.«
»Vielleicht ja, vielleicht auch nein,« erwiderte der Andere nach einem Augenblick des Nachdenkens; »auf alle Fälle ist es gut, uns vorzusehen.«
»Uns vorzusehen, warum?« fragte erstaunt der junge Mann.
Olivier warf ihm einen seltsamen Blick zu.
»Ihr kennt noch nichts von dem amerikanischen Leben,« antwortete er endlich: »in Mexico ist das erste Gesetz der Selbsterhaltung immer, sich gegen die wahrscheinlichen Eventualitäten eines Ueberfalls zu schützen. Folgt mir und thut, was ich thun werde.«
»Wollen wir uns denn verstecken?«
»Wahrhaftig!« erwiderte er achselzuckend.
Ohne etwas Weiteres zu erwidern, näherte er sich seinem Pferde, legte ihm den Zügel wieder an und schwang sich mit einer Leichtigkeit und Geschicklichkeit, die eine lange Gewohnheit anzeigte, in den Sattel und sprengte auf ein höchstens hundert Meter entferntes Gehölz zu.
Wider Willen durch die Macht beherrscht, welche dieser Mann, durch seine seltsame Handlungsweise auf ihn ausübte, folgte der Graf seinem Beispiel.
»Wohlan,« sagte der Abenteurer, sobald sie sich vollständig geschützt hinter den Bäumen befanden, »jetzt wollen wir warten.«
Einige Minuten vergingen.
»Seht,« sprach Olivier lakonisch, indem er den Arm in der Richtung eines kleinen Gehölzes ausstreckte, aus welchem sie zwei Stunden früher hervorgeritten waren.
Der Graf wendete mechanisch den Kopf nach dieser Seite; in demselben Augenblick sprengten ungefähr zehn, mit Säbeln und langen Lanzen bewaffnete Reiter im Galopp in das Thal und auf den Paß von Las-Cumbres zu.
»Soldaten des Präsidenten von Vera-Cruz,« murmelte der junge Man »was hat Das zu bedeuten?«
»Wartet,« versetzte der Abenteurer.
Bald wurde das Rollen eines Wagens vernehmbar und eine durch ein Gespann von sechs Mauleseln gleich einem Sturmwind dahergetragene Berline erschien.
»Verdammt,« rief der Abenteurer mit einer Geberde des Zorns, als er den Wagen bemerkte.
Der junge Mann blickte seinen Gefährten an; dieser war bleich wie eine Leiche, ein convulsivisches Zittern ging durch alle seine Glieder.
»Was habt Ihr denn?« fragte voller Interesse der Graf.
»Nichts,« antwortete der Andere trocken, »blicket hin ...«
Hinter, dem Wagen folgte demselben in geringer Entfernung eine Abtheilung Soldaten, die auf ihrem Wege ganze Wogen von Staub aufwühlten.
Darauf verloren sich Reiter und Berline in den Paß, worin sie bald darauf verschwanden.
»Teufel,« meinte lachend der junge Mann, »das wenigstens sind vorsichtige Reisende; sie laufen keine Gefahr, geplündert zu werden.«
»Glaubt Ihr?« versetzte Olivier im Tone beißender Ironie. »Nun! Ihr seid im Irrthum, sie werden im Gegentheil noch vor einer Stunde, und wahrscheinlich durch die zu ihrer Vertheidigung bezahlten Soldaten angegriffen werden.«
»Geht doch, das ist nicht möglich.«
»Wollt Ihr es sehen?«
»Ja, der seltenen Thatsache wegen.«
»Allein, nehmt Euch dabei in Acht; vielleicht kostet es Pulver.«
»Ich hoffe es in der That.«
»So seid Ihr entschlossen, diese Reisenden zu vertheidigen?«
»Gewiß, wenn man sie angreift.«
»Ich wiederhole Euch, daß man sie angreifen wird.«
»Auf denn, zur Schlacht!«
»Gut denn, Ihr seid ein braver Cavalier.«
»Beunruhigt Euch meinetwegen nicht; wo Ihr bleiben werdet, bleibe ich auch.«
»So mit Gottes Hülfe! Wir haben gerade noch die nöthige Zeit um hin zu kommen, wachet über Euer Pferd, denn bei meiner Seele, wir werden einen Ritt machen, wie Ihr noch nie einen erlebt.«
Die beiden Reiter neigten sich auf den Hals ihrer Pferde, drückten denselben die Sporen in die Seiten und sprengten den Reisenden nach.
II.
Die Reisenden.
Zu jener Zeit, in der sich unsere Geschichte ereignet, unterlag Mexiko einer seiner schrecklichen Krisen, deren periodische Wiederkehr dieses unglückliche Land allmählich in die äußerste Noth versetzt hat, aus welcher sich allein wieder zu erheben, es ohnmächtig ist. Hier in wenigen Worten die Thatsachen, welche sich ereignet hatten.
Der General Zulaoga, zum Präsidenten der Republik ernannt, hatte eines Tages, man weiß nicht weshalb, die Last für seine Schultern zu schwer gefunden und zu Gunsten des Generals Don Miguel Miramon abgedankt, der dem zufolge zum interimistischen Präsidenten ernannt worden war. Dieser, ein energischer und überdies sehr ehrgeiziger Mann, hatte seine Herrschaft in Mexiko begonnen, indem er vor Allem Sorge trug, seine Ernennung zur ersten obrigkeitlichen Würde des Landes durch den Congreß, der ihn einstimmig erwählt hatte, bestätigen zu lassen.
Miramon war also nach Recht und Gesetz rechtmäßiger interimistischer Präsident, das heißt für die Zeit, welche noch vor den allgemeinen Wahlen verfließen mußte.
So standen die Sachen eine geraume Zeit, aber Zulaoga, ohne Zweifel durch die Unbedeutendheit, in welcher er lebte, gelangweilt, änderte eines schönen Tages seine Meinung, und in einem Augenblicke, wo man es am Wenigsten erwartete, verbreitete er unter dem Volke eine Proclamation, verständigte sich mit den Parteigängern Juarez', – welche Letzterer bei der Abdankung Zulaoga's in seiner Eigenschaft als Vicepräsident, den eingesetzten Nachfolger nicht anerkannt und sich durch eine sogenannte nationale Junta zum constitutionellen Präsidenten in Vera-Cruz hatte erwählen lassen – und erließ eine Verordnung, nach welcher er seine Abdankung zurücknahm, Miramon seiner ihm anvertrauten Macht enthob und sie von Neuem selbst zu übernehmen erklärte.
Miramon schenkte dieser ungewöhnlichen Erklärung nur geringe Beachtung; stark in seinem Recht, welches er zu haben glaubte und welches der Congreß sanctionirt hatte, begab er sich allein nach dem, von dem General Zulaoga bewohnten Hause, bemächtigte sich seiner Person und zwang ihn, ihm zu folgen, indem er mit spöttischem Lächeln sagte:
»Da Ihr die Macht wieder zu übernehmen wünscht, will ich Euch lehren, wie man Präsident der Republik wird.«
Und ihn als Geißel behaltend, obgleich er ihn mit der größten Rücksicht behandelte, nöthigte er ihn, ihn auf einem Feldzug zu begleiten, welchen er in die Provinzen des Innern, nach Guadalajara zu, gegen die Generäle der entgegengesetzten Partei unternahm, die, wie wir bereits erwähnt haben, den Namen der Constitutionellen angenommen hatten.
Zulaoga leistete keinen Widerstand; er ergab sich anscheinend in sein Schicksal, ja, er ging so weit, sich gegen Miramon zu beklagen, daß er ihn nicht ein Commando in seiner Armee anvertraute. Dieser ließ sich durch seine scheinbare Ergebung täuschen und versprach ihm, daß bei der ersten Schlacht sein Wunsch befriedigt werden sollte. Aber eines schönen Morgens, waren Zulaoga und die Generaladjutanten, die man ihm beigegeben hatte, vielmehr um ihn zu bewachen, als ihm eine Ehre zu erweisen, plötzlich verschwunden und man vernahm einige Tage später, daß sie sich zu Juarez geflüchtet hatten, von wo Zulaoga von Neuem gegen die Gewalt, deren Opfer er gewesen war, zu protestiren und neue Verordnungen gegen Miramon zu erlassen begann.
Juarez ist ein hinterlistiger, schlauer und tiefer Verstellung fähiger Indianer; ein geschickter Staatsmann, ist er der einzige Präsident der Republik, welcher seit der Unabhängigkeitserklärung nicht zur Armee gehört. Hervorgegangen aus den niedrigsten Schichten der mexikanischen Gesellschaft, erhob er sich allmählich kraft seiner Zähigkeit bis zu dem hohen Posten, welchen er heute einnimmt. Da er den Charakter der Nation, welche er zu regieren behauptet, besser als irgend Jemand kennt, so weiß auch keiner den Leidenschaften des Volkes so gut zu schmeicheln und den Enthusiasmus der Massen so zu erregen wie er. Mit einem unmäßigen Ehrgeiz begabt, den er sorgfältig unter dem düsteren Scheine einer tiefen Liebe zum Vaterlande verbirgt, war es ihm gelungen, sich nach und nach eine Partei zu schaffen, welche zu der Zeit, von der wir reden, furchtbar geworden war. Der constitutionelle Präsident hatte seine Stadthalterschaft in Vera-Cruz errichtet und kämpfte aus der Tiefe seines Cabinets durch seine Generäle gegen Miramon.
Obwohl er von keiner Macht als der der vereinigten Staaten anerkannt wurde, so handelte er dennoch, als ob er der wirklich rechtmäßige Bevollmächtigte der Nation gewesen wäre; der Beitritt Zulaoga's, den er im Grunde seines Herzens wegen seiner Feigheit und Nichtigkeit verachtete, lieferte ihm die Waffe in die Hand, deren er benöthigt war, um seine Pläne zu einem guten Ende zu führen. Er machte es gleichsam zu einem Schutz für seine Partei, indem er forderte, daß Zulaoga zuvor in die Macht, aus welcher ihn Miramon verdrängt, wieder eingesetzt und alsdann zu neuen Wahlen geschritten werden sollte. Uebrigens zögerte Zulaoga nicht, ihn als den einzigen, durch die freie Wahl der Bürger rechtmäßigen Präsidenten feierlichst anzuerkennen.
Die Frage war klar ausgesprochen: Miramon repräsentirte die conservative Partei, das heißt die der Geistlichkeit, der großen Grundbesitzer und des Handels; Juarez dagegen die absolut demokratische Partei.
Der Krieg nahm damals furchtbare Dimensionen an. Leider braucht man zum Kriegführen Geld, und Geld war es, was Juarez gänzlich fehlte, und zwar aus folgenden Gründen:
In Mexiko ist das öffentliche Vermögen nicht in den Händen der Regierung concentrirt; jeder Staat, jede Provinz behält das Recht der freien Verfügung und Verwaltung der Privatbesitzungen der Städte, welche einen Theil seines Gebietes ausmachen. Anstatt daß die Provinzen also von der Regierung abhängen, sind diese und die Hauptstadt dem Joche der Provinzen unterworfen, welche, sobald sie sich empören, die Subsidien einbehalten und die Gewalt in eine kritische Lage bringen. Ferner befinden sich zwei Dritttheile des öffentlichen Vermögens in den Händen der Geistlichkeit, die sich wohl hütet, etwas davon wieder herauszugeben, und welche, da sie weder Abgaben noch Verbindlichkeiten irgend welcher Art zahlt, sich begnügt, ihr Geld zu ziemlich hohen Zinsen auszuleihen und erlaubten Wucher damit zu treiben, was sie noch mehr bereichert, ohne daß sie jemals ihr Capital riskirt.
Juarez, obwohl Herr von Vera-Cruz, befand sich also in einer sehr schwierigen Lage; aber er ist vor allen Dingen ein Mann, der sich zu helfen weiß, und um das Geld aufzutreiben, welches ihm fehlte, war er durchaus nicht in Verlegenheit. Er begann damit, auf den Zoll in Vera-Cruz Beschlag zu legen, dann bildete er Cuadrillas oder Guerillas, die sich keinen Scrupel machten, die Haciendas der Anhänger Miramon's, der in dem Lande wohnenden, größtentheils reichen Spanier und Fremden aller Nationen, bei denen sie etwas Gutes zu finden hofften, zu überfallen. Mit diesen Thaten begnügten sich diese Guerillas nicht einmal: sie unternahmen es sogar, die Reisenden zu plündern und die Eisenbahnzüge zu überfallen; man glaube nicht, daß wir die Thatsachen vergrößern, im Gegentheil wir stellen sie geringer dar. Um gerecht zu sein, müssen wir hinzufügen, daß Miramon seinerseits es nicht daran fehlen ließ, dieselben Mittel anzuwenden, sobald sich die Gelegenheit dazu bot, aber sie war selten, seine Lage war nicht so abenteuerlich wie die Juarez', um mit wirklichem Nutzen in trübem Wasser zu fischen.
Allerdings handelten die Guerillas anscheinend aus eigenem Antrieb, was die beiden Regierungen höchlichst mißbilligten, die sogar bei gewissen Gelegenheiten mit Strenge gegen sie einzuschreiten schienen, indessen war der Schleier so durchsichtig, daß diese Comödie Niemand täuschte.
Mexiko war demnach in der That in eine unendliche Räuberhöhle umgestaltet, in welcher die Hälfte der Bevölkerung die andere beraubte und mordete.
Dies war die politische Lage des unglücklichen Landes zu der Zeit, von der wir sprechen; zweifelhaft ist es, ob sie sich seitdem sehr geändert hat, wofern sie nicht noch schlimmer geworden ist.
An demselben Tage, wo unsere Geschichte ihren Anfang nimmt, zur Zeit, als die noch unter dem Horizonte befindliche Sonne das tiefe Blau des Himmels mit ihren goldigen und purpurnen Strahlen zu färben begann, bot ein aus Schilfrohr errichteter Rancho, der, trotzdem er ziemlich geräumig war, einem Hühnerkorbe glich, in einer so frühen Morgenstunde einen seltsam belebten Anblick dar.
Dieser mitten in einer köstlichen Gegend, kaum einige Schritte von dem Rincon-Grande erbaute Rancho war seit Kurzem in eine Venta oder Herberge verwandelt worden für solche Reisende, die durch die Nacht überrascht oder welche aus irgend einem andern Grunde es vorzogen, daselbst Halt zu machen, anstatt bis zur Stadt ihren Weg fortzusetzen.
Auf einem ziemlich großen vor der Venta freigelassenen Raum waren im Halbkreis die Ballen mehrer Frachtfuhren mit einer gewissen Symmetrie übereinander aufgeschichtet, in der Mitte dieses Kreises kauerten die Arrieros neben dem Feuer und dörrten Tasajo zu ihrem Frühstück oder reparirten die Saumsättel ihrer Pferde, die, gruppenweiß vertheilt, ihren auf die Erde geschütteten Vorrath von Mais verzehrten. Eine mit Koffern und Schachteln beladene Berline war etwas seitwärts in einem Schuppen untergebracht und stand neben einem Postwagen, der durch einen Unfall an einem seiner Räder gezwungen gewesen, an diesem Orte Halt zu machen. Mehrere Reisende, welche die Nacht, in ihre Zarape gehüllt, unter freiem Himmel zugebracht hatten, erwachten aus ihrem Schlummer, andere gingen, ihre Papelitos rauchend, auf und ab, während einige Lebhaftere bereits ihre Pferde gesattelt hatten und nach verschiedenen Richtungen im Galopp davon sprengten.
Bald darauf kam der Kutscher der Post unter seinem Wagen hervor, wo er, tief im Grase vergraben, geschlafen hatte, gab seinen Thieren zu fressen, verband ihre durch das Geschirr geriebenen Wunden, spannte sie ein und begann daraus seine Passagiere zusammenzurufen. Diese, durch sein Geschrei erweckt, kamen schlaftrunken aus der Venta hervor und schickten sich an, ihre Plätze im Wagen einzunehmen. Es waren neun Personen; außer zwei europäisch gekleideten und leicht für Franzosen zu erkennenden Individuen, trugen alle Andern die mexikanische Tracht und schienen wirkliche hijos de pays, das heißt Kinder des Landes zu sein.
In dem Augenblick, wo der Kutscher oder Mayoral, ein Amerikaner reinen nordischen Blutes, – nachdem es ihm vermittelst einiger mit schlechtem Spanisch untermischten Yankéeflüche, gelungen war, seine Reisenden, so gut es ging, in seinen durch die Stöße des Weges halb verstauchten Wagen unterzubringen, die Zügel ergriff, um aufzubrechen, ließ sich der Galopp von Pferden mit Säbelgeklirr vermischt, vernehmen und eine Reitertruppe, in fast militairischer, aber sehr defecter Tracht, machte vor dem Rancho Halt.
Diese aus einigen zwanzig Männern mit wahren Galgengesichtern bestehende Truppe war von einem Alferez oder Unterlieutenant commandirt, der ebenso armselig wie seine Soldaten gekleidet war, dessen Waffen jedoch nichts zu wünschen übrig ließen.
Dieser Officier war ein langer, magerer und nerviger Mann, mit tückischer Physiognomie, schielendem Blick und rußiger Hautfarbe.
»Holla! Gevatter,« rief er dem Mayoral zu, »Ihr brecht sehr früh auf, scheint mir.«
Der einen Augenblick vorher so grobe Yankee war plötzlich wie umgewandelt; er verbeugte sich demüthig mit verstelltem Lächeln und antwortete mit einer schleppenden, einfältigen Stimme, indem er eine große Freude, – die er wahrscheinlich nicht empfand, – zur Schau trug.
»Ah! Valga me dios! das ist ja der Sennor Don Jesus Dominguez! Welch' glückliches Zusammentreffen! Eine so große Freude hätte ich mir diesen Morgen nicht träumen lassen; kommt Eure Herrlichkeit, um die Post zu escortiren?«
»Nein, heute nicht; eine andere Pflicht führt mich her.«
»Oh! Eure Herrlichkeit hat ganz recht, meine Passagiere verdienen keineswegs eine so ehrenvolle Begleitung; es sind Costenos, die mir nicht sehr reich zu sein scheinen, überdies werde ich gezwungen sein, wenigstens auf einige Stunden in Orizaba zu verweilen, um meinen Wagen zu repariren.«
»Dann lebt wohl und geht zum Henker!« antwortete der Officier.
Der Mayoral zögerte einen Augenblick, worauf er, anstatt dem Befehl zum Aufbruch Folge zu leisten, schnell von dem Bock stieg und sich dem Officier näherte.
»Ihr habt mir irgend eine Nachricht zu geben, nicht wahr, Gevatter« sagte dieser.
»Ja, Sennor« antwortete der Mayoral, verstellt lachend.
»Ah! ah!« meinte der Andere, »und was ist das für eine? Ist sie gut oder schlecht?«
»Der Rayo ist auf dem Wege nach Mexiko voran.«
Der Officier schauderte unmerklich bei dieser Eröffnung, aber sich sogleich wieder beherrschend, sagte er:
»Ihr seid im Irrthum.«
»Ah! doch nicht; ich habe ihn gesehen, wie ich Euch sehe.«
Der Officier schien einige Minuten zu überlegen.
»Es ist gut, Gevatter, ich danke Euch; ich werde meine Vorsichtsmaßregeln treffen. Und Eure Passagiere?«
»Es sind arme Tröpfe, außer den beiden Dienern eines französischen Grafen, dessen Koffer und Kisten allein den ganzen Wagen ausfüllen, die Andern sind nicht der Mühe werth, daß man sich mit ihnen beschäftigt. Habt Ihr die Absicht, sie zu visitiren?«
»Ich bin noch nicht dazu entschlossen, werde es mir jedoch überlegen.«
»Nun, Ihr werdet schon handeln, wie Ihr es für gut findet. Verzeiht, wenn ich Euch jetzt verlasse, Sennor Don Jesus; meine Passagiere werden unruhig, ich muß aufbrechen.«
»Auf Wiedersehen denn!«
Der Mayoral bestieg seinen Sitz; peitschte auf die Maulesel und der Wagen rollte mit einer Schnelligkeit dahin, die wenig beruhigend für Diejenigen war, welche er umschloß und die bei jeder Wendung des Weges Gefahr liefen, ihre Knochen zu zerbrechen.
Sobald der Officier sich allein sah, näherte er sich dem mit dem Messen des Mais beschäftigten Venturo und fragte in hochmüthiger Weise:
»Habt Ihr nicht einen spanischen Caballero und eine Dame hier?«
»Ja,« antwortete der Venturo, indem er den Kopf mit einer mit Furcht gemischten Ehrerbietung entblößte, »ja, Herr Officier, ein ziemlich bejahrter Caballero ist gestern in Begleitung einer ganz jungen Dame etwas nach Sonnenuntergang in jener Berline, die Ihr dort vor der Thür des Rancho erblickt, angekommen; sie hatten eine Eskorte bei sich. Nach Dem, was die Soldaten gesagt haben, kommen sie von Vera-Cruz und begeben sich nach Mexiko.«
»Es ist so, ich bin gesandt, um ihnen bis Puebla-de-Los-Angelos als Eskorte zu dienen; aber sie scheinen es nicht eilig zu haben; dennoch wird der Tag lang werden und sie würden nicht übel daran thun, sich zu beeilen.«
In diesem Augenblick öffnete sich eine innere Thür, ein reich gekleideter Mann trat in den gemeinschaftlichen Raum und nachdem er leicht seinen Hut gelüftet und dabei sein Ave Maria purissima ausgesprochen hatte, schritt er auf den Officier zu, der ihm, sobald er ihn erblickte, einige Schritte entgegen ging.
Diese neue Persönlichkeit war ein noch rüstiger Mann von ungefähr fünf und fünfzig Jahren; seine Gestalt war hoch und elegant, seine Gesichtszüge schön und edel, ein Ausdruck von Offenheit und Güte lag über seiner Physiognomie verbreitet.
»Ich bin Don Antonio de Carrera,« sagte er, den Officier anredend, »ich habe die Worte, die Ihr mit unserem Wirth austauschtet, gehört und glaube, die Person zu sein, welche Ihr zu eskortiren, den Auftrag habt, Herr.«
»In der That, Sennor Caballero,« erwiderte höflich der Unterlieutenant, »der von Euch ausgesprochene Name ist allerdings der in meiner Ordre befindliche; ich erwarte daher Eure Befehle.«
»Ich danke Euch, Sennor, meine Tochter ist etwas leidend, ich müßte fürchten, wenn wir so früh aufbrechen, daß ihre zarte Gesundheit einer Krankheit unterliegen würde; wenn es Euch daher nicht ungelegen kommt, so werden wir noch einige Stunden hier bleiben und erst nach unserem Frühstück, welches Ihr mit uns zu theilen mir die Ehre erweisen werdet, abreisen.«
»Ich danke Euch vielmals, Caballero,« versetzte der Officier, indem er sich höflich verbeugte, »aber ich bin nur ein einfacher Soldat, dessen Gesellschaft einer Dame nicht angenehm sein würde; Ihr wollt mich daher gütigst entschuldigen, wenn ich Eure freundliche Einladung ablehne, für welche ich indessen eben so dankbar bin, als wenn ich sie annähme.«
»Ich bestehe nicht darauf, Herr, obwohl es mir schmeichelhaft gewesen wäre, Euch als Gast zu haben; so ist es also abgemacht; nicht wahr, daß wir noch hier bleiben werden.«
»So lange es Euch beliebt, Sennor, ich wiederhole, ich bin ganz zu Eurem Befehl.«
Nach diesem wechselseitigen Austausch freundlicher Redensarten trennten sich die Beiden; der Greis trat wieder in das Innere des Rancho und der Officier ging hinaus, um das Bivouac seiner Truppe einzurichten.
Die Soldaten sprangen von ihren Pferden, befestigten dieselben an einen Pfahl und begannen, ihre Cigarre rauchend, auf und ab zu gehen, indem sie Alles mit jener den Mexikanern eigenthümlichen unruhigen Neugier betrachteten.
Indessen hatte der Officier leise einem Soldat einige Worte zugeflüstert, und dieser, anstatt dem Beispiel seiner Gefährten zu folgen, war wieder zu Pferde gestiegen und im Galopp davon geritten.
Gegen zehn Uhr Morgens spannten die Diener des Don Antonio de Carrera die Pferde vor die Berline, worauf einige Minuten später der Greis erschien.
Er führte eine Dame am Arme, die dergestalt in ihren Schleier und Mantel eingehüllt war, daß man buchstäblich nichts von ihrem Gesicht erkennen, noch die Eleganz ihrer Gestalt errathen konnte.
Sobald die junge Dame bequem in der Berline untergebracht war, wendete sich Don Antonio zu dem Officier, der sich ihm rasch genähert hatte.
»Wir wollen aufbrechen, wenn es Euch recht ist, Herr Lieutenant,« sagte er.
Don Jesus verneigte sich zustimmend.
Die Eskorte schwang sich in den Sattel, der Greis stieg in die Berline, deren Schlag von einem Diener geschlossen wurde, welcher sich darauf an die Seite des Kutschers setzte; vier andere wohl bewaffnete Diener nahmen ihren Platz hinter dem Wagen ein.
»Vorwärts,« rief der Officier.
Die Hälfte der Eskorte bildete die Vorhut, die andere Hälfte die Nachhut; der Kutscher trieb durch Peitschenhiebe seine Pferde an und Wagen und Reiter, in rasendem Galopp davongetragen, verschwanden in einer Staubwolke.
»Gott schütze ihn!« murmelte der Venturo, indem er sich bekreuzte und in seiner Hand zwei Goldunzen klingen ließ, die ihm Don Antonio gegeben hatte; »dieser Greis ist ein würdiger Edelmann; unglücklicher Weise ist Don Jesus bei ihm und ich fürchte sehr, daß seine Begleitung ihm Unheil bringt.«
III.
Die Salteadores.
So rollte die Berline, von ihrer Escorte umgeben, auf dem Wege nach Orizaba dahin. Aber in geringer Entfernung von dieser Stadt schlug sie einen Seitenweg ein, welcher sich mit dem Wege von Puebla vereinigte, und fuhr, während die beiden Reisenden in eine Unterhaltung vertieft waren, auf die Pässe von Las-Cumbres zu.
Die Dame, welche den Greis begleitete, war ein junges Mädchen von höchstens sechszehn bis siebzehn Jahren; ihre feinen, zarten Züge, ihre blauen Augen, deren lange Wimpern beim Niederblicken einen dunklen Halbkreis auf ihre sammetartigen Wangen zeichneten, ihre gerade Nase mit rosigen Flügeln, ihr kleiner Mund, dessen halbgeöffnete Korallenlippen eine doppelte Perlenreihe zeigte, ihr durch ein Grübchen getheiltes Kinn, ihr bleicher Teint, dessen Weiße noch matter erschien durch die seidenweichen, dunklen Locken, die ihr Gesicht umrahmten und auf ihre Schultern fielen, gaben ihr eine jener seltsamen und sympathischen Physiognomieen, wie sie allein die Aequinoctialländer hervorbringen und die, ohne die Zartheit unserer spröden Schönheiten der kalten Klimate des Nordens zu besitzen, jene unwiderstehliche Anziehungskraft haben, welche uns in der Frau den Engel träumen läßt und nicht allein Liebe, sondern selbst Anbetung hervorruft.
Anmuthig in eine Ecke des Wagens zurückgelehnt, halb in den Falten des Schleiers verborgen, ließ sie mit träumerischem Ausdruck ihre Blicke über die Landschaft schweifen, indem sie nur einsylbig und mit zerstreuter Miene die Reden ihres Vaters beantwortete.
Obwohl der Greis eine gewisse Sicherheit zur Schau trug, so schien er dennoch ziemlich unruhig.
»Sieh, Dolores,« sagte er, »dies Alles ist nicht recht klar; trotz der wiederholten Versicherungen der Häupter der Regierung von Vera-Cruz, und des Schutzes, mit dem sie mich dem Anscheine nach umgeben, habe ich kein Vertrauen zu ihnen.«
»Warum denn nicht, mein Vater?« fragte nachlässig das junge Mädchen.
»Aus tausend Gründen; hauptsächlich weil ich ein Spanier bin, und Du weißt, daß leider in unserer jetzigen Zeit dieser Name ein Grund mehr zu dem Haß der Mexikaner gegen alle Europäer im Allgemeinen ist.«
»Das ist nur zu wahr, mein Vater, aber erlaubt mir eine Frage.«
»Sprich, Dolores, ich höre.«
»Wohlan, ich wünschte, daß Ihr mir den so dringenden Beweggrund mittheiltet, der Euch veranlaßt hat, so plötzlich Vera-Cruz zu verlassen und mich auf dieser Reise mitzunehmen, wo ich Euch doch sonst nie auf Euren Auflügen begleiten durfte.«
»Der Grund ist sehr einfach, mein Kind, ernste Interessen erfordern meine Anwesenheit in Mexiko, wohin ich mich so schnell als möglich begeben muß; anderntheils bewölkt sich der politische Horizont von Tag zu Tage mehr, und so glaubte ich, daß der Aufenthalt in unserer Hacienda-del-Arenal in kurzer Zeit für unsere Familie gefährlich werden könnte. Ich beabsichtige Dich daher in Puebla zu lassen bei unserm Verwandten, Don Louis de Pezal, dessen Pathe Du bist und der Dich sehr liebt, dann nach Arenal zu gehen, Deinen Bruder Melchior zu holen, und diesen mit Dir nach der Hauptstadt zu bringen, wo es uns leicht sein wird, einen wirklichen Schutz zu finden, in dem leider voraus zu sehenden Falle, daß, ich will nicht sagen eine neue Revolution, – denn wir unterliegen derselben schon seit langer Zeit – wohl aber eine Sündfluth losbrechen sollte die plötzlich die constituirte Macht umstoßen würde, um daselbst die von Vera-Cruz einzusetzen.«
»Und Ihr hattet keinen andern Grund als diesen, mein Vater?« fragte das junge Mädchen, sich mit einem leichten Lächeln halb vorbeugend.
»Welchen andern Grund, als den Dir eben angeführten, sollte ich haben, meine liebe Dolores?«
»Ich weiß es nicht, mein Vater, deshalb frage ich Euch.«
»Du bist ein neugieriges Mädchen,« erwiderte er und drohte ihr lachend mit dem Finger, »Du möchtest wohl gern mich zum Geständniß meines Geheimnisses bringen?«
»Es giebt also ein Geheimniß, mein Vater?«
»Es ist möglich, aber jetzt mußt Du Dich begnügen, denn ich werde es Dir nicht sagen.«
»Wirklich, mein Vater?«
»Gewiß, ich gebe Dir mein Wort.«
»Oh! dann bestehe ich nicht weiter darauf; ich weiß nur zu wohl, daß Ihr dann böse werdet und Eure Stirn runzelt, und da ist alles Bitten vergeblich.«
»Du bist thöricht, Dolores.«
»Das ist einerlei; ich hätte so gern wissen mögen, weshalb Ihr einen falschen Namen für diese Reise angenommen habt?«
»Oh! das will ich Dir sagen: mein Name ist zu bekannt als der eines reichen Mannes, als daß ich es wagen sollte, ihn auf Wegen zu tragen, die von Banditen wimmeln.«
»Habt Ihr keinen andern Grund gehabt als diesen?« »Keinen andern, liebes Kind; ich glaube, er ist hinreichend, und die Vorsicht allein mußte mich veranlassen, so zu handeln, wie ich es gethan habe.«
»Mag sein, mein Vater,« antwortete sie kopfschüttelnd und mit schmollender Miene; »aber,« rief sie plötzlich, »blicket hinaus, mein Vater, es scheint mir, als gehe der Wagen langsamer.«
»In der That,« versetzte der Greis, »was bedeutet Das?«
Er ließ das Wagenfenster nieder und blickte hinaus, aber er sah nichts, die Berline war in diesem Augenblicke in den Paß von Las-Cumbres eingefahren und der Weg machte so zahlreiche Biegungen, daß der Blick nicht weiter als fünf und zwanzig bis dreißig Schritt vor oder rückwärts zu dringen vermochte.
Der Greis rief darauf einen der Diener herbei, die dem Wagen unmittelbar folgten.
»Was giebt es denn, Sanchez?« fragte er; »es scheint mir, als führen wir nicht mehr so schnell.«
»In der That, Sennor,« versetzte Sanchez; »seitdem wir die Ebene verlassen haben, kommen wir nicht mehr so rasch vorwärts, ohne daß ich die Ursache davon kenne; die Soldaten unserer Escorte scheinen unruhig zu sein, sie sprechen leise mit einander und schauen unaufhörlich um sich; es ist augenscheinlich, daß sie irgend eine Gefahr befürchten.«
»Sollten die Salteadores oder Guerrillas, welche die Wege unsicher machen, uns angreifen wollen?« sprach der Greis mit schlecht verhehlter Unruhe; »erkundigt Euch doch, Sanchez. Der Ort wäre allerdings zu einem Ueberfall gut gewählt, indessen unsere Escorte ist zahlreich und wofern sie nicht mit den Banditen einverstanden ist, zweifle ich, daß diese es wagen sollten, uns den Weg zu versperren. Seht zu, Sanchez, sucht die Soldaten auszuforschen und stattet uns von Dem, was Ihr gehört, Rapport ab.«
Der Diener verneigte sich, hielt den Zügel an und ließ den Wagen vorüber, dann schickte er sich an, den erhaltenen Auftrag auszuführen.
Aber Sanchez kehrte fast augenblicklich zu der Berline zurück; seine Miene war bestürzt, seine keuchende Stimme kam pfeifend zwischen seinen vor Schreck zusammengepreßten Zähnen hervor, eine leichenartige Blässe bedeckte sein Gesicht.
»Wir sind verloren, mein Gebieter,« murmelte er, indem er sich zu dem Wagenschlag neigte.
»Verloren!« rief der Greis mit nervösem Schauder, indem er einen Blick auf seine vor Entsetzen stumme Tochter warf, – ein Blick, welcher die ganze Leidenschaft der väterlichen Liebe enthielt – »verloren! Ihr seid närrisch, Sanchez, erklärt Euch, um's Himmelwillen.«
»Es ist nicht nöthig, Sennor,« antwortete der arme Tropf stammelnd. »Hier kommt Sennor Don Jesus Dominguez, der Anführer der Escorte, ohne Zweifel will er Euch von Dem in Kenntniß setzen, was vorgeht.«
»Er möge kommen! Bei meiner Seele, eine Gewißheit, so schrecklich sie auch sei, ist besser als solche Angst.«
Der Wagen hatte auf einer Art Plattform von hundert Meter im Quadrat, Halt gemacht; der Greis warf einen raschen Blick hinaus. Die Escorte umgab noch immer die Berline, allein sie schien sich verdoppelt zu haben: anstatt zwanzig Reiter waren es deren vierzig.
Der Reisende begriff, daß er in einen Hinterhalt gefallen, daß jeder Widerstand Wahnsinn sein würde und ihm keine andere Chance blieb, als sich zu unterwerfen. Da er indessen trotz seines Alters noch rüstig, und mit einem entschlossenen Charakter und energischer Seele begabt war, so hielt er sich nicht auf den ersten Stoß für besiegt und beschloß, einen Versuch zu machen, sich so gut als möglich aus seiner schlimmen Lage zu ziehen.
Nachdem er seine Tochter zärtlich geküßt, ihr anempfohlen hatte, ruhig zu bleiben und sich in Nichts, was vorgehen würde, zu mischen, öffnete er den Schlag und sprang ziemlich behend auf den Weg, einen Revolver in jeder Hand.
Obwohl die Soldaten von dieser Handlung überrascht waren, machten sie keine Bewegung um sich gegen ihn zu vertheidigen, sondern standen unbeweglich in Reihe und Glied.
Die vier Diener des Reisenden stellten sich ohne Zögern hinter ihren Herrn, jeder mit einem Carabiner bewaffnet und bereit, auf Befehl ihres Gebieters Feuer zu geben.
Sanchez hatte die Wahrheit gesagt: Don Jesus Dominguez sprengte im Galopp heran; aber er war nicht allein, ein anderer Reiter begleitete ihn.
Dieser war ein untersetzter, dicker Mann, mit finstern Zügen und schielendem Blick, dessen röthliche Hautfarbe ihn für einen Indianer reinster Race erkennen ließ; er trug die reiche Kleidung eines Obristen der regulären Armee.
Der Reisende erkannte sogleich diese unheilverkündende Persönlichkeit als Don Felippe Neri Irzabal, einer der Befehlshaber der Guerrillas der Partei Juarez'; er hatte ihn in Vera-Cruz einige Male gesehen.
Mit einem nervösen Zittern und Schaudern erwartete der Greis die Ankunft der beiden Männer, indessen sobald sie sich nur noch einige Schritte von ihm befanden, war er der Erste, der das Wort ergriff.
»Holla, Caballeros,« rief er ihnen in stolzem Tone zu, »was bedeutet dies, und weshalb nöthigt Ihr mich, auf diese Weise meine Reise zu unterbrechen?«
»Ihr werdet es hören, lieber Herr,« antwortete höhnisch der Guerrillero; »und damit Ihr gleich wißt, woran Ihr Euch zu halten habt, so verhafte ich Euch im Namen des Vaterlandes.«
»Ihr verhaftet mich? Ihr?« rief der Greis, »und mit welchem Recht?«
»Mit welchem Recht?« versetzte der Andere mit einem Unglück verheißenden Hohnlachen, » vive Christo! Ich könnte Euch antworten, wenn es mir beliebte, mit dem größten Rechte und dieser Grund würde völlig entscheidend sein, denke ich.«
»In der That,« entgegnete der Reisende mit scherzender Stimme, »ich vermuthe, das ist das Einzige, was Ihr angeben könnt.«
»Nun, Ihr seid im Irrthum, mein edler Herr; das werde ich nicht angeben, ich verhafte Euch als Spion, des Hochverraths überführt.«
»Geht doch, Sennor Colonel, Ihr seid närrisch, ich ein Spion und Verräther!«
»Sennor, schon seit langer Zeit hat die Regierung des vortrefflichen Herrn Präsidenten Juarez ein Auge auf Euch; Eure Schritte sind überwacht worden, man weiß, aus welchem Grunde Ihr so schleunig Vera-Cruz verlassen habt und zu welchem Zwecke Ihr nach Mexiko geht.«
»Ich begebe mich wegen Handelsgeschäfte nach Mexiko und der Präsident weiß es wohl, weil er selbst meinen Geleitsbrief unterzeichnet und mir zur Begleitung gütigst eine Escorte bewilligt hat, noch bevor ich nöthig hatte, dieselbe von ihm zu erbitten.«
»Alles dies ist wahr, Sennor; unser großmüthiger Präsident, welcher stets strengen Maßregeln abgeneigt ist, wollte Euch nicht verhaften lassen, er zog es aus Rücksicht für Euer weißes Haar vor, Euch die Mittel zur Flucht zu lassen. Aber Euer letzter Verrath hat das Maß voll gemacht und der Präsident hat, sich Gewalt anthuend, die Nothwendigkeit erkannt, ohne Zögern mit Strenge gegen Euch einzuschreiten. Ich bin zu Eurer Verfolgung abgesandt, mit dem Befehl, Euch zu verhaften; diesen Befehl führe ich aus.«
»Und darf ich wissen, welches Verrathes man mich anklagt?«
»Besser als irgend Jemand müßt Ihr, Don Andrès de-la-Cruz, die Beweggründe kennen, welche Euch veranlaßt haben, den Namen eines Don Antonio de Carrera anzunehmen.«
Don Andrès, denn dies war in Wahrheit sein Name, wurde durch diese Eröffnung niedergeschmettert; nicht daß er sich schuldig fühlte, denn der Wechsel des Namens war nur mit Genehmigung des Präsidenten bewirkt worden, aber er war bestürzt über die Falschheit der Leute, welche ihn verhafteten und welche, aus Mangel an bessern Gründen, sich dieses Umstands bedienten und ihn in eine schändliche Schlinge lockten, um sich eines Vermögens zu bemächtigen, nach dem es ihnen seit langer Zeit gelüstete.
Dennoch beherrschte Don Andrès seine Bewegung und sich von Neuem zu dem Guerrillero wendend, sagte er:
»Hütet Euch in Dem, was Ihr thut, Sennor Colonel, ich bin kein Neuling, ich werde mich nicht berauben lassen, ohne mich zu beklagen, es giebt in Mexiko einen spanischen Gesandten, welcher mir Gerechtigkeit zu verschaffen wissen wird.«
»Ich weiß nicht, was Ihr damit sagen wollt,« antwortete unerschütterlich Don Felippe; »wenn es Sennor Pachero ist, von dem Ihr sprecht, so wird Euch sein Schutz, glaube ich, nicht viel nützen; dieser Caballero, der sich für den Gesandten ihrer Majestät der Königin von Spanien ausgiebt, hat es für gut befunden, die Regierung des Verräthers Miramon anzuerkennen. Wir Andern haben also mit ihm nichts zu schaffen und sein Einfluß bei dem Nationalpräsidenten ist vollständig werthlos; überdies habe ich nicht mit Euch zu streiten, – was auch geschehe, ich verhafte Euch. Wollt Ihr Euch ergeben oder gedenkt Ihr mir einen unnützen Widerstand zu leisten? Antwortet.«
Don Andrès warf einen Blick auf die Männer, die ihn umgaben, er sah ein, daß er außer von seinen Dienern, von Niemand Hülfe oder Schutz zu erwarten hatte; so ließ er denn seine Revolver auf die Erde fallen und seine Arme über die Brust kreuzend, sagte er mit entschlossener Stimme:
»Ich weiche der Gewalt, aber ich protestire vor Allen, die mich umgeben, gegen die mir angethanen Gewaltthätigkeiten.«
»Sei es, protestirt, lieber Herr, das steht Euch frei, mir ist es gleichgültig; Don Jesus Dominguez,« setzte er hinzu, indem er sich zu dem Officier wandte, der ruhig und gleichgültig dieser Scene beigewohnt hatte, »wir wollen ohne Verzug zur genauen Untersuchung des Gepäcks und hauptsächlich der Papiere des Gefangenen schreiten.«
Der Greis zuckte verächtlich die Achseln.
»Das ist gut gespielt,« sagte er, »leider kommt Ihr ein Wenig zu spät, Caballero.«
»Was meint Ihr?«
»Nichts Anderes, als daß Geld und Werthsachen, die Ihr in meinem Gepäck zu finden hofft, nicht darin sind; ich kannte Euch zu gut, Sennor, um nicht meine Vorsichtsmaßregeln in Voraussicht dessen, was in diesem Augenblick geschieht, zu treffen.«
»Verflucht!« schrie der Guerrillero und schlug mit der Faust auf den Sattelknopf, Gachupine von Dämon, glaube nicht, uns so zu entwischen, und sollte ich Dich bei lebendigem Leibe schinden müssen, so werde ich wissen, das schwöre ich Dir, wo Du Deine Schätze versteckt hast.«
»Versucht es,« antwortete ironisch Don Andrès, und wandte ihm den Rücken.
Der Bandit hatte sich verrathen; nach dem Ausbruch, zu welchem ihn seine Habsucht hingerissen, wußte er Demjenigen gegenüber, den er auf eine so kühne, cynische Art zu plündern beabsichtigte, kein Maß zu halten.
»Gut,« sagte er, »wir wollen sehen,« und sich zu Don Jesus neigend, flüsterte er mit diesem einige Minuten.
Die beiden Räuber verabredeten ohne Zweifel mit einander die wirksamsten Mittel, welche sie anzuwenden gedachten, um den Spanier zu zwingen, sein Geheimniß zu entdecken und sich ihrer Willkür zu unterwerfen.
»Don Andrès,« sagte nach einer Weile der Guerrillero hohnlachend, »da es so ist, würde ich mir einen Scrupel machen, Eure Reise zu unterbrechen; bevor wir nach Vera-Cruz zurückkehren, wollen wir uns zusammen nach Eurer Hacienda-del-Arenal begeben, wo wir bequemer als hier auf diesem Wege von Geschäften werden sprechen können. Ich bitte, daß Ihr die Güte habt, den Platz in Eurem Wagen wieder einzunehmen, wir brechen auf; überdies bedarf Eure Tochter, die reizende Dolores, der Beruhigung.«
Der Greis erbleichte, denn er begriff die ganze schreckliche Trageweite dieser Drohung des Banditen, er hob die Augen gen Himmel und that einen Schritt vor, um sich dem Wagen zu nähern.
Aber in demselben Augenblick ließ sich der rasende Galopp eines Pferdes vernehmen, die Soldaten wichen entsetzt zurück und ein Reiter drang wie ein Sturmwind mitten in den Kreis, welcher sich um die Berline gebildet hatte.
Dieser Reiter war maskirt, ein schwarzer Schleier bedeckte vollkommen sein Gesicht, er hielt rasch sein Pferd an und richtete seine Augen, die wie glühende Kohlen durch die Oeffnungen des Schleiers glänzten, auf den Guerrillero.
»Was geht denn hier vor?« fragte er mit kurzer, drohender Stimme.
Durch eine instinktmäßige Geberde, drückte der Guerrillero, ohne zu antworten, auf den Zügel und ließ sein Pferd zurückweichen.
Die Soldaten und selbst der Officier bekreuzten sich vor Schrecken und murmelten mit halblauter Stimme:
»El Rayo! el Rayo!«
»Ich habe eine Frage an Euch gerichtet,« begann der Unbekannte nach einigen Secunden wieder.
Die vierzig Männer, die ihn umgaben, senkten jämmerlich den Kopf und sich immer mehr zurückziehend, erweiterte sich der Kreis allmählich bedeutend; Alle schienen wenig geneigt, sich mit dieser geheimnißvollen Persönlichkeit in ein Gespräch einzulassen.
Don Andrès fühlte die Hoffnung in sein Herz zurückkehren, ein geheimes Vorgefühl sagte ihm, daß die plötzliche Ankunft dieses Mannes seine Lage, wenn nicht vollständig ändere, so doch in eine für ihn vortheilhaftere Phase eintreten lassen würde. Noch mehr, er schien die Stimme des Unbekannten wieder zu erkennen, ohne daß es ihm möglich gewesen wäre, anzugeben, wo er dieselbe gehört, und so, als Alle furchtsam zurückwichen, näherte er sich mit einem instinktmäßigen Eifer, von dem er sich keine Rechenschaft ablegen konnte.
Don Jesus Dominguez, der Commandant der Eskorte, war verschwunden; er hatte schmachvoll die Flucht ergriffen.
IV.
El Rayo.
Zu der Zeit, in welche unsere Geschichte fällt, zog in Mexiko ein Mann alle Neugier, allen Schrecken und was mehr ist, alle Sympathieen auf sich.
Dieser Mann war El Rayo, das heißt der Donner.
Wer war el Rayo? Woher kam er? Was that er?
Auf diese drei, obwohl sehr kurzen Fragen wußte Niemand mit Gewißheit zu antworten.
Und dennoch cursirten Gott weiß welche wunderbare Sagen über ihn.
Hier in wenigen Worten, was man Sicheres über ihn wußte.
Gegen das Ende des Jahres 1857 war er plötzlich auf dem Wege erschienen, der von Mexiko nach Vera-Cruz führt, dessen Ueberwachung er alsdann auf seine Weise übernommen hatte. Die Fracht- und Postwagen anhaltend, die Reisenden beschützend oder ein Lösegeld von ihnen fordernd, indem er die Reichen zu einem leichten Aderlaß ihrer Börsen zu Gunsten ihrer vom Glück weniger begünstigten Gefährten veranlaßte, nöthigte er die Escortenführer, die Personen, die ihrem Schutz anvertraut worden waren, gegen die Angriffe der Salteadores zu vertheidigen.
Niemand konnte sagen, ob er jung oder alt, schön oder häßlich, braun oder blond war, denn Keiner hatte je sein Gesicht unbedeckt gesehen. Was seine Nationalität anbetrifft, so war sie eben so wenig zu erkennen; er sprach mit derselben Leichtigkeit und mit derselben Eleganz Castillianisch, Französisch, Deutsch, Englisch und Italienisch.
Diese geheimnißvolle Persönlichkeit war von Allem vollkommen unterrichtet, was sich auf dem Gebiete der Republik ereignete; er kannte nicht allein die Namen und sociale Stellung der Reisenden, mit denen es ihm beliebte sich zu beschäftigen, sondern er wußte sogar geheime Einzelnheiten, die sie oft stark compromittirten.
Noch seltsamer als Alles, was wir berichtet haben, ist, daß El Rayo immer allein war und niemals zögerte, seinen Gegnern, so groß auch ihre Anzahl war, in den Weg zu treten. Wir müssen hinzufügen, daß der Einfluß seiner Gegenwart auf diese Leute so groß war, daß sein Anblick genügte, um jeden Gedanken an Widerstand zu verbannen, und daß eine Drohung von ihm ein Beben des Schreckens bei Denen hervorrief, an die er das Wort richtete.
Die beiden Präsidenten der Republik, die um einander auszustechen, einen erbitterten Krieg führten, hatten, Jeder für sich, zu wiederholten Malen versucht, die Landstraße von einem so unbequemen Caballero, der ihnen ein gefährlicher Mitbewerber zu sein schien, zu befreien; aber alle ihre Versuche waren ohne jedes Resultat gescheitert: el Rayo, stets von allen Bewegungen der zu seiner Verfolgung ausgesandten Soldaten, man wußte nicht auf welche Weise, unterrichtet, erschien immer unvermuthet vor ihnen, vereitelte ihre Listen und zwang sie zu einem schmählichen Rückzuge.
Einmal indessen hoffte die Regierung Juarez', daß el Rayo den zu seiner Gefangennahme getroffenen Maßregeln nicht entwischen würde.
Man hatte vernommen, daß er seit einigen Tagen die Nächte in einem in geringer Entfernung von Paso-del-Macho gelegenen Rancho zubrachte; sogleich wurde ein Detachement von zwanzig Dragonern, unter Befehl Carvajals, eines der grausamsten und entschlossensten Guerrilleros, im Geheimen nach Paso-del-Macho gesandt.
Der Commandant hatte den Befehl seinen Gefangenen, sobald er sich seiner bemächtigt haben würde, zu erschießen, wahrscheinlich um ihm zu einer Flucht, während man ihn von Paso-del-Macho nach Vera-Cruz transportirte, keine Zeit zu lassen.
Das Detachement brach also in aller Eile auf; die Dragoner, denen man eine große Belohnung versprochen hatte, wenn sie ihr gefährliches Unternehmen glücklich zu Ende führten, waren vollkommen bereit, ihre Pflicht zu thun, beschämt darüber, daß sie schon seit so langer Zeit von einem einzigen Manne im Schach gehalten wurden, und erfreut, endlich Revanche dafür zu nehmen.
Die Soldaten langten bei dem Rancho an; ungefähr zwei Meilen von Paso-del-Macho waren sie einem Mönche begegnet, welcher, die Capotte über sein Gesicht geschlagen und auf einem elenden Maulesel reitend, seinen Rosenkranz betend, dahertrabte.
Der Commandant hatte den Mönch aufgefordert, sich seiner Truppe anzuschließen, was dieser auch nach einigem Zögern gethan hatte. In dem Augenblick wo das Detachement, welches in ziemlicher Unordnung marschirte, den Rancho bald erreichen mußte, stieg der Mönch von seinem Maulesel ab.
»Was macht Ihr denn da, Pater?« fragte ihn der Befehlshaber.
»Ihr seht es wohl, mein Sohn, ich steige ab; meine Geschäfte rufen mich nach einem in geringer Entfernung gelegenen Rancho, und indem ich Euch Euren Weg fortsetzen lasse, bitte ich um die Erlaubniß, Euch verlassen zu dürfen, indem ich für Eure angenehme Gesellschaft, welche Ihr mir seit unserer Begegnung leistetet, herzlich danke.«
»Oh! oh!« meinte der Commandant mit rohem Gelächter, »dies wird nicht angehen, Pater, wir können uns nicht auf diese Weise trennen.«
»Weshalb denn nicht, mein Sohn?« fragte der Mönch, indem er, seinen Maulesel am Zügel führend, sich dem Officier näherte.
»Aus einem sehr einfachen Grunde, mein würdiger Bruder ...«
»Pancratio, zu dienen, Sennor Caballero,« versetzte, sich verbeugend, der Mönch.
»Pancratio, wohl, es sei,« erwiderte der Officier. »Ich bedarf Eurer, oder, um ganz offen zu sein, Eures Dienstes, mit einem Wort, es handelt sich darum, die Beichte eines zum Tode verurtheilten Mannes zu hören.«
»Und wen meint Ihr?«
»Kennt Ihr el Rayo, Sennor Pater?«
» Santa Virgen! ob ich ihn kenne, erlauchter Commandant.«
»Wohlan, er ist es, der sterben soll.«
»Ihr habt ihn verhaftet?«
»Noch nicht, aber in wenigen Minuten wird es geschehen sein, ich suche ihn.«
»Ah bah! wo ist er denn?«
»Seht dort, in jenem Rancho, den Ihr von hier aus bemerkt,« antwortete der Officier, sich gefällig zu dem Mönch neigend und den Arm in der angegebenen Richtung ausstreckend.
»Ihr seid dessen sicher, erlauchter Commandant?«
»Caraï! ob ich dessen gewiß bin?«
»Nun, ich glaube, Ihr irrt Euch.«
»Hm? was wollt Ihr damit sagen, solltet Ihr vielleicht etwas wissen?«
»Gewiß, weiß ich etwas, weil ich selbst el Rayo bin, verfluchter Spitzbube!«
Und bevor der Officier, bestürzt durch diese plötzliche Eröffnung, die zu erwarten er weit entfernt war, seine Kaltblütigkeit wieder erlangt hatte, ergriff ihn El Rayo bei den Beinen, warf ihn auf die Erde, schwang sich an seiner Statt in den Sattel und stürzte, zwei sechsläufige Revolver unter seinem Kleide hervorziehend, auf das Detachement los, gab mit beiden Händen zugleich Feuer, indem er sein schreckliches Kriegsgeschrei: El Rayo! el Rayo! ertönen ließ.
Die Soldaten ebenso und noch mehr als ihr Officier von diesem unerwarteten Angriff überrascht, lösten sich in Unordnung auf und flohen nach allen Richtungen.
Nachdem El Rayo durch das ganze Detachement gedrungen war, von dem er sieben Mann tödtete und den achten vom Pferde warf, mäßigte er plötzlich den schnellen Lauf seines Thieres und machte einige hundert Schritt von demselben mit verächtlicher Miene Halt – ohne daß ihn die Dragoner, die nur an eine Flucht dachten, zu verfolgen suchten, sondern ihren Officier verließen, – wendete um und kehrte zu diesem zurück, welcher noch immer für todt auf dem Erdboden lag. »He! Commandant,« sagte er zu ihm und sprang zur Erde, »hier ist Euer Pferd, nehmt es zurück, es wird Euch dazu dienen, Eure Soldaten wieder einzuholen; was mich anbetrifft, so bedarf ich desselben nicht mehr, ich werde Euch im Rancho erwarten, wo Ihr mich zu Eurem Empfange, wenn Ihr noch den Wunsch haben solltet, mich zu verhaften und erschießen zu lassen, bis morgen früh acht Uhr finden werdet; auf Wiedersehen.«
Darauf grüßte er mit der Hand, bestieg seinen Maulesel und schlug die Richtung nach dem Rancho ein, wo er wirklich eintrat.
Wir haben nicht nöthig hinzuzufügen, daß er friedlich bis zum Morgen schlief, ohne daß der Officier und die auf seine Verfolgung so erbitterten Soldaten, es gewagt hätten, seine Ruhe zu stören; sie waren nach Vera-Cruz zurückgekehrt, ohne hinter sich zu blicken.