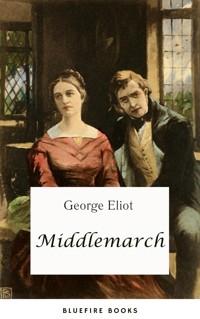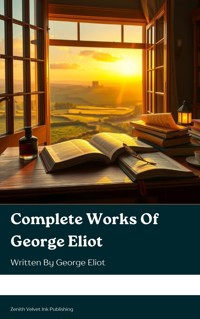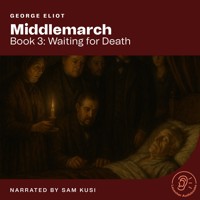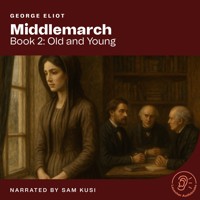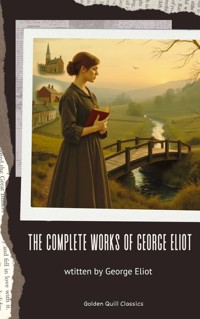14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Middlemarch», der berühmteste Roman von Mary Ann Evans, die unter dem männlichen Pseudonym George Eliot auftrat, um als schreibende Frau wahrgenommen zu werden, gilt bis heute zu Recht als Höhepunkt der englischen Romankunst des 19. Jahrhunderts; seine Mischung aus Realismus, farbiger Personenzeichnung, psychologischer Einfühlung, naturwissenschaftlichem und philosophischem Interesse und historischem und sozialgeschichtlichem Bewusstsein ist unerreicht. Das Buch zeichnet ein lebhaftes Gemälde von den Skurrilitäten der englischen Provinz und ihrer Bewohner. Es ist mit scheinbar leichter Hand geschrieben, in einem Stil, den eine verhaltene, doch stets präsente elegante Ironie prägt, wie sie ähnlich vollendet in der englischen Literatur vielleicht am ehesten Jane Austen ein halbes Jahrhundert vor George Eliot zu Gebote stand. Für Virginia Woolf war es «das herrliche Buch» schlechthin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1609
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
George Eliot
Middlemarch
Eine Studie über das Leben in der Provinz
Roman
Über dieses Buch
«Middlemarch», der berühmteste Roman von Mary Ann Evans, die unter dem männlichen Pseudonym George Eliot auftrat, um als schreibende Frau wahrgenommen zu werden, gilt bis heute zu Recht als Höhepunkt englischer Romankunst des 19. Jahrhunderts; seine Mischung aus Realismus, farbiger Personenzeichnung, psychologischer Einfühlung, naturwissenschaftlichem und philosophischem Interesse und historischem und sozialgeschichtlichem Bewusstsein ist unerreicht. Das Buch zeichnet ein lebhaftes Gemälde von den Skurrilitäten der englischen Provinz und ihrer Bewohner. Es ist mit scheinbar leichter Hand geschrieben, in einem Stil, den eine verhaltene, doch stets präsente elegante Ironie prägt, wie sie ähnlich vollendet in der englischen Literatur vielleicht am ehesten Jane Austen ein halbes Jahrhundert vor George Eliot zu Gebote stand. Für Virginia Woolf war es «das herrliche Buch» schlechthin.
Vita
George Eliot (eigentlich Mary Ann Evans; geboren in Warwickshire am 22. November 1819, gestorben in London am 22. Dezember 1880) gehörte zu den erfolgreichsten Autorinnen des Viktorianischen Zeitalters. Ihr Roman «Middlemarch» ist einer der berühmtesten Klassiker der englischen Literatur und wurde 2015 von 82 internationalen Literaturkritikern und -wissenschaftlern zum bedeutendsten britischen Roman gewählt.
Melanie Walz, geboren 1953 in Essen, hat, neben zahlreichen Herausgeberarbeiten, u. a. Jane Austen, Honoré de Balzac, A. S. Byatt, Charles Dickens, Michael Ondaatje, R. L. Stevenson und Virginia Woolf übersetzt. Preise und Auszeichnungen: Zuger Übersetzer-Stipendium 1999, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis 2001, Literaturstipendium der Stadt München 2006, zahlreiche Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds.
«Das entscheidende Buch der englischen Literaturgeschichte.»
Martin Amis
In den Worten von A. S. Byatt:
«Sie schrieb so machtvoll. Und sie hatte solchen Mut.»
«Der Urknall des 20. Jahrhunderts.» Süddeutsche Zeitung
Impressum
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e. V. Berlin für die Förderung.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Kristian Wachinger
Covergestaltung FAVORITBUERO, München
Coverabbildung Vilhelm Hammershoi – Interieur mit Rueckenansicht einer Frau, Artepics/Alamy Stock Photo
ISBN 978-3-644-05741-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Präludium
Wer, der sich für die Geschichte der Menschheit interessiert und dafür, wie diese rätselhafte Mixtur sich unter den abwechselnden Experimenten der Zeit beträgt, hätte nicht wenigstens kurz sein Augenmerk auf das Leben der Teresa von Ávila gerichtet und bei der Vorstellung von dem kleinen Mädchen, das sich eines Morgens Hand in Hand mit seinem noch kleineren Bruder aufmachte, um im Land der Mohren das Märtyrertum zu suchen, nachsichtig gelächelt? Da tappten sie aus dem alten Ávila, mit großen Augen und so hilflos wie zwei Rehkälbchen, aber mit menschlichen Herzen, die bereits im Takt eines nationalen Gedankens pochten, bis die häusliche Wirklichkeit ihnen in Gestalt ihrer Onkel begegnete und sie von ihrem großen Vorhaben zurückbrachte. Diese kindliche Pilgerschaft war ein passender Anfang. Teresas leidenschaftliche, idealistische Natur verlangte nach einem heroischen Leben: Was hätten einem so hochbegabten Mädchen vielbändige Romanzen über Ritterlichkeit und Eroberungen auf dem gesellschaftlichen Parkett bedeuten sollen? So leichten Brennstoff verzehrte ihre Flamme im Handumdrehen und loderte, von innen gespeist, einer unermesslichen Befriedigung entgegen, einem Gegenstand, der niemals Überdruss erzeugen konnte und jeden Selbstzweifel mit der beseligenden Gewissheit eines über das eigene Dasein hinausgehenden Lebens versöhnen musste. Was ihren Nachruhm begründete, fand sie in der Reform eines religiösen Ordens.
Diese Spanierin, die vor dreihundert Jahren lebte, war gewiss nicht die Letzte ihrer Art. Viele Teresas wurden geboren, denen kein heroisches Leben beschieden war, erfüllt von ständiger Entfaltung wirkmächtigen Handelns, sondern vielleicht nur ein Leben voller Irrtümer, entsprungen aus der unglücklichen Verbindung einer gewissen spirituellen Größe mit schäbigen Aussichten, ein vielleicht tragisches Scheitern, das kein geistlicher Dichter besang und das unbeweint vergessen wurde. Unsicher tastend unter hinderlichen Umständen, wollten sie ihr Denken und Handeln in edle Übereinstimmung bringen, aber für gewöhnliche Menschen nahm sich ihr Bestreben nur nach Unbeständigkeit und Formlosigkeit aus, denn diese spätgeborenen Teresas stützte keine verbindliche gesellschaftliche Gesinnung und Ordnung, die der inbrünstigen Seele als Wissen hätte dienen können. Ihre Inbrunst schwankte zwischen einem undeutlichen Ideal und den gewöhnlichen Sehnsüchten der Weiblichkeit, und so wurden sie im einen Fall der Überspanntheit geziehen und im anderen Fall des Unvermögens.
Manchen galten diese erratischen Lebensläufe als Ergebnis der unerfreulichen Unbestimmtheit, mit der die Allmacht die Natur der Frauen versehen hat; und gäbe es ein Niveau weiblicher Unfähigkeit, das so verlässlich wäre, wie nur bis drei zählen zu können, könnte man über das gesellschaftliche Los der Frauen mit wissenschaftlicher Gewissheit befinden. Indessen besteht die Unbestimmtheit fort, und die Variationen sind tatsächlich weit größer, als man aus der Gleichförmigkeit weiblicher Haartrachten und der beliebten Liebesgeschichten in Prosa und Dichtung schließen könnte. Hie und da wächst ein junger Schwan unbehaglich zwischen den Entenküken in einem trüben Teich heran und wird nie zu dem schnell fließenden Strom und der Gesellschaft seiner ruderfüßigen Artgenossen finden. Hie und da wird eine heilige Teresa geboren, die nichts begründet, deren inbrünstige Herzschläge und Seufzer der Sehnsucht nach dem unerreichten Guten gelten, sich verlieren und sich zwischen Hindernissen verstreuen, statt ihre Kräfte in einer eindrucksvollen Handlung zu bündeln.
Erstes BuchMiss Brooke
Erstes Kapitel
Da ich als Frau nichts Gutes tun kann,
bemühe ich mich ständig um dem Guten Nahes.
Die Braut von Beaumont und Fletcher
Miss Brookes Schönheit war von jener Art, die durch ärmliche Kleidung betont wird. Hand und Handgelenk waren so anmutig, dass sie Ärmel tragen konnte, die kaum weniger unelegant waren als die, in denen die Heilige Jungfrau italienischen Malern erschienen war; und ihrem Profil, ihrer Gestalt und ihrem Auftreten verlieh die einfache Kleidung noch mehr Würde, was sie neben der provinziellen Mode so beeindruckend wirken ließ wie ein vortreffliches Bibelzitat oder wie das Zitat eines unserer alten Dichter, eingerückt in einen Zeitungsartikel unserer Tage. Man bezeichnete sie für gewöhnlich als ausnehmend klug, allerdings mit dem Zusatz, ihre Schwester Celia verfüge über mehr gesunden Menschenverstand. Dennoch trug Celia kaum mehr Putz, und nur sehr aufmerksamen Beobachtern wäre aufgefallen, dass ihre Kleidung sich von der ihrer Schwester unterschied und ein klein wenig koketter war, denn die schlichte Aufmachung Miss Brookes gründete in Umständen, die fast alle auch ihre Schwester berührten. Stolz auf ihren Stand machte sich darin bemerkbar: Die Brookes waren zwar nicht aristokratischer Herkunft, entstammten aber einer unstreitig «guten» Familie; wenn man ein, zwei Generationen zurückging, fanden sich keine Vorfahren, die Ellenreiter oder Ladenschwengel gewesen wären – keine unedleren Berufe als den eines Admirals oder eines Geistlichen –, und es ließ sich sogar ein Ahne ausmachen, der als puritanischer Edelmann unter Cromwell gedient, danach aber die anglikanische Konfession angenommen hatte und dem es gelungen war, aus allen politischen Wirrnissen mit einem beachtlichen Familienbesitz hervorzugehen. Junge Damen solchen Standes, die auf einem friedlichen Landsitz lebten und eine Dorfkirche besuchten, die kaum größer war als ein Wohnzimmer, mussten Putz zwangsläufig für den Ehrgeiz einer Hausierertochter halten. Hinzu kam die Sparsamkeit besserer Kreise, die es in jenen Tagen geraten sein ließ, auf prunkvolle Kleidung als Erstes zu verzichten, wenn alles, was man erübrigen konnte, für standesgemäßere Ausgaben benötigt wurde. All das hätte schlichte Kleidung mehr als hinreichend erklärt, von religiösen Empfindungen ganz abgesehen, doch im Fall Miss Brookes hätten Letztere allein den Ausschlag gegeben; und Celia fügte sich nachgiebig allen Überzeugungen ihrer Schwester, verdünnte sie aber mit dem gesunden Menschenverstand, der eine gewichtige Doktrin hinnehmen kann, ohne in exzentrische Aufwallungen zu verfallen. Dorothea kannte viele Stellen aus Pascals Pensées und von Jeremy Taylor auswendig, und in ihren Augen machten die Geschicke der Menschheit, im Licht des Christentums gesehen, ein Nachdenken über Damenmoden zu einer des Narrenhauses würdigen Beschäftigung. Die Bestrebungen eines spirituellen Lebens samt seinen Folgen in der Ewigkeit konnte sie nicht mit lebhaftem Interesse an Chemisetten und Tournüren in Einklang bringen. Ihr Geist war theoretischer Ausrichtung und sehnte sich nach einem erhabenen Begriff von der Welt, der selbst die Pfarrei von Tipton und Dorotheas eigene moralische Maßstäbe umfassen konnte; sie schwärmte für Inbrunst und Größe und zögerte nicht, alles gutzuheißen, was ihr davon zu künden schien; es war ihre Art, sich nach dem Märtyrertum zu sehnen, Rückzüge anzutreten und dann das Märtyrertum dort zu erleiden, wo sie nicht damit gerechnet hatte. Solche Persönlichkeitselemente eines heiratsfähigen jungen Mädchens waren dazu angetan, ihr Schicksal nicht zu erleichtern, sondern eher zu verhindern, dass es sich wie üblich erfüllte, durch gutes Aussehen, Eitelkeit und hündische Zuneigung. Bei alledem war sie als die Ältere noch keine zwanzig Jahre; beide Schwestern waren nach dem Alter von zwölf Jahren und dem Verlust ihrer Eltern in Befolgung sowohl sparsamer als auch verworrener Grundsätze zuerst in einer englischen Familie und danach in einer Schweizer Familie in Lausanne aufgewachsen, womit ihr lediger Onkel und Vormund die Nachteile ihres Waisendaseins zu lindern gesucht hatte.
Seit kaum einem Jahr lebten sie in Tipton Grange bei ihrem Onkel, einem Mann von Anfang sechzig, gefügigen Temperaments, divergierender Ansichten und wankelmütigen Wahlverhaltens. In jüngeren Jahren war er gereist, und in diesem Teil der Grafschaft galt er als jemand, der sich eine allzu unstete Geistesverfassung angeeignet hatte. Mr. Brookes Beschlüsse waren so schwer vorauszusehen wie das Wetter: Mit einiger Sicherheit konnte man nur sagen, dass er wohlwollende Absichten hegen und bei ihrer Umsetzung so wenig Geld wie möglich ausgeben würde. Denn auch die schlüpfrigsten und sprunghaftesten Geister bergen einen harten Kern der Gewohnheit, und schon mancher hat sich nachlässig in allen persönlichen Belangen gezeigt bis auf den Umgang mit seiner Schnupftabaksdose, über die er misstrauisch, eifersüchtig und habgierig wachte.
In Mr. Brooke war das Erbe puritanischer Energie unzweifelhaft nur schwach ausgeprägt, doch bei seiner Nichte Dorothea durchglühte es ihre Fehler wie ihre Tugenden, äußerte sich bisweilen als Unmut über das Gerede ihres Onkels und seine Art, auf seinen Ländereien «alles beim Alten» zu belassen, und so erwartete sie ungeduldig den Zeitpunkt, an dem sie volljährig sein und über eigenes Geld für großherzige Vorhaben verfügen würde. Sie galt als Erbin, denn die Schwestern hatten von ihren Eltern nicht nur ein Einkommen von jeweils siebenhundert Pfund jährlich geerbt, sondern falls Dorothea heiratete und einen Sohn bekam, würde dieser Sohn Mr. Brookes Landbesitz im vermuteten Wert von dreitausend Pfund Jahreseinkommen erben – wahrer Reichtum in den Augen von Familien in der Provinz, die sich noch immer über Mr. Peels Kehrtwendung in der Katholikenfrage ereiferten und nichts von künftigen Goldfeldern ahnten oder von der großartigen Plutokratie mit ihrer noblen Veredelung vornehmer Lebensbedürfnisse.
Und warum hätte Dorothea nicht heiraten sollen? – ein so schönes Mädchen mit solchen Aussichten? Nichts stand dem im Weg außer ihrem Hang zur Überspanntheit und der Beharrlichkeit, mit der sie im Alltagsleben Grundsätzen huldigte, die einen vorsichtigen Mann davor zurückscheuen lassen konnten, um ihre Hand anzuhalten, und die sie selbst möglicherweise dazu bewegen mochten, jeden Freier abzuweisen. Eine junge Dame aus gutem Hause und mit Vermögen, die sich unvermittelt neben einem kranken Arbeiter auf den gepflasterten Boden kniete und inbrünstig betete, als wähnte sie sich in den Zeiten der Apostel, und die befremdlichen Grillen frönte – zu fasten wie ein Papist und nachts dazusitzen und alte theologische Schwarten zu lesen! So einer Frau war zuzutrauen, dass sie ihren Ehemann eines schönen Morgens mit einem neuen Plan für die Verwendung ihres Einkommens überraschte, der weder mit politischer Ökonomie noch mit dem Halten von Reitpferden vereinbar gewesen wäre, und verständlicherweise würde ein Mann es sich gut überlegen, bevor er wagte, sich auf eine solche Gemeinschaft einzulassen. Von Frauen erwartete man keine ausgeprägten Ansichten; doch der große Schutzschirm der Gesellschaft und des Privatlebens bestand darin, dass Ansichten keine Taten zeitigten. Vernünftige Menschen handelten, wie ihre Nachbarn handelten, sodass man irgendwelche Geistesgestörten, die ihr Unwesen trieben, erkennen und ihnen aus dem Weg gehen konnte.
Die öffentliche Meinung über die neu zugezogenen jungen Damen tendierte – selbst unter den Landarbeitern – eher zugunsten Celias, die so liebenswürdig und arglos war, während Miss Brookes große Augen genau wie ihre religiösen Überzeugungen allzu ungewohnt und auffällig wirkten. Arme Dorothea! Im Vergleich zu ihr war die arglose Celia durchtrieben und weltklug; so viel undurchschaubarer ist der Geist des Menschen als das äußere Gewebe, das sein Wappen oder Zifferblatt bildet.
Doch wer mit Dorothea näher zu tun hatte, stellte ungeachtet aller auf verstörenden Gerüchten fußenden Voreingenommenheit schnell fest, dass sie einen Zauber besaß, der damit schwer zu vereinbaren war. Die meisten Männer fanden sie hinreißend, wenn sie ritt. Sie liebte die frische Luft und die Aussicht im Freien, und wenn ihre Augen und Wangen von den vielfältigen Freuden glühten, glich sie nicht im Entferntesten einer Betschwester. Das Reiten war ein Vergnügen, das sie sich trotz aller Gewissensbisse erlaubte; sie spürte, dass sie es auf heidnisch-sinnliche Weise genoss, und nahm sich immer wieder vor, darauf zu verzichten.
Sie war ungekünstelt, leidenschaftlich und völlig uneitel; es war bezaubernd zu sehen, wie ihre Phantasie ihre Schwester Celia mit Reizen schmückte, die den ihren weit überlegen waren, und wenn irgendein Gentleman den Landsitz aus anderen Beweggründen aufzusuchen schien als dem, Mr. Brooke zu sprechen, schloss sie daraus, dass er in Celia verliebt sein müsse: Sir James Chettam beispielsweise, den sie unablässig von Celias Standpunkt aus betrachtete und dabei erwog, ob Celia gut daran täte, ihn zu heiraten. Dass er ihr selbst den Hof machen könnte, hätte sie als lächerliche Abstrusität abgetan. Bei all ihrer inbrünstigen Sehnsucht, die Wahrheiten des Lebens zu ergründen, hegte Dorothea sehr kindliche Vorstellungen von der Ehe. Sie war überzeugt, dass sie dem «klugen» Hooker ihr Jawort gegeben hätte, wenn sie rechtzeitig geboren worden wäre, um ihn vor dem traurigen Irrtum zu bewahren, den er mit der Wahl seiner Ehefrau begangen hatte, oder John Milton, als er erblindet war, oder irgendeinem anderen der großen Männer, deren Wunderlichkeiten zu erdulden glorreiche Pietät bedeutet hätte; aber ein liebenswürdiger, gutaussehender Baronet, der ihre Bemerkungen mit «Ganz genau» quittierte, selbst wenn sie Ungewissheit ausdrückten – wie sollte so jemand als Liebhaber in Frage kommen? Die wahrhaft beglückende Ehe musste so beschaffen sein, dass der Ehemann eine Art Vater war und einen sogar in Hebräisch unterrichten konnte, wenn man es wünschte.
Wegen dieser Eigentümlichkeiten in Dorotheas Charakter verübelten es benachbarte Familien Mr. Brooke besonders, dass er keine Dame mittleren Alters als Aufsichtsperson und Gesellschafterin für seine Nichten gewählt hatte. Doch er fürchtete sich so sehr vor den untadeligen Damen, die sich für diese Rolle angeboten hätten, dass er sich bereitwillig von Dorotheas Einwänden überzeugen ließ und in diesem Fall tapfer genug war, der Gesellschaft die Stirn zu bieten – anders gesagt Mrs. Cadwallader, der Pfarrersgattin, und dem kleinen Kreis von Landadeligen, mit denen er in diesem nordöstlichen Winkel von Loamshire verkehrte. Also führte Miss Brooke den Vorsitz im Haushalt ihres Onkels und hatte an dieser neuen Autorität und den damit verbundenen Ehrenbezeigungen nichts auszusetzen.
Sir James Chettam wurde an diesem Tag zum Dinner in Brookes Landsitz erwartet, in Begleitung eines Gentlemans, den die jungen Damen nicht kannten und dem Dorothea ehrfurchtsvolle Erwartung entgegenbrachte. Es handelte sich um den Geistlichen Edward Casaubon, in der Grafschaft bekannt als tiefschürfender Gelehrter, von dem es hieß, er sei seit vielen Jahren mit einem gewichtigen religionsgeschichtlichen Werk beschäftigt; zudem hieß es, er sei wohlhabend genug, um seiner Frömmigkeit Glanz zu verleihen, und er vertrete Ansichten, die bei Erscheinen seines Buches klarer erkennbar würden. Sogar sein Name war auf eine Weise beeindruckend, die ohne umfassendes Wissen um die Chronologie der Gelehrsamkeit kaum zu ermessen war.
Früh am Tag war Dorothea von der Kinderschule zurückgekehrt, die sie im Dorf begründet hatte, und nahm ihren gewohnten Platz in dem hübschen Wohnzimmer ein, das zwischen den Schlafzimmern der Schwestern lag, weil sie einen Entwurf für Bauernhäuschen beenden wollte (eine Tätigkeit, der sie mit Vorliebe nachging), als Celia, die sie in dem Wunsch, etwas vorzuschlagen, schüchtern beobachtet hatte, zu ihr sagte: «Liebe Dorothea, wenn es dir nichts ausmacht – wenn du nicht zu viel zu tun hast –, könnten wir dann vielleicht heute Mamas Schmuck ansehen und ihn aufteilen? Heute sind es genau sechs Monate, seit unser Onkel ihn dir gegeben hat, und du hast ihn noch nie angesehen.»
Celias Miene trug die Spur eines Schmollens – das ganze Schmollen unterdrückte sie aus gewohnter Furcht vor Dorothea und Grundsätzen, zwei eng verbundenen Gegebenheiten, die eine geheimnisvolle Elektrizität erzeugen konnten, wenn man sie unversehens berührte. Zu ihrer Erleichterung waren Dorotheas Augen voller Fröhlichkeit, als sie aufblickte.
«Was für ein phantastischer kleiner Kalender du bist, Celia! Sind es sechs Kalendermonate oder sechs Mondmonate?»
«Heute ist der letzte September, und Onkel hat dir die Geschmeide am ersten April gegeben. Du weißt, dass er sagte, er habe es bis dahin vergessen gehabt. Ich glaube, du hast nie mehr daran gedacht, seit du sie in diesem Schränkchen hier verwahrt hast.»
«Meine Liebe, wir sollten sie ja ohnehin niemals tragen, nicht wahr?» Dorothea sprach voll herzlicher Überzeugung, halb schmeichelnd und halb erklärend. Sie hielt den Stift in der Hand und zeichnete am Seitenrand kleine Zusatzentwürfe.
Celia errötete und sah sehr ernst aus. «Liebe Dorothea, ich glaube, es wäre ein Versäumnis an Ehrerbietung Mama gegenüber, wenn wir ihren Schmuck beiseitelegten und uns nicht weiter darum scherten. Und», fügte sie, nachdem sie kurz gezögert hatte, mit einem sich leise bemerkbar machenden Schluchzen der Demütigung hinzu: «Halsketten sind heutzutage verbreitet; und sogar Madame Poinçon, die in manchen Dingen strenger war als du, hat Schmuck getragen. Und was Christen betrifft – sicher hat es Frauen gegeben, die jetzt im Himmel sind und Schmuck getragen haben.» Celia war sich ihrer Überzeugungskraft gewiss, wenn es ihr um etwas ging.
«Du würdest den Schmuck gerne tragen?», rief Dorothea, und der Ausdruck verblüfften Entdeckens belebte ihre ganze Person mit einer Dramatik, die sie von besagter Schmuck liebender Madame Poinçon übernommen hatte. «Ja natürlich, dann lass ihn uns gleich holen. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Aber die Schlüssel, die Schlüssel!»
«Hier», sagte Celia, die dieses Gespräch lange erwogen und vorbereitet hatte.
«Mach bitte die große Schublade des Schränkchens auf und nimm die Schmuckkassette heraus.»
Schon bald war die Schatulle vor ihren Augen geöffnet, und die verschiedenen Juwelen lagen ausgebreitet und bildeten auf dem Tisch ein buntes Blumenbeet. Es war keine herausragende Sammlung, aber einige der Schmuckstücke waren tatsächlich von bemerkenswerter Schönheit, darunter am auffallendsten eine Halskette aus purpurnen Amethysten mit feinster Goldeinfassung und ein Kreuz aus Perlen mit fünf Diamanten. Dorothea ergriff sofort die Halskette und legte sie ihrer Schwester um den Hals, den sie so eng umschloss wie ein Armband; dieser Henrietta-Maria-Reif passte vollendet zu Celias Hals und Kopf, was diese in dem großen Wandspiegel an der Wand gegenüber sehen konnte.
«So, Celia! Das kannst du zu deinem indischen Musselin tragen. Aber das Kreuz musst du zu deinen dunklen Kleidern tragen.»
Celia bemühte sich, ihr beglücktes Lächeln zu unterdrücken. «O Dodo, das Kreuz musst du behalten.»
«Nein, nein, meine Liebe, nein», sagte Dorothea mit einer flüchtigen abwehrenden Handbewegung.
«Doch, doch; es würde dir so gut stehen – zu deinem schwarzen Kleid», sagte Celia beharrlich. «Das Kreuz kannst du tragen.»
«Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ein Kreuz ist das Letzte, was ich als Tand tragen könnte.» Dorothea schüttelte sich leicht.
«Dann fändest du es auch verwerflich, wenn ich es trüge», sagte Celia unsicher.
«Nein, mein Schatz, nein», sagte Dorothea und streichelte ihrer Schwester die Wange. «Auch Seelen haben unterschiedliche Charaktere: Was der einen steht, muss nicht unbedingt der anderen stehen.»
«Aber vielleicht hättest du es gerne zur Erinnerung.»
«Nein, ich habe andere Andenken an Mama, ihr Kistchen aus Sandelholz, das mir so gut gefällt – und vieles mehr. Liebe Celia, der Schmuck gehört dir. Wir müssen das nicht weiter erörtern. Da – nimm deinen Besitz an dich.»
Celia war etwas gekränkt. Diese puritanische Nachsicht hatte einen starken Beigeschmack von Herablassung und war für eine weniger exaltierte Schwester kaum erträglicher als puritanische Verfolgung.
«Aber wie soll ich Schmuck tragen können, wenn du als meine ältere Schwester nie welchen trägst?»
«Aber Celia, du kannst doch nicht verlangen, dass ich Tand trage, um dich bei Laune zu halten. Würde ich eine solche Halskette anlegen, käme ich mir vor, als vollführte ich Pirouetten. Die Welt würde sich vor meinen Augen drehen, und ich könnte keinen geraden Schritt tun.»
Celia hatte die Halskette aufgehakt und abgenommen. «Für deinen Hals wäre sie ein wenig eng; eine längere Kette würde dir besser stehen», sagte sie mit einer gewissen Befriedigung. Dass die Halskette in jeder Hinsicht für Dorothea ungeeignet war, erleichterte es Celia, sie anzunehmen. Nun öffnete sie Ringschachteln, die einen schönen Smaragdring mit Diamanten offenbarten, und im selben Augenblick sandte die Sonne, die hinter einer Wolke hervorkam, einen hellen Strahl über den Tisch.
«Wie herrlich diese Steine anzusehen sind!», sagte Dorothea unter dem Einfluss einer neuen Empfindung, die so plötzlich wie der Sonnenstrahl gekommen war. «Es ist merkwürdig, wie tief Farben einen berühren können, genau wie Düfte. Vermutlich ist das der Grund, warum Edelsteine in der Offenbarung Johannis als Sinnbilder der Spiritualität vorkommen. Sie sehen aus wie Partikel des Himmels. Dieser Smaragd erscheint mir schöner als alles andere.»
«Und es gibt ein dazu passendes Armband», sagte Celia. «Das haben wir vorhin nicht bemerkt.»
«Sie sind wunderschön», sagte Dorothea, zog Ring und Armband über ihren zierlichen Finger und ihr schmales Handgelenk und hielt beides gegen das Licht zum Fenster. Unterdessen war sie geistig damit beschäftigt, ihr Entzücken an den Farben zu rechtfertigen, indem sie es mit ihrer mystischen religiösen Begeisterung zu vereinbaren versuchte.
«Die hättest du gern, Dorothea», sagte Celia eher zögernd, denn sie bemerkte verwundert, das ihre Schwester Schwächen zeigte, und außerdem, dass Smaragde ihrem Teint noch besser stehen würden als purpurne Amethyste. «Diesen Ring und dieses Armband musst du behalten, wenn schon nichts anderes. Aber sieh nur, diese Achate sind sehr hübsch – und dezent.»
«Ja, diese hier nehme ich – diesen Ring und das Armband», sagte Dorothea. Dann ließ sie die Hand auf den Tisch sinken und sagte in anderem Ton: «Aber was für elende Menschen finden diese Dinge und bearbeiten sie und verkaufen sie!» Sie hielt wieder inne, und Celia dachte sich, dass ihre Schwester auf das Geschmeide verzichten würde, wie es ihrem Gewissen entsprach.
«Ja, meine Liebe, diese hier werde ich behalten», sagte Dorothea entschieden. «Aber alles Übrige und die Schatulle nimmst du mit.»
Sie nahm ihren Stift, ohne den Schmuck abzulegen, den sie immer noch ansah. Sie spielte mit dem Gedanken, die Schmuckstücke immer in der Nähe zu haben, um ihr Auge an den kleinen Springbrunnen reiner Farben zu erfreuen.
«Wirst du sie in Gesellschaft tragen?», fragte Celia voll ehrlicher Neugier.
Dorothea warf ihrer Schwester einen schnellen Blick zu. All ihre phantasievolle Ausschmückung derer, die sie liebte, durchschoss hin und wieder ein scharfsichtiger Blick, der durchaus etwas Beißendes haben konnte. Sollte Miss Brooke jemals zu vollkommener Demut finden, läge das nicht an der Ermangelung inneren Feuers.
«Vielleicht», sagte sie in eher hochmütigem Ton. «Ich kann nicht voraussagen, zu welchem Niveau ich herabsinken kann.»
Celia errötete bekümmert; sie erkannte, dass sie ihre Schwester gekränkt hatte, und wagte nicht einmal, für das Geschenk des Schmucks zu danken, den sie in die Schatulle zurücklegte und mitnahm. Auch Dorothea war unglücklich, und während sie an ihren Plänen weiterzeichnete, bezweifelte sie die Lauterkeit ihrer eigenen Empfindungen und ihrer Worte in der Szene, die diese kleine Explosion herbeigeführt hatte.
Celias Gewissen sagte ihr, dass sie keineswegs im Unrecht gewesen war; es war völlig natürlich und gerechtfertigt, dass sie die Frage gestellt hatte, und sie sagte sich nochmals, dass Dorothea inkonsequent gehandelt habe; entweder hätte sie ihren Anteil an dem Geschmeide nehmen oder ganz darauf verzichten sollen.
«Ich bin mir sicher – oder hoffe zumindest», dachte Celia, «dass das Tragen einer Halskette meine Gebete nicht beeinträchtigen wird. Und ich wüsste nicht, dass Dorotheas Ansichten für mich verbindlich wären, wenn wir in die Gesellschaft eingeführt werden, obwohl sie natürlich für sie verbindlich sein sollten. Aber Dorothea ist nicht immer konsequent.»
So dachte Celia, die stumm über ihre Gobelinstickerei gebeugt blieb, bis sie hörte, dass ihre Schwester nach ihr rief.
«Kitty, komm und sieh dir meinen Entwurf an; mir scheint, ich könnte eine große Architektin sein, falls ich nicht unmögliche Treppen und Kamine eingebaut haben sollte.»
Als Celia sich über den Entwurf beugte, schmiegte Dorothea ihre Wange an den Arm ihrer Schwester. Celia verstand die Geste. Dorothea hatte erkannt, dass sie im Unrecht war, und Celia verzieh ihr. Solange sie zurückdenken konnten, hatte in Celias Geist eine Mischung aus Kritik und ängstlicher Ehrfucht vor der älteren Schwester geherrscht. Die Jüngere hatte immer ein Joch getragen; aber gibt es ein unterjochtes Geschöpf ohne eigene Meinung?
Zweites Kapitel
– Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? – Lo que yo veo y columbro – respondió Sancho – no es sino un hombre sobre un asno pardo, come el mío, que trae sobre la cabeza une cosa que relumbra. – Pues ése es el yelmo de Mambrino – dijo Don Quijote.
Cervantes
«Siehst du nicht den Ritter dort, der uns auf einem Apfelschimmel entgegenkommt und einen Goldhelm auf dem Kopf trägt?» «Was ich von hier aus sehe und erspähe», entgegnete Sancho, «ist nichts weiter als ein Mann auf einem graubraunen Esel, ganz wie der meine, und auf dem Kopf trägt er etwas Glänzendes.» «Nun, das ist der Helm des Mambrin», sagte Don Quijote.
«Sir Humphry Davy?», sagte Mr. Brooke beim Suppengang leichthin und mit einem Lächeln, womit er Sir James Chettams Bemerkung aufgriff, er studiere gerade Davys Elemente der Agrikultur-Chemie. «Tja, Sir Humphry Davy; mit dem habe ich vor Jahren bei Cartwright gespeist, und Wordsworth war auch anwesend – Sie wissen schon, der Dichter Wordsworth. Und da gibt es etwas Bemerkenswertes. Ich war in Cambridge, als Wordsworth auch dort war, und bin ihm nie begegnet – und zwanzig Jahre später habe ich mit ihm bei Cartwright gespeist. Ja, so seltsam kann es gehen. Jedenfalls war Davy anwesend, auch er ein Dichter. Oder, sagen wir, Wordsworth war der Dichter Nummer eins, Davy der Dichter Nummer zwei.»
Dorothea war etwas nervöser als sonst. Zu Beginn der Mahlzeit mit wenigen Gästen im anfangs stillen Esszimmer machten sich diese Staubflusen von allem, was im Geist dieses Mitglieds der Obrigkeit rumorte, unerquicklich bemerkbar. Sie fragte sich, wie ein Mr. Casaubon so viel Oberflächlichkeit ertragen konnte. Sein Betragen erschien ihr sehr würdevoll; mit seinem stahlgrauen Haar und den tiefliegenden Augen ähnelte er dem Porträt von John Locke. Er war mager und blass, wie es einem Gelehrten wohl anstand, im denkbar größten Gegensatz zu dem blühenden Engländer mit rotblondem Backenbart, wie ihn Sir James Chettam verkörperte.
«Ich lese die Elemente der Agrikultur-Chemie», sagte dieser untadelige Baronet, «weil ich einen der Bauernhöfe selbst bewirtschaften will, um zu sehen, ob es etwas nützen könnte, meinen Pächtern ein gutes Beispiel zu geben. Findet das Ihre Zustimmung, Miss Brooke?»
«Ein großer Fehler, Chettam», mischte sich Mr. Brooke ein, «Ihre Ländereien zu elektrifizieren und so weiter und Ihren Kuhstall zu einem Salon herauszuputzen. Das kann nicht gutgehen. Ich habe mich seinerzeit selbst ausführlich mit den Naturwissenschaften beschäftigt, aber ich habe gemerkt, dass das nicht gutgehen kann. Es führt überallhin; man lässt am Ende keinen Stein auf dem anderen. Nein, nein – achten Sie darauf, dass Ihre Pächter das Stroh nicht verkaufen und so weiter; und geben Sie ihnen Drainagerohre, Sie wissen schon. Aber mit Ihren landwirtschaftlichen Hirngespinsten werden Sie nichts ausrichten, das ist das teuerste Vergnügen, das man sich leisten kann; genauso gut könnten Sie sich eine Hundemeute zulegen.»
«Gewiss», sagte Dorothea, «ist es besser, Geld auszugeben, um herauszufinden, wie Menschen das Beste aus dem Grund und Boden machen können, von dem sie alle leben, statt Hunde zu halten oder Pferde zu dem einzigen Zweck zu halten, über sein Land zu galoppieren. Man versündigt sich nicht, wenn man sein Geld ausgibt, um Experimente zum Wohl aller durchzuführen.»
Sie sprach energischer, als man es von einer so jungen Dame erwartet hätte, aber Sir James hatte sie nach ihrer Meinung gefragt. Das tat er immer, und sie dachte oft, dass sie ihn zu vielen guten Taten anhalten könnte, wenn er erst ihr Schwager wäre.
Mr. Casaubon richtete den Blick sehr dezidiert auf Dorothea, als sie sprach, und schien sie auf neue Weise wahrzunehmen.
«Junge Damen verstehen nichts von politischer Ökonomie, Sie wissen schon», sagte Mr. Brooke und lächelte Mr. Casaubon an. «Ich weiß noch, wie wir alle Adam Smith lasen. Das ist vielleicht ein Buch, ja. Ich habe die ganzen neuen Ideen auf einmal aufgenommen – dass Menschen zu besseren Menschen werden können und so weiter. Aber anderen zufolge bewegt sich die Geschichte immer zyklisch, und das ist gut möglich; ich habe das auch schon gedacht. Es ist nun einmal so, dass der Verstand den Menschen manchmal über das Ziel hinausschießen lässt – über das Ziel hinaus, ja. Mich hat er seinerzeit ziemlich weit hinausschießen lassen, aber ich habe gemerkt, dass das nicht gutgehen kann. Ich habe angehalten, rechtzeitig angehalten. Aber nicht zu abrupt. Ich hatte immer etwas für ein bisschen Theorie übrig; Denker brauchen wir, sonst landen wir im finsteren Mittelalter. Aber was Bücher betrifft, da haben wir Southeys History of the Peninsular War. Darin lese ich vormittags. Sie kennen Southey?»
«Nein», sagte Mr. Casaubon, der mit Mr. Brookes stürmischem Räsonieren nicht Schritt halten konnte, sondern an das Buch dachte. «Für solche Lektüre kann ich zurzeit wenig Muße erübrigen. Ich habe in letzter Zeit mein Augenlicht mit dem Entziffern alter Buchstaben geschwächt; tatsächlich bräuchte ich einen Vorleser für die Abende, aber ich bin heikel, was Stimmen betrifft, und kann es nicht ertragen, einem schlechten Vorleser zu lauschen. In gewisser Hinsicht ist das betrüblich: Ich nähre mich zu sehr von meinen inneren Quellen; ich lebe zu sehr mit den Toten. Mein Geist hat etwas vom Gespenst eines Ahnen, das durch die Welt wandelt und versucht, sie mental zu rekonstruieren, so wie sie einst war, trotz aller Zerstörung und aller verwirrenden Veränderungen. Aber ich weiß, dass ich mit meinem Augenlicht größte Vorsicht walten lassen muss.»
Das war das erste Mal, dass Mr. Casaubon sich etwas ausführlicher geäußert hatte. Er drückte sich so sorgfältig aus, als müsste er vor der Öffentlichkeit sprechen; und der ausgewogene Singsang seiner Worte, hin und wieder von einer Kopfbewegung begleitet, war im Kontrast zu der schlampigen Sorglosigkeit des guten Mr. Brooke umso auffälliger. Dorothea dachte sich, dass Mr. Casaubon der interessanteste Mann sei, den sie je erlebt hatte, interessanter noch als Monsieur Liret, der Walliser Geistliche, der Vorträge über die Geschichte der Waldenser gehalten hatte. Eine vergangene Welt zu rekonstruieren, zweifellos im Hinblick auf die höchsten Ziele der Wahrheit – was für eine Arbeit, und dabei zugegen zu sein, daran teilzuhaben, und sei es nur als Kerzenhalter! Dieser erhebende Gedanke linderte die Verärgerung, über ihr Unwissen in politischer Ökonomie verspottet worden zu sein, dieser niemals erklärten Wissenschaft, die wie ein Löschhütchen auf all ihre Erkenntnisse gesenkt wurde.
«Aber Sie reiten gerne, Miss Brooke», ergriff Sir James nun die Gelegenheit. «Ich würde denken, Sie könnten sich für die Freuden des Jagens erwärmen. Ich wünschte, Sie ließen mich Ihnen einen Fuchs zukommen. Er ist für Damen zugeritten. Am Samstag sah ich Sie auf einer Mähre über den Hügel traben, die Ihrer nicht würdig ist. Mein Stallknecht wird Ihnen Corydon bringen, sobald Sie sagen, zu welcher Tageszeit.»
«Ich danke Ihnen, das ist sehr freundlich. Ich will das Reiten aufgeben. Ich werde nicht mehr reiten», sagte Dorothea, zu diesem unvermittelten Entschluss durch die leise Verärgerung angestachelt, dass Sir James ihre Aufmerksamkeit beanspruchen wollte, die sie ganz und gar Mr. Casaubon widmen wollte.
«Nun, das ist aber sehr streng», sagte Sir James in vorwurfsvollem Ton, der starkes Interesse verriet. «Ihre Schwester neigt zur Selbstkasteiung, nicht wahr?», sagte er zu Celia, die zu seiner Rechten saß.
«Ich glaube schon», sagte Celia, die sich fürchtete, etwas zu sagen, was ihrer Schwester nicht recht wäre, und die so reizend wie möglich über ihrem Spitzenkragen errötete. «Sie gibt gerne Dinge auf.»
«Wenn das so wäre, Celia, wäre es keine Selbstkasteiung, sondern Selbstzufriedenheit. Aber es mag gute Gründe geben, sich dafür zu entscheiden, auf etwas zu verzichten, was sehr angenehm ist», sagte Dorothea.
Mr. Brooke sprach gleichzeitig, aber es war offenkundig, dass Mr. Casaubon Dorothea beobachtete, und das entging ihr nicht.
«Ganz genau», sagte Sir James. «Sie geben es aus einem edlen, großherzigen Beweggrund auf.»
«Nein, wahrhaftig nicht, keineswegs. Ich sprach nicht von mir», sagte Dorothea mit roten Wangen. Sie errötete nicht oft wie Celia, sondern nur in Momenten größten Entzückens oder Zorns. In diesem Augenblick war sie zornig auf Sir James und seinen Starrsinn. Warum richtete er seine Aufmerksamkeit nicht auf Celia und ließ Dorothea Mr. Casaubon zuhören? – wenn dieser gelehrte Mann doch nur gesprochen hätte, anstatt den Redeschwall Mr. Brookes über sich ergehen zu lassen, der ihn gerade darüber informierte, dass die Reformation entweder etwas bedeutete oder nicht, dass er selbst eingefleischter Protestant sei, der Katholizismus aber unstreitig existiere; und was den Unwillen betraf, Grund für ein römisch-katholisches Gotteshaus herzugeben, so brauchten alle Menschen die Zügel der Religiosität, die schließlich und letztlich in der Furcht vor dem Jenseits bestand.
«Ich habe mich seinerzeit ausführlich mit Theologie beschäftigt», sagte Mr. Brooke, als wollte er seine soeben geäußerten Erkenntnisse erläutern. «Ich kenne alle Schulen mehr oder weniger. Ich kannte Wilberforce in seinen besten Tagen. Kennen Sie Wilberforce?»
Mr. Casaubon sagte: «Nein.»
«Nun ja, Wilberforce war vielleicht kein großer Denker; aber wenn ich Parlamentsmitglied würde, was man mir oft nahegelegt hat, dann säße ich bei den Unabhängigen wie einst Wilberforce und würde mich für die Philanthropie einsetzen.»
Mr. Casaubon neigte den Kopf und bemerkte, es sei dies ein weites Feld.
«Ja», sagte Mr. Brooke mit leutseligem Lächeln, «aber ich habe Unterlagen. Ich habe schon vor langem begonnen, Unterlagen zu sammeln. Sie müssten geordnet werden, aber wenn eine Frage mich beschäftigt hat, habe ich jemandem geschrieben und eine Antwort erhalten. Ich habe Unterlagen in der Hinterhand. Apropos, wie ordnen Sie Ihre Unterlagen?»
«Teilweise in Karteikästen», sagte Mr. Casaubon, der etwas aufgeschreckt wirkte.
«Tja, Karteikästen sind nicht das Wahre. Ich habe es damit versucht, aber in den Karteikästen kommt alles durcheinander: Ich weiß nie, ob eine Schrift unter A oder unter Z eingeordnet ist.»
«Onkel, ich wünschte, du würdest mich deine Unterlagen für dich ordnen lassen», sagte Dorothea. «Ich würde sie alle nummerieren und dann unter jeder Nummer eine Liste der Themen aufführen.»
Mr. Casaubon schenkte ihr ein gravitätisches zustimmendes Lächeln und sagte zu Mr. Brooke: «Wie Sie sehen, steht Ihnen eine ausgezeichnete Sekretärin zur Verfügung.»
«O nein», sagte Mr. Brooke kopfschüttelnd. «Junge Damen lasse ich nicht mit meinen Unterlagen herumspielen. Junge Damen sind zu leichtsinnig.»
Dorothea war gekränkt. Mr. Casaubon musste denken, ihr Onkel hätte einen Grund, diese Meinung zu äußern, obwohl seine Bemerkung in seinem Geist so leicht wog wie der Flügel eines Insekts unter allen anderen Bruchstücken dort und reiner Zufall sie gegen sie gerichtet hatte.
Als die zwei Schwestern allein im Salon waren, sagte Celia: «Wie schrecklich hässlich Mr. Casaubon ist!»
«Celia! Er ist eine der distinguiertesten Erscheinungen, die ich je zu sehen bekommen habe. Er sieht dem Porträt Lockes bemerkenswert ähnlich. Er hat die gleichen tiefliegenden Augen.»
«Hatte Locke auch zwei weiße Warzen mit Haaren darauf?»
«Oh, gewiss doch!, wenn bestimmte Leute ihn ansahen», sagte Dorothea und ging ein paar Schritte.
«Mr. Casaubon ist so fahl.»
«Umso besser. Ich nehme an, dir gefallen Männer mit dem Teint eines cochon de lait.»
«Dodo!», rief Celia und sah ihr überrascht nach. «So einen Vergleich habe ich noch nie von dir gehört.»
«Warum hätte ich ihn ohne Anlass machen sollen? Es ist ein guter Vergleich: eine treffende Analogie.»
Miss Brooke war offenbar von Sinnen, dachte sich Celia.
«Ich verstehe nicht, warum du so gereizt bist, Dorothea.»
«Es ist betrüblich, Celia, dass du Menschen beurteilst, als wären sie bekleidete Tiere, und nie die große Seele eines Menschen in seinem Gesicht siehst.»
«Hat Mr. Casaubon eine große Seele?», fragte Celia nicht ohne eine Spur naiver Bosheit.
«Ja, da bin ich mir ganz sicher», sagte Dorothea im Brustton der Überzeugung. «Alles, was ich an ihm sehe, entspricht seiner Schrift über die Kosmologie der Bibel.»
«Er redet nicht viel», sagte Celia.
«Hier ist niemand, mit dem er sprechen könnte.»
Celia dachte sich insgeheim: «Dorothea hält nicht viel von Sir James Chettam; ich glaube, sie würde ihn nicht heiraten wollen.» Das fand Celia bedauerlich. Sie war sich über den Gegenstand seines Interesses nie im Unklaren gewesen. Manchmal allerdings hatte sie gedacht, dass Dodo einen Ehemann, der ihre Sicht der Dinge nicht teilte, vielleicht nicht glücklich machen würde, und in ihrem tiefsten Herzen unterdrückte sie das Gefühl, dass ihre Schwester zu religiös war, um Freude am Familienleben zu haben. Grundsätze und Skrupel waren wie verstreute Nadeln, dass man kaum zu gehen, sich zu setzen oder auch nur zu essen wagte.
Als Miss Brooke den Tee ausschenkte, setzte Sir James sich zu ihr, denn der Ton ihrer Antworten hatte ihn keineswegs gekränkt. Warum auch? Er hielt es für wahrscheinlich, dass Miss Brooke ihn mochte, und ein Betragen muss wahrhaftig sehr ausgeprägt sein, um nicht länger durch die Brille zuversichtlicher oder misstrauischer Vorurteile gesehen zu werden. Sie erschien ihm rundum bezaubernd, doch er versuchte natürlich auch, sich seine Zuneigung zu erklären. Er war ein Mensch von tadellosem Charakter und besaß die seltene Einsicht, dass seine Fähigkeiten, selbst wenn man ihnen freien Lauf ließe, nichts Weltbewegendes bewirken würden, und deshalb gefiel ihm die Aussicht auf eine Ehefrau, die er zu diesem oder jenem fragen konnte: «Was sollen wir tun?», die ihrem Ehemann Gründe nennen konnte und dazu auch befähigt war. Was die übertriebene Religiosität betraf, die gegen Miss Brooke eingewendet wurde, hatte er nur eine sehr unbestimmte Vorstellung von ihrer Beschaffenheit und dachte, nach der Heirat würde sich das legen. Alles in allem war er der Ansicht, die Richtige auserkoren zu haben, und war bereit, ziemlich viel Überlegenheit zu ertragen, die ein Mann schließlich jederzeit dämpfen konnte, wenn er wollte. Sir James dachte nicht im Traum daran, jemals die Überlegenheit dieser schönen jungen Frau dämpfen zu wollen, deren Klugheit ihn entzückte. Und warum? Der Geist eines Mannes – soweit vorhanden – hat immer den Vorteil, männlich zu sein – wie die kleinste Birke von höherer Art ist als die größte Palme –, und selbst sein Unwissen ist von robusterer Natur. Diese Überlegung mag Sir James nicht angestellt haben, aber eine freundliche Vorsehung versorgt auch die schwächste Persönlichkeit mit etwas Herz oder Stärke in Form von Tradition.
«Ich will hoffen, dass Sie Ihren Entschluss über das Pferd rückgängig machen werden, Miss Brooke», sagte der beharrliche Verehrer. «Ich kann Ihnen versichern, dass das Reiten die gesündeste Betätigung ist.»
«Das ist mir bekannt», sagte Dorothea kühl. «Ich denke, es würde Celia guttun – wenn sie reiten wollte.»
«Aber Sie sind eine so hervorragende Reiterin.»
«Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe sehr wenig Übung und könnte leicht stürzen.»
«Dann wäre das ein Grund für mehr Übung. Jede Dame sollte eine exzellente Reiterin sein, damit sie mit ihrem Ehemann ausreiten kann.»
«Sie sehen, wie unterschiedlich wir denken, Sir James. Ich habe mich entschieden, keine exzellente Reiterin zu sein, und folglich könnte ich nie Ihrer Vorstellung von einer Dame entsprechen.» Dorothea blickte starr vor sich hin und sprach kalt und schroff im Ton eines hübschen Knaben und in belustigendem Gegensatz zu der unermüdlichen Liebenswürdigkeit ihres Verehrers.
«Ich wüsste nur zu gern die Gründe für Ihren grausamen Entschluss. Es kann doch nicht sein, dass Sie das Reiten falsch finden.»
«Es ist gut möglich, dass ich es für mich falsch finde.»
«Oh, warum?», sagte Sir James im Ton eines zärtlichen Vorwurfs.
Mr. Casaubon war mit der Teetasse in der Hand an den Teetisch getreten und hörte zu.
«Wir dürfen nicht zu neugierig nach Gründen fragen», mischte er sich auf seine gemessene Weise ein. «Miss Brooke weiß, dass sie schwach klingen können, wenn man sie ausspricht; ihr Duft vermischt sich mit der grobschlächtigeren Luft. Wir müssen den keimenden Samen vom Licht fernhalten.»
Dorothea errötete vor Freude und sah dankbar zu Casaubon auf. Hier war ein Mann, der das höhere innere Leben verstand und mit dem eine spirituelle Verständigung möglich war – nein, der Grundsätze mit dem profundesten Wissen erleuchten konnte: ein Mann, dessen Gelehrsamkeit fast ein Beweis dessen war, woran er glaubte!
Dorotheas Schlussfolgerungen mögen sich weit hergeholt ausnehmen; aber zu keiner Epoche hätte das Leben sich fortsetzen können ohne den freigebigen Gebrauch von Schlüssen, der unter den Erschwernissen der Zivilisation das Heiraten erleichtert hat. Hat jemals jemand das Spinnennetz vorehelicher Bekanntschaft auf seine winzige Größe zusammengezwängt?
«Gewiss», sagte der gutherzige Sir James. «Miss Brooke soll nicht gedrängt werden, Beweggründe zu nennen, die sie lieber für sich behalten möchte. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Ehre machen.»
Er war nicht im Geringsten eifersüchtig auf das Interesse, mit dem Dorothea Mr. Casaubon bedachte; niemals wäre er auf den Gedanken gekommen, dass eine junge Frau, der er einen Heiratsantrag machen wollte, Zuneigung zu einem alten Bücherwurm um die fünfzig empfinden könnte außer in religiöser Hinsicht, wie man sie einem herausragenden Geistlichen entgegenbringt.
Doch da Miss Brooke sich nun mit Mr. Casaubon über die Geistlichkeit der Waldenser unterhielt, ging Sir James zu Celia und sprach mit ihr über ihre Schwester, sprach von einem Haus in der Stadt und fragte sie, ob Miss Brooke eine Abneigung gegen London habe. In Abwesenheit ihrer Schwester sprach Celia ganz ungezwungen, und Sir James dachte sich, dass die jüngere Miss Brooke zweifellos sehr angenehm und sehr hübsch war, wenn auch nicht, wie manche behaupteten, klüger und vernünftiger als die ältere Schwester. Er war überzeugt, sich für diejenige entschieden zu haben, die in jeder Hinsicht überlegen war; und es liegt in der Natur eines Mannes, das Beste erringen zu wollen. Er würde der Mawworm aller Junggesellen sein, die diese Erwartung leugneten.
Drittes Kapitel
Sag, Göttin, was geschah, als Raphael, der gütige Erzengel …
Aufmerksam lauschte Eva der Geschichte, erfüllt von Bewunderung und tiefem Sinnen, von so edlen und so seltsamen Dingen zu hören.
Das Verlorene Paradies, Buch VII
Wäre es Mr. Casaubon in den Sinn gekommen, Miss Brooke als geeignete Ehefrau für sich zu betrachten, waren die Gründe, seinen Antrag anzunehmen, bereits fest in ihr verwurzelt, und bis zum Abend des nächsten Tages hatten sie gekeimt und waren erblüht. Denn am Vormittag hatten sie ein langes Gespräch geführt, während Celia, der die Gesellschaft von Mr. Casaubons Warzen und fahler Gesichtsfarbe nicht zusagte, sich zum Pfarrhaus davongemacht hatte, um mit den nachlässig beschuhten, aber fröhlichen Kindern des Hilfspfarrers zu spielen.
Dorothea hatte inzwischen tiefe Einblicke in das unermessliche Reservoir von Mr. Casaubons Geist gewonnen und sah darin in undeutlicher labyrinthischer Ausdehnung alles, was ihr eigenes Denken ausmachte; sie hatte ihm viel von ihren Empfindungen offenbart und hatte von ihm die Breite seines großen Werks erfahren, von ebenfalls begeisternd labyrinthischen Ausmaßen. Denn er war so auskunftsfreudig gewesen wie Miltons «gütiger Erzengel», und gewissermaßen in Manier eines Erzengels schilderte er ihr sein Unterfangen zu beweisen (was in der Tat schon zuvor versucht worden war, doch nicht mit der Gründlichkeit, Genauigkeit im Vergleichen und überzeugenden Ordnen, die er anstrebte), dass alle Mythen oder irrigen mythischen Fragmente der Welt Entstellungen einer Urüberlieferung waren. Hatte man erst die richtige Position ausfindig gemacht und festen Fuß gefasst, wurde das weite Feld mythischer Konstrukte verständlich, ja im Licht der Entsprechungen klar und deutlich. Aber diese große Ernte der Erkenntnis einzubringen war keine leichte oder schnell zu bewältigende Aufgabe. Seine Notizen machten bereits eine beängstigende Menge Bände aus, aber die krönende Leistung würde darin bestehen, diese umfangreichen und weiterhin wachsenden Ergebnisse zusammenzufassen und sie wie die frühere Ernte hippokratischer Schriften in eine Form zu bringen, die ein kleines Regal füllen würde. Indem er dies Dorothea darlegte, drückte Mr. Casaubon sich fast so aus, als spräche er zu einem Gelehrten seines Schlags, denn er kannte nur eine Art, sich auszudrücken; jede griechische oder lateinische Wendung übersetzte er gewissenhaft ins Englische, doch das hätte er sowieso stets getan. Ein gelehrter Provinzgeistlicher ist es gewohnt, seine Bekannten als «Edelmänner, Ritter und andere rechtschaffene Männer» zu betrachten, «die des Lateinischen nur wenig mächtig sind».
Dorothea war von dem weit ausgreifenden Vorhaben hingerissen. Hier war etwas, was über die seichte Literatur der Bildung von «Damen» hinausging; hier war ein lebender Bossuet, in dessen Werk größtmögliches Wissen mit frommer Hingabe verschmelzen würde; hier war ein heutiger Augustinus, der den Ruhm des Gelehrten mit dem des Heiligen verbinden würde.
Die Heiligmäßigkeit schien nicht weniger ausgeprägt zu sein als die Gelehrsamkeit, denn als Dorothea sich gedrängt fühlte, ihr Denken über bestimmte Themen zu enthüllen, über die sie mit niemandem sprechen konnte, den sie in Tipton kannte, insbesondere über die untergeordnete Bedeutung kirchlicher Formen und Glaubensartikel, verglichen mit der spirituellen Religiosität, dem Aufgehen des eigenen Ich in der Vereinigung mit der göttlichen Vollkommenheit, die für ihre Begriffe in den besten christlichen Schriften weit auseinanderliegender Epochen ausgedrückt war, traf sie in Mr. Casaubon auf einen Zuhörer, der sie auf der Stelle verstand und ihr seine Zustimmung zu diesem Denken versichern konnte, sofern kluge Anpassung an die Gepflogenheiten es entsprechend milderte, und der historische Beispiele aufzählen konnte, von denen sie bislang nichts gewusst hatte.
«Er denkt wie ich», befand Dorothea, «besser gesagt, sein Denken umfasst eine ganze Welt, von der mein Denken nur ein armseliger Abklatsch ist. Und seine Empfindungen, all seine Erfahrung – was für ein See, verglichen mit meinem kleinen Tümpel!»
Miss Brooke gelangte nicht weniger übereilt als andere junge Damen ihrer Tage von Worten zu Meinungen. Indizien sind kleine messbare Einheiten, Interpretationen aber sind grenzenlos, und in jungen Frauen liebevoller und leidenschaftlicher Natur kann jedes Indiz Verwunderung, Hoffnung und Glauben bewirken, so weit wie der Himmel und gefärbt von einem verworrenen Fingerhut voll des Gegenständlichen in Form von Wissen. Nicht immer täuschen sie sich allzu sehr; selbst Sindbad hätte mit etwas Glück auf eine zutreffende Beschreibung stoßen können, und falsches Räsonieren führt arme Sterbliche bisweilen zu richtigen Schlussfolgerungen; wir können weit weg von dem eigentlichen Sachverhalt beginnen, uns in Schleifen und im Zickzack bewegen und bisweilen an der richtigen Stelle ankommen. Nur weil Miss Brooke übereilt Vertrauen fasste, geht daraus nicht zwingend hervor, dass Mr. Casaubon ihres Vertrauens unwürdig gewesen wäre.
Er blieb etwas länger als beabsichtigt, ein wenig von Mr. Brookes Gastfreundschaft und dessen Angebot genötigt, ihm seine Unterlagen über Maschinenstürmer und Brandschatzer zu zeigen. Mr. Casaubon wurde in die Bibliothek eingeladen, wo die Papiere sich häuften und sein Gastgeber aufs Geratewohl das eine oder andere herausfischte und unzusammenhängend und stolpernd daraus vorlas, mit einem «Ja, gut, aber jetzt!» von einer abgebrochenen Stelle zur nächsten überging und zuletzt alles wegschob und das Tagebuch seiner Reisen in Jugendzeiten auf dem Kontinent aufschlug.
«Sehen Sie hier – hier haben wir alles über Griechenland. Rhamnous, die Ruinen von Rhamnous – Sie sind ja ein Kenner der griechischen Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie sich viel mit Topographie beschäftigt haben; ich habe unendlich viel Zeit damit verbracht, diese Sachen zu erkunden – zum Beispiel den Helikon. Ja, hier! – ‹Wir brachen am nächsten Morgen zum Parnass auf, dem zweigipfligen Parnass.› In diesem ganzen Band geht es um Griechenland, wissen Sie», endete Mr. Brooke und hielt das Notizbuch hoch, wobei er mit dem Daumen schräg über die Seitenränder strich.
Mr. Casaubon war ein würdevoller, wenn auch etwas melancholischer Zuhörer, neigte den Kopf an den richtigen Stellen und vermied es, beim unvermeidlichen Betrachten von Dokumenten Missachtung oder Ungeduld zu erkennen zu geben, im Wissen, dass diese Flatterhaftigkeit mit den ländlichen Gegebenheiten zusammenhing und dass der Mann, der ihn dieser anstrengenden geistigen Hatz unterzog, nicht nur ein liebenswürdiger Gastgeber war, sondern darüber hinaus ein Gutsherr und custos rotulorum. Trug zu seiner Duldsamkeit auch die Überlegung bei, dass Mr. Brooke Dorotheas Onkel war?
Zweifellos war ihm zunehmend daran gelegen, sie zum Sprechen zu ermuntern, sie auszuhorchen, wie Celia sich insgeheim dachte; und wenn er sie ansah, erhellte sich seine Miene oft zu einem Lächeln wie blasser winterlicher Sonnenschein. Bevor er am nächsten Tag abreiste, hatte er bei einem angenehmen Spaziergang mit Miss Brooke auf der kiesbestreuten Terrasse erwähnt, dass er die Nachteile der Einsamkeit fühle, das Bedürfnis nach heiterer Gemeinschaft, mit dem die Anwesenheit der Jugend die ernsthaften Mühen reifen Alters erleichtern oder von ihnen ablenken könne. Und dies äußerte er mit so beflissener Genauigkeit, als wäre er ein Gesandter im diplomatischen Dienst, dessen Worte Ergebnisse zeitigen würden. In der Tat war Mr. Casaubon nicht gewohnt zu erwarten, seine Mitteilungen praktischer oder persönlicher Art wiederholen zu müssen. Er hielt es für ausreichend, sich auf Neigungen, die er am 2. Oktober wohlüberlegt ausgesprochen hatte, durch die bloße Erwähnung des Datums zu beziehen, indem er sein eigenes Gedächtnis zum Maßstab nahm, das ein Buch war, in dem ein vide supra Wiederholungen ersetzte, und nicht der gewöhnliche abgenutzte Block Löschpapier, der nur von vergessenem Schreiben kündet. In diesem Fall aber war nicht zu gewärtigen, dass Mr. Casaubons Zuversicht enttäuscht werden würde, denn Dorothea hörte und merkte sich alles, was er sagte, mit dem eifrigen Interesse einer unverbrauchten jungen Natur, der jede neue Erfahrung einen Meilenstein bedeutet.
Es war drei Uhr nachmittags an dem schönen frischen Herbsttag, als Mr. Casaubon zu seinem Pfarrhaus in Lowick abfuhr, das nur fünf Meilen von Tipton entfernt war; und Dorothea eilte mit Haube und Umschlagtuch durch den Strauchgarten und den Park, um im benachbarten Wald umherzuwandern, in keiner sichtbaren Begleitung als der des großen Bernhardiners Monk, der die jungen Damen stets auf ihren Spaziergängen beschützte. Vor dem inneren Auge der jungen Frau war die Vision einer möglichen Zukunft erstanden, die sie mit unsicherer Hoffnung ersehnte, und sie wollte sich ungestört in dieser visionären Zukunft ergehen. Sie ging schnell in der frischen Luft, Farbe stieg ihr in die Wangen, und ihre Haube aus Stroh (die unsere Zeitgenossen mit spekulativer Neugier für die veraltete Form eines Korbs halten könnten) rutschte ihr in den Nacken. Vielleicht wäre sie nicht ausreichend beschrieben, verschwiege man, dass sie ihr braunes Haar zu flachen Zöpfen geflochten trug, die am Hinterkopf einen Knoten bildeten, sodass der Umriss ihres Schädels auf provozierende Weise sichtbar war, und das zu einer Zeit, in der die allgemeine Empfindsamkeit verlangte, dass die Dürftigkeit der Natur mit hohen Barrikaden gekräuselter Locken und Wellen zu kaschieren sei, wie sie kein Volk außer den Fidschis je überboten hatte. Dies zeugte von der asketischen Haltung Miss Brookes. Aber nichts Asketisches war im Ausdruck ihrer strahlenden Augen, als sie den Blick nach vorne richtete und nichts bewusst wahrnahm, sondern die feierliche Pracht des Nachmittags mit seinen langen Lichteinfällen zwischen den fernen Reihen der Linden, deren Schatten einander berührten, in die Eindringlichkeit ihrer Stimmung aufnahm.
Allen Menschen, jung oder alt (das heißt allen Menschen in diesen Zeiten vor den Reformen), wäre sie interessant erschienen, hätten sie das Feuer in ihren Augen und Wangen den neuerwachten üblichen Bildern junger Liebe zugeschrieben: Die Illusionen einer Chloe über Strephon sind in der Dichtung ausreichend verewigt, wie es dem rührenden Zauber jedes ungekünstelten Vertrauens gebührt. Miss Pippin, die den jungen Pumpkin anschmachtete und sich endlose unverbrüchliche Gemeinschaft erträumte, bildete ein kleines Schauspiel, das unsere Väter und Mütter unweigerlich fesselte und in jeder Kostümierung dargeboten wurde. Solange Pumpkins Figur die Nachteile des Anzugs mit kurzem Oberteil und langen Schößen wettmachen konnte, wollte es jedem nicht nur verständlich erscheinen, sondern als unerlässlich für weibliche Vollkommenheit, dass ein reizendes junges Ding ohne weiteres von seiner Rechtschaffenheit, seinen außerordentlichen Fähigkeiten und vor allem von seiner ungeheuchelten Aufrichtigkeit überzeugt war. Aber vielleicht hätte niemand, der zu jener Zeit lebte – und ganz gewiss niemand in der Umgebung von Tipton –, mitfühlendes Verständnis für die Träume einer jungen Frau aufgebracht, deren Vorstellungen von der Ehe ihre Farbe allein einer übersteigerten Begeisterung für den Sinn des Lebens verdankten, einer Begeisterung, die sich nur von ihrem eigenen Feuer nährte und weder den Feinheiten eines trousseau oder dem Muster des Essgeschirrs galt und nicht einmal dem Ansehen und den Freuden einer blühenden Matrone.
Inzwischen war Dorothea der Gedanke gekommen, dass Casaubon wünschen könnte, sie zu heiraten, und dieser Gedanke erfüllte sie mit ehrfürchtiger Dankbarkeit. Wie gut von ihm – nein, es war fast, als hätte sich plötzlich ein geflügelter Bote neben ihrem Weg eingefunden und hätte die Hand zu ihr ausgestreckt! Lange hatte die Ungewissheit in ihrem Geist sie bedrückt wie dichter sommerlicher Dunst über all ihrem Sehnen, ihr Leben zu größtem Nutzen zu verwenden. Was konnte sie tun, was sollte sie tun? – sie, kaum zur Frau herangereift, aber dennoch mit einem regen Gewissen und einer großen geistigen Not, von keiner Jungmädchenbildung zu befriedigen, die nicht mehr zeitigen konnte als das Knabbern und Kritteln einer unsteten Maus. Mit einem ausreichenden Maß an Dummheit und Hochnäsigkeit hätte sie sich einbilden können, eine vermögende christliche junge Dame könnte ihr Lebensideal in Dorfwohltätigkeiten finden, im Patronisieren der niedrigeren Geistlichen, in der Lektüre von Female Scripture Characters, worin die persönlichen Erfahrungen von Sara im Alten Testament oder von Dorkas im Neuen enthüllt werden, und in der Pflege ihrer Seele über ihrer Stickerei in ihrem Boudoir – vor dem Hintergrund einer eventuellen Heirat mit einem Mann, der weniger strenggläubig wäre als sie, in religiös unerklärliche Geschäfte verwickelt, für den man beten und den man rechtzeitig ermahnen konnte. Solche genügsame Zufriedenheit war Dorothea verwehrt. Ihre überwältigende Religiosität, der Zwang, den diese auf ihr Leben ausübte, war nur eine Facette ihrer überaus feurigen, spekulativen und konsequent intellektuellen Natur: Und unter solchen Voraussetzungen, in der Auflehnung gegen eine engherzige Ausbildung, eingeengt durch ein Leben, das sich ausnehmen musste wie ein Labyrinth schäbiger Wege, ein ummauerter Irrgarten kleiner Pfade, die nirgendwo hinführten, musste das Ergebnis Außenstehenden sowohl überspannt als auch wankelmütig erscheinen. Das, was sie als das Beste ansah, wollte sie mit größtmöglichem Wissen rechtfertigen, statt im vorgeblichen Befolgen von Regeln zu leben, denen nie jemand entsprach. In diesen seelischen Hunger floss all ihre jugendliche Leidenschaft ein; sie ersehnte sich eine Verbindung, die sie von der kindlichen Abhängigkeit ihres Unwissens befreien und ihr die Wahl freiwilliger Unterwerfung unter einen Führer erlauben würde, dem sie auf dem größten Weg folgen konnte.
«Dann würde ich alles lernen», dachte sie, während sie schnellen Schritts den Reitweg im Wald entlangging. «Es wäre meine Pflicht, mich zu bilden, damit ich ihn bei seiner großen Aufgabe besser unterstützen könnte. In unserem Leben gäbe es nichts Triviales. Alltäglichkeiten wären für uns große Dinge. Es wäre, als hätte man Pascal geheiratet. Ich würde lernen, die Wahrheit im gleichen Licht zu sehen, in dem große Männer sie gesehen haben. Ich wüsste, was zu tun wäre, wenn ich älter würde: Ich würde wissen, wie man ein würdiges Leben führen kann, hier, heute, in England. Im Augenblick sehe ich nicht, wie ich etwas Gutes bewirken könnte: Alles nimmt sich so aus, als wollte man ein Volk missionieren, dessen Sprache man nicht spricht – abgesehen vom Bauen nützlicher Bauernhäuschen, daran kann kein Zweifel bestehen. Oh, ich hoffe, es wäre mir möglich, den Leuten in Lowick zu guten Häuschen zu verhelfen! Ich werde viele Pläne entwerfen, solange ich Zeit dazu habe.»
Unvermittelt unterbrach sich Dorothea mit Selbstvorwürfen ob ihrer Anmaßung, auf ungewisse Dinge zu rechnen, aber jede geistige Anstrengung, ihre Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, ersparte ihr der Anblick eines Reiters, der um eine Wegbiegung galoppiert kam. Der gepflegte dunkle Fuchs und die zwei schönen Vorstehhunde ließen keinen Zweifel daran, dass der Reiter Sir James Chettam war. Er erblickte Dorothea, sprang sofort vom Pferd, und nachdem er es seinem Stallknecht übergeben hatte, ging er zu ihr mit etwas Weißem auf dem Arm, das die zwei Jagdhunde aufgeregt anbellten.
«Wie reizend, Ihnen zu begegnen, Miss Brooke», sagte er und lüpfte den Hut, wobei er sein leicht gewelltes blondes Haar enthüllte. «Das Vergnügen, Sie zu sehen, wurde dadurch beschleunigt.»
Die Unterbrechung verärgerte Miss Brooke. Der liebenswürdige Baronet, ein wahrhaft passender Ehemann für Celia, übertrieb es mit der Erfordernis, sich mit der älteren Schwester auf guten Fuß zu stellen. Selbst ein möglicher Schwager kann einem auf die Nerven gehen, wenn er immer von zu großer Übereinstimmung ausgeht und einem sogar zustimmt, wenn man ihm widerspricht. Die Vorstellung, er könnte ihr irrtümlich den Hof machen, war ihr nicht gekommen: All ihre geistigen Fähigkeiten waren mit völlig anderen Gedanken beschäftigt. Aber in diesem Augenblick war er eindeutig im Weg, und seine Hände mit ihren Grübchen waren ihr alles andere als angenehm. Ihr Gereiztheit ließ sie tief erröten, als sie seinen Gruß nicht ohne Hoffärtigkeit erwiderte.
Sir James deutete ihr Erröten auf die für ihn erfreulichste Weise und dachte sich, Miss Brooke habe noch nie so attraktiv ausgesehen.
«Ich habe einen kleinen Bittgänger mitgebracht», sagte er, «oder besser gesagt, ich habe ihn mitgebracht, um zu sehen, ob er angenommen wird, bevor er seine Bitte äußern kann.» Er zeigte das weiße Etwas auf seinem Arm, einen winzigen Malteserwelpen, eines der treuherzigsten Spielzeuge der Natur.
«Es schmerzt mich zu sehen, dass diese Geschöpfe nur als Schoßhunde gezüchtet werden», sagte Dorothea, deren Meinung sich (wie es bei Meinungen oft der Fall ist) in der Hitze der Verärgerung bildete.
«Oh, und warum?», sagte Sir James, als sie weitergingen.
«Ich glaube, dass alle Fürsorge, die man ihnen gibt, sie nicht glücklich macht. Sie sind zu hilflos: Ihr Leben ist zu unsicher. Ein Wiesel oder eine Maus, die sich selbst ernähren können, sind interessanter. Ich denke gerne, dass die Tiere um uns herum Seelen haben, der unseren nicht unähnlich, und entweder ihren kleinen Geschäften nachgehen oder wie Monk hier Gefährten für uns sein können. Die anderen Geschöpfe sind Parasiten.»
«Ich bin so froh zu wissen, dass Sie sie nicht mögen», sagte der brave Sir James. «Ich selbst würde nie welche halten, aber Damen haben für gewöhnlich eine Vorliebe für diese Malteserhündchen. Hier, John, nehmen Sie den Hund, ja?»
Der unerwünschte Welpe, dessen Schnauze und Augen gleichermaßen schwarz und ausdrucksvoll waren, wurde so ohne viel Federlesens entfernt, da Miss Brooke der Ansicht war, er wäre besser nicht geboren worden. Doch sie wollte ihre Meinung erklären.
«Sie dürfen nicht von meinen Gefühlen auf die Celias schließen. Ich glaube, sie mag kleine Schoßhunde. Sie besaß einmal einen kleinen Terrier, den sie sehr gernhatte. Mir hat er Sorgen gemacht, weil ich immer befürchtete, ihm auf die Pfoten zu treten. Ich bin ziemlich kurzsichtig.»
«Sie haben zu allen Dingen eine eigene Meinung, Miss Brooke, und es ist immer eine gute Ansicht.»
Was sollte man auf so alberne Komplimente antworten?
«Wissen Sie, darum beneide ich Sie», sagte Sir James, während er mit Dorotheas schnellem Schritt mithielt.
«Ich verstehe nicht recht, was Sie sagen wollen.»
«Ihre Fähigkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich kann mir eine Meinung über Menschen bilden. Ich weiß es, wenn ich Menschen mag. Aber in anderen Dingen, verstehen Sie, fällt es mir oft schwer, eine Entscheidung zu treffen. Man hört oft ganz vernünftige Argumente für gegensätzliche Standpunkte.»
«Oder scheinbar vernünftige Argumente. Vielleicht können wir nicht immer klar zwischen Vernunft und Unvernunft unterscheiden.»
Dorothea musste sich eingestehen, dass sie ziemlich unhöflich war.
«Ganz genau», sagte Sir James. «Aber Sie besitzen die Fähigkeit, das zu erkennen.»
«Im Gegenteil, ich kann den Unterschied oft nicht sehen. Aber das liegt an meinem Unwissen. Die richtige Folgerung ist vorhanden, aber ich kann sie nicht ausmachen.»
«Ich glaube, nicht viele wären so befähigt, sie so zu erkennen wie Sie. Lovegood sagte mir übrigens gestern, Sie hätten die besten Ideen für einen Entwurf für Bauernhäuschen – ganz erstaunlich bei einer jungen Dame, schien es ihm. Sie hätten einen wahren genus, so hat er sich ausgedrückt. Er sagte, Sie wollten, dass Mr. Brooke neue Häuschen bauen lässt, aber er hält es nicht für wahrscheinlich, dass Ihr Onkel dazu bereit wäre. Wissen Sie, das ist eines der Dinge, die ich gerne tun würde – auf meinen eigenen Ländereien, meine ich. Ich wäre sehr froh, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen, wenn Sie sie mir zeigen wollen. Natürlich ist so etwas ein Verlustgeschäft; deshalb scheuen die Leute davor zurück. Pächter können nie eine Miete aufbringen, die sich auszahlen würde. Aber letzten Endes würde es sich lohnen.»
«Sich lohnen, ja, allerdings!», sagte Dorothea nachdrücklich, ohne an ihre vorherige Übellaunigkeit zu denken. «Ich denke, wir hätten es alle verdient, mit der Peitsche aus unseren schönen Häusern vertrieben zu werden – wir alle, die wir es zulassen, dass Pächter in solchen Schweineställen leben, wie wir sie ringsum sehen. Das Leben in ihren Häuschen könnte glücklicher sein als unser Leben, wenn es richtige Häuser wären, wie sie Menschen gebühren, von denen wir Pflichtbewusstsein und Zuneigung erwarten.»
«Wollen Sie mir Ihre Entwürfe zeigen?»