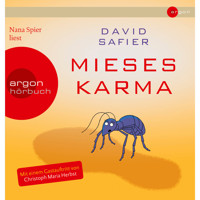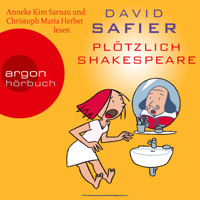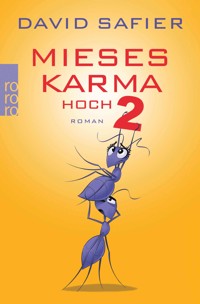
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wiedergeburt von «Mieses Karma» Die Gelegenheitsschauspielerin Daisy Becker trinkt, raucht und bestiehlt auch schon mal ihre WG-Genossen. Mit Mitte zwanzig hat sie noch immer keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben eigentlich anfangen will. Noch viel weniger weiß sie, was das Wort «Liebe» eigentlich bedeutet. Und sie wird es in diesem Leben auch nicht mehr erfahren, gerät sie doch in einen tödlichen Autounfall mit dem arroganten Hollywoodstar Marc Barton. Daisy und Marc werden als Ameisen wiedergeboren und erfahren von Buddha, dass sie in ihrem Leben zu viel mieses Karma angesammelt haben. Allerdings haben die beiden nur wenig Lust, fortan als Ameisensoldaten in den Krieg zu ziehen. Außerdem wollen sie um jeden Preis verhindern, dass Daisys bester Freund, von dem sie erst jetzt erkennt, was sie für ihn empfindet, und Marcs Ehefrau ein Paar werden. Was also tun? Gutes Karma sammeln, um die Reinkarnationsleiter über die Stufen Goldfisch–Storch–Schnecke hochzuklettern und wieder zu Menschen zu werden! Doch das ist nicht so einfach, wenn man sich nicht ausstehen kann und sich gegenseitig die Schuld an dem Unfalltod gibt. Und noch viel schwerer wird es, wenn man sich trotz allem ineinander verliebt … Für alle Fans des Millionensellers «Mieses Karma»: noch mehr Humor und Wahrheit von David Safier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
David Safier
Mieses Karma hoch 2
Roman
Über dieses Buch
Die Wiedergeburt von «Mieses Karma»
Die Gelegenheitsschauspielerin Daisy Becker trinkt, raucht und bestiehlt auch schon mal ihre WG-Genossen. Mit Mitte zwanzig hat sie noch immer keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben eigentlich anfangen will. Noch viel weniger weiß sie, was das Wort «Liebe» eigentlich bedeutet. Und sie wird es in diesem Leben auch nicht mehr erfahren, gerät sie doch in einen tödlichen Autounfall mit dem arroganten Hollywoodstar Marc Barton.
Daisy und Marc werden als Ameisen wiedergeboren und erfahren von Buddha, dass sie in ihrem Leben zu viel mieses Karma angesammelt haben. Allerdings haben die beiden nur wenig Lust, fortan als Ameisensoldaten in den Krieg zu ziehen. Außerdem wollen sie um jeden Preis verhindern, dass Daisys bester Freund, von dem sie erst jetzt erkennt, was sie für ihn empfindet, und Marcs Ehefrau ein Paar werden. Was also tun? Gutes Karma sammeln, um die Reinkarnationsleiter über die Stufen Goldfisch–Storch–Schnecke hochzuklettern und wieder zu Menschen zu werden! Doch das ist nicht so einfach, wenn man sich nicht ausstehen kann und sich gegenseitig die Schuld an dem Unfalltod gibt. Und noch viel schwerer wird es, wenn man sich trotz allem ineinander verliebt …
Für alle Fans des Millionensellers «Mieses Karma»: noch mehr Humor und Wahrheit von David Safier.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2015
Copyright © 2015 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Textstellen aus: Das Lied der Schlümpfe, Pierre Kartner/Vader Abraham, 1975
Text: Frank Dostal
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagillustration Oliver Kurth
ISBN 978-3-644-31491-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Marion, Ben, Daniel und Max – ihr seid mein Nirwana (hoch zwei)
1
Der Tag, an dem wir beide starben, hat nicht wirklich Spaß gemacht. Und das lag nicht nur an unserem Tod. Um genau zu sein: Der schaffte es nur auf Platz 6 der miesesten Momente des Tages. Ein paar Plätze dahinter – auf 10 – landete der Augenblick ein paar Stunden zuvor, in dem meine WG-Mitbewohnerin Sylvie vor meinem Ikea-Bett stand, mir die Decke wegzog und mich anpflaumte: «Daisy, du hast seit fünf Monaten deine Miete nicht gezahlt.»
«Deswegen weckst du mich so früh?», stöhnte ich. Meine Augen versuchten vergeblich, sich ans Tageslicht zu gewöhnen, und mein Kopf gab mir zu verstehen, dass ich gestern drei bis acht Tequila weniger hätte trinken sollen.
«Es ist 14 Uhr», erwiderte Sylvie spitz. Sie trug ihr spießiges Jurastudentin-im-letzten-Semester-Outfit, während ich in verrauchter Unterwäsche vor ihr lag.
«Sag ich doch, früh.»
Ich zog die Decke wieder über meinen Kopf, doch die Ziege riss sie mir erneut weg. Darauf öffnete ich meine Augen zu mehr als zwei Schlitzen und erkannte, dass auch meine anderen beiden Mitbewohner in meinem Mini-Zimmer standen, über das Sylvie mal gesagt hatte, es gebe Hurrikan-Gebiete, die aufgeräumter wirkten. Da stand zum einen die rundliche Lehramtsreferendarin Aysche, die später mal armen Migranten-Kindern beibringen wollte, dass sie mehr sein konnten als ihr eigenes Klischee. Und zum anderen war da Jannis, mein bester Freund seit Schultagen. Der dünne Brillenträger war der Einzige von den dreien, der nicht so übelgelaunt wirkte wie ein Salafist auf einem Miley-Cyrus-Konzert.
«Dein One-Night-Stand», meckerte Aysche, «hat in unserem Klo im Stehen gepinkelt.»
Ich drehte mich zur Seite: Der gutgebaute Brasilianer, den ich gestern Nacht von der Tanzfläche des Berghains abgeschleppt hatte, war schon gegangen. Ohne zum Frühstück zu bleiben. So mag ich meine Männer.
«Ich wette», ätzte Aysche weiter rum, «du weißt noch nicht mal, wie er heißt.»
«Klar weiß ich das», hielt ich etwas patzig dagegen. Ich konnte es einfach nicht ausstehen, wenn man mir schon am frühen Morgen Vorwürfe machte.
«Und, wie ist sein Name?»
«Ähem …» Mir fiel er partout nicht ein. Doch das konnte ich ja schlecht eingestehen und suchte daher nach irgendeinem Namen, der brasilianisch klang. Leider dröhnte mir der Schädel so sehr, dass mir nur Blödsinn einfiel. So etwas wie «Gutgebauto», «Gutriecho» oder «Longodildo». Ich behielt diese Namen lieber für mich.
«Er hieß Falcao», zischte Aysche.
«Woher willst du das denn wissen?», fragte ich erstaunt.
«Seit Wochen erzähl ich dir, dass ich an ihm interessiert bin!»
Oh Mist, ja, das war sie. Daran hatte ich gestern Nacht gar nicht gedacht. Was man so alles vergisst, wenn man betrunken ist. Und ein paar Pillen eingeworfen hat. Und scharf ist. Vor allen Dingen, wenn man scharf ist.
Ich rappelte mich etwas auf, lehnte mich an die Wand und sagte: «Sei mir dankbar.»
«Dankbar?»
«Jetzt weißt du, dass er im Stehen pinkelt und nichts für dich ist.»
Ayshe war mir nicht dankbar.
«Können wir uns jetzt mal wieder dem Wesentlichen zuwenden?», meckerte Sylvie. «Wir wollen die Miete.»
«Ich zahl sie, wenn ich meine nächste Rolle hab.»
«Daisy, dein letzter bezahlter Schauspieljob liegt schon Ewigkeiten zurück.»
«Na, Ewigkeiten sind im Laufe der Geschichte des Universums doch sehr relativ», entgegnete ich.
Es war sieben Monate her, da hatte ich eine Joggerin gespielt, die bei Aktenzeichen XY eine Leiche findet. Mein einziger Satz bei diesem Dreh lautete: «Ich glaube, ich bin da in was reingetreten.»
«Wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit einem richtigen Job?», schlug Aysche schnippisch vor.
«Blöd», antwortete ich.
Für einen richtigen Job war ich irgendwie nicht gemacht. Hatte ich mal ausprobiert. Hatte mir keinen Spaß gemacht.
«Daisy wird bestimmt bald wieder eine Rolle bekommen», versuchte Jannis zu vermitteln, während er sich die Brille mit seinem verwaschenen T-Shirt putzte. Er war der einzige Mensch auf diesem Erdball, der noch an mein Talent glaubte. Das hatte er schon getan, als ich in der Theater-AG unseres Bremerhavener Gymnasiums in Die Schöne und das Biest das Biest gab. Auch noch, als ich in einer Nebenrolle des Kieler Tatort eine junge Drogensüchtige spielte und eine große Wochenzeitung über mich urteilte «Jungtalent ist was anderes». Und er glaubte sogar noch an mich, nachdem ich meinen Job in einer Telenovela verloren hatte, weil die zuständige Senderredakteurin der Ansicht gewesen war, dass man «Frauen mit Charakterköpfen» nicht im Nachmittagsprogramm sehen möchte. Bei «Frauen mit Charakterköpfen» hatte sie natürlich jemanden wie mich gemeint – mit leicht schiefer Nase, widerspenstigen Straßenköter-Haaren und undefinierbarer Augenfarbe. Als die Redakteurstussi mich auch noch darauf hinwies, dass es so etwas wie plastische Nasenchirurgie gibt, hatte ich ihr geantwortet, dass ich gerne dafür sorgen könnte, dass sie welche benötigt. Dies hatte mir auch nicht gerade geholfen, weitere Aufträge von diesem Sender zu bekommen.
«Wir wollen das Geld jetzt», erklärte Sylvie bestimmt.
«Wann seid ihr beiden eigentlich so verdammt ernst geworden?», wollte ich wissen. Früher waren wir zusammen als beste Freundinnen durch die Berliner Nächte gezogen, und jetzt waren die Mädels mit einem Male so albern erwachsen.
«Ich plane eine Hochzeit, die will finanziert sein», ließ Sylvie nicht locker.
«Du mit deinem Prinzessinnentraum», lächelte ich milde.
Sie verzog das Gesicht.
«Du weißt», sagte ich freundlich, «dass die Prinzessinnen früher zwangsverheiratet wurden. Und dann haben sie sich in irgendeinem feuchten Karpatenschloss wiedergefunden. Mit einem fetten alten Kerl, der noch nie was von professioneller Zahnreinigung gehört hat.»
«Daisy, romantisch wie immer», grinste Jannis und setzte sich seine frisch geputzte Brille wieder auf.
«Menschen sind die einzigen Wesen», fuhr ich fort, «die sich ewig an ein und denselben Partner binden wollen.»
«Das macht uns Menschen nun mal so besonders», fand Sylvie.
«Wir sind auch die einzigen Wesen, die Atomwaffen erfunden haben, Giftmüll und Ronald McDonald.»
«Du wirst nie verstehen, was Liebe ist, Daisy», erwiderte meine Mitbewohnerin, nicht etwa sauer, sondern eher mitleidig.
Liebe. Hatte ich auch mal ausprobiert. Hatte mir ebenfalls keinen Spaß gemacht. Sogar noch weniger als richtige Arbeit. Das war damals in Bremerhaven gewesen, als ich noch zur Schule ging. Tom war 21, studierte irgendwas mit Medien und spielte in einer Indie-Band namens Schlumpfines Lovers. Ich sah ihn auf der Bühne, bekam Schmetterlinge im Bauch, wir wurden ein Paar, und ich ließ mich von ihm entjungfern. Womöglich wäre ich auch etwas länger mit ihm zusammengeblieben, wenn meine Mutter in jenen Wochen nicht an Krebs erkrankt und im Zeitraffer daran gestorben wäre. Mit Tom konnte ich damals nicht sonderlich gut über meine Trauer reden. Seine Aufmunterungen erschöpften sich in der Erkenntnis: «Tod ist irgendwie echt blöd.»
Zwei Wochen nach dem Begräbnis fragte er mich zaghaft: «Wann bist du denn mal wieder in der Stimmung, mit mir zu schlafen?» Und nach vier Wochen machte er Schluss mit den Worten: «Deine Trauer belastet mich einfach zu sehr.»
In jenem Moment starben die Schmetterlinge in meinem Bauch einen langsamen qualvollen Tod.[1] Danach war ausgerechnet mein unscheinbarer Mitschüler Jannis der einzige Mensch auf der Welt, mit dem ich über alles reden konnte: Über meine Mutter, mit der ich mich immer übel gestritten hatte, wofür ich mich nach ihrem Tod so sehr schämte. Über meinen Vater, von dem ich wusste, dass er schon seit langem ein Verhältnis mit einer Kollegin aus seinem Steuerbüro hatte (ja, Papa hatte noch nicht mal abgewartet, dass der Tod ihn von Mama schied). Und darüber, dass ich nichts lieber tun würde, als die verdammte Schule zu schmeißen, in der man eh nur mit Faust 2, Weltkriegen und Kurvendiskussionen belästigt wurde. Jannis verstand mich. Als Einziger.
Zwei Tage vor den Abiprüfungen haute ich von zu Hause ab und zog nach Berlin in eine WG mit Aysche und Sylvie, die damals noch nicht auf dem Karrieretrip waren, sondern echt lustige, trinkfeste Frauen. Jannis folgte mir kurz darauf. Er studierte Geschichte, und ich arbeitete an dem, was ich meine Schauspielkarriere nannte. Ich wollte immer Rollen spielen, die mir etwas bedeuten und die den Menschen etwas bedeuten. So wie Meryl Streep oder Glenn Close oder Sandra Bullock. Doch leider war ich keine Streep, Close oder Bullock. Leider war ich immer nur ich. Jetzt, mit Mitte zwanzig, war Jannis immer noch das einzige männliche Wesen, das je mein WG-Zimmer betreten hatte, ohne dass ich mit ihm im Ikea-Bett gelandet war. Sex, das war mir immer schon klar gewesen, würde unsere Freundschaft zerstören. Und die war für mich nun mal das Wertvollste auf der ganzen Welt.
«Es gibt da noch etwas», sagte Sylvie.
«Ich kann kaum abwarten, es zu hören.»
«Kann es sein, dass du gestern Nacht an meinem Portemonnaie warst?»
Wie sonst, dachte ich, hätte ich das Taxi nach Hause zahlen sollen?
«Nein, war ich nicht», log ich wie von Gutenberg gedruckt und ergänzte mit beleidigter Miene: «Und ich finde es ziemlich unverschämt, dass du so etwas von mir denkst.»
Sylvie war von meiner Antwort nicht überzeugt, aber als angehende Juristin wusste sie, dass man ohne Beweise im Zweifel für den Angeklagten sein musste. Sie biss sich auf die Lippen und erklärte dann: «Bis nächste Woche ist die Miete überwiesen. Oder du landest auf der Straße.»
«Und du putzt heute auch das Klo!», ergänzte Aysche.
Bevor ich etwas erwidern konnte, waren die beiden schon aus dem Zimmer. Ich atmete durch. Jannis ebenfalls. Ihm war die ganze Hexenjagd unangenehm gewesen. Und mein Verhalten noch mehr. Verlegen fasste er ein Blatt meiner traurigen Topfpflanze an, die auf dem Fensterbrett stand. Das Blatt zerbröselte in seinen Händen.
«Daisy, du hast da noch ein paar unbezahlte Rechnungen», deutete Jannis auf einen Haufen ungeöffneter Briefumschläge.
«Rechnungen werden in unserer Gesellschaft überbewertet.»
«Ehrlichkeit auch?»
«Was?»
«Ich habe dich heute Nacht an Sylvies Portemonnaie gesehen.»
Dieser Moment, in dem er mich tief enttäuscht ansah, landete auf Platz 9 der miesesten Augenblicke des Tages. Vor lauter Scham versteckte ich mich unter der Decke.
«Du glaubst, ich kann dich unter der Decke nicht sehen?», fragte Jannis.
«Ja, ich bin nämlich unsichtbar.»
«Und wann wirst du wieder sichtbar?»
«Nie.»
«Ist das dein Plan, den ganzen Schlamassel zu lösen?»
«Ja, und ich finde ihn sehr kreativ», bekräftigte ich.
«Und so durchdacht.»
«Dinge zu durchdenken wird auch überbewertet.»
«Beeindruckend, wie erwachsen du sein kannst, Daisy.»
«Nicht wahr?»
«Ganz im Ernst, so kann es nicht weitergehen.» Jannis sagte dies nicht vorwurfsvoll, dafür aber bestimmt. Und ich wusste, dass er recht hatte. So konnte es wirklich nicht weitergehen.
Jedenfalls nicht ohne einen doppelten Espresso.
Doch bevor ich Jannis bitten konnte, mir einen zu machen, klingelte mein Handy. Ich schaute mich vergebens in meinem Chaos-Zimmer mit den Sperrmüllmöbeln und den leeren Pizzaschachteln nach dem Telefon um (Pizza war mein Grundnahrungsmittel: Wenn ich schon ein Charaktergesicht hatte, könnte ich ja auch auf einen Charakterbauch hinarbeiten).
Jannis angelte das Handy aus meiner Jeanshose, blickte drauf und sagte: «Dein Agent.»
Mein Agent hieß Schmohel und hatte herausragende nationale und internationale Kontakte … gehabt. Vor ungefähr dreißig Jahren. Jetzt hatte der alte Herr in seiner Agentur nur noch drei Künstler unter Vertrag: meine Wenigkeit, einen Vorabendkrimistar und einen Stand-up-Comedian, dessen grausame Wortspiele schon mal dafür sorgen konnten, dass Zuschauer Gehirn-Aneurysmen bekamen («Was singt ein Kölner Karnevalist im Chinarestaurant, wenn er bestellt? Wenn nicht jetzt, Wan Tan!»).
Ich mochte den verwuschelten alten Schmohel gerne und er mich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen auch, vermutlich weil seine Tochter irgendwann mit ihm gebrochen hatte. Jedenfalls war ich wie elektrisiert, als ich seinen Namen auf dem Display sah. Denn wenn Schmohel anrief, konnte das nur bedeuten, dass er eine Rolle für mich hatte.
Ich riss Jannis das Handy aus der Hand, und mein Agent begrüßte mich mit den Worten: «Daisy, mein Schatz, kannst du Französisch sprechen?»
Kein einziges Wort – wäre die korrekte Antwort gewesen. Da es hier jedoch um eine Rolle ging, log ich meinen Agenten an: «Klar kann ich das!»
«Sehr gut, mein Schatz», freute sich Schmohel. «Was würdest du sagen, wenn ich zwei Worte sage: James Bond?»
«Oh mein Gott, würde ich sagen!», rief ich aus, wusste ich doch, dass in Babelsberg gerade der neue James Bond mit dem Titel You will never die alone gedreht wurde.
«Besser wäre es, wenn du ‹Mon Dieu› antworten würdest», lachte Schmohel. «Ich habe eine Rolle für dich in dem Film.»
«Wie hast du das denn hinbekommen?» Ich konnte mein Glück kaum fassen.
«Die Bond-Produzentin Barbara Broccoli kenn ich schon seit der Zeit, als ihr Vater die Filme mit Sean Connery gemacht hat und sie ein kleines Mädchen war, das mit Puppen spielte. Barbara ist gerade eine Darstellerin ausgefallen. Und jetzt muss deren Rolle ganz schnell neu besetzt werden, und in ihrer Not hat sich die kleine Barbara an den guten alten Schmohel erinnert.»
«Was für eine Rolle ist es?», fragte ich aufgeregt. Ich hoffte so sehr, gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Bond-Girl sein könnte.
«Du spielst eine Informantin des französischen Geheimdienstes, die stirbt. Es ist knapp eine Seite Sprechrolle. »
Also kein Bond-Girl. War ja klar. Aber eigentlich auch egal. Jede Sprechrolle in einem Bond-Film würde meine Karriere endlich in Gang bringen. Und vor allen Dingen Kohle in mein Portemonnaie.
«Es gibt nur noch eine Kleinigkeit», sagte Schmohel.
«Welche?»
«Du musst in dreißig Minuten im Studio Babelsberg in der Maske sein. Schaffst du das? Sonst kürzen sie die Rolle ein und nehmen eine Statistin vor Ort.»
Auf die S-Bahnen in Berlin konnte man sich nicht verlassen, die hielten den Fahrplan eher für eine unverbindliche Richtlinie. Also musste ich mein Auto nehmen, und mit dem würde es im Berliner Verkehr auch nicht ganz zu schaffen sein. Doch wenn ich das jetzt zugab, würde ich die Rolle nicht kriegen. Also antwortete ich: «Ich bin schon unterwegs.»
2
Nach Duschen, Anziehen und Schminken – alles zusammen dauerte gerade mal fünfeinhalb Minuten – rannte ich aufgeregt zur Wohnungstür, an der mir Jannis einen doppelten Espresso in die Hand drückte. Ich kippte ihn auf ex und jubelte: «So ein Auftrag bringt mindestens fünftausend Euro. Damit kann ich mir endlich neue Klamotten leisten.»
«Und, was noch?», hakte er nach.
«Möbel.»
«Und, was noch?», hakte er noch eindringlicher nach.
«Ich find schon noch ein paar Sachen, die Spaß machen.»
«Die Miete», sagte er vorwurfsvoll.
«Oh ja, ja … klar, die Miete», stammelte ich. «Da freu ich mich richtig drauf, die zu zahlen.»
«Ich möchte gerne noch etwas weiter mit dir in einer WG leben», sagte Jannis bestimmt.
«Keine Sorge, wir werden noch unser ganzes Leben zusammenwohnen», erwiderte ich.
Jannis lächelte sein wehmütiges Lächeln, bei dem mir stets ein wenig mulmig wird. Ich befürchtete, dass er noch immer heimlich in mich verliebt war, so wie damals in Schulzeiten. An dem Tag, als meine Mutter starb, hatte ich in Jannis’ Armen einen Heulkrampf bekommen. Und als endlich die letzte Träne über meine Wange lief, hatte er sie mir sanft weggeküsst. Doch ich hatte den Kuss nicht erwidert, weil ich ja damals mit dem Empathie-Weltmeister Tom zusammen war. Seit jener Zurückweisung hatte Jannis mir nie wieder Avancen mehr gemacht.
«Wir sehen uns», sagte ich, wandte mich zum Gehen und verdrängte wie so oft den Gedanken, er könne noch Gefühle für mich hegen. Denn falls Jannis mich tatsächlich lieben sollte, würde ich ihm weh tun, da ich ihn nicht liebe. Dieser Gedanke war schlichtweg unerträglich. Jannis war der einzige Mensch auf Erden, den ich niemals verletzen wollte.[2] [3]
Ich rannte unser Altberliner Treppenhaus im Affenzahn herunter, stürmte aus der Tür und sprang in meinen alten VW-Käfer. Der hatte seine besten Jahre schon lange hinter sich. Seine letzte TÜV-Prüfung auch. Aber er fuhr. Und was machte es schon aus, wenn so ein olles Fernlicht kaputt war?
Ich brauste durch mein Berlin, das nie aufhörte, mich zu faszinieren. Überall wurde man an Geschichte erinnert. Leider oft an blöde. So war Hitler immer noch irgendwie präsent mit Steinmonsterbauten wie dem Finanzministerium. Jedes Mal, wenn ich an Hitler erinnert wurde, fühlte ich mich in meiner Ansicht bestätigt, dass es keinen Gott gab. Wenn Gott existierte, warum hatte er dann auf Hitler nicht einfach einen 1000 Kilo schweren Schokokuss geworfen?
Meine Mama hatte immer versucht, mir Gott näherzubringen, doch ich konnte mir schon als Teenager einfach nicht vorstellen, dass es irgendeine höhere Macht gab. Das fällt einem nun mal schwer, wenn die Mutter mit Krebs im Hospiz liegt und der Vater mit der Steuer-Else herumknutscht. Kurz vor ihrem Tod wandte sich Mama mit einem Male dem Buddhismus zu, weil ihre aus Indien stammende Pflegerin sie dafür begeistert hatte. Doch diese Religion erschien mir kaum weniger albern als die Vorstellung von einem Gott. Wieso sollte man, wenn man nicht gut gewesen war, als Tier wiedergeboren werden? Was ist denn das für eine Logik? Wie soll einen das zu einem besseren Menschen machen? Und wenn tatsächlich alle Menschen zu Tieren werden, sollten wir dann nicht alle lieber Vegetarier werden? Nein, so etwas wie ein Leben nach dem Tod gibt es nicht. Da ist garantiert nur ein Nichts. So wie vor dem Leben. Wenn es da irgendetwas gegeben hätte, würde man sich ja wohl daran erinnern.
«Daisy», hatte meine von der Krankheit ganz dünne und zerbrechliche Mama damals zu mir im Hospiz gesagt, «du hast einfach nur Angst davor, an etwas Größeres zu glauben.»
«Warum sollte ich Angst davor haben?», hatte ich leicht bockig gefragt.
«Wenn du an etwas Größeres glauben würdest, würdest du auch erkennen, dass etwas Großes in dir steckt.»
«Und was soll das sein?»
«Das wirst du schon noch herausfinden.»
Ich hatte damals nicht verstanden, was Mama meinte, und heute verstand ich es immer noch nicht. In mir steckte einfach nichts Großes.
Während der Fahrt linste ich immer wieder auf mein Handy und versuchte, auf dem zersplitterten Display – Apple machte bestimmt über die Hälfte des Umsatzes mit dem Reparieren von heruntergefallenen iPhones – die Drehbuchseite zu lesen, die mir Schmohel mittlerweile gemailt hatte. Oh Mann: Das war nicht irgendeine Drehbuchszene! Ich spielte in einer zusammen mit Bond, James Bond. Gespielt von dem neuen 007-Darsteller Marc Barton. Ein Mann, der als der ehrgeizigste Schauspieler Hollywoods galt und dieses Jahr vom People-Magazine zum «Sexiest Man Alive» gewählt worden war. Barton war verheiratet mit der Schauspielern Nicole Kelly, die ihrerseits vom Esquire zur «Sexiest Woman Alive» gekürt wurde. Die beiden lebten in einem superschicken Apartment in New York, direkt am Central Park, und waren ein Paar, in dessen Anwesenheit sich selbst Angelina Jolie und Brad Pitt vorkamen wie Bremerhavener Reihenhausspießer. Wie würde es dann erst mir gehen, die bei einer Wahl zur «Sexiest Woman Alive» auf Platz 2782346338 landen würde?
Während mir all das durch den Kopf schoss, las ich weiter auf meinem Handy: Wenn ich es richtig verstand, sollte ich eine französische Informantin spielen. Sie gibt Bond Hinweise über den Aufenthalt eines Terroristen, der für einen mental Instabilen eindeutig zu viele Atomsprengköpfe in seinen Besitz gebracht hatte. Leider musste ich in dieser Szene tatsächlich ein paar Sätze französisch mit Bond parlieren. Dummerweise hatte ich keine Ahnung, was diese Sätze bedeuteten, geschweige denn, wie sie ausgesprochen wurden. Ich würde mich also vor dem internationalen Superstar Barton nach allen Regeln der Kunst blamieren.
Dennoch verfiel ich nicht in Panik. Ich hoffte einfach darauf, dass sich vor Ort alles in Wohlgefallen auflösen würde. Ich war nun mal ein großer Anhänger der These, dass die meisten Probleme sich gefälligst von alleine zu lösen hatten. Zuerst einmal wollte ich den restlichen Text lernen. Und zu den Studios in Babelsberg gelangen. Und den winkenden Motorradpolizisten hinter mir lassen.
Winkender Motorradpolizist?
Ach du meine Güte, da fuhr wirklich ein Polizist neben mir und bedeutete mir, links ranzufahren!
Ich tat, wie mir geheißen, und kurbelte meine Scheibe runter. Der durchtrainierte Polizist, den ich unter anderen Umständen in seiner Lederuniform sicherlich süß gefunden hätte, fragte mich: «Sollen wir denn beim Fahren auf das Handy starren?»
«Och, ich weiß nicht, ob Sie das sollten, aber ich …», hob ich an.
«Die richtige Antwort lautet: Nein, das sollen wir nicht», schnitt der Polizist mir das Wort ab. Er ging um meinen Käfer herum, und ich betete zu Gott, dass er die antike TÜV-Plakette nicht bemerkte.
«Ihr Auto hat keinen TÜV mehr.»
Braucht es noch einen Beweis für die Nicht-Existenz Gottes?
«Ich fahr gerade zum TÜV hin, um sie zu erneuern», lächelte ich.
«Und wer soll Ihnen das glauben?»
«Ähem … Sie?»
Seine Augen verfinsterten sich. Ich beschloss, die Strategie zu wechseln. Wäre doch gelacht, wenn der gute alte Daisy-Charme nicht weiterhelfen würde: «Können Sie nicht eins Ihrer wunderbaren Augen zudrücken?», säuselte ich und sah ihm tief in die Augen.
«Sparen Sie sich die Mühe, ich bin homosexuell.»
So viel zum guten alten Daisy-Charme.
«Ich kann», schlug ich vor, «Sie gerne mit einem sehr netten Tänzerfreund von mir bekannt machen, mit dem kann man jede Menge Spaß haben …»
«Und Sie können jetzt aus Ihrem Auto steigen und Ihren Führerschein abgeben.»
«Der Tänzer, den ich kenne, ist aber von den Chippendales. Er macht da den Feuerwehrmann und macht Sachen mit seinem Schlauch …»
Der Polizist sah mich noch finsterer an.
«… und Sie sind anscheinend nicht interessiert», seufzte ich.
«Gut erkannt.»
Geschlagen stieg ich aus dem Wagen, gab Autoschlüssel und Führerschein ab, kassierte einen Strafzettel und diverse Belehrungen, welche Schritte ich nun zu unternehmen hatte, falls ich mein Auto, das abgeschleppt werden müsste, jemals wieder fahren wollte. Schließlich fuhr der Polizist mit seinem Motorrad davon. Frustriert lehnte ich mich an meinen Käfer, blickte auf mein kaputtes iPhone-Display und stellte fest, dass ich zehn wertvolle Minuten verloren hatte. Panisch überlegte ich, ob ich nicht doch die S-Bahn nehmen sollte. Doch mit der würde ich – selbst wenn sie sich mal bequemen sollte, planmäßig zu fahren – eine ganze halbe Stunde zu spät zum Drehort kommen, also außerhalb jeglicher Verspätungstoleranz. Für ein Taxi hatte ich keine Kohle. Jedenfalls für keines, das weiter als 700 Meter fuhr. Dennoch sprang ich auf die Straße und hielt das erste an, das mir entgegenkam. Ich stieg ein und bat den Fahrer, er solle mich nach Babelsberg fahren. Das mit dem Bezahlen würde eben ein weiteres Problem sein, das sich im Laufe der Zeit gefälligst von selbst zu lösen hatte.
Allerdings, so stellte ich schnell fest, hätte ich mir den Fahrer vorher vielleicht besser anschauen sollen. In Berlin konnte man schon mal an sehr spezielle Taxifahrer geraten, und dieser tätowierte Mann sah aus wie ein Tschetschenien-Kämpfer, der sich hauptsächlich von Pitbulls ernährt. Wenn dieser Typ nachher in Babelsberg erfuhr, dass ich die Fahrt nicht bezahlen konnte, würde er wohl kaum vor lauter Begeisterung einen tschetschenischen Volkstanz aufführen.
Um schon mal vorab ein klein wenig gute Stimmung zu verbreiten, sprach ich den Fahrer auf seinen Tattoo-Schriftzug an, der auf seinem glattrasierten Stiernacken zu sehen war. «Ihre Tätowierung sieht sehr interessant aus. Was bedeutet die?»
«Blut und Ehre», antwortete er mit hartem Akzent.
Ich hätte lieber nicht fragen sollen.
«Habe ich mache lasse in Gefängnis.»
«Warum waren Sie denn im Gefängnis?», wollte ich neugierig wissen.
«Weil ich Totschlag mache hab.»
‹Totschlag mache hab› hörte sich nicht schön an. Ganz und gar nicht schön. Eigentlich ziemlich kacke.
«Ärzte sage, ich haben Impulskontrollstörung.»
«Wie bitte?»
«Das bedeuten, ich nicht können kontrollieren meine Aggression.»
«Die Antwort hab ich befürchtet.»
«Was?», brüllte er.
«Nichts, nichts», erwiderte ich hastig.
«Ich mich aber nun haben besser im Griff», wurde er wieder ein klein wenig ruhiger.
«Das heißt, Kleinigkeiten lassen Sie nicht mehr ausrasten?», fragte ich ebenso nervös wie hoffnungsvoll.
«Kleinigkeiten? Was für Kleinigkeiten?»
«Also, wenn ich jetzt mal einen ganz abwegigen Fall konstruiere … sagen wir mal, jemand zahlt für seine Tour nicht …»
«Nein», antwortete er, «dann ich würde nicht ausrasten.»
«Gut», atmete ich auf.
«Würde einfach nur breche Beine.»
Und dieser Augenblick landete auf Platz 8 der miesesten Momente des Tages.
3
Wir fuhren auf die Schranke des Filmgeländes Babelsberg zu. Der Pförtner erklärte, dass man schon auf mich wartete, öffnete die Schranke, und wir fuhren durch bis zu einem großen Studiogebäude. Dort stieg ich aus dem Taxi, und der Mann mit der Impulskontrollstörung sagte: «54 Euro 20.»
«Ach», antwortete ich so lässig wie möglich, «lassen Sie einfach die Uhr laufen. Ich bin gleich wieder da.»
Wenn ein Problem sich nicht von alleine löste, so war es meine feste Überzeugung, sollte man es einfach verschieben. Mit dieser Philosophie wäre ich sicherlich auch eine super Politikerin geworden.
«Sein ja nicht mein Geld, das durch Uhr rauschen», grunzte der Tschetschene.
Wenn ich ehrlich gewesen wäre, hätte ich ihm antworten müssen: Eigentlich ist es das schon. So aber lächelte ich ihn nur möglichst charmant an. In diesem Moment stürmte eine verhärmte Mittdreißigerin mit Headset, offensichtlich die Aufnahmeleiterin, auf mich zu und fragte: «Bist du Daisy Becker?»
«Eine muss es ja sein», versuchte ich zu scherzen.
«Du bist zu spät», antwortete sie scharf, ohne auch nur ein bisschen auf meinen Scherz einzugehen.
«Nur ein klitzekleines bisschen», versuchte ich zu relativieren.
«Unpünktlichkeit ist eine der sieben Todsünden», zischte sie wie eine Hexe in einem Disney-Film.
«Ich glaube, das stimmt so nicht ganz …»
«Widersprechen ist eine weitere!»
Ich beschloss, lieber zu schweigen, konnte doch anscheinend alles, was ich sagte, gegen mich verwendet werden. Mit einer zackigen Handbewegung bedeutete die Headset-Frau mir, ihr zu folgen. Wir eilten in das Studio-Gebäude und durch dessen Gänge zur Maske, in der bereits eine mollige Visagistin mit zwei Dutzend Schminkköfferchen wartete.
«Wir müssen Zeit aufholen», befahl die Headset-Frau und rauschte davon, um den Nächsten zu stressen.
Die Visagistin sah mich ganz verzückt mit ihrem Mondgesicht an und rief aus: «Wie schön!»
Für eine kurze Sekunde dachte ich, ihr würde mein Gesicht gefallen. Doch dann sagte sie: «Ich liebe Herausforderungen.»
Als sie mit mir fertig war, sah mein geschminktes Gesicht so anmutig aus wie noch nie. Fast wie das eines echten Stars. Ich strahlte vor Freude. Die Visagistin war jedoch weniger begeistert und seufzte: «Na ja, vielleicht kann man in der Postproduktion am Computer noch was rausholen.»
Schlagartig hörte ich auf zu strahlen.
In diesem Moment rauschte die Aufnahmeleiterin wieder hinein und schleppte mich drei Räume weiter zur Kostümbildnerin. Laut Drehbuch sollte ich einen hautengen Kampfanzug tragen. Die Kostümbildnerin, eine alte Mumie, rümpfte die verrunzelte Nase: «Für einen Bodysuit muss man einen Body haben.»
«Ich habe einen Body», protestierte ich.
«Ich würde es eher einen Plumps nennen.»
Noch ehe ich etwas erwidern konnte, begann die Mumie all meine Makel aufzuzählen: «Zu klein, zu dicke Beine, zwei ungleiche Brüste, ein Hintern, auf dem Hubschrauber landen könnten …»
In Gedanken ergänzte ich: … und Fäuste, mit denen man dritte Zähne rausschlagen kann.
Die Alte verpasste mir einen schwarzen Bodysuit aus Latex, steckte ein paar Nadeln rein, damit er besser anlag, und als ich mich damit im Spiegel betrachtete, war mein Zorn auf sie wie weggeblasen. Ich fand, dass ich super sexy aussah. Eigentlich schade, dass man Visagistin und Kostümbildnerin nicht im echten Leben haben konnte.
Die Mumie jedoch war weniger begeistert und seufzte: «Na ja, vielleicht kann man in der Postproduktion am Computer noch was rausholen.»
Ich schluckte getroffen, da zog mich die Aufnahmeleiterin auch schon aus der Garderobe heraus, um mich zum Set zu bringen. Während ich mich bemühte, mit ihr Schritt zu halten, erklärte sie mir, dass ich gleich auf den Regisseur Steven Bendis treffen würde. Ich hatte von dem Mann noch nie gehört, aber wer kannte schon die Namen von Bond-Regisseuren?
Wir betraten ein großes Studioatelier, in dem Kameramänner, Lichtmänner, Tonmänner und Kabelmänner herumwuselten. Vor einer grünen Wand wurden von den Bühnenbildnern Trümmer drapiert – Steine, Fensterscheibensplitter, kaputte Büromöbel.
Ein kleiner Glatzkopf mit schwarzen Klamotten und roter Designerbrille wurde mir von der Headset-Frau als Regisseur Bendis vorgestellt. Kaum war sie damit fertig, überprüfte sie die neusten Nachrichten auf ihrem Smartphone, und der Regisseur fragte mich auf Englisch: «Bist du die, die die französische Informantin spielt?»
«Ja, und ich habe mir auch eine Kleinigkeit überlegt», versuchte ich mit meinem, dank des exzessiven Ansehens von US-Fernsehserien, halbwegs passablen Englisch, das drängendste meiner vielen Probleme zu lösen. «Wäre es nicht viel cooler, wenn die Informantin eine Deutsche wäre anstatt einer Französin? Eine Deutsche hilft einem Engländer, das hätte voll etwas von einer Zweiter-Weltkriegs-Versöhnung, das wäre doch eine ganz tolle Symbolik …»
«Weißt du, wie gerne ich Kleindarsteller mag, die Ideen zu ihren Rollen haben?», unterbrach mich der Glatzkopf.
«Nicht so sehr?»
«Ich würde lieber mein Gehirn pürieren lassen, als ihnen zuzuhören.»
Dieser Mann war anscheinend kein Anhänger von flachen Hierarchien.
«Hör zu, Kleine», deutete Bendis auf die Szenerie mit den Trümmern, «deine Szene spielt auf dem Dach eines Pariser Hochhauses während eines Raketenangriffes.» Er zeigte nun auf die grüne Wand. «Hochhaus, Raketenangriff und Helikopter werden nachher am Computer eingesetzt …» Er hielt kurz inne und seufzte leise: «Schade, dass man das mit Marc Barton nicht auch machen kann.»
Anscheinend mochte da jemand seinen Hauptdarsteller nicht.
Bendis wandte sich zu der Headset-Frau: «Wo ist eigentlich unser Superstar?»
«Barton hat mir gerade getextet, dass er noch ein paar Änderungen an dem Drehbuch gemacht hat.»
«Änderungen? Schon wieder?» Der Regisseur wirkte schwer verzweifelt.
«Er möchte, dass die Szene nicht auf einem Hochhaus spielt, sondern auf dem Eiffelturm. Das gibt die besseren Bilder.»
«Wir … wir haben aber doch schon alles eingerichtet …» Für einen kurzen Augenblick meinte ich Tränen in den Augen des Regisseurs zu erkennen.
«Barton sucht halt immer nach einer besseren Lösung», zuckte die Aufnahmeleiterin mit den Schultern, «er ist nun mal Perfektionist.»
«Darin, mich in den Wahnsinn zu treiben.»
«Redet ihr von mir?», hörten wir eine Stimme von hinten.
Wir drehten uns alle um. Marc Barton sah exakt so aus wie in den Hochglanzmagazinen. Blond. Dreitagebärtig. Ein Lächeln wie ein junger Gott. Er trug Jeans und dazu ein lässiges Hemd. Ich hatte noch nie einen Menschen gesehen, der so lässig lässige Hemden trug. Er hatte einen kleinen Jack Russell Terrier dabei, der ihm nicht von der Seite wich. Es war Boopsie, der Hund des Glamourpaares, gerade frisch von der Elle zum «Sweetest Dog Alive» gewählt.
Der Regisseur fragte ihn nervös und leicht unterwürfig: «Du willst wirklich, dass ich die Szene auf den Eiffelturm verlege?»
«Exakt», lächelte Barton. Sein Lächeln war unglaublich. Jede Frau würde dahinschmelzen. Sogar Angela Merkel würde bei seinem Anblick What A Man singen.
«Wir … wir brauchen aber Stunden, um alles mit den Special-Effects-Leuten zu besprechen.»
«Dann verschieben wir eben den Dreh. Dies soll nicht irgendein Bond-Film werden, sondern der beste Bond aller Zeiten.»
«Aber das kostet Geld, viel Geld …», beklagte sich der Regisseur, und Schweißperlen bildeten sich auf seiner Glatze.
«Ich bin der festen Überzeugung, dass du die Verzögerung und die damit verbundenen Kosten auffangen kannst», lächelte Barton wie ein Haifisch, der sich die Zähne hat bleachen lassen.
«Marc …», flehte der Regisseur verzweifelt.
«Und ich bin der festen Überzeugung, dass du weißt, wer die Macht hat, dich zu feuern.»
Dem Regisseur wich die Farbe aus dem Gesicht.
In diesem Augenblick hörten wir ein Knattern, und es begann zu müffeln.
«Oh», lächelte Barton sanft und streichelte seinen kleinen Terrier. «Boopsie hat anscheinend seine vegane Mahlzeit nicht so gut vertragen.»
Der Regisseur wurde nun komplett kreidebleich und sagte gar nichts mehr. Barton wandte sich zu mir und fragte: «Und wer bist du, kleine Latexfrau?»
Marc Barton sprach mit mir. Mit mir, Daisy Becker aus Bremerhaven! Mein Herz raste. Meine Knie wurden weich. Meine Birne war es schon längst. Und dennoch musste ich jetzt irgendetwas Geistreiches sagen.
«Grdll», antwortete ich.
Ein klein wenig geistreicher hätte es schon sein dürfen.
«Dein Name ist Grdll?»
«Blmm.»
Barton wandte sich an die Aufnahmeleiterin: «Hatte sie einen Schlaganfall?»
«Nein, sie ist nur etwas sprachlos in deiner Anwesenheit.»
Er musterte mich von oben bis unten und stellte fest: «Du siehst originell aus.»
Ich grinste wie eine Grenzdebile: Marc Barton fand mich originell!
«Originell muss aber nicht immer gut sein», ergänzte er.
Das Grinsen fiel mir aus dem Gesicht, und ich fand meine Sprache wieder: «Was … was soll das denn heißen?»
Die Headset-Frau warf mir einen strengen Blick zu. Es war ganz klar, was mir dieser Blick sagen sollte: Dem Star zu widersprechen, gehörte ebenfalls zu den sieben Todsünden.
«In einem Bond-Film erwarte ich von einer Frau sehr viel höhere Standards», lächelte Barton von oben herab. Und wenn einer so richtig übel von oben herab lächeln konnte, dann war es dieser Mann.
Trotz des warnenden Blicks der Headset-Tante konnte ich meinen Mund nicht halten und antwortete süßsauer: «Na ja, vielleicht kann man ja in der Postproduktion am Computer noch was rausholen.»
«Selbst die modernste Technologie hat ihre Grenzen», lächelte der Filmstar.
So schnell wie er hatte sich noch kein Mann für mich entzaubert. Für mich war er nun «The Nervigst Man Alive».
«Aber weißt du», lächelte er noch breiter, «was gut ist?»
«Was?», fragte ich und hoffte, doch noch etwas Gutes über mich zu hören.
«Dass ich deine Rolle bereits aus dem Drehbuch gestrichen habe.»
«Grdll?»
«Mein James Bond ist ein James Bond des 21. Jahrhunderts. Er ist ein begnadeter Hacker und braucht keine Hilfe, um an Informationen zu kommen.»
«Bitte, Mr. Barton», flehte ich ihn nun an und vergaß dabei jeglichen Stolz, «ich brauche diese Rolle. Ich bin mit meiner Miete im Rückstand, und meine Karriere ist am Ende …»
«Und das ist mein Problem, weil?», fragte Barton gelangweilt.
«Es ist nicht Ihr Problem», stammelte ich, «aber Sie könnten was echt Gutes tun …»
«Ich tue genug Gutes, Kleine. Ich habe im letzten Jahr eine Million Dollar dafür gespendet, dass afrikanische Kinder Schauspielunterricht bekommen. Wann hast du das letzte Mal etwas Gutes getan?»
Darauf fiel mir nichts ein.
«Hab ich mir gedacht», lächelte Barton und wandte sich zum Gehen. «Ich gehe jetzt aufs Laufband. Ruft mich, wenn der Umbau fertig ist.»
Boopsie pupste noch mal in meine Richtung. Der Name des Hundes war echt Programm. Dann verschwanden Star und Hund vom Set. Damit löste sich auch meine Rolle in Luft auf. Und meine Chance, die Miete zu zahlen. Oder dem Beinbrecher mit der Impulskontrollstörung die Taxifahrt.
Der Regisseur wandte sich ab, wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Glatze und murmelte leise: «Ich hätte auf meine Eltern hören und Wirtschaftsprüfer werden sollen.»
Ich wäre jetzt auch so gerne eine Wirtschaftsprüferin gewesen. Und dass ich mich nach einem solchen Beruf sehnte, landete auf Platz 7 der miesesten Momente des Tages. Es war der letzte Augenblick auf der Liste, der weniger schlimm war als unser Tod.
4
Niedergeschlagen ließ ich mich von der Kostümbildnerin abschminken – was eine ganze Zeit lang dauerte, waren doch so viele Schichten Make-up aufgetragen – und ging anschließend in Richtung Kostüm-Mumie. Am anderen Ende des Ganges kam mir der tschetschenische Taxifahrer entgegen. Anscheinend mochte er nicht länger auf sein Geld warten.
«139 Euro 80!», rief er mir von weitem zu.
Anstatt ihm zu antworten, tat ich so, als ob ich ihn nicht gesehen hätte, drehte mich um und eilte den Gang zurück. Wenn ein Problem sich nicht von alleine löste und man es auch nicht mehr aufschieben konnte, war es immer noch möglich, vor ihm davonzulaufen.
«140 Euro!», rief der Tschetschene. Der Typ besaß anscheinend ein inneres Taxameter.
Ich begann zu rennen und hörte hinter mir, wie er ebenfalls anfing zu laufen. Ich verschwand um die Ecke, sah mich panisch um und erblickte eine Garderobentür mit der Aufschrift Marc Barton. Da ich wusste, dass der Star auf dem Laufband war, entschied ich mich, durch die Tür zu gehen und mich in der Garderobe zu verstecken. Der Raum war mit Luxus geradezu vollgepfropft: Drei Highend-Fernseher standen darin, eine Bang-&-Olufsen-Stereoanlage, diverse Apple-Geräte und mittendrin in all dem neumodischen Schnickschnack ein Plüschsofa, das aussah, als hätte Marie Antoinette einst ihren königlichen Popo darauf gebettet.
Kaum hatte ich die Tür geschlossen, stieg mir ein strenger Geruch in die Nase. Boopsie! Der Terrier lief auf mich zu. Und er konnte nicht nur pupsen, sondern auch bellen. Doch das durfte er nicht! Denn sonst würde der Taxifahrer bestimmt gleich hier reinstürmen.
«Halt die Klappe», zischte ich Boopsie an.
Der Köter kläffte lauter. Und er furzte Amok. Obwohl mich der Gestank benebelte, fiel mir ein, dass der Hund sonst bestimmt nur auf englische Befehle hörte. Hastig suchte ich nach der englischen Übersetzung von «Halt die Klappe» und sagte: «Hold the Klapp!» Ich war mir ziemlich sicher, dass diese Übersetzung nicht korrekt war.
Boopsie war nun vor lauter Kläffen kurz vorm Hyperventilieren.
«Shut up!», sagte ich nun. Boopsie shuttete tatsächlich ab. Aber nur, weil er in meine Wade biss. Ich hingegen biss mir auf die Lippe, um nicht aufzuschreien und mich damit zu verraten. Verzweifelt versuchte ich, den Terrier abzuschütteln. Doch Boopsies Zähne drangen immer tiefer in mein Wadenfleisch. Der Schmerz war nicht mehr zu länger ertragen. Ich schüttelte mein Bein wie wild hin und her. Schließlich gelang es mir, das kleine Biest wegzuschleudern. So heftig, dass es regelrecht flog. Weit flog. Bis der Flug jäh von der Wand unterbrochen wurde. Boopsie jaulte kurz auf, und dann war endlich Ruhe.
«141 Euro 20!», hörte ich den Tschetschenen an der Garderobe vorbeigehen.
Ich hielt die Luft an. Die Schritte entfernten sich. Ich atmete auf. Dann blickte ich zu dem Hund. Der lag noch immer reglos an der Wand. Irgendwie sah das nicht gut aus. Ich ging auf ihn zu und stupste mit meinem Fuß gegen ihn. Keine Reaktion. Das sah überhaupt nicht gut aus. Ich beugte mich nun zu Boopsie runter und rüttelte ihn. Er machte rein gar nichts. Das sah jetzt sogar außerordentlich schlecht aus. Panisch nahm ich einen Spiegel vom Tisch und hielt ihn dem Hund vor die Schnauze. Der Spiegel dachte gar nicht daran zu beschlagen.
Oh … mein … Gott!
Ich hatte Boopsie getötet.
Den beliebtesten Hund der Welt.
Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass dieser Augenblick auf Platz 5 der miesesten Momente des Tages landete.
Zu allem Überfluss hörte ich von draußen Barton, wie er in ein Handy sagte: «Call you later, Sugarbutt!»
Unter normalen Umständen hätte ich mich wohl darüber gewundert, dass Barton seine Frau Zucker-Hintern nannte, aber ich geriet in Panik, weil er nicht mehr auf dem Laufband war. Jeden Augenblick würde der Filmstar seine Garderobe betreten und mich erwischen. Und noch viel schlimmer: Er würde den toten Terrier sehen!
Panisch schnappte ich mir den Hund und versteckte ihn hinter den flauschigen Kissen des antiken Sofas. Gerade noch rechtzeitig, bevor Barton in seinen lässigen Sportklamotten die Garderobe betrat. Sofort begann ich zu plappern: «Sicherlich sind Sie total überrascht, dass ich in Ihrer Garderobe bin, aber dafür gibt es eine ganz simple Erklärung, und die lautet … die lautet …»
Ich hatte keine Ahnung, wie die lautete.
«Ich weiß, wie sie lautet», lächelte Barton.
«Ah ja?», fragte ich erstaunt.
«Du bist nicht die erste Frau, die mir in der Garderobe auflauert.»
Natürlich nicht.
«Und du bist auch nicht die erste, die für eine Rolle mit mir ins Bett will.»