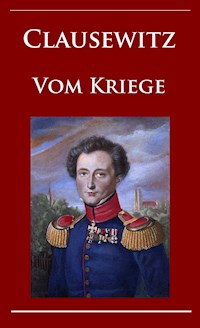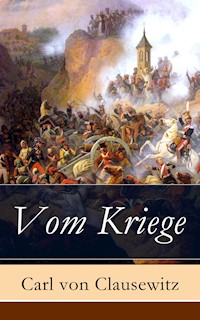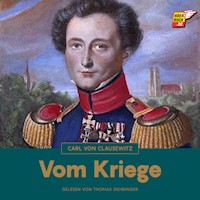Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Carl von Clausewitz war ein preußischer General, Heeresreformer und Militärtheoretiker. Seine Schriften zur Kriegsführung und -politik gehören auch heute noch zur Standardliteratur. Hier sind enthalten. Geist und Tat - Das Vermächtnis des Soldaten und Denkers Nationalstolz Deutschlands Verfassung Über Koalitionskrieg Charaktervolle Politik Journalismus Bei Gelegenheit deutscher Philosophen, die es gut meinen. Politisches Rechnen Über Monarchie Aus Briefen 1806 - 1807 Über den Nationalgeist der Franzosen Über den Zustand der Theorie der Kriegskunst Was Großes in der Kriegsgeschichte geschehen ist, ist nicht die Schuld der Bücher Aus Briefen 1808 - 1809 Die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens, zur Ergänzung meines Unterrichts bei Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Bekenntnisse Aus Briefen 1812 Aus Briefen 1813 Der Feldzug von 1813 bis zum Waffenstillstand Über Kunst und Kunsttheorie Über den Begriff des körperlich Schönen Schluß des Feldzugs 1796/97 Die Verhältnisse Europas seit der Teilung Polens Über die politischen Vorteile und Nachteile der preußischen Landwehr
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Militärische und politische Schriften
Carl von Clausewitz
Inhalt:
Carl von Clausewitz – Biografie und Bibliografie
Geist und Tat – Das Vermächtnis des Soldaten und Denkers
Nationalstolz
Deutschlands Verfassung
Über Koalitionskrieg
Charaktervolle Politik
Journalismus
Bei Gelegenheit deutscher Philosophen, die es gut meinen.
Politisches Rechnen
Über Monarchie
Aus Briefen 1806 – 1807
Über den Nationalgeist der Franzosen
Über den Zustand der Theorie der Kriegskunst
Was Großes in der Kriegsgeschichte geschehen ist, ist nicht die Schuld der Bücher
Aus Briefen 1808 – 1809
Die wichtigsten Grundsätze des Kriegführens, zur Ergänzung meines Unterrichts bei Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen
Bekenntnisse
Aus Briefen 1812
Aus Briefen 1813
Der Feldzug von 1813 bis zum Waffenstillstand
Über Kunst und Kunsttheorie
Über den Begriff des körperlich Schönen
Schluß des Feldzugs 1796/97
Die Verhältnisse Europas seit der Teilung Polens
Über die politischen Vorteile und Nachteile der preußischen Landwehr
Militärische und politische Schriften, Carl von Clausewitz
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849638184
www.jazzybee-verlag.de
Carl von Clausewitz – Biografie und Bibliografie
Preuß. General und Militärschriftsteller, geb. 1. Juni 1780 in Burg, gest. 16. Nov. 1831 in Breslau, trat 1792 in die preußische Armee, kämpfte 1793 und 1794 am Rhein, besuchte 1801–1803 die Berliner Akademie für junge Offiziere und erwarb sich hier die Gunst Scharnhorsts. 1806 begleitete er den Prinzen August als Adjutant, wurde infolge der Kapitulation von Prenzlau Gefangener, arbeitete nach seiner Auswechselung seit 1809 unter Scharnhorst im Kriegsministerium und als Major im Generalstab. Beim Ausbruch des russischen Krieges trat er in russische Dienste und war, von Diebitsch beauftragt, beim Abschluss der Konvention von Tauroggen beteiligt, bearbeitete den Entwurf zur Bildung der ostpreußischen Landwehr im Sinne Scharnhorsts und war 1813 Chef des Generalstabs in Wallmodens Korps. Während des Waffenstillstandes schrieb er: »Übersicht des Feldzuges von 1813« (Leipz. 1814), trat nach dem Frieden von 1814 wieder ins preußische Heer und wurde 1815 Chef des Generalstabs des 3. Korps unter Thielemann. In dieser Stellung blieb er in Koblenz bis 1818 und wurde dann Generalmajor und Direktor der allgemeinen Kriegsschule, 1830 Artillerieinspekteur und später Chef des Generalstabs des Feldmarschalls Gneisenau. Seine zuerst als »Hinterlassene Werke über Krieg und Kriegführung« (Berl. 1832–37, 10 Bde.) erschienenen Schriften nehmen in der Theorie der Kriegskunst eine bedeutende Stellung ein, namentlich: »Vom Krieg« (4. Aufl. 1880; gleichzeitig Bearbeitung von v. Scherff, Berl. 1880); »Der Feldzug von 1796 in Italien« (3. Aufl. 1889); »Der Feldzug von 1815«; »Über das Leben und den Charakter von Scharnhorst«. Sehr wichtig sind die »Nachrichten über Preußen in seiner großen Katastrophe 1806« (hinterlassene Handschrift des Generals v. C., hrsg. in den »Kriegsgeschichtlichen Einzelschriften des Großen Generalstabs«, 1888; franz., Par. 1903). Briefe von C. an seine Gemahlin erschienen 1876 in der »Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde«. Vgl. Schwartz, Leben des Generals v. C. u. der Frau Marie v. C. (geborene Gräfin v. Brühl) (Berl. 1877, 2 Bde.); v. Meerheimb, Karl v. C. (das. 1875); v. Bernhardi, Leben des Generals Karl v. C. (10. Beiheft zum »Militär-Wochenblatt«, das. 1878). 1889 erhielt das oberschlesische Feldartillerieregiment Nr. 21 den Namen Feldartillerieregiment von C.
Geist und Tat – Das Vermächtnis des Soldaten und Denkers
1941
Wirft man nun auch einen Blick auf den Zustand der Kultur, in welchem sich Frankreich befindet, nämlich so, wie wir sie in der Verfassung des Reichs in den Sitten, in dem Geist der Nation erblicken, so sieht man wohl, daß höchstens Deutschland und England sich mit ihm vergleichen lassen. Spanien und Italien sind gelähmt durch innere Erschlaffung. Bei dem erstern ist es hauptsächlich die Schwäche, die gänzliche Abspannung der Regierung, welche seit vielen Jahren unaufhörlich auf die Nation einwirken, die Würde derselben, den edlen Stolz, als Repräsentanten ihrer ehemaligen Kraft, nicht vernichten, aber in Trägheit und des Lasters unnatürliche Verbindung fesseln konnten. Italien steht noch viel tiefer; seitdem seiner Weltherrschaft Thron von deutschen Armeen zusammengestürzt wurde, hat es in ewiger Abhängigkeit von fremder Herrschaft geschmachtet.
Man wird mir die italienischen Freistaaten des Mittelalters anführen. Allein, was wollen ein paar kleine Republiken sagen in Vergleichung mit dem ganzen italienischen Volke? Kann ein Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit ein Nationalgefühl genannt werden, wenn es nicht die ganze Nation ist, sondern eine kleine Kolonie, umgeben von der unterjochten großen Masse, die dies Gefühl genießt? Konnte selbst der republikanische Italiener je zu dem Gefühl seiner Würde als Italiener kommen, der vielleicht fünf Sechsteile seiner Nation unter fremder Herrschaft stehen sah? Überdem: nie werde ich mich überreden können, daß der Geist der italienischen Republik im Mittelalter ein wahrhaft großer Geist für Freiheit und Unabhängigkeit und die Kraft, welche sie entwickelt haben, eine Äußerung moralischer Würde sei. Oft war die reine Kraft der Usurpation und Demokratie wie in Florenz, oft ein geschickt geleitetes Handelsinteresse wie in Venedig, und immer war das Instrument, dessen sie sich bedienten, mehr der Geist der Intrige und des Verbrechens als kriegerische Tugend. Man denke nur an die Art ihrer Kriege mit gemieteten Heeren und gedungenen Feldherrn.
Es (Italien) ist nicht bloß durch den Drang politischer Ereignisse, sondern durch einen förmlichen Untergang seiner inneren Größe, durch eine allgemeine Sitten- und Geistesverderbnis so tief gefallen. Die lastervolle Herrschaft seiner Päpste über Europa mußte die Nation nur noch tiefer versenken, und wenn wir einzelne mächtige Geister unter ihnen hervorragen sehen, so ist es der herrliche klassische Boden, der trotz der allgemeinen Zerstörung und ohne Wartung und Pflege die üppigen Zweige und duftenden Blüten hin und wieder hervortreibt. Es ist die Glut und das Licht der Religion, durch und in welcher sie strahlen.
Von der Sklaverei fremder Herrschaft kann eine Nation sich nicht durch Künste und Wissenschaften loskaufen. Ins wilde Element des Kampfes muß sie sich werfen; tausend Leben gegen tausendfachen Gewinn des Lebens einsetzen. Nur so kann sie von dem Siechbette wieder aufstehen, worauf sie fremde Fesseln trug. Bei den Reichen Italien und Spanien scheint das fremde Joch wenig zu lasten; man darf also nur wenig kräftigen Beistand von daher erwarten. Überdem ist der Wohlstand dieser Länder durch die elenden Grundsätze der Regierungen im tiefsten Verfall.
England, so wenig es auch Frankreich in jeder Rücksicht nachstehen möchte, hat einen zu wenig direkten Anteil an dem Kontinent, um ihm hauptsächlich zum Gegengewicht dienen zu können, und von dem Augenblick an, da Europa sich vorzüglich auf England verlassen wird, wird es in tiefsten Verfall geraten. Deutschland, an Kultur und innerem Wohlstand vielleicht auf gleicher Höhe mit Frankreich, hat bekanntlich ein so schwieriges Föderativsystem, daß es durchaus nicht mehr mit seiner natürlichen Schwere gegen dieses Reich wirken kann. Rußland kann nicht eher bedeutend wirken, bis Deutschland schon verloren ist. Welch eine Aussicht für Europa! – Nichts bleibt übrig als das Koalitionssystem. Und wenn wir dies System seit Ludwig XIV. unaufhörlich anwenden und immer mit Erfolg anwenden sehen, aber doch sehen, wie es sich mit Mühe dem mächtigen Frankreich entgegengestellt hat und nach und nach immer etwas gewichen ist, und nun bedenken, wie weit sich unsere Politik entfernt hat von der Politik eines Leopold, Joseph, Wilhelm von Oranien und der Königin Anna – welch eine Aussicht für Europa!
Nationalstolz
Ob die Franzosen den Römern glichen? – Sonderbar! Warum soll dann eine Epoche von zehn Jahren diese Ähnlichkeit beweisen, da soviel Jahrhunderte sie nicht einmal ahnen ließen? Wenn man von Franzosen und von Römern spricht, so spricht man von der ganzen Nation; diese läßt sich nur ihrem Nationalcharakter nach mit einer andern vergleichen, und hier kann wenigstens von keiner rühmlichen Ähnlichkeit die Rede sein. Aber fragt man, gleicht das System, der Charakter der französischen Politik dem der römischen, findet sich Ähnlichkeit in ihrer beiderseitigen politischen Lage, so muß man antworten: ja so viel, so sehr viel, als sich bei der Verschiedenheit der Zeitalter finden kann.
Rom wollte die Welt erobern oder wollte sie wenigstens regieren, Frankreich geht mit starken Schritten auf einen gleichen Zweck los, es will die übrigen Staaten mit seiner Größe erdrücken und in tiefer Abhängigkeit von sich erhalten. Dies ist das furchtbare Resultat der Vergleichung!
Für das Glück der Völker darf jetzt kein zweites Rom entstehen, welches auch die neue Schöpfung ist, die sich aus der politischen Krise erzeugt. Es dürfen nicht ganze Nationen an dem Triumphwagen einer einzigen gefesselt liegen – was meint es anderes!!
Vielleicht läßt der jetzige Zustand Europens es nicht fürchten, daß ein neues Rom entstehe, vielleicht sind die mächtigen Schritte, mit welchen sich Frankreich seinem Ziel genähert hat, vergebens, und das schon verlorene Gleichgewicht stellt sich durch neue fürchterliche Kämpfe oder auch durch ein ruhiges Scheiden der Teile nach unaufgehaltenen Gesetzen der Natur wieder her – immer bleibt eine verzeihliche, eine empörende Furcht in unserer Seele. Furcht? – Jawohl! Wenn man sieht, wie Frankreich ganz so, wie es jetzt in Europa auftritt, nur ein Gegenstand der Bewunderung und Ehrfurcht und feiger Abgötterei anderer Nationen ist. Niemand kann einer Nation das Recht versagen, mit allen Kräften für ihre Vorteile zu kämpfen, sich von Sklavenketten loszureißen – ja nicht Frankreich kann man tadeln, wenn es seinen Fuß auf unsern Boden setzt und sein Reich furchtsamer Vasallen bis ans Eismeer reichen läßt.
Aber läßt sich denn damit nur Kleinmut gründen? Nur auf feige Menschen macht das Große einen solchen Eindruck. Bei Menschen von Mut und gesunden Kräften erzeugt die Größe wiederum Größe; sie weckt den Mut, den edlen Stolz, sie streut den Samen großer Taten aus. Wohin deutet nun diese Abgötterei? Sind wir denn wirklich ein so feiges Geschlecht, daß wir uns nicht mit jenen stolzen Siegern zu messen wagen? Dies zu glauben, darin liegt die Feigheit! Sind wir denn wirklich so tief gesunken, daß es uns ehrenvoll erscheint, unser ganzes Dasein der Huldigung einer andern Nation zu widmen, in ihrem Ruhm und ihrem Zweck uns selbst zu verlieren?
Spott und Verachtung allen, die so mutlos und selbstvergessen sind! Leider ladet mehr als ein Deutscher diesen Bannspruch auf sich, indem er schamvergessen den Wert der ganzen Nation, seiner eigenen Nation leugnet. Verachtungswerter noch als der gemeine Mensch, der sich in dem Anschauen großer Taten wie im Anschauen der Unendlichkeit verliert, ist der, der die Nation herabsetzt, damit er selbst um so größer dastehe. Er richtet die Nation, er versteht die Großtaten der Nachbarn zu würdigen – darum steht er höher als die übrigen der Nation.
Stehe er, wo er sich einbildet zu stehen; er kann nichts beitragen, die Nation zu erheben, zu veredeln, zu verewigen – sie stößt ihn aus als ein unnützes Glied und überläßt es seinem Eigendünkel, ihm zu lohnen, damit er das Lob seiner Vaterlandsgenossen entbehren könne.
Deutschlands Verfassung
Deutschlands Verfassung und seine jetzige politische Schwäche rühren hauptsächlich aus folgenden drei Gründen her.
Daß es wieder ein Wahlreich wurde gleich nach der Auflösung der fränkischen Monarchie, während in Frankreich das Königtum erblich war; daß seine geographische Lage weniger günstig wie die von Frankreich, Spanien und England war, weil es in Berührung mit den Ungarn, Polen und Böhmen, den griechischen Kaisern und zuletzt mit den Türken stand, woraus eine zahllose Menge von Kriegen entstanden;daß es einen so großen Umfang zu einer Zeit hatte, da man noch nicht imstande war, eine solche Staatenmasse zu regieren, nämlich im Mittelalter, als das Feudalsystem in seiner Tendenz zur Anarchie den höchsten Punkt erreicht hatte. Damals, als in Spanien, Frankreich und England sich die bürgerliche Verfassung zu bilden anfing und die Regenten beschäftigt waren, ihre Macht im Innern zu verstärken (das allgemeine Bedürfnis dieser Zeit), damals waren die deutschen Kaiser so in den italienischen Angelegenheiten verwickelt und durch die gefährlichen Kabalen der Päpste so gelähmt, daß ihre Bemühungen in Deutschland zur Beförderung ihrer fürstlichen Autorität nur sehr unbedeutend sein konnten.Wenn auch diese Gründe zureichend scheinen sollten, so ist doch gewiß im Nationalcharakter ein Prinzip vorhanden, das in eben dem Sinn gewirkt hat.
Politische Regeln
Die wichtigsten politischen Regeln sind mir: nie sorglos zu sein; nichts von der Großmut anderer zu erwarten; einen Zweck nicht eher aufzugeben, bis es unmöglich ist, ihn zu erreichen; die Ehre des Staats als heilig zu betrachten.
Über Koalitionskrieg
Ich kenne nur zwei Mittel, um auf eine zweckmäßige Allianz einen zweckmäßigen Krieg folgen zu lassen. Das eine ist die Summe der Streitmassen, welche man für den Krieg bestimmt hat, zusammenzuwerfen und einem Feldherrn die Leitung derselben zu übertragen; oder man entwirft sich einen allgemeinen Kriegsplan, der sich auf die natürlichen Verhältnisse und Vorteile eines jeden Staates gründet und wovon wir die näheren Grundsätze und Beispiele ein andermal geben werden.
Zuweilen hat schon der erste Fall stattgefunden, wenn nämlich die Streitkräfte, welche der eine Staat aufstellen wollte, zu unbedeutend waren, um ihm einen Anteil an der Leitung des Krieges auszuwirken. Sooft es aber nur geschehen konnte, haben die Minister ihren Scharfsinn aufgeboten, alle kleinen Vorteile des Staates aufzuspüren und ihnen nachzugehen. Sie meinen töricht, jede Aufopferung, wodurch sie nicht grade einen politischen Vorteil erkaufen, sei Schwäche oder Ungeschicklichkeit; denn sie bedenken nicht und wissen nicht zu schätzen, was sie auf der andern Seite wieder gewinnen, sowohl an Größe als Wahrscheinlichkeit des Erfolges.
Charaktervolle Politik
Ich halte nicht viel von den kleinlichen Tricken und Kabalen in der Politik. Ich will nicht behaupten, daß die Politik immer eine offene Straße gehen könne mit unverhehlter Absicht. Allein wie versteckt auch der Plan liege, dem ein Staat mit Gewandtheit nachgeht, immer müssen die Hilfsmittel kräftig und des Staates würdig bleiben, wenn es dabei auf den Ausgang einer wichtigen Sache ankommt.
Bei einzelnen bestimmten Unterhandlungen sind einfache und entscheidende Maßregeln noch notwendiger, und das Spiel seiner Intrigen kann hier höchstens den Unterhändlern selbst dienen, um sich auf die eine oder andere Art Erleichterung in ihren Schritten zu verschaffen.
Die Betrachtung des Westfälischen Friedens hat mich vorzüglich in dieser Idee bestärkt; denn ich sehe nicht, daß den Spaniern und Österreichern ihre erbärmlichen endlosen Kabalen großen Nutzen geschafft hätten, und die Schweden, die eine offene, feste, würdige Sprache führten und sie mit dem Degen unterstützten, haben dabei mehr für sich und ihre Alliierten erreicht als alle übrigen.
Journalismus
Heut wird ein Staat aus seinen Fugen losgerissen und von seiner Höhe hinuntergeschleudert, und morgen erscheinen Betrachtungen an seinem Grabe; morgen wird in den Eingeweiden des Freundes geforscht, der heut gestorben ist. Dies ist der Geist der deutschen politischen Journale und Flugschriften. Sie scheinen auf den Untergang des Großen und Heiligen nur zu lauern, um alsobald (mit einer wahren Barbier- und Friseureilfertigkeit) die traurige Erbschaft einer Biographie, Abhandlung, Betrachtung, Prophezeiung, und was dergleichen auf Gräbern wachsendes Unkraut mehr ist, in Besitz zu nehmen.
Wenn ihr, die ihr zu dumm seid, um ohne Gefühl sein zu dürfen, nicht einem wohltätigen Vorurteil frönen wollt, wozu seid ihr dann da, Gesindel?
Nie hat es eine Nation gegeben, welche den unmittelbaren Druck, den eine andere gegen sie ausübt, anders erwidert hat als mit Haß und Feindschaft. Nur wir haben diese Afterweisheit, diesen Narrenstolz, der sich einbildet, eine Krone zu tragen, während er eine Sklavenkette schleppt.
Bei Gelegenheit deutscher Philosophen, die es gut meinen.
Eingebildete, verachtungs-spottenswürdige Philosophie, die uns auf einen Standpunkt stellen will hoch über das Treiben der Gegenwart hinaus, damit wir uns ihrem Druck entziehen und alles innere Widerstreben unseres Busens aufhöre! Die ein totes Vertrauen an die Weltregierung und ihre höheren Zwecke an die Stelle seht und eine kalte Klügelei als Zuschauerin der Werke Gottes an die Stelle der verzehrenden Glut, die sein Werkzeug ist!
Daß einzelne Geschlechter nichts sind als ein geringes Werkzeug der Vorsehung, daß sie ihren Wert nur darstellen können in dem Werke, das durch sie geschaffen wurde, daß es gleichgültig ist, ob das Werkzeug ein wenig früher oder später zerbricht; daß sie nicht da sind, um die Welt zu beobachten, sondern um die Welt zu sein, durch beständiges Streben nach vernünftigen Zwecken – das, denke ich, ist der höchste Standpunkt, über welchen es keinen weiter gibt.
Traurige Ruhe, törichte Hoffnung auf die Zukunft! Heut ist es, wo das Morgen, in der Gegenwart ist es, daß die Zukunft geschaffen wird. Indem ihr töricht der Zukunft harret, tritt sie aus euren faulen Händen mißgestaltet schon hervor.
Politisches Rechnen
Die Wahrheit eines politischen oder moralischen Raisonnements ist nichts als Wahrscheinlichkeit, also mancherlei Grade fähig, die für zwei Menschen nicht immer ein und dieselben sind. Doch diese Verschiedenheit der Meinung ist nicht so bös als eine andere, die darin besteht, daß der eine alle die Möglichkeiten, die noch neben einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bestehen können, wegwirft, um sich nicht in ein Labyrinth von Alternativen zu verlieren, während der andere sie beibehält. Der erstere kommt bald auf ein reines Resultat, der andere nie. Den ersten leitet in seinem Handeln stets der wahrscheinlichste Fall; er kann irren, weil der wahrscheinlichste Fall doch nicht der einzig mögliche ist; aber immer bleibt doch sein Irrtum unwahrscheinlich, und immer wird sein Betragen konsequent sein. Der andere, nicht imstande, alle möglichen Fälle immer gleich scharf ins Auge zu fassen, sie alle nach ihrem wahren Wert zu würdigen, hat bald keinen anderen Führer als seine Wünsche. Hiermit hört seine Intelligenz auf, und er ist seinen Feinden ein leichtes Spiel.
Daher handeln gewöhnliche Menschen in großen Krisen nicht eher vernünftig, als bis sie, auf die Spitze der Verzweiflung gestellt, gar keinen anderen Rettungsweg mehr sehen, als einen gewagten Sprung zu tun. Dieser Zustand gibt ihnen Mut, Einheit und Energie; weg ist aber dieser ganze Geistesreichtum, wenn entfernte Möglichkeiten törichte Hoffnungen erwecken, das sind die wahren Ableiter der Kraft, der moralischen Elektrizität, und vor unsern Augen sinkt mit unglaublicher Schnelligkeit der innere Mensch von seiner künstlichen Höhe herab und schrumpft zusammen zur alten Erbärmlichkeit, in der das lauernde Gespenst eines feindseligen Geschöpfes ihn dann mit leichter Mühe ergreift.
Über Monarchie
Platte Menschen glauben wunder, was es für ein effort von Scharfsinn ist, wenn sie in der Person des Regenten eine Distinktion zwischen sein Privatindividuum und sein öffentliches Individuum anstellen; und nichts hat zu gröbern und heillosem Irrtümern verleitet. Weil zuweilen ein König Privateigentum besitzt, das mit dem öffentlichen nichts zu schaffen hat, so denken sie, daß er auch eine Privatehre hat, um die sich der Staat nicht zu kümmern braucht. Das Interesse eines Fürsten läßt sich freilich oft von dem Interesse seiner Untertanen trennen, ob dies gleich gegen die Vernunft ist, wir sehen es von Bonapartes Beispiel; aber nie läßt sich die Person des Fürsten von seiner Würde absondern, denn die Würde ist nicht ein Prädikat der Person, das man davon hinwegdenken kann, sooft man will, sondern die Person ist ein Eigentum der Würde und wird als solches ebenso unverletzlich als sie selbst. Die Ehre ist ein Attribut der Person, das gar nicht von ihr getrennt werden kann. Darum ist die öffentliche Ehre des Königs unzertrennlich von der persönlichen; diese ist das herrlichste Insignum der Krone. Eine Nation, die sich sinnliche Vorteile erkauft um den Preis ihrer Ehre, muß sosehr im Verfall sein, daß sie ohne große Revolution unter andern Nationen nicht mehr lange bestehen kann. Denn die Ehre und Würde einer Nation stellt ihren ganzen moralischen Zustand in einem Endresultat dar. Wo aber kann die Ehre einer Nation empfindlicher gekränkt werden als in der Ehre ihres Monarchen, in welcher jene gleichsam konzentriert enthalten ist? Eine ehrliebende edle Nation wird es schon tief empfinden und bereit sein zu rächen, wenn einer ihrer Mitbürger gekränkt wird; wieviel mehr muß dies sein, wenn die Kränkung einer ihr geheiligten Person widerfährt, welcher aufgetragen ist, die ganze Nation zu repräsentieren? In Staaten und unter Völkern, wo nicht eine herzlose Sophisterei den Advokaten der Elendigkeit macht, wo das Herz noch eine Quelle warmer und edler Gefühle ist, wird nicht bloß durch die abstrakte Vernunft des Regenten die moralische Person des Staates, sondern auch durch seine ganze Menschennatur die Nationalität des Volkes dargestellt. Die Person des Regenten muß also der Nation in jeder Rücksicht ihr Allerheiligstes sein, das niemand beleidigen kann, ohne die Nation selbst zu beleidigen. Wie könnte also eine Nation wünschen, daß, um ihres sinnlichen Vorteils willen, der Regent seine Ehre hingebe? Das würde nichts anderes sein, als wenn die Nation ihre eigene Ehre um diesen Vorteil aufgäbe; d. i., noch einmal sei es gesagt, wenn die Nation sich einer großen Revolution oder ihrem Untergang näherte.
*
Welche verrückte Lehre ist es, die den Menschen lehrt, dem Physischen das Moralische aufzuopfern, die Tugend hinzugeben für den sinnlichen Genuß? Welcher Lehrer kann das seinem Schüler sagen und erlauben, welcher König seiner Nation? Darum ist es ein feiger Sophismus, wenn man von der Verpflichtung des Regenten spricht, seine eigne Ehre wie die der Nation dem physischen Wohl derselben aufzuopfern. Der König ist Repräsentant der Nation; was er tut, was an ihm bewundert wird, daran hat die Nation einen unwillkürlichen, vielleicht unverdienten Teil vor Mit- und Nachwelt. Der König, der schmachvoll verdirbt, beschimpft die Nation und verschuldet ihr Unglück; der, welcher glorreich untergeht, verherrlicht die Nation, und sein herrlicher Name ist Balsam auf ihre Wunden!
Aus Briefen 1806 – 1807
Kantonierungsquartier Gelbstädt in der Grafschaft Mansfeld, den 18. September 1806
Wir rücken immer weiter vor, und ein schwacher Schimmer kriegerischer Aussicht fällt von neuem in meine Seele und erleuchtet so manches Bild, so manche Hoffnung, die schon wieder in die Dunkelheit zurückgetreten waren. – Wenn wir so über Berg und Tal in der gekrümmten Straße des Waldes mit offenen, langgedehnten Reihen einherziehen und Musik und Gesang die Lüfte erfüllt, so erweitert sich mir das Herz, und ich bin reich an frohen Hoffnungen und Ahnungen – wie suche ich dann nach einem Wesen, dem ich mich mitteilen könnte, von dem ich verstanden und durch gleiche Gefühle belohnt würde –, und ich finde keines. Auch nicht eine Seele, in welcher sich die Welt in einer veredelten Ansicht spiegelte; auch nicht ein Gefühl, was tiefer griffe als in die Gemeinheit unseres Daseins. Kein gehaltreiches Wort kommt über meine Lippen, kein solches dringt zu meinem Ohre. – Sie vorzüglich, geliebte Freundin, müssen mit mir die Armut eines solchen Lebens fühlen; Sie werden mich bedauern und, mich zu trösten, schon einmal öfter erlauben, Ihnen zu schreiben und den ins Dasein zurückgetretenen Empfindungen und Hoffnungen die himmlische Wohltat der Sprache gewähren. Dieses schöne Recht erwarb ich mit Ihrer Liebe, und es schmeichelt meinem Stolze die Ausübung desselben ebensosehr, als sie mein Herz befriedigt. Ich werde nie aufhören, dem Himmel laut zu danken für dieses wohltätige Geschenk, denn ich fühle in jedem Augenblicke meines Lebens mehr, wieviel, selbst bei dem unglücklichsten Ausgange desselben, mir Ihre Liebe gewesen ist.
Es ist wirklich ein recht ästhetischer Eindruck, den das Vorüberziehen eines Kriegshaufens macht; wobei man nur nicht an unsere Revuen denken muß. Hier sind es nicht wie dort steife Truppenlinien, die sich dem Auge darbieten, sondern man unterscheidet in den geöffneten Reihen noch das Individuum in seiner Eigentümlichkeit, und es herrscht neben der ruhig fortschreitenden Bewegung viel Mannigfaltigkeit und Ausdruck des Lebens. Jeder leuchtet mit seiner Rüstung einzeln durch die grünen Zweige des jungen Waldes, und wenn schon der Mann dem Auge entschwunden ist, blitzt noch seine Waffe durch die Wolke von Staub, die sich hoch über dem Rande des Tales erhebt und dem Entfernten des verborgenen Heeres Zug verkündet. Selbst die Mühseligkeit, die aus der Anstrengung spricht, wenn sich die Reihen mit ihrem Geschütz und Gepäck langsam den Berg hinaufziehen, gibt einen glücklichen Zug in dem Bilde. Die Menge der Individuen, welche selbst ein kleiner Kriegshaufe dem Auge darstellt, verbunden zu einer langen, mühevollen, gemeinschaftlichen Reise, um endlich auf dem Schauplatze von tausend Lebensgefahren anzukommen, der große und heilige Zweck, dem sie alle folgen, legt diesem Bilde in meiner Seele eine Bedeutung unter, die mich tief ergreift.
Glauben Sie ja nicht, teure Marie, daß Sie dies alles zu lesen bekommen, weil ich es für schicklich halte, einer Künstlerin mit der Feder etwas vorzumalen – ich bin wirklich ein wahres Kind, wenn ich so etwas sehe und weiß recht gut, daß ich manchem in diesem kindischen Wesen lächerlich erscheinen würde, daher ich mir Äußerungen der Art nur gegen meine vertrautesten und nachsichtigsten Freunde erlaube.
Der Ort, worin wir jetzt stehen, liegt am Fuße des Brockengebirges in einer tiefen Schlucht, so wie die Gebirgsbäche sie einreißen, wenn sie zuerst auf der flachen Ebene in ihrem wilden Laufe aufgehalten werden. Über unseren Häusern ragt ein langer Schieferfelsen hervor, so daß die Menschen über die Gipfel der Dächer hinwegzuschreiten scheinen. Die Gegend ist daher schon ziemlich romantisch und wird es noch mehr durch ein fürchterliches Unwetter, was von den Bergen die Bäche herabstürzt und die Schloßen gegen die Fenster wirft. Ein mächtiger Baum, der dicht vor den meinigen steht, ist das noch unfreundlichere Organ des unfreundlichen Windes. – Möchten wir bald den sicheren Schutz des Daches verlassen, der Unvernunft des wilden Elementes trotzen und durch den Schrecken unserer Waffen die Schrecken der Natur vergessen machen! Aus dieser langen fürchterlichen Nacht wird uns ja ein schöner Sommertag hervorgehen! O, so nahe an der Grenze eines Landes zu sein, in welchem man des Lebens ganzes Glück und höchstes Gut erringen kann, und die Grenze nicht überschreiten zu können! Des Krieges bedarf mein Vaterland und – rein ausgesprochen – der Krieg allein kann mich zum glücklichen Ziele führen. Auf welche Art ich auch mein Leben an die übrige Welt anknüpfen wollte, immer führt mich mein Weg über einen großen Kampfplatz; ohne diesen zu betreten, blüht mir kein dauernd Glück. Vieles denke ich mir zu erstreben, mehr als ein gemeiner Mut hoffen läßt – zwar habe ich, wenn ich mein Leben mit einem Blick überschaue, manchen glücklichen Erfolg gesehen, wozu die erste Anlage wenig berechtigte, manches Gut errungen, was ich als unmittelbare Gabe des Himmels betrachten muß – aber noch große Anforderungen an mein Glück habe ich zu tun!
Ich kann es nicht verhehlen, teure Marie, sooft meine Wünsche und Hoffnungen den Schauplatz des Lebens durchlaufen, eilen sie, früh oder spät, je nachdem eine heitere oder düstere Phantasie ihnen vorleuchtete, zu Ihnen, geliebte, teure Marie, um mich an Ihrer Hand das schönste Glück des Lebens genießen zu lassen. – Wieviel ist bis dahin zu tun übrig; wie wenig steht es in meiner Macht, es zu tun! Möglich wird es durch den Krieg, ich sehe ihm daher auch in dieser Rücksicht mit Verlangen entgegen.
Eben da ich dieses schreibe, erhalten wir Befehl zum neuen Aufbruch, um gegen Thüringen weiter vorzurücken. So wenig Hoffnung mein Verstand daraus ziehen kann, sosehr beschäftigt es meine Phantasie.
Roßbach, den 20. September
Hier hatte ich abgebrochen; ein schleuniger Aufbruch erlaubte mir nicht, weiterzuschreiben. Heute sind wir hier eingerückt. Sie können denken, mit welchen Empfindungen ich das Schlachtfeld besuchte, wo der unerträgliche Hochmut der Franzosen sosehr gedemütigt, uns aber ein stolzes Monument errichtet wurde, was über viele Zeiten und Länder, sogar über jenen Berg von Begebenheiten hinwegragt, den die letzten zehn Jahre vor es hingerollt haben, und woran sich unser Mut und unser Vertrauen mit der üppigsten Kraft emporrankt. Diese Schlacht hat das Eigentümliche, daß sie der ganzen Welt, besonders aber den Franzosen bekannt ist, ungeachtet sie, sowohl in Rücksicht der Kunst als der aufgeopferten Kräfte, sehr leicht erkauft wurde. Nie in der Welt ist eine so unbedeutende Schlacht von so wichtigen Folgen gewesen. Aller dieser Umstände wegen, muß ich gestehen, ist sie nicht sehr imponierend für mich. Doch ist es mir sehr interessant, täglich in ein Zimmer zu gehen, wo Friedrich der Große wohnte und wo er gerade aß, als man ihm die Nachricht brachte, daß die Franzosen ihn zu umgehen suchten, Seidlitz sprang zuerst auf, um die Kavallerie vorläufig satteln zu lassen; Prinz Heinrich folgte ihm und benachrichtigte die Infanterie. Endlich, gegen zwei Uhr, stieg auch der König auf das oberste Stockwerk des Hauses, um den Feind zu beobachten; er traute kaum seinen Augen, so unbegreiflich war das Unternehmen, nicht an Kühnheit, sondern an Dummheit. Der König befahl sogleich, daß die Armee zu den Waffen greifen und den Umständen gemäß abmarschieren sollte. Alle sprengten nun mit verhängtem Zügel zu dem Schloßhof hinaus durch des Dorfes enge Gassen, der Gefahr entgegen, die auf den Bergen ihrer wartete – welch ein Augenblick! Wenn ich den König in dieser Schlacht selbst nicht in dem Maße bewundere, wie der große Haufe des Militärs: so muß ich doch über seine Größe in diesem Zeitpunkte seines Lebens überhaupt erstaunen.
Er war in einer blutigen fürchterlichen Schlacht (bei Kolin) in Böhmen geschlagen worden und erhielt sich mit Not und Mühe noch einige Zeit in diesem Lande; er kehrte dann nach Sachsen zurück, wo drei Armeen sich die Hand boten, seine Staaten zu verschlingen. Eine zweite große Schlacht raubte ihm sein Heer in Preußen und dieses ganze Königreich. Eine vierte Armee, der ganzen preußischen Macht allein überlegen, folgte ihm aus Böhmen auf dem Fuße nach. In dieser verzweiflungsvollen Lage dachte der König an keinen Frieden. Aber diese Lage war noch nicht verzweiflungsvoll genug, um die Größe dieses erhabenen Gemütes auszumessen. Eine dritte Schlacht vernichtete bei Breslau den schönsten Teil seines Heeres, und brach die einzige Säule zusammen, auf welcher die Grundvesten des Staates ruhten; zwei Dritteile von Schlesien gingen verloren. So brachte der indes bei Roßbach erfochtene Sieg den König kaum einen Schritt von dem Abgrunde zurück, in welchen sein Staat zu stürzen und ihn unter seinen Trümmern zu begraben drohte. Der König sammelte die Reste seiner Heere und führte sie, dreißigtausend Mann stark, den neunzigtausend Österreichern bei Leuthen in Schlesien entgegen. Er war entschlossen, alles zu verlieren oder alles wieder zu gewinnen, wie ein verzweifelter Spieler und – daß unsere Staatsmänner es sich wohl merken möchten! – in diesem leidenschaftlichen Mute, der nichts ist als der Instinkt einer kräftigen Natur – liegt die höchste Weisheit. Die ruhigste Überlegung des glänzendsten Kopfes kann, entfernt von jeder Gefahr und jedem leidenschaftlichen Antriebe, auf kein anderes Resultat kommen. Davon bin ich ganz überzeugt. Hier, bei Leuthen, errang Friedrich in einer Mordschlacht jenen glänzenden Sieg, der den schönsten Stein in die Strahlenkrone seines Ruhmes fügte und den Staat, wie ein Zauberschlag, aus seinen Trümmern neugefügt hervorgehen ließ. – In dieser ganzen Periode sieht man den König mit einer Freiheit des Geistes und Heiterkeit handeln und leben, die mich bis zur leidenschaftlichen Bewunderung hinreißt. Sie verzeihen mir wohl, herrliche Marie, wenn ich mich hier einen Augenblick gehen ließ; ich habe doch gewiß nichts gesagt, was Ihrer nicht würdig wäre. Hätten doch alle Preußen vornehmen wie geringen Geschlechts den Blick so fest auf diesen glänzendsten Zeitpunkt unserer Geschichte gerichtet wie ich, sie würden früher schon es mehr der Mühe wert geachtet haben, ein so schön errungenes Dasein politischer Freiheit zu behaupten.
Merseburg, den 26. September
So weit hatte ich geschrieben, als ich, aus dem Hauptquartier zurückkehrend, den Brief meiner geliebten Marie vorfand. Ich danke Ihnen, denn mit Dank muß ich beginnen, ich danke Ihnen mit der höchsten Innigkeit für diesen Brief so voll Zärtlichkeit, und für diesen Ring für mich so voll schöner Bedeutung. Wie ein Kind habe ich mich darüber gefreut, und ich trage ihn – liebe Marie, wenn Du sehen könntest, mit welchem Vergnügen! Hier darf ich mir diese Freude schon erlauben, in Berlin werde ich mich darauf beschränken müssen, ihn recht oft zu betrachten. Schön und mir aus der Seele gesprochen die Aufforderung, ihn an dem Tage zu tragen, da Ruhm und Gefahren uns umgeben. Wenn Sie ihn denn je zurückerhalten, Marie, so werden Sie vielleicht stolz sein dürfen in dem Gedanken, daß in der wilden Wut des Streites, wo der Ruhm und die Freiheit des Vaterlandes und die eigene Ehre uns mit vollen Segeln über den glühenden Lavastrom der Gefahren hinwegtreibt, immer bereit zum Untergang – dennoch mancher Blick der Wehmut und stillen Freude auf diesen Ring fiel.