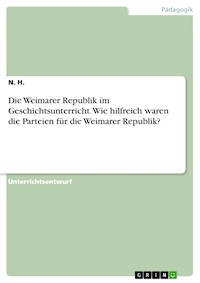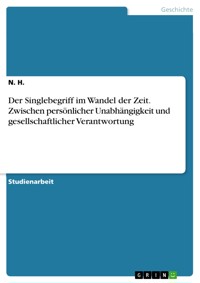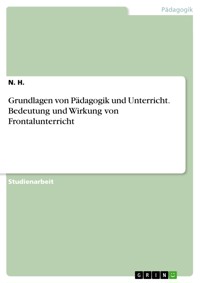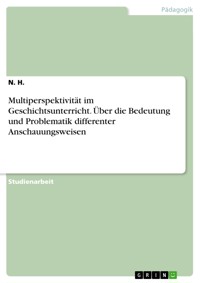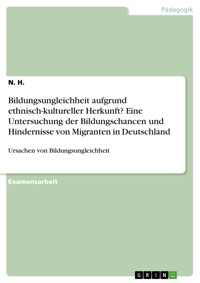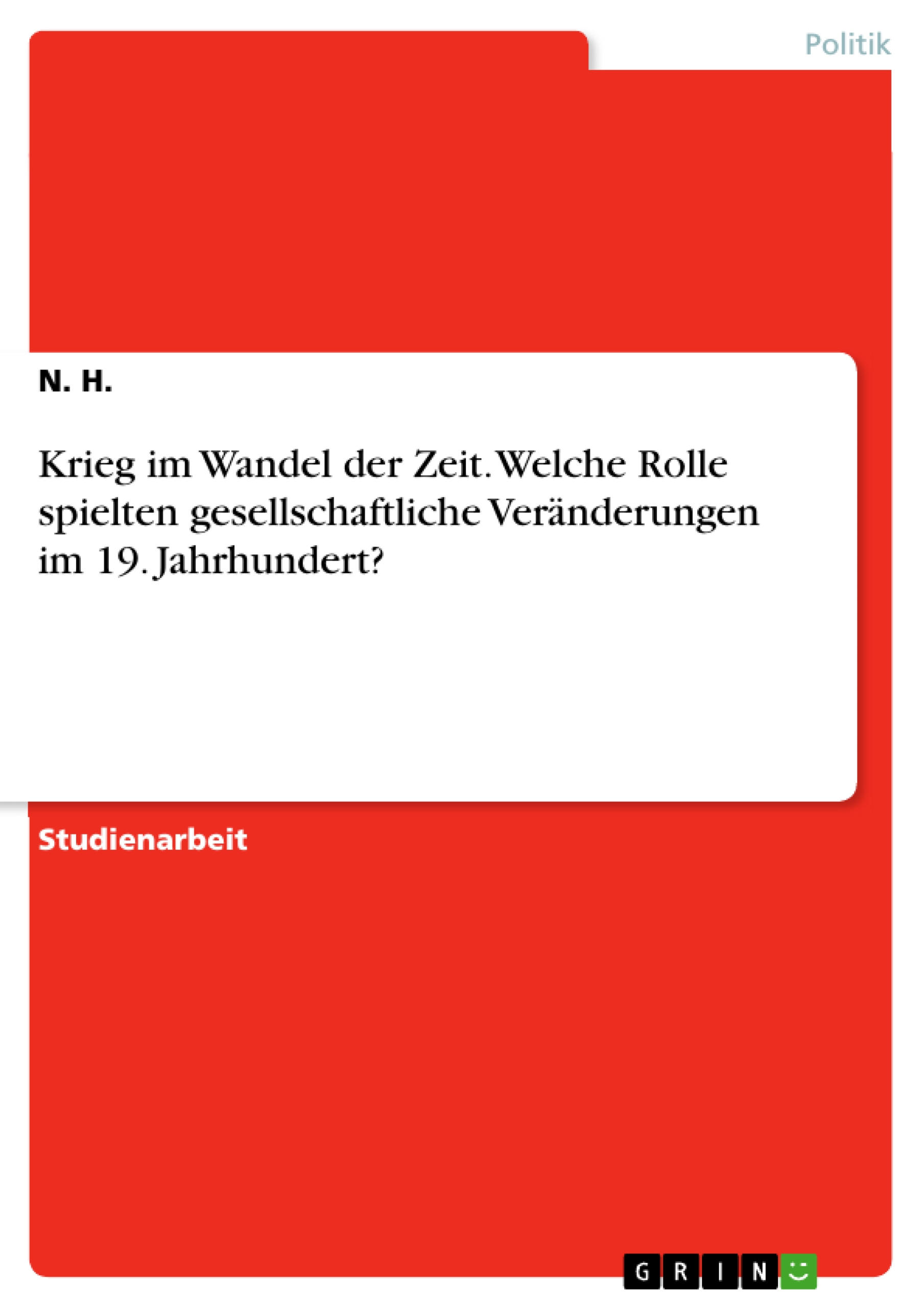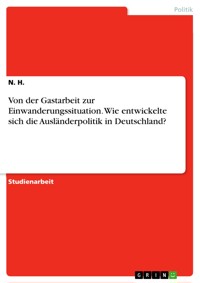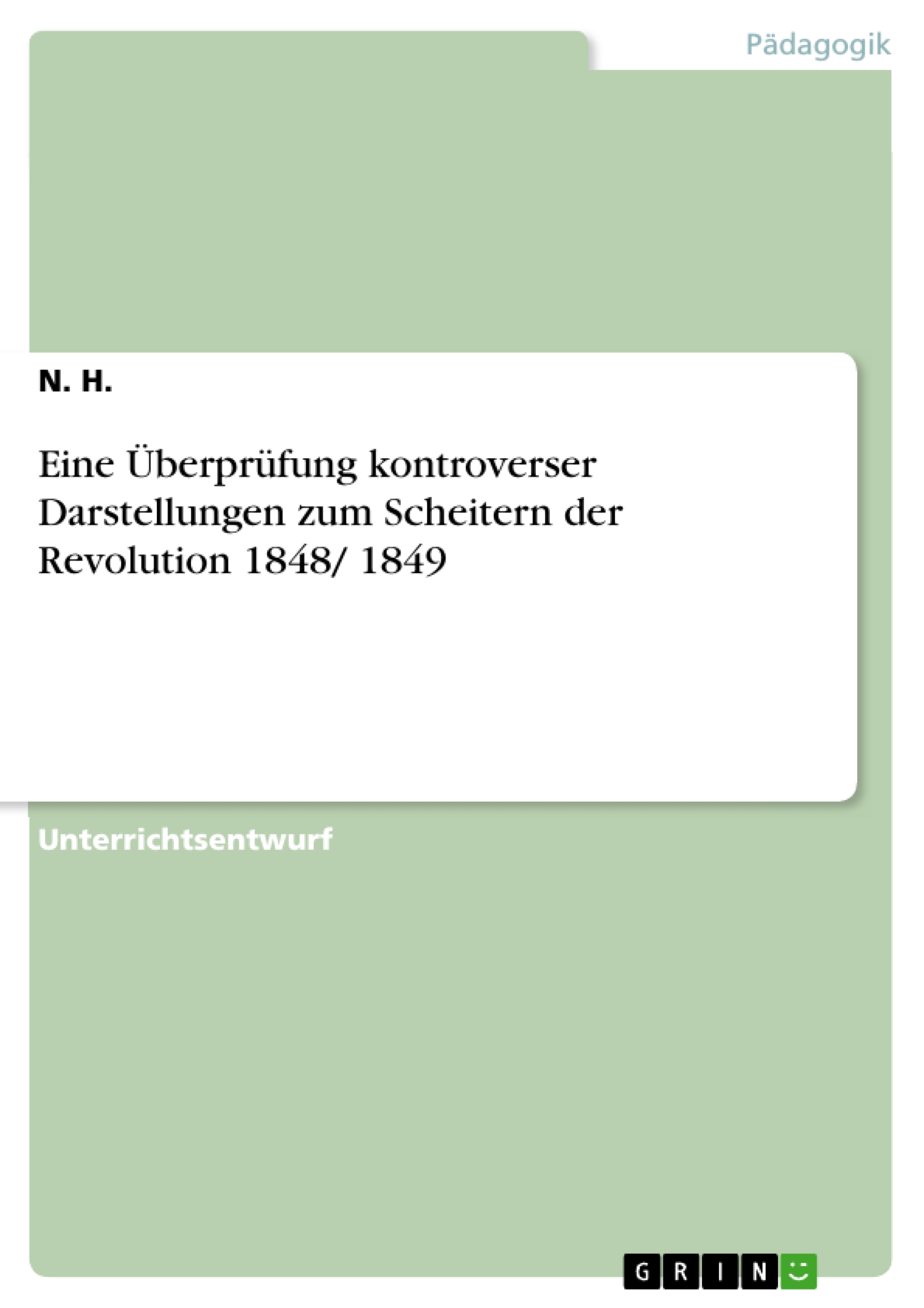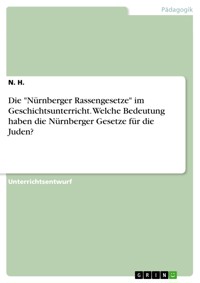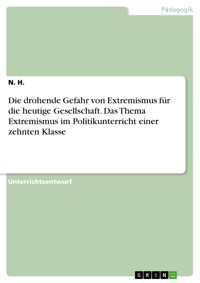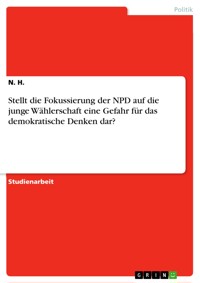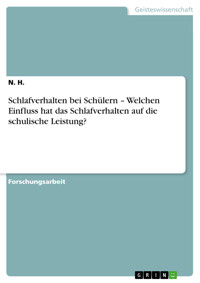Mindestlohn für das Praktikum. Chance oder Problem? Unterrichtspraktische Prüfung für gymnasiale Oberstufe E-Book
N. H.
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Didaktik - Politik, politische Bildung, Note: 1,3, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im Bereich der Beschäftigungspolitik und künftigen Arbeitswelt spaltet eine Thematik die Gesellschaft. Es ist ein besonders aktuelles und gleichzeitig prekäres Thema, die Frauenquote. Diese Kontroverse in der UPP-Stunde steht dabei exemplarisch für den Wandel in der Arbeitswelt und den dazugehörigen Chancen und Grenzen. Während der Großteil der Arbeitnehmerverbände und politischen Parteien die ab 1.1.2016 kommende Frauenquote befürworten, kritisieren besonders Arbeitgeber(-verbände) das verabschiedete Gesetz, weil dadurch Stellen in der Führungsebene nur nach Quote anstatt durch Leistung und somit auch nicht im Sinne des Gleichstellungsgrundsatzes besetzt werden. Kritisiert werden aber auch die Ausnahmeregelungen, wonach die Frauenquote nur für 108 Dax-Unternehmen und die Aufsichtsräte gilt. Diese tiefgreifend sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wandlungsprozesse in der Arbeitswelt und den privaten Lebensformen sollen im vorliegenden Unterrichtsvorhaben vermittelt und untersucht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhalt
I. Längerfristiges Unterrichtsvorhaben – Unterrichtskontext
I.1 Lernvoraussetzungen und Lernausgangslage
I.2 Synopse der Unterrichtsreihe
I.3 Darlegung und Begründung der Reihenkonzeption
I.4 Erläuterung des geplanten bzw. durchgeführten Umgangs mit Evaluation, Kompetenzüberprüfung und Formen der Leistungsmessung
II. Planung der UPP-Stunde
II.1 Angestrebte Lernziele
II.2 Zentrale methodisch-didaktische Begründungen
1. Curriculare Legitimation
2. Sachstrukturanalyse
3. Didaktisches Prinzip und unterrichtsmethodische Entscheidungen
4. Stundenverlaufsplan
5. Antizipiertes Tafelbild
6. Quellen- und Literaturangaben
7. Anhang
I. Längerfristiges Unterrichtsvorhaben – Unterrichtskontext
I.1 Lernvoraussetzungen und Lernausgangslage
Bei der Lerngruppe handelt es sich um einen Grundkurs in der Qualifikationsphase eins und gemäß dem übergeordneten Auftrag der gymnasialen Oberstufe sollen Erziehung und Unterricht Folgendes leisten: 1. Hilfe zur persönlichen Entfaltung und sozialen Verantwortung geben und 2. Zu einer wissenschaftspropädeutischen Ausbildung führen. Demzufolge sind in den Bereichen der systematischen Arbeitsweise, des selbstständigen Lernens sowie der kritischen Reflexions- und Urteilsfähigkeit ein hoher Maßstab anzusetzen. Dabei sind nicht nur die sozialwissenschaftlichen „Phänomene“ Gegenstand der Betrachtung, sondern sollen in besonderem Maße und Intensität auch die kritische Überprüfung unterschiedlicher damit verbundener Theoriemodelle im Unterricht eines Grundkurses Einzug erhalten.[1] Bei dem derzeitigen Stand der Lerngruppe ist zu erwähnen, dass es sich bei dieser um einen zu Beginn des Schuljahres 2014/2015 neu zusammengesetzten Kurs handelt. Resultierend aus dem vorherigen Schuljahr konnten durch Beobachtungen unterschiedliche Lernvoraussetzungen bei den SuS festgestellt werden und gilt im Hinblick auf Unterrichtsplanung sowie Binnendifferenzierung zu beachten.
Hervorzuheben sind bei den meisten SuS ein gutes Textverständnis gemäß dem Anforderungsbereich I und die guten Grundkenntnisse im Umgang mit Texten. Sie erarbeiten selbstständig und differenziert die im Unterricht behandelten Fragen und Probleme und wenden diese gemäß dem Anforderungsbereich II an.
Ein differenzierteres Bild hat sich in der aktiven Mitarbeit verdeutlicht. Besonders drei SuS agieren im Unterricht sehr passiv. Daher sind kooperative Lernmethoden, in denen die Zusammensetzung der Lerngruppe variiert und es eine hohe SuS-aktivierung gibt, Bestandteil der Reihenplanung (z.B. Einsatz von Think-Pair-Share, rotierendes Partnergespräch). Für das Unterrichtsvorhaben bietet sich auf Grund der Kursgröße von lediglich 16 SuS, der kontroversen Thematik- und Materialauswahl sowie vor allem wegen des eben genannten Aspektes der Mitarbeit Partnerarbeit als Sozialform an, um den passiveren SuS mehr Gelegenheiten zur aktiven Teilnahme am Unterricht zu ermöglichen.
Deutlich differenzierte SuS-leistungen zeigen sich ebenso auf der Urteilsebene gemäß Anforderungsbereich III, bei der richtigen Unterscheidung von Beurteilung und Bewertung. So ist bei mehreren SuS zu beobachten, dass diese häufig bei der Beurteilung der Sachebene bereits auf die Werturteilsebene übergehen. Demzufolge ist es notwendig, die Beurteilung und Differenzierung von Sach- und Werturteil im längerfristigen Unterrichtsvorhaben zu vertiefen und das stetige Üben bei den unterrichtsmethodischen Entscheidungen zu berücksichtigen, in dem der Fokus der Stunde auf dem Prinzip der Urteilsbildung liegt.
Bezüglich der Sicherung der Ergebnisse ist zu erwähnen, dass die SuS auf eigene Initiative Mitschriften anlegen und im Sinne der Selbstständigkeit verantwortlich für die Übertragung von Tafelbildern etc. sind.
I.2 Synopse der Unterrichtsreihe
I.3 Darlegung und Begründung der Reihenkonzeption
Das Ziel der Reihe besteht darin, den SuS ein Grundverständnis sozioökonomischer Zusammenhänge, Einflüsse und Interessenlagen der Gesellschaftsstruktur mit zurückliegenden und zukünftigen Entwicklungen zu vermitteln, um somit Urteilskompetenz zu erzeugen, die notwendig ist, um aktuelle sozialwissenschaftliche Themen und Kontroversen verstehen und beurteilen zu können. Aufbauend darauf soll im konkreten Unterrichtsvorhaben[2] die Untersuchung des sozialen Wandels komplexer Gesellschaften dazu beitragen, eine fundierte Bewertung gesellschaftlicher Kernstrukturen und ihrer Auswirkungen auf Bevölkerungsentwicklungen, Arbeitsverhältnisse und private Lebensformen zu erlangen.[3]