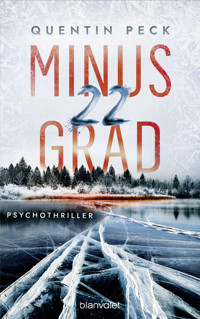
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Johannsen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine junge Studentin, gefangen in einem Käfig. Und ein Spiel mit einer tödlichen Deadline ...
Ein Tag im Winter, kurz vor Mitternacht. Laura Gehler ist mit ihrem Trekkingrad im tief verschneiten Wald unterwegs. Wie aus dem Nichts taucht hinter ihr ein SUV auf. Der Fahrer drängt sie vom Weg ab und überwältigt sie. Stunden später erwacht sie in einem Käfig aus Plexiglas. Zwischen Laura und ihrem Entführer beginnt ein tödliches Spiel: Sie muss das Rätsel des Käfigs lösen – sonst wird sie sterben.
Lauras Mutter bekommt zeitgleich eine unheimliche Botschaft: eine Barbiepuppe mit Sterbedatum. Kommissar Lukas Johannsen erkennt darin die Handschrift eines nie gefassten Mörders. Soll Laura sein nächstes Opfer werden? Lukas macht sich bereit, in der Winterkälte ein Phantom zu jagen ...
»Spannend. Originell. Ein Thriller wie ein reißender Strudel – bis einen die schockierende Wendung unausweichlich erwischt. Unverzichtbar für Crime-Fans.«
Paulina Krasa, Mordlust – Der Podcast
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Ein Tag im Winter, kurz vor Mitternacht. Laura Gehler ist mit ihrem Trekkingrad im tief verschneiten Wald unterwegs. Wie aus dem Nichts taucht hinter ihr ein SUV auf. Der Fahrer drängt sie vom Weg ab und überwältigt sie. Stunden später erwacht sie in einem Käfig aus Plexiglas. Zwischen Laura und ihrem Entführer beginnt ein tödliches Spiel: Sie muss das Rätsel des Käfigs lösen – sonst wird sie sterben.Lauras Mutter bekommt zeitgleich eine unheimliche Botschaft: eine Barbiepuppe mit Sterbedatum. Kommissar Lukas Johannsen erkennt darin die Handschrift eines nie gefassten Mörders. Soll Laura sein nächstes Opfer werden? Lukas macht sich bereit, in der Winterkälte ein Phantom zu jagen …
Autor
Quentin Peck, geboren in Berlin, studierte Dokumentarfilmregie, Germanistik und Publizistik in Deutschland, Madrid und New York. Seit über dreißig Jahren arbeitet er als Fernsehjournalist und -produzent. Für seine Psychothriller experimentiert und prüft er an realen Orten seine Szenen, was seinen Büchern enorme filmische Dichte und Detailverliebtheit verleiht – Kopfkino beim Lesen!Mehr Infos zum Autor unter: www.quentin-peck.de
Quentin Peck
Minus 22 Grad
Psychothriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Redaktion: Regine Weisbrod
Umschlaggestaltung und – motiv: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von Getty Images Plus (© Evgeniy Ivanov; © mycteria; © betyarlaca)
BSt · Herstellung: mar
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30095-1V004
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Achtundvierzig Tage und siebzehn Stunden später
EIN DANK UND NOCH EINER …
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Wenn eine Katze eine Maus fängt, schlägt sie ihr die Zähne in den Nacken und wirft sie hin und her. Doch es ist kein sadistischer Akt, kein blinder Spieltrieb, der sie dazu veranlasst. Der Körper der Maus wird so besser durchblutet. Die Panik lässt ihr Herz schneller schlagen, lässt es wie wild pulsieren.
Und die Beute gewinnt an Geschmack.
Kapitel 1
Sie liebte den Schmerz. Die Muskelfasern in ihren Oberschenkeln überdehnten sich, standen kurz vor dem Reißen. Ihre Waden pochten. In den Fingerspitzen begann ein Kribbeln, das die Arme emporkroch wie eine warme Welle. So fühlte sich das Lebendige an, nur so und niemals anders.
Laura trat in die Pedale, die Reifen ihres Trekkingrads knirschten im frisch gefallenen Schnee. Die Frontlampe warf ihr Licht auf die Straße, nur an einigen Stellen schimmerte noch der Asphalt durch die weiße Decke.
Die Digitalziffern ihrer Smartwatch blinkten am Handgelenk. Lauras Puls lag bei einhundertneunzig. Steigend. Schneller. Noch schneller. Sie verlagerte ihre Kraft in die Beine, und ihr Herz hörte mit, als wollte es sich den schnelleren Trittfolgen anpassen. Einhundertdreiundneunzig. Weiter. Komm.
Die Talsperre mit ihrer Mauer aus Beton lag wie ein schlafendes graues Ungetüm in der Dunkelheit, bestrahlt nur vom halben Mond. Atem entstieg Lauras Mund, die Schwaden zerfächerten in der Luft. Ihre Lippen waren aufgesprungen. Die fingerlosen Handschuhe ließen die Eiseskälte des Novembers zu, an den Händen, auf der Haut.
Dreimal die Woche schwang sie sich aufs Rad und hörte auf ihre schreienden Muskeln. Die Zeit kurz vor Mitternacht war ihre. Laura schwitzte, und sie fror. Sie nahm bewusst wahr, wie ihre Gedanken leichter wurden, sich ihre Sorgen und Probleme mit jeder rotierenden Bewegung der Pedale auflösten.
Hier draußen in der Kälte gab es keinen Professor, der sie mit väterlicher Fürsorge umwarb und sie doch nur in sein vorgewärmtes Bett locken wollte. Zwischen Fichten und Schnee gab es keinen Platz für ihre Freundin Marie, die Lauras Studium der zeitgenössischen Fotokunst als Fantasterei einer ewig Pubertierenden abtat. Fotos kann doch heute jedes Kleinkind mit dem Handy machen. Dafür brauchst du kein Studium. Harmlose Sticheleien unter Freundinnen. Doch obwohl Marie über zweihundert Kilometer entfernt in einem modernisierten Bauernhaus lebte, hatten sich ihre Worte in Lauras Kopf eingenistet. Von dort streuten sie ihre Zweifel mit Heimtücke immer dann, wenn eine Prüfung anstand.
Hier draußen gab es nichts von alldem – keinen Professor, keine Marie, keine geflüsterten Worte. Nur sie und ihr Rad inmitten der befreienden Kälte.
Die mächtigen Steilufer zogen an Laura vorüber. Die sechzig Meter hohen Fichten neigten sich im Wind, Schnee rieselte von den Kronen und berührte Lauras Stirn. Die Landschaft erinnerte sie an norwegische Fjorde, die sie als kleines Mädchen mit ihren Eltern so oft besucht hatte.
Da trug der Wind ein tiefes Grollen an ihre Ohren. Ein Auto, sein Motor tönte in der Ferne. Laura blickte über die Schulter. Die Bänder ihrer Kapuze flatterten vor ihrem Gesicht, mit einer Hand bändigte sie die Strippen.
Ein dunkler SUV fuhr über die verschneite Straße. Die Strahlen seiner Scheinwerfer folgten dem geschlängelten Verlauf der Fahrbahn. Vielleicht fünfzig Meter – mehr Distanz lag nicht zwischen Laura und dem Auto. Um diese Uhrzeit und vor allem bei diesem Wetter mieden die Menschen aus Saalburg die Straße mit ihren gefährlichen Windungen. Wer auch immer hinter dem Lenkrad saß, ganz sicher verfluchte er die Nacht mit ihrem Schneetreiben.
Laura konzentrierte sich wieder auf die Straße. Die Pedale knackten, die Kette surrte. Schneeflocken schmolzen auf ihren Lippen. Der Nacken war müde, die Hände taub. Noch fünfundzwanzig Minuten, dann würde sie den Kopf in ihre Kissen pressen, den Docht ihrer Duftkerze entflammen und bei den Gerüchen von Leder und Vanille langsam wegdämmern. In einer Viertelstunde begann der Sonnabend, sie würde ihn mit zehn Stunden Schlaf feiern. Mindestens. Das hatte sie sich nach dieser harten Woche an der Uni verdient.
Laura tippte den Kippschalter am Lenker mit dem Daumen an, die Kette reagierte sofort mit einer höheren Übersetzung. In zweihundert Metern wurde die Fahrbahn abschüssig, bis dahin wollte sie ordentlich Geschwindigkeit aufbauen.
Sie beugte den Oberkörper tiefer nach unten, umklammerte mit beiden Händen die Griffe des Lenkers, bis ihre Knöchel schmerzten. Ihre Muskeln wussten, was Laura von ihnen erwartete, und sie gaben es ihr. Da blitzten die Reflektoren an ihrem Vorderrad wie rote Kristalle auf. Im Scheinwerferlicht des SUV wirkte der fallende Schnee vor ihr wie eine weiße Wand. Das Brummen des Motors war nun ganz nah. Viel zu nah.
Wieder warf Laura einen Blick über die Schulter. Nur zwei Meter trennten sie von der Haube des Wagens. Was soll das, formte sie stumm die Worte und deutete mit der flachen Hand einen Schlag gegen die Stirn an. Als Antwort heulte nur der Motor des SUV auf.
Hinter der Frontscheibe zeichneten sich die Konturen des Fahrers ab. Seine tief in die Stirn gezogene Basecap und der aufrechte Stehkragen seiner Jacke verrieten nichts über die Gesichtszüge – keine zusammengekniffenen Lippen, kein Stirnrunzeln –, in den schwarzen Umrissen suchte sie vergeblich nach einer Regung. Schnee verdeckte das Kennzeichen. Nicht einmal ein verräterisches Duftbäumchen baumelte am Rückspiegel. Der Mensch hinter den surrenden Scheibenwischern blieb ein charakterloser Schatten.
»Idiot«, flüsterte Laura und wedelte mit der Hand. Vorbeifahren, er sollte einfach nur an ihr vorbeifahren und verschwinden. »Hau endlich ab!«
Der Lenker schlackerte in ihrer Hand, das Rad verlor seine Stabilität. Laura wandte sich ab. Der Schnee verwandelte sich in ein Gestöber. Flocken wirbelten durch die Luft und verfingen sich in ihren Wimpern. Sie blinzelte nicht, schaute stur nach vorn und rechnete jede Sekunde mit dem an ihr vorbeirauschenden SUV. Vergeblich. Der Wagen hing weiter an ihrem Hinterreifen und überholte nicht.
Laura hob und senkte die Fersen und legte noch mehr Kraft in die Beine. Sie erhöhte ihr Tempo, der SUV folgte ihr, passte sich ihrer Geschwindigkeit an und ließ den Motor aufheulen. Der Mensch am Steuer schien sie vor sich hertreiben zu wollen.
Womöglich war es einer der Typen, den sie tags zuvor am Nachbartisch im Café abserviert hatte. Oder ein Betrunkener, der sich nur einen Spaß machen wollte. Beides womöglich oder nichts davon. Sie könnte einfach bremsen und vom Fahrrad absteigen, das Spiel beenden – wenn es denn überhaupt eines war.
Der Schnee knirschte, metallische Schleifgeräusche hallten über die Straße. Der Lichtschein des SUV verharrte auf der Stelle, wirkte wie eingefroren. Der Wagen stand, sein Motor lief weiter. Laura floh aus dem Kegel der gleißenden Scheinwerfer. Womöglich hatte der Fahrer die Lust an seinem schwachsinnigen Spiel verloren. Oder er hatte in einem lichten Moment begriffen, dass er einen Menschen in Gefahr gebracht hatte. Wie auch immer. Nur weg von hier.
Laura trat in die Pedale und reckte den Mittelfinger nach hinten. Ein einziges Fingerglied als höchster Ausdruck ihres Zorns sollte reichen. »Was für ein Mega-Idiot!«
Eisige Luft drang in ihren Mund, sie presste die Lippen aufeinander. Geschafft. Jetzt geht es richtig los. Die Straße fiel um mindestens dreißig Grad ab, der verschneite Asphalt lag vor ihr. Der Wind trieb die Zweige der Fichten hin und her, der Wald wuchs wie ein Dach über die Straße. Die Abfahrt konnte beginnen.
Laura verkrallte die Finger um den Lenker und folgte dem Sog der Tiefe. Schnee spritzte am Vorderreifen empor. Ein Loch tat sich in ihrem Magen auf. Sie berauschte sich an dem flauen Gefühl und der Geschwindigkeit. Wie sehr sie diesen Moment herbeigesehnt hatte!
Wind kann nicht schneiden. Er lässt sich nicht säen, um einen Sturm zu ernten. Er kann einem Menschen auch nicht wirklich ins Gesicht schlagen. Aber er war da und trieb Laura die Tränen in die Augen. Das hier war ihr persönlicher Ersatzwahnsinn, und sie genoss jede Sekunde davon.
In der Ferne heulte der Motor des SUV auf, Reifen drehten durch und fingen sich. Laura beugte sich tief nach unten, krümmte den Rücken. Ihr Kinn berührte den Lenker. Sie wagte einen schnellen Blick zurück.
Der Wagen rollte wieder, dicke Flocken tanzten vor seinen Scheinwerfern auf und ab. Er folgte dem Verlauf der Straße, er folgte Laura. Der Motor brummte, als wollte er die Luft zum Schwingen bringen.
Dieses verdammte Geräusch! Es erinnerte Laura an etwas längst Vergessenes. An das tiefe Grollen des Rottweilers, der ihr so oft nach der Schule vor dem Haus ihrer Eltern aufgelauert hatte. Pascha, der Hund hatte Pascha geheißen, und er hatte sie nachmittags zwischen den parkenden Autos die Straße hinab gehetzt. Lauras ganze Kindheit war von ihrer Angst vor dem Tier überschattet worden, vor seinen zitternden Lefzen und den kleinen schwarzen Augen. Aber das hier war das Heute. Sie war kein verängstigtes Kind mehr, und erst recht fürchtete sie sich nicht vor einem Unbekannten, der sich in einem Haufen Blech verschanzt hatte. Das zumindest redete sie sich ein.
Der Wagen schoss hinter ihr die Straße hinab, das Brummen unter der Haube wurde lauter. Dreißig Meter noch, und er hatte sie eingeholt.
Laura riss den Kopf nach rechts und links. Die Seitenplanken aus Stahl ließen ihr keine Ausweichmöglichkeit. Mit den Fingerspitzen berührte sie die Bremshebel am Lenker, das kalte Aluminium. Nein. Bei der Geschwindigkeit konnte sie das Rad nicht einfach stoppen, die Reifen griffen kaum im frisch gefallenen Schnee. Besser, sie folgte der Straße.
Weiter unten, vielleicht achtzig Meter entfernt, gab es einen Zugang zum Fluss. Im Sommer hatte sie sich dort häufig ein schattiges Plätzchen zwischen Fichten und Sandstein gesucht, um in der Stille Lindberghs Arbeiten zu studieren. Laura blinzelte den Schnee auf ihren Wimpern fort. Achtzig Meter. Das war machbar.
Der Schnee baute sich vor Laura zu einem weißen Raum auf, den sie durchquerte. Noch ein Raum und noch einer. Endlose Räume. Die Flocken nahmen ihr die Sicht, beengten sie. Die fallenden Eiskristalle warfen das Scheinwerferlicht ihres Verfolgers wie Tausende kleine Spiegel zurück. Sie ließen die Nacht leuchten.
Das Brummen des Motors vermischte sich mit knirschendem Schnee und surrenden Scheibenwischern. Lauter, die Geräusche wurden immer lauter.
Treten. Tritt schneller. Irgendwo hinter der weißen Mauer, rechts von ihr, da musste der Zugang zum Fluss kommen. Gleich. Sie würde über knackende Zweige laufen, über Steine springen und sich hinter den Fichten verstecken – so lange, bis der Irre, der sie ins Visier genommen hatte, wieder in dem dichten Gestöber verschwunden war.
Laura stieß den Atem aus, schnell, viel zu schnell. Ihre Kapuze schlug ihr, vom Wind getrieben, gegen den Hinterkopf. Weiter. Schau nicht zurück. Konzentrier dich auf die Straße. Sie blickte erneut über die Schulter, konnte dem Zwang nicht widerstehen. Nicht einmal ein Meter lag zwischen ihr und der schwarzen Motorhaube. Gott, nur ein verdammter Meter!
Jetzt erst fiel Laura die mit Schaumstoff ummantelte Stoßstange des SUV auf. Die grünen Ballen waren mit einer Paketschnur umwickelt, an den Enden mit schwarzem Klebeband abgebunden. Sie riss den Kopf zurück, wandte sich wieder der Straße zu. »Was willst du von mir?«, flüsterte sie in die Nacht, bevor sie die Antwort bekam.
Stoßstange gegen Hinterreifen. Schaumstoff gegen Gummi. Kein lautes Geräusch. Der Aufprall vollzog sich mit einer sanften Bewegung. Das Fahrrad brach aus, geriet in Schräglage. Laura riss den Oberkörper nach links, wollte ihr Rad stabilisieren. Mit beiden Händen umklammerte sie den Lenker, härter als zuvor. Die Bändchen ihrer Kapuze schlugen ihr ins Gesicht. Schnee wirbelte von der Straße auf. Laura stemmte ein Bein nach außen, bremste mit dem Absatz, spürte Schnee und Asphalt unter dem Fuß. Da traf sie die Stoßstange erneut.
Diesmal war der Ruck stärker, ihr Hinterrad wurde von der Seite touchiert. Das Fahrrad schlingerte, Laura wurde vom Sattel gerissen, über den Lenker geschleudert. Mit rudernden Armen torkelte sie durch die Luft.
Zweige rauschen, Scheibenwischer surren. Laura prallt auf die Seitenplanke, schlägt mit der Stirn auf den Stahl. Dumpfes Geräusch. Sie fällt mit dem Gesicht in den Schnee. Dunkle Spritzer auf Weiß. Blut. Eine Tür klappt auf. Schritte. Sie kommen näher. Schnee knirscht. Direkt neben ihr. Immer wieder surren die Scheibenwischer. Eine Hand reißt an ihrem Haar, zerrt ihren Kopf in die Höhe, presst den Hals zusammen. Keine Luft. Schwindel. Schmerz an ihrem Hals. Ein Stich, etwas durchbohrt ihre Haut. Ihr Kopf fällt zurück in den Schnee. Kalt, so kalt. Sie will hoch, sich an der Planke aufrichten, sackt zusammen. Das Surren wird leiser, noch leiser. Lauras Gedanken versinken in der Dunkelheit, und dann – nichts.
Kapitel 2
Das Licht brannte auf ihren geschlossenen Lidern. Ein Pochen zog über ihren rechten Stirnhügel. Das Hämmern klang so rhythmisch, als entstammte es einer Maschine, die sich einen Weg direkt durch Lauras Schädelwand bahnen wollte.
Mit dem Zeigefinger ertastete sie einen Strich über der Augenbraue. Eine Unebenheit, zwei klaffende Ränder. Laura hatte sich oft genug mit waghalsigen Manövern beim Handball verletzt. Diese Schramme aber stammte vom Aufprall an der Planke.
Laura streckte die Hände aus, tastete den Boden ab. Sie lag auf dem Rücken, unter ihr wohl ein Teppich mit langen Zotteln. Wahrscheinlich aus Wolle, doch der Stoff fühlte sich wie ein Tierfell an. Ein leicht muffiger Geruch wie von Roter Bete stieg in Lauras Nase auf. Doch ehe sie dieses Aroma weiter analysieren konnte, war es schon wieder fort.
Sie öffnete die Augen. Ein einziger Deckenstrahler warf sein kegelförmiges Licht auf sie. Rotierende Punkte flirrten vor ihren Augen. Das Licht stach auf ihrer Netzhaut, sie musste blinzeln.
An ihrem Finger klebten feine Krümel getrockneten Blutes, sie verrieb sie. Wie lange war sie schon hier? Und viel wichtiger als das – wo ist hier?
Laura richtete den Oberkörper auf. Ein Zimmer. Sie befand sich in der Mitte eines Zimmers. Vielleicht war es vierzig Quadratmeter groß. Reine Spekulation. Die Wände versanken im Halbdunkel, wirkten seltsam glänzend. Vier Meter von ihr entfernt stand ein Sessel. Papageien und Kakadus mit langen orangefarbenen Schnäbeln waren inmitten tropisch anmutender Blätter auf den Stoff gedruckt. Der Sessel wurde von zwei modernen Leuchtern aus Silber eingerahmt, in deren Armen zwölf abgebrannte Kerzen steckten. Sie waren nicht entflammt. Rechts daneben lehnte ein rotes Bücherregal an der Wand, darin reihten sich Dutzende Bildbände über Paris und den Amazonas aneinander. In einem anderen Regalbrett standen Rücken an Rücken Romane, sie wirkten abgenutzt. Einige Bücher lagen aufgeschlagen auf dem Boden. Davor stand ein hölzerner Schreibtisch mit einem weiß lackierten Stuhl ohne Lehnen. Das Zimmer wirkte, als sei sein Bewohner nur kurz aufgestanden und verschwunden, um jede Sekunde zurückzukehren und sich wieder an den Tisch zu setzen.
»Hallo? Ist hier irgendwer?« Der Boden knackte unter ihr. Aus einer Ecke drang ein Brummen, so lang gezogen und dunkel wie die Schwingungen einer Klaviersaite. Womöglich ein Generator, wie ihn Lauras Großeltern in ihrem Campingmobil auf Sylt verwendet hatten. Was ein solches Gerät in einem Wohnzimmer verloren hatte, erschloss sich ihr nicht.
»Hallo?« Sie hockte sich auf die Knie, ihre Gelenke knackten. Ein Ziehen ging durch ihren Hals. Sie strich über die Haut, ertastete eine feine Schwellung. Er hatte ihr wahrscheinlich eine Spritze mit einer Knock-out-Substanz in die Venen gejagt. Das erklärte ihren Bewusstseinsverlust.
Die ummantelte Stoßstange, ihre einsame Fahrradroute – wer immer der Unbekannte war, er musste einem Plan gefolgt sein. Er hatte ihre Gewohnheiten analysiert.
Die Kenntnis der Ursachen bewirkt die Erkenntnis der Ergebnisse. Wie oft hatte ihre Mutter ihr das schon als Heranwachsende eingebläut! Die ermüdenden Weisheiten einer Historikerin. Selbst hier meinte Laura noch ihre vom Rauchen dunkel gefärbte Stimme zu hören.
Von irgendwoher drang das Rauschen des Windes, kurz nur schwoll es zu einem schrillen Pfeifen an. Genauso schnell verebbte es wieder.
Ursache und Ergebnis. In einem Reflex schob sich Laura beide Hände ins Innere ihrer Radhose. Sie ertastete den Gummizug. Die doppelt gebundene Schlaufe am Bund war intakt. Alles in Ordnung. Niemand hatte sie geöffnet, niemand hatte sie während ihrer Bewusstlosigkeit vergewaltigt. Der Gummi im Hosenbund schnalzte zurück. Niemand hatte sich an ihr vergangen, und doch gab es einen Jemand. Jemand, der sie nicht nur von ihrem Fahrrad, sondern auch aus ihrer Welt gerissen hatte.
Laura zwang sich zu langen Atemzügen. Warum, verdammt noch mal, war sie hier? Was sollte das alles? Sie blickte über die Schulter. Hinter ihr stand ein Bett mit schneeweißer Wäsche. Es wirkte nicht wie frisch bezogen, die Decke lag zerknautscht auf der Matratze. Zwei riesige Kissen lehnten am Kopfende. Die Oberfläche des Gestells schimmerte rötlich braun wie Kirschbaumholz. Eine Kommode aus demselben Holz befand sich rechts daneben. Auf ihr stand eine Wasserkaraffe. Ein aufgeschlagenes Magazin lag neben dem Bett. Laura erkannte die Fotografie einer durchgestylten Frau auf einem schweren Motorrad. Wahrscheinlich Werbung für irgendeine überteuerte Jeans-Marke.
Der ganze Raum strahlte die Atmosphäre des Benutzten aus, des Durchlebten. Wer immer dieses Zimmer bewohnte, er würde zurückkehren. Vielleicht schon bald.
Jetzt nicht panisch werden. Noch einmal sog sie tief die Luft ein. Diesmal nahm sie einen süßlich-verdorbenen Duft wahr. Wieder ließ er sich nicht fassen, als ob er sich absichtlich ihren Geruchsrezeptoren entwand und nur in ihrer Einbildung existierte.
Sie musste hier raus. Sofort.
Laura stützte sich am Boden auf, schob sich mit einem Ruck in die Höhe. Ihre Beine knickten ein, sie taumelte. Ihr war heiß. Ein schneidender Schmerz zog ihr über den Rücken, eine Folge des Fahrradsturzes. Die Bänder ihrer Kapuze schaukelten. Laura wankte.
Schreibtisch, Kerzenleuchter und Stuhl verschwammen vor ihren Augen zu einem Farbenbrei aus Braun, Silber und Weiß. Ihre Sinne verloren sich in einem Trudel. Sie schwankte aus dem gleißenden Lichtkegel und näherte sich dem Sessel mit seinen bunten Papageien und Kakadus. Sie kippte um, verlagerte das Gewicht auf die Zehenspitzen und stürzte in das weiche Polster. Die Federn im Innern reagierten mit einem Knarren.
Laura drehte sich und ließ die Arme auf die Lehnen sinken. Feine Rillen waren in den Stoff des Sessels eingearbeitet, sie ertastete die Fugen. Es beruhigte sie. Laura legte den Hinterkopf auf die Rückenlehne und blickte nach oben.
Da hielt sie inne. Etwa zweieinhalb Meter über ihr, da war eine Bewegung gewesen. Wie grauer, wabernder Nebel. Nur ganz kurz. »Was … was ist das?«
Das Licht stach nicht mehr auf ihrer Netzhaut, da war kein Flirren mehr, keine Unschärfe, und doch glaubte Laura an eine Täuschung. Mit dem Handrücken fuhr sie sich über die Augen, ein feiner Streifen Tränenflüssigkeit blieb darauf zurück.
Laura sah die Decke nun ganz klar. Nicht nur die Decke. Sie erkannte ihre eigenen Umrisse darin, ihren Kopf mit dem langen Haar und ihre schmalen Schultern. Sie richtete den Oberkörper auf. In der Fläche über ihr spiegelte sich die Bewegung. »Das ist doch nicht möglich.«
Sie blickte nach rechts, nach links, versuchte die Wände des Zimmers auszumachen, doch sie lagen außerhalb des Deckenspots im Halbdunkel.
Laura zog sich aus dem Sessel. Mit vorsichtigen Bewegungen ging sie auf die Wand neben dem Schreibtisch zu. Meter um Meter kam sie ihr näher. Laura berührte die Rückenlehne des Stuhls, die Kante des Tischs. Ihre Sportschuhe knirschten bei jedem Schritt. Der Generator brummte.
»Gott, nein …« Sie erreichte die Wand – die Wand, die keine war.
Plexiglas.
Der ganze Raum war umgeben von Plexiglas.
Laura berührte das Glas mit beiden Händen, sie strich über die kühle Oberfläche. »Unmöglich …« Ein Käfig. Sie war in einer gottverdammten gitterlosen Zelle gefangen.
Ihr Gesicht reflektierte schwach in dem Kunststoff – die vollen Lippen, die geschwungenen Augenbrauen, die immer einen fragenden Ausdruck besaßen. Sie konzentrierte sich und versuchte, hinter ihre Spiegelung, hinter das Plexiglas zu blicken. Sie beugte den Kopf vor, ihre Stirn berührte die Scheibe.
Dunkelheit.
Hinter dem Glas war nichts. Nur eine Schwärze, die auf Laura noch bedrohlicher wirkte als das Zimmer selbst. Sie ballte die Fäuste und schlug auf das Glas ein. Der Kunststoff vibrierte. Mehr nicht.
»Raus … ich muss hier raus, bevor der Typ mit der Basecap kommt.« Ein Ausgang. Wenn sie jemand hier hereingebracht hatte, musste es irgendwo eine Öffnung geben. Eine Tür. Irgendetwas. Das war nur logisch. Das war es doch. Bitte.
Laura drehte sich um die eigene Achse. Sie scannte den Raum von Ecke zu Ecke, suchte nach einem Riegel oder einem Schloss. Doch da war nichts.
Sie schob sich an der Wand entlang, tastete sich voran. Langsam erst, dann immer schneller. Der kühle Kunststoff quietschte unter ihrer Haut wie eine frisch gereinigte Fensterscheibe. Sie stolperte über den Teppich, fing sich und torkelte an der Kommode vorbei.
Und endlich, endlich, fanden ihre Finger einen schmalen Spalt, direkt neben dem Bücherregal.
Er mochte einen halben Zentimeter breit sein, an den Ecken abgerundet. Der Spalt reichte vom Boden bis zur Decke. Drei Scharniere aus Metall und eine Schiene waren in die Rückseite des Glases eingelassen. Die gläserne Zelle besaß also doch eine Tür. Ein wuchtiger Riegel stabilisierte sie in der Breite. Weiter unten, auf Fußhöhe, befand sich eine geschlossene Luke. Sie war ebenfalls mit Scharnieren befestigt.
Laura schlug mit beiden Händen auf das Plexiglas ein, ihre Hände klatschten auf die Oberfläche. Sie rammte das Knie in das Glas, riss mit den Fingerspitzen an dem Spalt, zwei Nägel rissen ein. »Dreck.« Noch einmal warf sie sich mit der Schulter gegen die Tür. Aussichtslos. Sie konnte den Widerstand des Glases nicht brechen.
Laura blickte sich im Zimmer um. Sie lief zum Schreibtisch und riss den Stuhl empor, balancierte ihn an den Beinen über dem Kopf und kehrte zurück – zurück zu der Schwachstelle in ihrem gläsernen Gefängnis. Sie holte tief Luft, streckte sich und warf den schweren Stuhl gegen die Tür.
Kein Krachen. Kein Splittern. Das Geräusch des Aufpralls klang so dumpf, als hätte Laura Watte in den Ohren. Der Stuhl fiel zu Boden. Der dicke Teppich verschluckte selbst diesen Laut wie in einem unwirklichen Vakuum.
Laura strich über das Plexiglas. Nur ein kaum sichtbarer Kratzer war dort zurückgeblieben. Mehr nicht.
Sie sackte auf die Knie. Ihre Finger hinterließen fettige Schlieren auf der Oberfläche. Ihr Gesicht spiegelte sich schemenhaft im Glas, die Striemen zogen sich wie Narben durch ihr Antlitz.
Laura tippte auf ihre Reflexion. Das da, die Frau mit dem Striemen auf der Stirn, das war nicht sie. Das war irgendeine fremde Frau, die ein Irrer in einer Zelle gefangen hielt. Aber nicht sie. Ausgeschlossen. Völlig unmöglich.
Laura verwischte die Schlieren auf dem Glas mit dem Handrücken. Diese Zelle konnte sich in einer verlassenen Fabrik befinden. Im Keller eines Hauses. In irgendeiner Ruine, die Menschen mieden. Ein Ort, von dem niemand wusste, dass er überhaupt existierte. Oder auch nicht. Wer konnte eine solche Zelle unbemerkt bauen? Was hatte denjenigen angetrieben? Wie viel Zeit hatte er für seinen Plan benötigt?
Laura umfasste ihr Handgelenk. Sie stutzte und riss den Ärmel ihrer Kapuzenjacke hoch. Helle Haut blitzte dort auf, wo eigentlich das schwarze Display ihrer Smartwatch hätte sein sollen. Sie war fort. Ihr Entführer hatte ihr die Uhr abgenommen. Nicht einmal die Abdrücke des Armbands konnte sie noch erfühlen. Wie lange war sie bewusstlos gewesen? Was war in dieser Zeit geschehen?
»Du brauchst keine Uhr. Zeit ist für dich ab jetzt irrelevant.«
Laura riss den Kopf herum. Eine fremde Stimme, elektronisch verzerrt. Sie kam aus der Mitte der Zelle. Doch niemand außer ihr befand sich hier drinnen.
»Wer ist da?« Sie blinzelte, prüfte jeden Quadratmeter des Raumes. »Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir?«
Ein Knistern setzte ein. »Hier drinnen gibt es keinen Sonnenaufgang und keinen Sonnenuntergang. Keine schleichenden Sekunden und keine rasenden Tage. Hier gibt es nur dich.«
Die Satzmelodie klang weich, intoniert von einer gefühlvollen tiefen Stimme – und doch wirkte sie durch den elektronischen Widerhall aller Menschlichkeit beraubt. Wieder sah Laura die Umrisse des Mannes mit der Basecap vor sich. Wieder scheiterte sie daran, sich sein Gesicht vorzustellen.
Laura erhob sich und trat in die Zellenmitte. Sie blickte nach oben. Das Licht stach ihr in die Augen, sie begannen zu tränen. Nur ein paar Zentimeter von dem Spot entfernt entdeckte sie kleine Löcher im Plexiglas. Eine Lautsprechermembran war dort befestigt. Sie legte den Kopf in den Nacken. Ganz sicher war auch eine Kamera in der Zelle verborgen. »Was wollen Sie von mir? Warum bin ich hier?« Laura wollte selbstsicher wirken, gefestigt und konnte doch nicht das Zittern ihrer Oberlippe unterdrücken.
»Du wirst genug Zeit haben, um die Antworten zu finden.« Die verzerrte Stimme ging wie ein elektrisches Rauschen durch die Zelle.
»Ich habe Freunde. Eine Familie … Sie werden mich suchen.«
»Sie werden dich nicht finden.«
»Sie werden mich suchen! Sie suchen mich … Das tun sie!«
»Bald wirst du vielleicht nur noch in ihrer Erinnerung existieren, Laura.«
Laura. Er nannte sie Laura, obwohl sie bei ihren Radtouren niemals einen Ausweis bei sich trug. Damit hatte er ihre letzte Hoffnung auf einen zufälligen Überfall zerstört. Er hatte sie ausgesucht. Es ging nur um sie.
»Aber … ich …« Sie jagte nach Worten, die sich nicht fangen lassen wollten. Niemals war sie um eine Antwort verlegen gewesen. Nie hatte sie sich in ihrem Leben so allein gefühlt. »Warum … warum tun Sie das?«
Wieder knackte es in der Lautsprechermembran. »Da draußen, Laura, da gibt es eine Welt, in der alle Menschen leben. Die echte Welt. Aber es gibt noch eine andere, eine verborgene. Eine Welt in der Welt, die nur wenige sehen und in der noch weniger Menschen leben.«
Laura verstand nichts von dem. Ein Irrer hatte sie entführt. Sie wollte hier nur raus. Raus!
»Du wirst wie ich in dieser Welt leben. Diese andere Welt ist für mich normal. Und sie wird es für dich auch sein. Bald.«
»Das ist doch … Wahnsinn!« Sie streckte den Kopf zum Lautsprecher empor. »Wahnsinn …«
»Nein, das wäre zu einfach, Laura. Viel zu einfach. Du wirst es bald verstehen. Du bist ein kluges Mädchen. Das bist du doch, oder?«
Das hier konnte unmöglich wirklich passieren. Laura erinnerte sich an den Wind im Gesicht, an die kraftvollen Tritte auf ihrem Trekkingrad. Sie müsste jetzt in ihrem Bett liegen, mit einem weichen Kissen im Nacken – stattdessen war sie in der Gewalt eines Irren.
»Es ist alles gesagt. Für den Moment. Akzeptiere dein neues Leben. Vertrau mir …« Ein Knacken erklang. »Am Ende wird es dir vielleicht sogar gefallen.«
Das elektrische Rauschen verstummte, das Deckenlicht verlosch. Nur die Finsternis blieb.
Laura glitt zu Boden. Die Zotteln des Teppichs strichen ihr übers Gesicht. Sie wartete auf Tränen, auf einen Schub ungebremster Panik. Wenigstens aber auf einen rasenden Puls, der sich in Wut verwandelte. Irgendeine Reaktion. Doch da kam nichts. Ihre Sinne waren wie ausgeknipst. Sie war müde, so unendlich müde. Ausgebrannt.
Unter Laura tat sich ein Gefühl von Tiefe auf. Sie wehrte sich nicht und ließ sich in die friedvolle Stille des Abgrunds fallen.
Kapitel 3
Kreise. Ein Kreis nach dem anderen. Immer und immer wieder. Die Schlittschuhe des Mannes glitten wie Klingen über den zugefrorenen See, Eis spritzte an seinen Kufen empor. Zwei Öllaternen flackerten am Boden, er zog seine Bahnen um die Lichter. Am Ende jeder Kurve riss er die Arme empor – der Ausdruck seines verzweifelten Kampfes ums Gleichgewicht, wie er für einen Anfänger typisch war. Vielleicht trainierte er hier fernab von den Menschen, weil ihm seine ungelenken Versuche peinlich waren. In der Dämmerung würde er ohnehin niemandem auffallen. Rein theoretisch.
Ariane ließ das Fernglas sinken. Das Feuer knisterte. Glut stob auf und prasselte gegen die Kaminwand. Seit einer Viertelstunde beobachtete sie den Fremden. Er war vor drei Tagen aufgetaucht und mühte sich immer ab halb fünf auf dem Eis ab. Sein halblanges Haar schwang bei jeder Bewegung mit, sein Schal flatterte wie eine Fahne im Wind. Seine eisläuferischen Fähigkeiten stagnierten knapp über dem Nullpunkt, ebenso wie seine Sinne für Gefahr. Der See mochte zugefroren sein, zumindest erweckte er den Anschein. Dennoch sollte sich niemand seiner trügerischen Sicherheit hingeben.
Wieder nahm der Mann Anlauf für einen Sprint auf der spiegelglatten Fläche. Mit geballten Fäusten und wackligen Knien jagte er übers Eis.
Ariane richtete sich in ihrem Sessel auf. Vor den Fenstern ihres Hauses hatte sie genug Tragödien beobachtet. Im Sommer noch waren Boote mit ihren weißen Segeln über den See gezogen. Zweimal waren Menschen vor dem Ertrinken gerettet worden. Ein drittes Mal hatte der See eine Frau in die Tiefe gezerrt, von dort wurde ihr lebloser Körper geborgen.
Ariane strich über das kühle Metall des Fernglases. Sie hatte alles aus der Ferne beobachtet, verborgen hinter den schützenden Mauern ihres Hauses. Das lange Haar der toten Frau hatte einem Schleier gleich über ihrem Gesicht herabgehangen. Arme und Beine schaukelten wie die Gliedmaßen einer Stoffpuppe, als sie einer ihrer Begleiter über das Gras trug. Sie beatmeten sie, pressten ihr die Hände auf die Brust, wollten sie mit aller Gewalt ins Leben zurückzerren. Vergeblich. Die herbeieilenden Rettungssanitäter konnten nur noch ein weißes Laken über ihren Körper legen. Dann wurde sie abtransportiert. Inmitten der friedvollen Umgebung von Fichten und türkisblauem Wasser hatte der See sein heimtückisches Wesen offenbart. Ariane war Zeugin des letzten Kapitels im Leben eines Menschen geworden. Stecker raus und fertig. Einfach so.
Sie erhob sich aus ihrem schweren, alten Ledersessel und legte das Fernglas auf die Armlehne. Auf nackten Füßen ging sie zum Küchenbuffet. Dampf stieg über ihrer rissigen Teetasse auf, die Scheibe darüber beschlug. Sie nahm einen tiefen Schluck und ließ die Mandelaromen im Mund kreisen.
Ariane hasste Überraschungen, plötzliche Begegnungen und Situationen, die aus dem Nichts über sie hereinbrachen. Sie bereitete sich gerne vor, wog ab und entschied erst dann.
Ein plötzlicher Tod aber war der ultimative Plotpoint, die Kehrtwendung, die in einem Leben alles zunichtemachte und jeden Sinn ins Sinnlose verkehrte. Ariane hätte alles dafür gegeben, ihr Ablaufdatum oder das der Menschen, die sie liebte, zu kennen. Sie hatte keine Angst vor Gewissheiten, nur vor dem Unbestimmten.
Das Parkett knarrte unter ihren Füßen. Ein Holzscheit rumpelte im Kamin. Ein Eiszapfen brach von der Dachrinne ab und fiel mit einem dumpfen Geräusch in den Schnee. Ein schwarzer Schatten huschte an einer Scheibe vorüber. Ariane trat zum Fenster und zog den eisernen Riegel nach unten. Sie streckte den Kopf hinaus. »Hugo? Hugo, bist du das?«
Ein lang gezogenes Krächzen ertönte, Flügel schlugen, und anderthalb Sekunden später landete Hugo auf dem Fenstersims. »Da bist du ja, mein Kleiner.« Ariane strich mit einem Finger über den schwarzen Kopf der Krähe. Wieder stieß Hugo ein Krächzen aus und beobachtete sie aus dunklen Augen. »Du bekommst ja gleich was.«
Ariane hatte die Nebelkrähe im März unter einer Fichte im Wald gefunden. Sie musste aus einem Nest gefallen sein, von den Eltern vergessen. Inmitten des strömenden Regens hatte sie sich den kleinen Federhaufen in die Hand gesetzt. Nein, das war kein guter Tag zum Sterben gewesen und erst recht nicht der darauffolgende oder der danach.
Ariane hatte Mehlwürmer und Brei in den aufgerissenen Schnabel gepresst. Wochenlang, jede Stunde zweimal. Manchmal auch Katzenfutter. Andere dreiundvierzigjährige Frauen kümmerten sich um ihre Familien, sie aber hatte die Mutterrolle für eine Krähe übernommen. Noch immer war sie stolz auf ihre Rettungsaktion.
Sie tippte Hugos schwarz glänzenden Schnabel an, er schüttelte sich. Schnee fiel von seinem Gefieder. Selbst für einen Jungvogel sah er immer noch zu klein aus – irgendwie unfertig, aber er war am Leben.
Ariane nahm ein Messer, um eine Scheibe vom Bergkäse abzuschneiden. Eigentlich nichts für Krähen, aber Hugo liebte den würzigen Geschmack. Da ließ sie ein Geräusch herumfahren, ein lang gezogener Ton in der Ferne.
Irgendwo da draußen hinter den Fichten, da war etwas. Eine Schwingung in der Luft. Sie blickte über Hugos Kopf aus dem Fenster. Der Laut war vom See gekommen und nun wieder verstummt. Sie blinzelte in die beginnende Finsternis. Vielleicht war es nur der Wind gewesen, der immer wieder durch die Äste der Fichten ging. Vielleicht der Ruf eines Kauzes oder aber …
Ariane ließ das Messer fallen. Sie stolperte zu ihrem Sessel, griff das Fernglas und suchte das Areal des Sees ab. Die Okulare lagen kalt auf ihren Augen. »Wo bist du?«
Fichten. Die Eisfläche. Die Öllaternen. Eine der Lampen war umgestürzt, ihr Docht verloschen. Der Mann auf dem See war nicht zu sehen. Halt. Da war eine Bewegung, weiter rechts, ganz unten.
Die Arme des Mannes ragten aus dem Eis, ruderten durch die Luft. Sein Unterkörper war im Wasser. Die ruckartigen Auf-und-ab-Bewegungen des Kopfes verrieten, dass er mit den Beinen unter der Eisfläche strampelte. Eingebrochen. Er war eingebrochen.
Immer wieder stemmte er den Oberkörper in die Höhe, riss den Kopf nach vorn, wollte mehr Schwung gewinnen. Er versuchte, seine Masse aus dem Eisloch zu katapultieren. Aussichtslos. Seine Hände fanden auf dem Eis keinen Halt, die Finger rutschten über die spiegelglatte Fläche. Wieder wollte er sich aufrichten, und erneut glitt er zurück ins Wasser, als zerrte ihn jemand in die Tiefe. Bald schon würden seine Muskeln durch die Kälte erschlaffen. Sehr bald. Ariane senkte das Fernglas. Letzte Kapitel – sie wusste, was sich da vor ihrem Binokular abspielte. Was für ein Idiot! Hatte er das Knacken nicht gehört? Hatte er die dunklen Flecken im Eis, die gefährlichen Schwachstellen, im abnehmenden Licht nicht erkannt?
Das nächste Haus war anderthalb Kilometer entfernt. Niemand war in der Dämmerung noch im Wald unterwegs. Der Mann auf dem See hatte nur eine Chance.
Ariane warf das Fernglas in den Sessel. Sie ging in die Hocke, streifte sich ihre Lederboots über. Die Schnallen rasteten ein. Sie sprang auf und riss ihren Mantel vom Haken neben der Tür. Ein Seil lag in der Scheune, der Schlüssel befand sich in einer Werkzeugkiste unter der Spüle. Keine Zeit. Mit der Fingerspitze fuhr Ariane über die Gürtelschnalle an ihrer Jeans. »Das geht. Das muss gehen.« Sie riss die Eichentür an ihrem gusseisernen Gitter auf und rannte durch den knirschenden Schnee. Kahle Apfelbäume und triste Kirschbäume säumten den Pfad. Wie verkrüppelte und schweigsame Wächter wiesen sie Ariane den Weg zum See. Die Kälte drang in ihren geöffneten Mund. Sie stieß die Luft aus, als ließe sich so das eisige Gefühl im Rachen verdrängen. In der Ferne brannte nur noch eine der Öllampen. Achtzig Meter, vielleicht ein wenig mehr – diese Strecke lag jetzt vor ihr.
Seit Tagen hatte es nicht mehr geschneit, doch die gefrorene Schneedecke reichte ihr bis zum Unterschenkel. Schritt für Schritt, Meter für Meter kämpfte sich Ariane vorwärts. Ihre Boots brachen den Schnee auf, Klumpen flogen nach allen Seiten. Über ihr schlug Hugo mit den Flügeln. In seinem Krächzen meinte sie, anfeuernde Rufe wahrzunehmen. Die Schreie des Mannes aber waren verstummt. Er hatte das Hoffen auf fremde Hilfe wohl aufgegeben. Oder schlimmer noch.
Ariane hielt die Arme eng am Körper, riss immer wieder die Knie in die Höhe und steigerte das Tempo. Die Schöße ihres Mantels schlugen gegen die Oberschenkel. Ihr Atem ging schwer, als sie das Ufer des Sees erreichte. Neben der Öllampe zeichneten sich die Arme des Mannes ab, die aus seinem durchnässten Parka ragten. Erschlafft lagen sie auf dem Eis. Seine Stirn ruhte auf einem Oberarm. Kein Lebenszeichen.
»Heb den Kopf. Los, heb ihn.« Leise, sie sprach viel zu leise. »Zeig mir, dass du lebst! Los!« Sie schrie, der Wind trug ihre Stimme wie ein wütendes Donnern über den See. Zweige knisterten im Wind. Die Öllampe flackerte. Der Mann hob erst den Kopf, dann eine Hand. Er war am Ende, aber am Leben.
»Gut. Ich komme! Beweg die Beine. Tritt das Wasser und hör nicht auf damit!« Kämpfen. Obwohl ihn die schweren Schlittschuhe an den Füßen behinderten, musste er kämpfen und den Körper am Laufen halten. Wenn die Kälte Nerven und Muskulatur erstarren ließ, konnte sie ihn unmöglich alleine aus dem Eisloch ziehen. Kreislauf und Atmung waren zweifelsohne schon geschwächt. Er musste nur bewusstlos werden, dann war alles vorbei.
Ariane streckte die Arme weit von sich und tastete sich mit den Schuhspitzen über die gefrorene Fläche. Wie erstarrt und leblos der See vor ihr lag, doch sie hatte seinen wahren Charakter erlebt. Wann immer das Eis unter ihr knirschte, änderte sie die Richtung. Das flackernde Licht der Lampe kam näher, so nah schließlich, dass sie es berühren konnte. Anderthalb Meter daneben streckte der Mann im Eisloch die Hand nach ihr aus. Sein Haar hing ihm in nassen Strähnen in die Stirn. Seine Lippen zitterten. Er mochte vielleicht dreißig Jahre alt sein, möglich, dass ihn das schwache gelb-orange Licht jünger wirken ließ.
»Moment, ich brauche nur eine Sekunde.« Ariane zerrte den Ledergürtel aus den Schlaufen ihrer Jeans und legte sich flach aufs Eis. Mit einer schnellen, präzisen Bewegung warf sie ihm das Ende mit der Schnalle zu. »Zieh dich daran hoch. Aber langsam, sonst landen wir da beide drin.«
Er deutete ein Nicken an und umklammerte die Schnalle mit einer Hand. Ariane spürte den Widerstand am anderen Ende und hielt ihm stand. Sie presste sich auf den Bauch, legte all ihre Schwere auf diese eine Stelle. Zusammen mussten sie ein Gleichgewicht finden, den Punkt der Stabilität, an dem er sich Zentimeter für Zentimeter aus dem Loch ziehen konnte – ohne sie zu gefährden.
Er verstand sie ohne weitere Worte. Ein Stück und noch ein Stück – ganz vorsichtig schob er den Oberkörper über die spiegelglatte Fläche und umklammerte den Gürtel. Die Knöpfe seines Parkas kratzen über das Eis, warme Luft entströmte seiner Lunge. Er robbte voran, kam ihr ein Stück näher und noch ein Stück. Zu schnell, Ariane verlor den Halt und rutschte nach vorne. Der Oberkörper des Mannes versackte wieder im Loch. Wasser spritzte empor, ein paar Tropfen trafen Arianes Wange.
»Langsamer. Hörst du? Langsamer!«
»Ich … ich … kann mich nicht … be … we … gen …« Seine zitternden Lippen zerhackten die Worte. »… Mei … ne Mus … keln …«
»Doch. Du kannst das.« Immer, wenn sie angespannt war, verfiel sie in einen harten Tonfall, einer Kriegsberichterstatterin nicht unähnlich. Oft schämte sie sich dafür. Doch nicht heute. Der Mann brauchte keine verbalen Streicheleinheiten. Er brauchte Härte, und Ariane gab sie ihm. »Noch mal! Komm!« Heute würde er nicht sterben. Nicht hier, nicht mit ihr. »Zeig es mir!«
Behutsam schob er den Oberkörper voran und blickte Ariane dabei in die Augen, löste sich nicht mehr von ihrem Gesicht. Vielleicht wollte er ihre Kommandos am Zucken der Augenbrauen oder am verspannten Zug um den Mund ablesen, bevor sie auch nur ein Wort in einem Schwall warmer Atemluft von sich gab.
Ariane nickte ihm zu. »Weiter!« Ihr Arm schmerzte, die Glieder ihrer Finger standen vor dem Zerreißen. Zentimeter für Zentimeter kam er ihr näher. »Zieh dich an meiner Hand hoch. Aber vorsichtig.« Sie spürte seine Haut auf ihrer. »Jetzt!«
Die Fichten knarrten. Der Wind trieb ein paar Flocken von den Ästen.
Er packte zu, seine Finger umklammerten ihr Handgelenk. Ariane ließ den Gürtel los, er rutschte ins Wasser und verschwand in der Tiefe. Der Mann zog ein Bein aus dem Eisloch und winkelte es an. Er schlug die Spitze der Kufe ins Eis, verschaffte sich so mehr Halt. Selbst diese mikroskopisch kleine Bewegung schien er konzentriert zu steuern. Das zweite Bein folgte. Wasser tropfte von seiner Hose. Das Eis knackte, ein dünner Riss zog sich neben ihm durch die Fläche. Seine Hand wanderte weiter, hoch zu Arianes Oberarm, sie spürte den Druck durch ihren Mantel hindurch. Noch ein Ruck, ihre Köpfe waren auf gleicher Höhe.
Sein Atem ging viel zu schnell, die warme Luft streifte ihre Wange. Seinen hämmernden Herzschlag konnte Ariane erahnen, ohne ihm die Hand auf den Brustkorb zu legen.
Der Mann riss die Kufe aus dem Eis und ließ sich neben ihr auf den Rücken fallen. Sein nasses Haar klatschte auf ihren Mantel. »Dan … ke …« Noch immer zitterten seine Lippen. Selbst im Licht der Öllampe schimmerte sein Gesicht blass und kalt, als würden seine Venen ihren blauen Schimmer durch seine Haut werfen.
»Schon gut. Wir müssen runter vom Eis. Aber erst müssen diese Dinger verschwinden.« Sie deutete auf die Schlittschuhe und kniete sich vor ihm nieder. »Du musst bei jedem Schritt vorsichtig sein.« Die Schnürsenkel lagen nass und eiskalt in ihren Händen, als sie die Schlaufen aufriss. Ariane umfasste die Kufen mit beiden Händen, eine nach der anderen, und riss sie ihm mit kraftvollen Bewegungen von den Füßen. Wieder knisterte und knackte das Eis, diesmal ganz nah bei Ariane. Der See sprach, und er drohte ihr. Darauf folgte ein lauter Knall, der an den Schlag einer Peitsche erinnerte. Schwallartig trat Wasser aus einem Riss neben dem Loch.
»Komm! Schnell!« Ariane richtete sich auf und zog den Mann an der Schulter in die Höhe. Wie leicht er war, kaum schwerer als siebzig Kilo. Er überragte sie um einen halben Kopf. In gebückter Haltung stolperten sie über den See und erreichten das Ufer.
Die hohen Schilfgräser raschelten im Wind. Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Zweige knackten, als sich der Mann auf den Boden sacken ließ und tief durchatmete. »Gott, ist … mir … kalt! Ich weiß gar nicht, wie … wie ich Ihnen … danken soll …«
Hugo zog seine Runden über den Baumwipfeln. Sein raues Krächzen begrüßte sie, als er einen Ast anflog und sich darauf niederließ.
»Kein Problem. Alles gut. Männer, die ich rette, sagen selten danke und haben normalerweise Federn.«
Er blickte sie von unten an. »Federn?« Wasser tropfte von seinem Haar und versickerte im Schnee. »Ich … verstehe nicht?«
Ariane nickte Hugo auf seinem wippenden Ast zu. »Federn, genau. Was gibt es denn da nicht zu verstehen?«
Kapitel 4
Er blinzelte selten. Höchstens viermal in der Minute. Die Schläge seiner Lider nahm Ariane wie eine Fehlfunktion seines Organismus wahr. Wie einen Impuls, der für ihn nicht steuerbar war, den er widerwillig zulassen musste.
Mit einer heißen Tasse Tee und einer Lammfelldecke auf den Schultern hockte der Mann vor dem prasselnden Kamin. Seine schlanken Beine lugten unter dem Bademantel hervor. Mit langsamen Bewegungen führte er die Tasse zu den Lippen. Geräuschlos nahm er kleine Schlucke, ließ den Tee im Mund kreisen, bevor er ihn herunterschluckte. Er schaute über die Schulter, seine Blicke wanderten und verharrten mal bei dem schweren Bücherregal aus Eiche, dann wieder bei dem halb blinden Spiegel neben der Kommode. Jedes Detail seiner Umgebung schien er bewusst wahrzunehmen: den Spazierstock mit dem silbernen Knauf eines Oktopus; die getäfelte Decke, in deren Winkeln Spinnen hausten; den durchgesessenen Ledersessel aus einem anderen Jahrhundert, in dem Ariane neben ihm saß; die knallbunten Teller im Regal über der Spüle; das Bild über dem Kamin aus anderen Tagen. Jede mikroskopisch kleine Nuance des Raums schien er bewusst zu scannen, sie durch die Verästelungen seiner Synapsen zu jagen und an einem verborgenen Ort abzulegen, der jederzeit für ihn abrufbar war. Mit einer seiner behutsamen Gesten strich er sich eine dunkelblonde Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich möchte mich bei Ihnen noch mal entschuldigen … für meine Dummheit.«
»Akzeptiert.« Ariane deutete mit der flachen Hand auf ihren Oberkörper »Und ich bin ein Du und keine Sie.« Mit Anfang vierzig war sie deutlich älter als er. Vielleicht wirkte er ihr gegenüber deswegen so respektvoll.
»In Ordnung.« Seine Mundwinkel hoben sich. »Ich heiße Tom.«
»Ariane.« Sie wollte ihm die Hand reichen, stoppte aber in der Bewegung. Nach ihrer Rettungsaktion erschien ihr diese Geste zu unpersönlich.
»Ariane …« Drei tiefe Furchen zogen sich über seine Stirn. »So heißen doch diese europäischen Raketen.«
Grau, nicht blau und keinesfalls braun. Seine Augen hatten im Licht des Feuers und der kleinen Stehlampe einen grauen Schimmer. Im Mittelalter galten Menschen mit dieser Farbe der Iris als seelenlos, das hatte sie im Buch ihres Vaters über Märendichtung gelesen. »Meine Eltern haben bei meiner Geburt bestimmt nicht an Raketen oder den Weltraum gedacht.«
Tom nickte sich selbst zu. »Der Name passt aber irgendwie. Sie … ich meine du, du hast mich in Supergeschwindigkeit aus dem Eisloch gerettet.«
»Ich hätte schneller sein können, aber ich wollte erst meinen Tee austrinken.«
»Echt?«
»Natürlich.«
Sein Lachen klang leise, mit einem vertrauten Unterton, wie er üblich war für Menschen, die einander seit Langem kannten. »Gute Priorität.« Er prostete ihr mit der Teetasse zu. »Mandeln. Schmeckt lecker.«
»Verträgst du eine ehrliche Frage?«
»Sicher.«
»Was treibt dich in der Dämmerung auf den See? Das ist einfach nur …«
»… dumm, irre, bescheuert – ich weiß.« Er wandte sich dem Feuer zu. Die Flammen züngelten empor. »Ich hätte draufgehen können.«
»Das ist keine Antwort.«
Tom stellte die Teetasse auf den Boden, die Keramik schabte über das Eichenholz. »Stimmt.« Er zog die Decke an den Zipfeln über der Brust zusammen. »Ich bin ein lausiger Schlittschuhläufer.«
»Die kleine Kostprobe von eben war jedenfalls sehr überzeugend.«
»Ich weiß.« In seinem Seufzen lag eine Schwere, wie sie für einen Mann seines Alters ungewöhnlich erschien. »Ich muss das bis zum Frühjahr können.«
»Weil?«
»Mein Vater.« Mit dem nackten Zeh stieß er einen Holzscheit vor dem Kamin an. »Er ist krank. Krebs. Viel Zeit bleibt ihm nicht mehr.«
Vater. Schlittschuhe. Krebs. Ariane stellte die Worte auf den Kopf, verband sie und suchte nach einem Sinn.
In Toms Lächeln lag Nachsichtigkeit, begleitet von einem langsamen Schlag der Lider. »Mein Vater hat sich immer gewünscht, dass wir mal zusammen über einen See gleiten. Als Kind war ich eine riesige Enttäuschung für ihn.« Er beugte sich vor und griff nach einem Kiefernzweig, der auf dem Holzscheit lag. »Einmal habe ich es versucht und mir gleich das Bein gebrochen. Da war ich sechs.« Der Zweig zerbrach mit einem Knacken zwischen seinen Fingern. »Meine Schlittschuhkarriere besteht nur aus Totalausfällen. Aber dieses eine Mal will ich es schaffen. Für meinen Vater, solange er noch da ist.« Zwei Grübchen bildeten sich um seine Mundwinkel. »Ich schaff das. Ich krieg das hin.« Die zwei Vertiefungen in seiner Haut ähnelten nun aufrecht stehenden Sicheln, wie eingemeißelt. »Also … vielleicht, wenn ich eine gute Trainerin hätte.«
Ariane winkte ab. »Ich bin nur mittelmäßig.« Vor vielen Monaten hatte sie sich in die Einsamkeit des Hauses zurückgezogen. Sie war nicht reif für neue Menschen in ihrem Umfeld. Zu spät oder zu früh – das hier war zweifellos der falsche Moment. »Und mir fehlt die Zeit.« Eine halbe Wahrheit blieb dennoch eine ganze Lüge.
Tom schwieg und deutete ein Nicken an. »Verstehe.«
Alles, was er tat, geschah langsam. Er strich langsam über die Spitze des zerbrochenen Zweiges, hob langsam den Kopf und ließ den Blick durch das Fenster neben der Tür in der Ferne abschweifen.
Der Wind rauschte. Im Bad brummte die Trockenmaschine so stoßweise, als läge sie in den letzten Zügen ihres maschinellen Lebens.
»Ariane, darf ich dich auch was fragen?«
»Klar. Trau dich.«
»Also … du lebst hier alleine.«
Keine Frage. Eine Feststellung. »Ich genüge mir. Die Welt da draußen ist mir fremd geworden.«
»Geht mir manchmal auch so.« Tom stand auf und trat an den Kaminsims. »Du hast ja nicht mal einen Fernseher hier. Aber jede Menge Bücher.«
»Mir sind Menschen unheimlich, deren Fernseher größer als ihre Bücherregale sind.«
Sein Lachen klang offen und ehrlich. »Ich frage nur, weil mir diese Malerei hier aufgefallen ist.«
Da stand es, im Schein des knisternden Feuers und keinesfalls für fremde Augen gedacht. Das Bild lehnte an der Mauer, entstanden aus kräftigen Strichen mit Ölfarben. Darauf trug Fabian sein hellblaues Hemd mit dem Kentkragen, seine Hand lag auf Arianes Hüfte. Noch jetzt und hier meinte sie, seine Wärme auf der Haut zu spüren. Eine Momentaufnahme an einem heißen Tag in Nairobi, im Hintergrund der rote Sand, hüfthohe grüne Farne und knorrige Affenbrotbäume. Ein junger kenianischer Lehrer hatte sie gemalt. Es war seine Art des Dankes gewesen, weil sie ihn an seiner Schule unterstützt hatten.
Ariane tippte die Leinwand an. »Das ist Fabian. Mein Mann. Der Käpt’n.« Sie erhob sich aus ihrem Sessel und trat neben Tom an den Kaminsims. »Er war Pilot.« Sie strich über die Baumwollstrukturen der Leinwand, ertastete die gehärtete Ölfarbe. »Wir haben ein paar Jahre in Nairobi gelebt.«
»Er war Pilot …«, flüsterte Tom.
»Von Kangeta bis nach Nairobi sind es zweihundertachtzig Kilometer. Fabian ist die Strecke immer mit seiner Bristell geflogen. Das Flugzeug war knallrot, du hast es schon Minuten vorher am Himmel gesehen, bevor die Motorengeräusche an deine Ohren gedrungen sind.« Ariane nahm den zersplitterten Kiefernzweig aus Toms Hand. »Und an einem Tag im beginnenden Herbst kehrte Fabian einfach nicht mehr zurück. Bei Makuyu war er in einen Sturm geraten.« Sie warf den Zweig in die Flammen, das Feuer züngelte daran empor. Würzige Aromen von Harz stiegen auf. »Fabian ist mit seiner Maschine in einem Maisfeld zerschellt. Er starb in den Trümmern.«
Wie oft hatte sie dieses Erlebnis verdrängt, und wie lange hatte sie gebraucht, um nur die Worte zuzulassen, nicht aber die Bilder in ihrem Kopf. Die weit verstreuten roten Trümmerteile. Der herausgerissene Sitz. Die Schneise, die das Flugzeug im Maisfeld hinterlassen hatte. Fabians lebloser Körper inmitten der aufgewühlten Erde und seine ausgestreckten Arme, als wollte er in die Tiefe des Planeten tauchen. Der Käpt’n hatte sie in dieser Welt alleine gelassen, und er würde nicht mehr zurückkehren.
»Ich … das tut mir leid …« Tom berührte ihren Oberarm. »Entschuldige bitte, Ariane …«
»Das Leben ist manchmal scheiße, ungerecht und dreckig, ohne Wenn und Aber. Aber dafür musst du dich nicht entschuldigen.« Sie hätte sich elaborierter ausdrücken können, doch ihren Worten hätte es die Klarheit genommen.
Tom presste die Fäuste in die Taschen des Bademantels, wie kleine Kugeln zeichneten sie sich unter dem Frottee ab. »Vielleicht müssen wir nur lernen, uns da draußen zu wehren.«
»Das müssen wir. Ganz sicher sogar.« Da klang ein Piepen aus dem Waschraum, der Trockner verstummte. »Fertig. Deine Sachen sind getrocknet. Ich hole sie schnell.«
Ariane lief die Eichenstufen zum Waschraum hinab und riss die Trommel auf. Ein frischer Duft strömte ihr entgegen. Sie kniete sich nieder, zerrte Hose, Unterwäsche, Socken und Pullover aus dem Trockner. Als sie Toms Parka aus der Maschine zog, verhakte sich die Kapuze am Handgriff. Mit einer schlenkernden Drehbewegung befreite sie den Stoff, der Parka landete in ihrem Schoß. Ein metallisches Klimpern ertönte rechts von ihr. Eine Plastikflasche mit Waschmittel kippte um, die blaue Flüssigkeit lief in einer Lache über die Fliesen und bildete abstrakte Muster. Düfte von Limone zogen durch den Raum. In der Trommel knackte es. Wasser blubberte in den Heizungsrohren.
Direkt vor Arianes Schuhspitze lag ein kleiner Klauenhammer. An seinem Kopf befanden sich zwei Krallen, mit denen sich Nägel aus Holz ziehen ließen. Sie hob den Hammer auf und wog ihn in der Hand. Vielleicht zweihundert Gramm schwer, nicht mehr. Die Krallen erschienen in dem funzeligen Licht der Deckenlampe seltsam spitz, wie nachbearbeitet. Sie berührte den Stahl mit der Fingerspitze. Kein Zweifel. Die Krallen fühlten sich ungleichmäßig und am Ende nachgeschärft an. Ariane begriff nicht, warum Tom einen solchen Hammer bei sich trug. Noch weniger ließ sich entschlüsseln, warum das Metall überhaupt bearbeitet worden war.
Sie faltete Toms Kleidung und legte sie zusammen. Den Hammer schob sie sich in den Hosenbund. So eilte sie nach oben.
Stufe für Stufe erklomm sie und sah dabei Fabian vor sich, sein breites Lächeln unter der dunkelblauen Wollmütze. Einmal hatte sie ihn zum Klettern zur Trafoier Eiswand in Italien gebracht. Er liebte die Kälte und die Höhen. Zu seiner Ausrüstung gehörte ein kleines Eisbeil, das er beim Besteigen des Berges an der Hüfte trug. Das Gerät hatte nur einen erkennbaren Sinn. Nur diesen einen.
Ariane stoppte auf der vorletzten Stufe. Sie wog Toms Hammer in der Hand. Niemals taugte ein Verdacht zur Feststellung, und doch war in ihr etwas in Bewegung geraten. Alte Skepsis, gepaart mit frischem Misstrauen – eine zerstörerische Mischung, die sie bisher am Leben erhalten hatte. Sie schüttelte den Kopf und ging weiter.
Oben angekommen, überreichte sie Tom seine Kleidung mit ausgestreckten Armen. »Bitte, alles trocken. Riecht vielleicht etwas zu zitronig, aber ich mag das.«
»Ich auch. Den Geruch habe ich schon als Kind geliebt.« Er nahm den Stoffhaufen entgegen. »Vielen, vielen Dank. Für alles.«





























