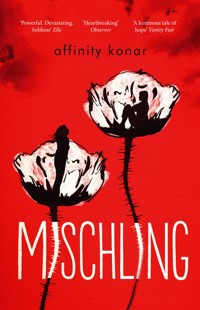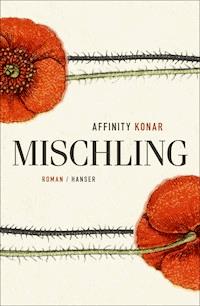
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Seele in zwei Körpern – Perle und Stasia sind zwölf und unzertrennlich, als sie 1944 deportiert werden. Doktor Mengele sucht eineiige Zwillinge für seinen "Zoo". Um zu überleben, flüchten sich die Geschwister in magische Welten, schmeicheln sich sogar beim Arzt ein. Doch eines Tages, kurz vor der Befreiung, verschwindet Perle und ein unheilbarer Riss geht durch Stasia. Zusammen mit Feliks, einem weiteren Opfer Mengeles, reist sie durch die verwüsteten Landschaften Polens auf der Suche nach ihrer Schwester. In der eindringlichen Sprache eines Märchens behauptet Affinity Konars „Mischling“ noch im Abgrund des Grauens die Kraft der Fantasie, des Widerstands und der Hoffnung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Perle und Stasia sind so sehr eins, dass sie nicht einmal sagen können, wo die eine anfängt und die andere aufhört. In ihrer Kindheit üben sie jeden Tag, gleich viele Schritte zu gehen, gleich viele Wörter zu sprechen, gleich zu lächeln. Als sie im Herbst 1944 aus dem Ghetto in Łódź nach Auschwitz deportiert werden, ziehen sie die Aufmerksamkeit von Josef Mengele auf sich, der eineiige Zwillinge für seine medizinischen Versuche sammelt. Innerhalb von Mengeles »Zoo« erfahren die Schwestern Privilegien, aber auch unvorstellbaren Schrecken. Unterschiedlichen Experimenten ausgesetzt, treiben sie immer weiter voneinander fort – und dann verschwindet Perle spurlos. Als das Lager wenige Wochen später durch die Rote Armee befreit wird, entkommt Stasia nur knapp den Todesmärschen. In den verwüsteten Landschaften Polens macht sie sich mit Feliks, einem weiteren Opfer Mengeles, auf die Suche nach ihrer anderen Hälfte.
Hanser E-Book
AFFINITY KONAR
MISCHLING
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Schaden
Carl Hanser Verlag
Für Philip und für meine Familie
TEIL 1
STASIA
1 WELT UM WELT
Wir wurden geschaffen, einst. Meine Zwillingsschwester Perle und ich. Genauer gesagt, Perle wurde geformt, und ich spaltete mich von ihr ab. Sie prägte sich der Gebärmutter ein, ich kopierte ihre Signatur. Acht Monate lang trieben wir in Fruchtwasserschneefall, zwei rosige Fäustlinge, die am Innenfutter unserer Mutter lagen. Ich konnte mir nichts Großartigeres vorstellen als den Mutterleib, den wir uns teilten, doch als das Gerüst unserer Gehirne stand und unsere Milzen fertig waren, wollte Perle die Welt jenseits von uns sehen. Und daher katapultierte sie sich mit dem Mut des Neugeborenen aus unserer Mutter hinaus.
Obwohl zu früh geboren, war Perle ein Witzbold und schlau obendrein. Ich redete mir ein, es sei nur einer ihrer Tricks; sie würde gleich wieder zurückkommen und mich auslachen. Doch als Perle nicht wiederkam, ging mir die Luft aus. Haben Sie mal zu leben versucht, wenn der beste Teil von Ihnen davontreibt und irgendwo in ungewisser Ferne verweilt? Wenn ja, wissen Sie sicher um die Gefahren dieses Zustands. Nachdem mir die Luft ausgegangen war, zog mein Herz gleich nach, und mein Hirn wurde von einem undenkbaren Fieber erfasst. Als rosiger Fötus hatte ich folgende Erkenntnis: Ohne meine Schwester war ich ein abgetrenntes, unwürdiges Ding, ein liebesunfähiges Wesen.
Also heftete ich mich an ihre Fersen und ließ mich von behandschuhten Arzthänden herausziehen und nach einem Klaps auf den Hintern ans Licht halten. Es sei hier darauf hingewiesen, dass ich während der gesamten Prozedur dieses ungewollten Übergangs kein einziges Mal schrie. Auch dann nicht, als sich unsere Eltern kurzerhand über meinen Wunsch hinwegsetzten, ebenfalls Perle genannt zu werden.
Stattdessen wurde ich Stasia. Und als die lästige Geburtsarbeit hinter uns lag, betraten wir die Welt aus Familie, Klavierspiel und Büchern, der in Schönheit und Staunen vorüberziehenden Tage. Wir waren uns so ähnlich – dauernd ließen wir Murmeln vom Fenster aus auf die Pflastersteine fallen und sahen ihnen mit dem Fernglas nach, wie sie hügelabwärts davonrollten, wollten wissen, wie weit ihr kleines Leben sie trüge.
Auch diese Welt, diese vor Ehrfurcht wimmelnde Welt, endete. So wie die meisten Welten.
Aber ich muss Ihnen auch erzählen, dass wir noch eine andere Welt kannten. Manche meinen, es sei die Welt, die uns am meisten formte. Das würde ich als Irrtum bezeichnen, aber vorläufig lassen Sie mich davon sprechen, wie wir in unserem zwölften Lebensjahr in diese Welt eintraten, indem wir uns ganz hinten in einem Güterwaggon aneinanderdrängten.
Während der Fahrt, die vier Tage und vier Nächte dauerte, schummelten wir uns unter Mamas und Sejdes Anleitung ins Überleben. Unsere Nahrung bestand aus einer Zwiebel, die wir einander hin- und herreichten und deren gelbe Haut wir ableckten. Zur Ablenkung spielten wir das Spiel, das Sejde sichfür uns ausgedacht hatte; es hieß Einteilung der Lebewesen. Eine Art Scharade, bei der man ein Lebewesen darstellen musste, und die Mitspieler mussten Spezies, Geschlecht, Familie und so weiter erraten, bis hin zur Pracht eines ganzen Reichs.
Wir mimten unendlich viele Lebewesen in diesem Güterwaggon, vom Bären bis zur Schnecke und zurück – wir müssten unbedingt, sagte Sejde mit seiner vor Durst brüchigen Stimme, das Universum so gut organisieren, wie es uns in unserer allzu menschlichen Beschränktheit möglich sei –, und als der Güterwaggon endlich anhielt, brach ich auch meine Scharade ab. Meiner Erinnerung nach wollte ich Mama eben davon überzeugen, ich sei eine Amöbe. Kann sein, dass ich ein anderes Lebewesen darstellte und die Amöbe nur deshalb in Erinnerung behalten habe, weil ich mich in jenem Moment so winzig fühlte, so durchscheinend und zerbrechlich. Ich weiß es nicht mit Sicherheit.
Als ich mich schon geschlagen geben wollte, wurde die Waggontür aufgeschoben.
Und das eindringende Licht erschreckte uns so sehr, dass uns die Zwiebel hinfiel und über die Rampe hinunterrollte, ein scharf riechender, halbgegessener Mond, der vor den Füßen eines Aufsehers landete. Seine Miene stelle ich mir angewidert vor – ich kann sie mir nur vorstellen, denn ich sah sie nicht. Er hielt sich ein Taschentuch vor die Nase und nieste mehrmals, dann hob er seinen Stiefel über unsere Zwiebel; der Schatten, den er warf, verfinsterte die kleine Kugel. Wir sahen die Zwiebel weinen, während er sie zermalmte, ihre Tränen waren bitterer Brei. Dann trat er noch näher, und wir suchten schleunigst in Sejdes weitem Mantel Deckung. Eigentlich waren wir dafür längst zu groß, doch die Furcht ließ uns schrumpfen, und wir wühlten uns in die Mantelfalten um seinen abgemagerten Körper, sodass unser Großvater zu einer unförmigen, vielbeinigen Gestalt wurde. In seinem Schutz blinzelten wir. Dann hörten wir ein Geräusch – ein Stampfen, ein Poltern – die Aufseherstiefel waren direkt vor uns.
»Was soll denn das für ein Insekt sein?«, fragte er Sejde und klopfte mit seinem Stock an jedes Mädchenbein, das unter dem Mantel hervorschaute. Unsere Knie brannten. Der Aufseher schlug auch auf Sejdes Beine. »Sechs Beine? Eine Spinne?«
Es war klar, dass der Aufseher keine Ahnung von Lebewesen hatte. Er hatte schon zwei Fehler gemacht. Aber Sejde hielt es nicht für nötig, darauf hinzuweisen, dass Spinnen keine Insekten sind und dass sie in Wirklichkeit acht Beine haben. Was er sonst sehr gern tat – in einem spielerischen Singsang pflegte er unsere Irrtümer über Lebewesen zu korrigieren, denn für ihn musste alles seine Ordnung haben. Hier aber, hier war es zu gefährlich, detailliertes Wissen über kriechendes oder als niedrig geltendes Getier zu äußern, sonst wurde man womöglich zu vieler Gemeinsamkeiten mit ihnen bezichtigt. Wir hätten es besser wissen und aus unserem Großvater kein Insekt machen sollen.
»Ich hab dich was gefragt«, wiederholte der Aufseher und versetzte unseren Beinen abermals einen Stockhieb. »Was für eins?«
Auf Deutsch gab Sejde ihm Auskunft: dass er Tadeusz Zamorski heiße. Fünfundsechzig Jahre alt. Polnischer Jude. Dann schwieg er, als wäre damit alles gesagt.
Und wir hätten gern an seiner Stelle weitergemacht, jedes Detail erzählt: dass Sejde mal Professor für Biologie gewesen sei. Dass er jahrzehntelang sein Fach an Universitäten unterrichtet habe, aber auch Experte in vielen anderen Dingen sei. Dass man ihn fragen müsse, wenn man ein Gedicht erklärt haben wollte. Oder wenn man wissen wollte, wie man auf den Händen läuft oder einen Stern findet: Er zeigte es einem. Mit ihm sahen wir mal einen Regenbogen, der in einer einzigen Farbe leuchtete, in Rot, wir sahen ihn einen Berg und ein Meer überspannen, und oft wollte Sejde auf die Erinnerung daran anstoßen. Auf die unerträgliche Schönheit!, sagte er, und seine Augen standen voller Tränen. Er liebte Trinksprüche so sehr, dass er sie wahllos, beinahe zu jeder Gelegenheit ausbrachte. Auf morgendliches Schwimmen! Auf die Linden vor dem Tor! Und in den letzten Jahren war dies sein beliebtester Spruch: Auf den Tag, an dem mein Sohn lebendig und unverändert zurückkehrt!
Aber nichts davon sagten wir dem Aufseher, so sehr wir es uns gewünscht hätten – es blieb uns in der Kehle stecken, und der Zwiebeltod in unmittelbarer Nähe hatte uns die Tränen in die Augen getrieben. Daran war die Zwiebel schuld, sagten wir uns, nichts sonst, und wir wischten die Tränen weg, damit wir durch die Löcher in Sejdes Mantel sehen konnten, was draußen geschah.
Durch diese Löcher sahen wir, wie von Bullaugen eingefasst, fünf Gestalten: drei kleine Jungen, ihre Mutter und einen Mann in weißem Kittel, der einen Stift über einem kleinen Buch gezückt hielt. Die Jungen faszinierten uns – wir hatten nie zuvor Drillinge gesehen. In Łódź hatte es außer uns noch ein weiteres Zwillingspaar gegeben, ebenfalls Mädchen, ein Trio aber war nur etwas aus Büchern. Ihre Zahl beeindruckte uns, allerdings übertrumpften wir sie an Übereinstimmung. Alle drei hatten die gleichen dunklen Locken und Augen, den gleichen schlaksigen Körper, doch ihr Ausdruck war unterschiedlich – einer blinzelte in die Sonne, während die anderen beiden die Stirn runzelten, und ihre Gesichter fielen erst in eins, als der Mann im weißen Kittel in alle drei Handflächen ein Bonbon legte.
Die Mutter der Drillinge war anders als alle anderen Mütter im Güterwaggon – ihre Sorge hatte sie gut verborgen, und sie stand so reglos da wie eine angehaltene Uhr. Eine Hand schwebte wie in nicht enden wollendem Zögern über den Köpfen ihrer Söhne, als habe sie kein Recht mehr darauf, sie zu berühren; eine Auffassung, die der Mann im weißen Kittel nicht teilte.
Er war eine einschüchternde Gestalt, mit blitzblank polierten schwarzen Schuhen und ebenso glänzendem dunklen Haar, und seine Ärmel waren so weit, dass sich der herabhängende Stoff bauschte und flog, wenn er den Arm hob, und unverhältnismäßig viel Himmel verdeckte. Er sah aus wie ein Filmstar und neigte zur Theatralik; Freundlichkeit quoll so augenscheinlich über sein Gesicht, als wollte er die gesamte Umgebung wissen lassen, wie außerordentlich seine guten Absichten waren.
Zwischen der Mutter und dem Mann im weißen Kittel wurden Worte gewechselt. Es schienen umgängliche Worte zu sein, allerdings redete der Mann sehr viel mehr als sie. Wir hätten gern gehört, was gesprochen wurde, aber vermutlich reichte es schon, dass wir sahen, was danach geschah: Die Mutter strich mit den Händen über die dunklen Wolken der drei gleichen Haarschöpfe, dann wandte sie sich ab und überließ ihre Kinder dem Mann im weißen Kittel.
Er sei Arzt, sagte sie, ehe sie mit wankenden Schritten davonging. Bei ihm hätten sie es gut, versicherte sie ihnen, und sie blickte nicht zurück.
Als unsere Mutter dies hörte, stieß sie einen leisen Schrei aus und schnappte nach Luft; dann streckte sie die Hand aus und zupfte den Aufseher am Ärmel. Ihre Kühnheit war ein Schock. Wir waren eine ängstliche Mutter gewohnt, eine, die zitterte, wenn sie beim Metzger etwas verlangte, eine, die sich vor der Putzfrau versteckte. Als flösse Pudding durch ihre Adern, so angstbebend und nachgiebig war sie, und seit Papas Verschwinden war es besonders schlimm geworden. Im Güterwaggon hatte sie sich nur aufrecht halten können, indem sie Mohnblumen an die Holzwände zeichnete. Stempel, Blütenblatt, Staubgefäß – sie zeichnete mit merkwürdiger Konzentration, und sobald sie damit aufhörte, brach sie zusammen. Doch hier auf der Rampe gewann sie auf einmal neue Festigkeit – mit einer Haltung stand sie da, die Ausgehungerte und Erschöpfte eigentlich niemals aufbringen. Hatte die Musik diese Veränderung bewirkt? Mama hatte Musik immer geliebt, und hier wimmelte es von hellen, fröhlichen Tönen, sie drangen bis zu uns herein und lockten uns mit argwohnerregendem Jubel aus dem Güterwaggon. Im Lauf der Zeit lernten wir die Abgründe dieser List ermessen und waren auf der Hut vor festlichen Melodien, auf deren Grund nur Schmerz und Leiden lauerten. Bald wussten wir, dass das Orchester die Aufgabe hatte, alle Ankommenden in die Irre zu führen. Sie waren gezwungen, diese Musiker, mit ihrer Begabung die Ahnungslosen zu umgarnen und ihnen einzureden, sie seien an einen Ort geraten, der nicht ohne Sinn für das Menschliche und Schöne war. Musik – sie ließ die eintreffenden Massen wieder Mut schöpfen, floss neben ihnen her, wenn sie das Tor durchschritten. War das der Grund, weshalb Mama so viel Kühnheit aufbrachte? Ich erfuhr es nie. Aber ich bewunderte sie für ihren Mut.
»Ist es gut hier – wenn man doppelt ist?«, fragte sie den Aufseher.
Er nickte kurz und rief den Arzt, der im Staub kauerte, um auf Augenhöhe mit den Jungen reden zu können. Es sah aus, als unterhielten sich die vier aufs Herzlichste.
»Zwillinge!«, rief ihm der Aufseher zu.
Der Arzt überließ die Drillinge einer Aufseherin und kam herübergeschlendert, und seine glänzenden Stiefel wirbelten den Staub auf. Er war liebenswürdig zu unserer Mutter und nahm ihre Hand, als er sie ansprach.
»Sie haben besondere Kinder?« Seine Augen schienen uns freundlich.
Mama, mit einem Mal gedämpft, trat von einem Fuß auf den anderen. Sie versuchte, ihre Hand seinem Griff zu entwinden, doch er hielt sie fest, und dann fing er auch noch an, sie mit behandschuhten Fingerspitzen zu streicheln, als wäre sie ein verwundetes, aber leicht zu besänftigendes Wesen.
»Nur Zwillinge, keine Drillinge«, entschuldigte sie sich. »Hoffentlich reicht es.«
Das Lachen des Arztes war laut und prächtig und hallte in den Hohlräumen von Sejdes Mantel wider. Wir waren erleichtert, als es verebbte und wir hören konnten, wie Mama unsere Begabungen herunterratterte.
»Sie können ein bisschen Deutsch. Ihr Vater hat es ihnen beigebracht. Im Dezember werden sie dreizehn. Ordentliche Leserinnen, alle beide. Perle liebt Musik – sie ist von rascher Auffassungsgabe, praktisch, sie lernt tanzen. Stasia, meine Stasia« – an dieser Stelle stockte Mama, als sei sie unsicher, wie sie mich einstufen sollte; dann erklärte sie: »Sie hat Phantasie.«
Der Arzt hörte diese Informationen mit Interesse an und rief uns auf die Rampe hinaus.
Wir zögerten. Besser war die stickige Luft unter dem Mantel. Draußen ging ein grauer, angesengter Wind, der uns unser ganzes Elend in Erinnerung rief, und darunter lag Brandgeruch. Gewehre warfen Schatten, und Hunde kläfften und sabberten und knurrten, wie es nur zur Grausamkeit gezüchtete Hunde können. Doch ehe wir noch tiefer zurückweichen konnten, zog der Arzt den Mantelvorhang beiseite. Wir blinzelten ins Sonnenlicht. Eine von uns knurrte. Es könnte Perle gewesen sein. Wahrscheinlich war ich es.
Wie könne es sein, wunderte sich der Arzt, dass diese vollkommenen Gesichtszüge für derart mürrische Mienen vergeudet würden? Er zog uns heraus, zwang uns, uns einmal um die eigene Achse zu drehen, und ließ uns dann zurücktreten, um uns genau studieren zu können.
»Lächeln!«, befahl er.
Warum gehorchten wir diesem Befehl? Unserer Mutter zuliebe, glaube ich. Ihretwegen grinsten wir, sogar als sie sich, helle Panik im Gesicht, an Sejdes Arm klammerte. Zwei Schweißtröpfchen rannen über ihre Stirn. Seit wir in den Güterwaggon gestiegen waren, hatte ich es vermieden, unsere Mutter anzusehen. Stattdessen sah ich die Mohnblumen an, die sie malte; ich konzentrierte mich auf die fragilen Blüten ihrer Gesichter. Doch irgendetwas an ihrer unechten Miene machte mir klar, was aus Mama geworden war: eine hübsche, aber schlaflose Halbwitwe mit verblasster Persönlichkeit. Einst die adretteste Frau, die man sich denken kann, war sie jetzt am Ende; ihr Gesicht war staubverschmiert, und der Spitzenkragen hing ihr schlaff um den Hals. In ihren vor Sorge zerbissenen Mundwinkeln hatten sich trübe Perlen aus Blut gebildet.
»Das sind Mischlinge?«, fragte er. »Dieses flachsblonde Haar!«
Mama zerrte an ihren dunklen Locken, als schämte sie sich ihrer Schönheit, und schüttelte den Kopf.
»Mein Mann – er war blond«, brachte sie heraus. Eine andere Antwort hatte sie nie, wenn sie nach unserer Haarfarbe gefragt wurde, die manchen Betrachter darauf beharren ließ, wir seien gemischtrassig. Als wir heranwuchsen, hörten wir dieses Wort, Mischling, immer öfter; dass es in unserer Gegenwart fiel, hatte Sejde auf die Idee von der Einteilung der Lebewesen gebracht. Kümmert euch nicht um den Nürnberger Rassenwahn, pflegte er zu sagen, ignoriert das Gerede von Mischlingen, Rassenvermischung, Vierteljuden und Sippschaft, diese absurden, abscheulichen Tests, die versuchen, unser Volk bis auf den letzten Blutstropfen, bis hinein in Ehe und Gotteshaus zu spalten. Wenn ihr dieses Wort hört, sagte er, setzt auf die Vielfalt aller Lebewesen. Haltet den Kopf hoch, in Ehrfurcht davor.
Als ich aber vor diesem weißbekittelten Arzt stand, wusste ich, dass Sejdes Rat in nächster Zeit schwer zu befolgen wäre, weil wir an einem Ort waren, der Sejdes Spiele nicht erhörte.
»Gene sind etwas Sonderbares, nicht wahr?«, sagte der Arzt.
Mama versuchte nicht mal, sich auf dieses Gespräch einzulassen.
»Wenn sie mit Ihnen gehen« – und dabei sah sie uns nicht an – »wann werden wir sie wiedersehen?«
»An eurem Sabbat«, versprach der Arzt. Dann wandte er sich uns zu und schwärmte von unseren Einzelheiten – wie schön, dass wir Deutsch sprächen, sagte er, wie schön, dass wir blond seien. Nicht schön fand er, dass wir braune Augen hatten, allerdings könne sich dies, bemerkte er gegenüber dem Bewacher, noch als nützlich erweisen – er beugte sich noch näher, um uns zu inspizieren, streckte sogar eine behandschuhte Hand aus, um meiner Schwester übers Haar zu streichen.
»Du heißt also Perle?« Allzu leicht tauchte seine Hand in ihre Locken, als täte sie seit Jahren nichts anderes.
»Sie heißt nicht Perle«, sagte ich. Ich trat vor, um mich vor meine Schwester zu stellen, doch Mama zog mich fort und sagte zu dem Arzt, ja, ganz recht, er habe das richtige Mädchen benannt.
»Also spielen sie gern Streiche?«, sagte er und lachte. »Verraten Sie mir Ihr Geheimnis – woher wissen Sie, wer wer ist?«
»Perle zappelt nicht«, war alles, was Mama sagte. Ich war froh, dass sie nicht näher auf unsere erkennbaren Unterschiede einging. Perle trug eine blaue Haarspange. Ich eine rote. Perle sprach ruhig. Meine Worte kamen gehetzt heraus, verhaspelten sich hin und wieder, waren durchlöchert von Pausen. Perle war blass wie ein Mehlkloß. Ich hatte Sommersprossen wie ein Pferd. Perle war ganz Mädchen, ich wollte ganz Perle sein, doch so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte nur ich sein.
Der Arzt bückte sich, sodass unsere Gesichter auf gleicher Höhe waren.
»Warum lügst du denn?«, fragte er mich. Und wieder lachte er, geradezu anheimelnd.
Wäre ich ehrlich gewesen, hätte ich gesagt, dass Perle meiner Ansicht nach die Schwächere von uns beiden sei und ich sie schützen zu können glaubte, indem ich sie würde. Stattdessen erzählte ich ihm eine Halbwahrheit. »Manchmal vergesse ich, welche ich bin«, sagte ich lahm.
Und von da an erinnere ich mich nicht mehr. An dieser Stelle möchte ich im Geist zurück- und hinuntergehen, vorbei am Rums-Bums von Stiefeln und Koffern, um wenigstens den Hauch eines Abschieds zu finden. Denn wir hätten doch sehen müssen, wie wir unsere Liebsten verloren, wir hätten in der Lage sein müssen, ihnen nachzuschauen, während sie davongingen, hätten den genauen Zeitpunkt unseres Verlusts kennen müssen. Hätten wir nur gesehen, wie ihre Gesichter sich von uns abwandten, das letzte Aufblitzen eines Auges, eine letzte Wangenrundung! Ein sich abwendendes Gesicht – das gönnten sie uns nie. Aber warum durften wir nicht einmal ihre Rücken sehen, um diesen Anblick zu bewahren, nur die sich entfernenden Rücken? Nur den flüchtigen Eindruck von einer Schulter, einem Stück Wollmantel? Den Anblick von Sejdes Hand, die schwer neben ihm herabhing – von Mamas Zopf, der sich im Wind hob!
Und wo unsere Liebsten hätten sein sollen, da hatten wir nur die erste Bekanntschaft mit diesem Mann im weißen Kittel, Josef Mengele, demselben Mengele, der sich während seiner vielen Jahre im Untergrund Helmut Gregor, G. Helmuth, Fritz Ulmann, Fritz Hollman, José Mengele, Peter Hochbichler, Ernst Sebastian Alves, José Aspiazi, Lars Ballstroem, Friedrich Edler von Breitenbach, Fritz Fischer, Karl Geuske, Ludwig Gregor, Stanislaus Prosky, Fausto Rindón, Fausto Rondon, Gregor Schklastro, Heinz Stobert und Dr. Henrique Wollman nennen sollte.
Der Mann, der sein tödliches Wirken unter diesen zahlreichen Namen begraben würde – er sagte, wir sollten ihn Onkel Doktor nennen. Wir mussten ihn so nennen, einmal, dann noch einmal, damit wir uns daran gewöhnten, keine Fehler machten. Bis wir den Namen so oft wiederholt hatten, dass er zufrieden war, war unsere Familie schon verschwunden.
Und als wir die Leere sahen, wo Mama und Sejde gestanden hatten, da fällte mich ein jähes Erkennen, denn ich sah auf einmal, dass diese Welt im Begriff war, eine sehr andere Kategorisierung von Lebewesen zu erfinden. Was für ein Lebewesen aus mir werden sollte, wusste ich damals noch nicht, der Aufseher aber ließ mir keine Zeit, darüber nachzudenken – er packte mich am Arm und zog daran, bis Perle ihm versicherte, sie werde mich stützen, und sie schlang mir den Arm um die Taille, als wir zusammen mit den Drillingen weggebracht wurden, fort von den Gleisen und in den Staub, auf eine kleine Straße, die an der Sauna vorbei zu den Krematorien führte, und als wir in diese neue Ferne hineingingen, während rechts und links von uns der Tod aufragte, sahen wir Leichen auf einem Karren, schwärzlich und übereinandergestapelt, und eine der Leichen – sie streckte die Hand aus, sie suchte nach einem Halt, als wäre da eine unsichtbare Leine in der Luft, die nur die Fast-Toten sehen konnten. Ihr Mund bewegte sich. Wir sahen eine rosarote Zunge schlenkern und kämpfen, aber Worte hatte sie nicht mehr.
Ich wusste, wie wichtig Worte für ein Leben waren. Wenn ich der Leiche einige von meinen gab, dachte ich, ließe sie sich vielleicht ins Leben zurückholen.
War es dumm von mir, so etwas zu denken? Schwachsinnig? Wäre mir der Gedanke auch an einem Ort ohne versengt riechenden Wind und weißgeflügelte Ärzte gekommen?
Das sind berechtigte Fragen. Ich stelle sie mir oft, habe aber nie versucht, Antworten zu finden. Die Antworten gehören mir nicht.
Ich weiß nur eines: Ich starrte die Leiche an, und die einzigen Worte, die ich heraufbeschwören konnte, waren nicht meine eigenen. Sie stammten aus einem Lied, das ich auf einem geschmuggelten Plattenspieler in unserem Ghettokeller gehört hatte. Es hatte mir jedes Mal Trost gespendet, daher versuchte ich es damit.
»Would you like to swing on a star?«, sang ich der Leiche vor.
Kein Laut, keine Regung. Lag es an meiner Piepsstimme? Ich versuchte es noch einmal.
»Carry moonbeams home in a jar«, sang ich.
Es war ein erbärmlicher Versuch, ich weiß, aber ich hatte immer daran geglaubt, dass die Welt in der Lage sei, sich selbst wieder zurechtzurücken, einfach so, mit einer kleinen Freundlichkeit. Und wenn keine Freundlichkeit in Sicht ist, erfindet man sich neue Regeln und Systeme, an die man glauben kann, und in diesem Moment, an diesem Ort, glaubte ich – mag es Dummheit oder Schwachsinn gewesen sein – an die Fähigkeit des menschlichen Körpers, sich mit dem Atem eines Wortes wiederzubeleben. Aber es war klar, dass die Zeilen aus diesem Lied auf keinen Fall die richtigen waren. Keines seiner Worte konnte das Leben in diesem Körper freisetzen oder war stark genug, um ihn zu reparieren. Ich suchte nach einem anderen Wort, einem guten Wort, das ich hergeben konnte – es musste eines geben, ich war mir ganz sicher –, aber der Aufseher ließ mich nicht. Er zerrte mich weg und trieb uns weiter voran, hatte es eilig, uns geduscht und registriert und nummeriert zu sehen, damit unsere Zeit in Mengeles Zoo beginnen konnte.
Auschwitz war errichtet worden, um Juden einzusperren. Birkenau war errichtet worden, um sie mit größerer Effizienz umzubringen. Nur ein paar Kilometer lagen zwischen dem einen und dem anderen Unheil. Wozu dieser Zoo diente, wusste ich nicht – ich konnte mir nur schwören, dass Perle und ich nie in einen Käfig gesperrt würden.
__________
Die Baracken des Zoos waren einst Pferdeställe gewesen; jetzt waren sie mit unseresgleichen vollgestopft: Zwillinge, Drillinge, Fünflinge. Hunderte und Aberhunderte von unseresgleichen, alle in Betten gepackt, die keine Betten waren, sondern Streichholzschachteln, enge Schächte, in die Körper hineingesteckt wurden, und übereinandergetürmt vom Boden bis zur Decke; und in diesen beklemmenden Gerüsten mussten drei, vier Körper gleichzeitig Platz finden, sodass ein Mädchen kaum wusste, wo es aufhörte und wo die Nachbarin anfing.
Wo immer man hinsah, war ein Duplikat, eine Eineiige. Lauter Mädchen. Traurige Mädchen, Mädchen, die kaum laufen gelernt hatten, Mädchen aus fernen Ländern, andere, die aus unserem Heimatort hätten stammen können. Manche der Mädchen waren still, hockten auf ihren Strohmatratzen wie Vögel auf der Stange und musterten uns. Als wir an ihnen vorbeigingen, sah ich die Auserwählten, diejenigen, die auserkoren waren, auf bestimmte Weise zu leiden, während ihre anderen Hälften unversehrt blieben. Von fast jedem Zwillingspaar hatte das eine ein schlimmes Bein, eine verformte Wirbelsäule, ein verbundenes Auge, eine Wunde, eine Narbe, eine Krücke.
Als Perle und ich in unsere Schlafkoje krochen, wurden wir von den bewegungsfähigen Zwillingen bestürmt. Sie kletterten über die wackeligen Holzgestelle mit ihren Strohmatratzen, begutachteten unsere Ähnlichkeit, fragten uns aus.
Wir seien aus Łódź, sagten wir. Erst ein Haus. Dann ein Keller im Ghetto. Wir hätten einen Großpapa, eine Mutter. Einen Vater hätten wir auch mal gehabt. Und Sejde, unser Großvater, habe einen alten Spaniel gehabt, der sich tot stellen konnte, wenn man nur mit dem Finger auf ihn zeigte, aber dann gleich wieder zum Leben erwachte. Hatten wir schon erwähnt, dass unser Vater Arzt war und anderen so selbstlos half, dass er eines Nachts verschwand? Dass er uns verließ, um sich um ein krankes Kind zu kümmern, und nie zurückkehrte? Ja, er fehlte uns dermaßen, dass wir auch gemeinsam das Gewicht unserer Trauer nicht tragen konnten. Es gebe noch manches, vor dem wir uns fürchteten: Keime, ein trauriges Ende in Büchern, Mama, wenn sie weinte. Es gebe manches, das wir liebten: Klaviere, Judy Garland, Mama, wenn sie weniger weinte. Aber wer waren wir wirklich? Es gab nicht viel zu sagen, außer dass die eine von uns eine gute Tänzerin war und die andere sich bemühte, aber außer neugierig zu sein, nichts wirklich gut konnte. Das war ich.
Zufrieden mit diesen Informationen, gaben die anderen ebenfalls Auskunft, wobei sie einander lautstark das Wort aus dem Mund nahmen.
»Wir kriegen hier mehr Essen«, begann Rachel, die so bleich war, dass man beinahe durch sie hindurchsehen konnte.
»Aber es ist nicht koscher, es frisst einen von innen her auf«, wandte ihre ebenso durchscheinende zweite Hälfte ein.
»Wir behalten unsere Haare«, sagte Scharon und zog demonstrativ an ihrem Zopf.
»Bis wir Läuse kriegen«, ergänzte ihre geschorene Schwester.
»Wir behalten auch unsere Kleidung«, sagte eine der Russinnen.
»Aber sie malen uns Kreuze auf den Rücken«, beendete ihre Doppelgängerin den Satz. Sie drehte sich um, damit ich das mit knallroter Farbe aufgemalte Kreuz sehen konnte, aber das war nicht nötig. Auch zwischen meinen Schulterblättern war ein rotes Kreuz.
Die Stimmen verstummten mit einem Schlag, und die ungebetene Stille legte sich auf uns alle – es war, als hätte sich eine Wolke in den Dachsparren des Zoos eingenistet. Die vielen Duplikate sahen einander fragend an – irgendwas muss doch sein, sagten ihre Mienen, mehr als Essen und Haare und Kleidung. Aus der Koje unter uns meldete sich eine Stimme. Wir reckten den Hals nach der Sprecherin, doch sie und ihr Zwilling lagen ineinander verschlungen an die Ziegelwand gedrückt. Wie sie aussah, erfuhren wir nie, aber ihre Worte prägten sich uns für immer ein.
»Sie sorgen dafür, dass unseren Familien nichts passiert«, sagte die ungesehene Fremde.
Daraufhin nickten alle Mädchen zustimmend, und Perle und ich wurden von einer neuen Woge von Stimmen überschwemmt, denn alle beglückwünschten einander, dass sie aus Familien kamen, die, im Unterschied zu so vielen anderen, intakt bleiben würden.
Das Naheliegende wollte ich nicht fragen. Ich kniff Perle, damit sie für uns fragte.
»Warum sind wir wichtiger als die anderen?« Ihre Stimme schrumpfte gegen Ende der Frage zusammen.
Eine Flut von Antworten brach los, alle hatten mit Aufgabe und Größe, mit Reinheit und Schönheit und Nützlichkeit zu tun. Keine einzige leuchtete uns ein.
Und ehe ich auch nur versuchen konnte, irgendetwas von diesen Ideen zu verstehen, kam die blokowa herein, die Blockführerin, die uns beaufsichtigte. Hinter ihrem gewaltigen Rücken nannten wir diese Person Ochse; sie sah aus wie ein Kleiderschrank mit Toupet und neigte zu Aufstampfen und Nüsternblähen, wenn sie bei einer ihrer leidenschaftlichen Tiraden angetroffen wurde, die unser angeblicher Ungehorsam häufig auslöste. Doch als Perle und ich ihr vorgestellt wurden, war sie nur eine Gestalt, die den Kopf zur Tür hereinstreckte, halb von der Dunkelheit draußen verschluckt und durch unsere Fragen beleidigt.
»Warum heißt das hier Zoo?«, fragte ich. »Wer hat das beschlossen?«
Ochse zuckte die Achseln. »Ist das nicht offensichtlich?«
Nein, sagte ich. Die Zoos, von denen wir mit Sejde gelesen hatten, waren Reservate, in denen die Vielfalt des Lebens gezeigt wurde. Hier ging es nur um den unheilvollen Akt des Sammelns.
»Der Name gefällt Doktor Mengele«, sagte Ochse nur. »Viele Antworten werdet ihr hier nicht finden. Und jetzt schlaft! Schlaf ist was, das ihr haben könnt. Jetzt lasst mir meinen!«
Hätten wir nur schlafen können. Die Dunkelheit war so dunkel, wie ich es noch nie erlebt hatte, und der Geruch heftete sich mir in die Nase. Aus der Koje unter uns kam ein Stöhnen, draußen bellten Hunde, und mein Magen knurrte unaufhörlich. Ich versuchte, mich mit einem unserer Buchstabenspiele abzulenken, doch immer wieder wurde mein Alphabet durch das Geschrei der Wächter draußen übertönt. Ich wollte Perle zum Mitspielen bewegen, doch sie fuhr nur eifrig mit den Fingerspitzen über das Silbernetz, das unsere Ziegelecke verzierte, um meine geflüsterten Fragen besser ignorieren zu können.
»Wärst du lieber eine Uhr, die nur die guten Zeiten misst?«, fragte ich sie. »Oder eine Uhr, die singt?«
»Ich glaube nicht mehr an Musik.«
»Ich auch nicht. Nicht mehr. Aber wärst du lieber eine Uhr …«
»Wieso soll ich überhaupt eine Uhr sein? Habe ich denn keine andere Wahl?«
Ich wollte einwenden, dass wir, als Lebewesen, als menschenartige Personen, die wahrscheinlich noch am Leben waren, uns manchmal selbst als Gegenstände ansehen müssten, um über die Runden zu kommen. Dass wir uns verstecken müssten und erst dann an Reparatur denken könnten, wenn solche Gedanken ungefährlich seien. Stattdessen bedrängte ich sie mit einer weiteren Frage.
»Wärst du lieber der Schlüssel zu einem Ort, der uns rettet, oder die Waffe, die unsere Feinde vernichtet?«
»Ich wäre lieber ein richtiges Mädchen«, sagte Perle dumpf. »Wie früher.«
Ich hätte gern eingewendet, dass Spiele ja eine Hilfe seien, damit sie sich wieder wie ein richtiges Mädchen fühlen könne, aber ich war mir selber nicht ganz sicher, ob das auch stimmte. Seitdem die Nazis uns nummeriert hatten, war das Leben nicht wiederzuerkennen, und in der Dunkelheit waren die Zahlen alles, was ich sehen konnte, und noch schlimmer war, dass man auf keinen Fall so tun konnte, als seien sie irgendwie weniger haltbar oder ernst oder blau. Meine waren verschmiert und undeutlich – ich hatte getreten und gespuckt, sie hatten mich festhalten müssen –, aber eine Nummer war es doch. Perle war auch nummeriert, und ich hasste ihre Zahlen noch mehr als meine, weil sie herausstrichen, dass wir zwei eigenständige Menschen waren, und als eigenständige Menschen kann man auch getrennt werden.
Ich würde uns wieder zurücktätowieren, sagte ich zu Perle, so bald wie möglich, damit wir wieder so wären wie früher, aber sie seufzte nur; es war der für Augenblicke schwesterlicher Frustration typische Seufzer.
»Es reicht mit den Geschichten. Du kannst nicht tätowieren.«
Gut genug, sagte ich. Ich hätte es von einem Seemann gelernt, in Danzig. Ich hätte seinen Bizeps mit einem Anker verziert.
Stimmt, das war eine Lüge. Eigentlich aber nur eine halbe Lüge, denn ich hatte tatsächlich mal bei einer Ankertätowierung zugesehen. Einmal, als wir zur Sommerfrische ans Meer gefahren waren, hatte ich meine Zeit damit zugebracht, ins graue Innere eines Tätowierladens zu spähen, in dem eine Bordüre aus Schiffs- und Schwalbensilhouetten um die Wände lief. Perle hingegen hatte einen Jungen gefunden, mit dem sie neben dem muschelbewachsenen Bug eines Boots Händchen hielt. Während also meine Schwester die Heimlichkeiten von Haut an Haut, Hand in Hand erforschte, schulte ich mich in den Intimitäten von Nadeln und dem Eintauchen einer Spitze, die so dünn war, dass nur ein Traum auf ihr Platz fand.
»Irgendwann mache ich uns wieder gleich«, beharrte ich. »Ich brauche nur eine Nadel und Tinte. Das muss doch irgendwie zu beschaffen sein, schließlich sind wir was Besonderes.«
Perle machte ein finsteres Gesicht und kehrte mir ostentativ den Rücken zu – das hölzerne Brett, auf dem wir lagen, stöhnte knarrend auf –, ihr Ellenbogen stach in die Höhe und mir in die Rippen. Es war ein Versehen – Perle hätte mir niemals absichtlich wehgetan, und sei’s auch nur, weil sie den Schmerz selber spürte. Das war einer der schlimmsten Stacheln dieser Schwesternschaft: Ein Schmerz gehörte nie einer allein. Wir hatten keine andere Wahl – jedes Leiden musste geteilt werden, und mir war klar, dass wir an diesem Ort eine Möglichkeit finden mussten, den Schmerz aufzuteilen, ehe er sich zu vervielfältigen begann.
Während ich darüber nachdachte, hatte ein Mädchen auf der anderen Seite der Baracke ein Licht aufgetrieben, ein kostbares Streichholzheftchen, und fand, dieses seltene Gut wäre am besten dafür verwendet, dem Barackenpublikum Schattenfiguren vorzuführen. Und so kam es, dass wir in den Schlaf hinüberglitten, während Schattengestalten über die Wände huschten, immer in Zweierreihen, eine neben der anderen, als wäre es eine Prozession zu einer unsichtbaren Arche, die sie in Sicherheit brächte.
So viel Welt bevölkerte die Schatten dort! Die Gestalten flatterten und krochen und krabbelten auf die Arche zu. Kein einziges Leben war zu gering. Der Blutegel behauptete sich, der Tausendfüßler bummelte dahin, die Grille zirpte sich vorwärts. Vertreter des Sumpfs, des Gebirges, der Wüste – alle duckten sich und wanden sich und streunten durch den Schatten. Ich klassifizierte sie immer paarweise, und dass ich dies so ordentlich tun konnte, tröstete mich. Doch ihr Weg zog sich hin, die Flammen begannen zu verlöschen, und die Schattengestalten verzerrten sich. Buckel wuchsen auf ihren Rücken, ihre Gliedmaßen trieben auseinander, das Rückgrat löste sich auf. Sie verwandelten sich und wurden monströs. Sie erkannten einander nicht wieder.
Doch solange das Licht lebte, hielten sich auch die Schatten. Und das war doch schon etwas.
PERLE
2 ZUGANG, ODER: NEUE ZAHLEN
Stasia wusste es nicht, aber wir waren immer, ganz von Anfang an, mehr als nur wir. Ich war nur zehn Minuten älter, aber das reichte, um mir klarzumachen, wie unterschiedlich wir waren.
Erst in Mengeles Zoo wurden wir allzu verschieden.
Zum Beispiel: In dieser ersten Nacht fühlte sich Stasia von den marschierenden Schatten getröstet, ich hingegen konnte keinen Frieden finden. Die Streichhölzer beleuchteten noch einen anderen Anblick, der von rasselnden Geräuschen des Todes begleitet wurde. Hat Stasia das sterbende Mädchen erwähnt?
Wir waren in dieser Nacht nicht allein in unserer Schlafkoje. Es lag noch ein drittes Kind mit uns auf der Strohmatratze, ein fieberndes, ausgemergeltes Wesen mit schwarzer Zunge, das sich neben mir einrollte und seine Wange an mich drückte, während es starb. Das war keine Geste der Zuneigung; unsere Nähe rührte daher, dass kein Zentimeter Platz war in unseren Streichholzschachtelbetten, doch ertappte ich mich in der folgenden Zeit des Öfteren bei der Hoffnung, dass meine Nähe diesem zwillingslosen, namenlosen Mädchen ein Trost gewesen sei. Ich musste einfach glauben, dass es nicht nur die Enge gewesen war, die ihre Wange an meine eigene gelegt hatte.
Als das Rasseln verstummte, krochen die elfjährigen Stepanov-Zwillinge, Esfir und Nina, aus der Koje unter uns auf unsere Matratze und zogen das Mädchen aus. Dies taten sie mit verstörender Gewandtheit, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes getan, als Leichen zu entkleiden – Esfir schlang sich freudestrahlend einen Pullover um die Schultern, und Nina schlängelte sich in einen Wollrock. Die Missbilligung in meiner Miene war wohl unübersehbar, denn Esfir bot mir die Strümpfe des Mädchens an, als Friedensgeste hielt sie mir den ausgefransten, ergrauten Sockenfuß unter die Nase. Als ich das Geschenk zurückwies, wurde sie – ein alter Hase, oder auch alte Nummer, wie sie das hier nannten – wütend und beschimpfte mich mit dem Wort für uns neuen Nummern, oder Neulinge.
»Zugang!«, zischte sie.
Hätte mich die Tote neben mir nicht so aus der Fassung gebracht, hätte ich mich vielleicht verteidigt, aber in dem Moment war es mir egal. Die Stepanovs tauschten listige Blicke, dann zwinkerte Nina mir zu, wie zur Bestätigung des großen Gefallens, den sie mir jetzt gleich zu erweisen gedachte. Ohne ein Wort der Verständigung packten die beiden die Leiche des Mädchens am Kopf und an den Füßen und zerrten das Federgewicht von unserem Bett.
»Sie kann bleiben.« Ich streckte die Hand aus und legte sie auf die noch warme Brust.
»Sie ist tot«, widersprachen sie. »Siehst du das Rinnsal, das aus ihrem Mund kommt? Tot!«
»Na und? Trotzdem braucht sie einen Schlafplatz, oder?«
»Das ist gegen unser Gesetz, Zugang.«
»Was für ein Gesetz?«
Sie waren zu sehr damit beschäftigt, die Leiche über die Leiter nach unten zu befördern, um eine Antwort zu geben. Ihre Bewegungen waren in dasselbe schwache Licht getaucht, das die Schattentiere hervorbrachte. In diesem Moment wünschte ich mir vollkommene Dunkelheit. Ich sah nämlich, wie die Augen des Mädchens aufflogen, als ihr Körper über die Sprossen auf den Boden schrammte. In den Kojen drehten sich alle Kinder weg, um den Exodus nicht mitansehen zu müssen, aber ich sah, wie sich das Haar des Mädchens über der Schwelle auffächerte, als sie hinausgeschleppt wurde, und als sie außer Sichtweite verschwand, versuchte ich mich an ihre Augen zu erinnern.
Ich dachte, es seien braune Augen, so braun wie meine eigenen, aber unsere Bekanntschaft war so flüchtig gewesen, dass ich mir nicht sicher war.
Das Einzige, dessen ich mir sicher sein konnte, war der Eifer der Zwillinge. Als sie wieder in der Tür erschienen, klopften sie sich den Schmutz von den Händen. Nina ließ den Rock wirbeln, und Esfir zupfte Fusseln von dem gestohlenen Pullover. Ihre neuen Besitztümer hatten sie in Stimmung gebracht. Nina schlenderte herüber; sie hatte ein Bündel in der Hand, das sie Stasia zuwarf.
»Nimm die Strümpfe«, zischte sie meine Schwester an. »Führ dich nicht auf, als wärst du dir zu gut dafür.«
Stasia betrachtete die Strümpfe, die in ihrem Schoß gelandet waren, wo sie schlaff und verlassen dalagen. Ich riet ihr, sie zurückzugeben, aber Stasia war noch nie gut darin gewesen, auf den Rat anderer zu hören, nicht mal auf meinen. Sie fuhr mit beiden Händen hinein wie in Handschuhe, sehr zu Ninas Vergnügen.
»Sehr erfinderisch«, sagte Nina anerkennend, ehe sie mit ihrer Schwester wieder in die untere Koje kroch und die beiden in ihrem Stroh zu rascheln anfingen wie die Plünderer, die sie waren; bestimmt planten sie schon ihren nächsten Raubzug.
Man überlebte durch Planung. Das sah ich ein. Und ich begriff auch, dass Stasia und ich uns die Zuständigkeiten des Lebens teilen mussten. Das Teilen war uns ohnehin zweite Natur, und daher teilten wir jetzt, in der frühmorgendlichen Dunkelheit, die Notwendigkeiten zwischen uns auf:
Stasia sollte für das Lustige, die Zukunft, das Böse zuständig sein. Ich für das Traurige, das Gute, die Vergangenheit.
Es gab Überschneidungen zwischen diesen Kategorien, aber das war nichts Neues, damit kamen wir zurecht. Mir schien es eine faire Vereinbarung, doch als wir mit der Pflichtenverteilung fertig waren, hatte Stasia auf einmal Bedenken.
»Du hast den schlechteren Part«, sagte sie. »Ich tausche mit dir. Ich nehme die Vergangenheit und du die Zukunft. Die Zukunft ist doch wirklich hoffnungsvoller.«
»Ich finde es ganz gut, wie es ist«, sagte ich.
»Nimm die Zukunft. Ich habe doch schon das Lustige – du sollst die Zukunft haben. Das macht es gerechter.«
Ich dachte an die vielen Jahre, die wir versucht hatten, jede einzelne Geste aufeinander abzustimmen. Als wir klein gewesen waren, hatten wir geübt, jeden Tag gleich viele Schritte zu gehen, gleich viele Wörter zu sprechen, gleich zu lächeln. Ich begann mich in diese Erinnerungen zurückzuziehen, doch kaum hatte ich mich ein bisschen beruhigt, fachte Ochse unsere Furcht von neuem an. Kalt und tüchtig, eine düstere Gestalt in einem haferflockenfarbenen Mantel, durchquerte sie die Baracke der Länge nach, das tote, jetzt nur noch in Schlamm gekleidete Kind in den Armen. Wortlos trug sie es bis zu unserer Koje und legte es neben mir auf den Rücken, kreuzte seine kalten Hände über der eingefallenen Brust und die Beine an den Knöcheln. Konzentriert, die Zungenspitze zwischen den Zähnen, verrichtete sie diese Aufgabe, als arrangierte sie Blumen im Zimmer eines geschätzten Gastes.
»Wer war das?«, fragte Ochse, als sie fertig war und das tote Mädchen blicklos zu den Dachbalken hinaufstarrte.
Niemand antwortete, aber Ochse kümmerte sich ohnehin nicht um Antworten, sondern nutzte jede Gelegenheit zur Einschüchterung. »Ich rate euch, Kinder, sucht euch einen anderen Zeitvertreib als Leichen vor die Latrinen zu kippen. Ihr wisst alle, dass Dr. Mengele wünscht, dass jedes Kind hier am Morgen gezählt wird. Wenn diese Leiche noch mal verschwindet …«
Sie ließ den Satz unbeendet, und das Unausgesprochene erschreckte uns noch mehr; und als ihre Mission erfüllt war, drehte sie sich um und ging mit dramatischem beigefarbenem Flattern davon, aber nicht ohne noch einmal innezuhalten, um dem Mädchen, das die Schattengestalten machte, die Streichhölzer abzunehmen. Alles war wieder dunkel, aber nicht dunkel genug, um den Tod, der neben uns lag, zu verschleiern.
»Selbst jetzt sieht sie noch hungrig aus«, sagte Stasia. Sie strich mit einem bestrumpften Finger über die starre Wange des Mädchens. »Meinst du, sie fühlt noch was?«
»Kein Toter fühlt was«, sagte ich. Aber ich war selber nicht ganz überzeugt. Wenn es je einen Ort gegeben hat, an dem die Toten ihre Qualen womöglich noch spüren, dann musste es der Zoo sein.
Stasia zog sich die Strümpfe von den Händen und versuchte, sie den Füßen des Mädchens überzustreifen. Erst dem linken Fuß, dann dem rechten. Der eine reichte bis zur Mitte der Wade, während der andere ohne weiteres bis übers Knie ging. Dieser Unterschied ärgerte sie, und sie zog an der Wolle, um sie auf eine Höhe anzugleichen; ich musste sie darauf aufmerksam machen, dass ihr Unterfangen aussichtslos war, weil das Paar nicht zusammengehörte. Nichts war reparierbar; wir konnten nur mit Notbehelfen vorliebnehmen.
»Bitte«, flüsterte ich Stasia zu, als durch ihr Gezerre in dem einen Strumpf ein neues Loch entstand. »Lass mir die Vergangenheit, und ich kümmere mich sogar um die Gegenwart. Nur die Zukunft will ich nicht.«
So kam ich zu meiner Rolle als Wächterin der Zeit und der Erinnerung. Von da an war die Anerkennung der Tage allein meine Verantwortung.
3. SEPTEMBER 1944
In unserem früheren Leben hatte ich immer das Wort für uns geführt. Ich war die Kontaktfreudige gewesen, die mit den bewährten Methoden, uns aus der Klemme zu holen, und diejenige, die mit Gleichaltrigen ebenso verhandelte wie mit Autoritätspersonen. Die Rolle behagte mir. Ich war jedermanns Freundin und eine gute Sprecherin für uns beide.
Bald stellten wir fest, dass Stasia in unserer neuen Welt besser mit den Leuten umgehen konnte. Eine neue Furchtlosigkeit hatte Besitz von ihr ergriffen. Wenn sie lächelte, zeigte sie mit Strenge die Zähne, und ihr stolzierender Gang war die mädchenhafte Nachahmung eines Filmcowboys oder Comichelden.
An unserem ersten Morgen schnatterte sie ohne Ende, sie fragte alle aus, die sie zu fassen bekam. Ein Versuch, uns die Anpassung zu erleichtern. Der Erste, den ihre Neugier traf, war ein Mann, der sich uns als Zwillingsvater vorstellte. Er sah uns mit neugierigen Gesichtern auf diesen sonderbaren Namen reagieren, versuchte aber nichts zu erklären, sondern sagte nur, er werde von allen Kinder so genannt – wie wir bald feststellen würden, sei es im Zoo üblich, den Leuten neue Namen und Identitäten zu geben, und auch die Erwachsenen seien da keine Ausnahme.
»Wann sehen wir unsere Familien?«, fragte Stasia den Zwillingsvater, als er auf einer Kiste saß und alle Fakten über uns notierte, die Mengele brauchen konnte. Wir saßen mit ihm hinter der Knabenbaracke, und vor seinen Füßen lag ein sinnloser Globus im Schmutz. Dieser Globus, ein meist im Lagerhaus verwahrtes Relikt, wurde von uns allen sehr um seine Reisen beneidet, denn er konnte von einem Lager ins andere wandern, während wir wie festgenagelt im Zoo saßen. Einer der Jungen – ein Peter Abraham, den Mengele zum »Mitglied der Intelligenzija« geadelt hatte – diente dem Arzt als einer von mehreren Boten, und in dieser Position konnte er den kleinen Globus leicht stehlen, unter dem Kittel verstecken und von Block zu Block wanken, als sei er von einer seltsamen Schwangerschaft befallen. Peter stahl ihn am Morgen, und am Abend holte ihn einer der Bewacher wieder zurück. Auf diese Weise wechselte die Welt immer wieder den Besitzer, und mit der Zeit war sie durch ihre ständigen Reisen arg ramponiert. Löcher taten sich auf, Grenzen verwischten, ganze Länder verschwanden. Dennoch war es ein Globus, und alles in allem war es doch ein nützlicher Gegenstand, denn bei Befragungen wie diesen konnte man sich auf seine Oberfläche konzentrieren statt auf Zwillingsvaters Gesicht, obwohl ich glaube, dass beide gleich mitgenommen und entmutigt aussahen.
»Unsere Familien sehen wir an Feiertagen«, antwortete Zwillingsvater auf seine geduldige Art. »Sagt jedenfalls Mengele.«
Zwillingsvater war neunundzwanzig und hatte in der tschechoslowakischen Armee gedient. Er hatte noch immer ein soldatisches Gebaren, doch zugleich auch eine Müdigkeit an sich, die von seinen Pflichten wahrscheinlich nicht besser wurde. Beeindruckt von seiner militärischen Laufbahn und seinem flüssigen Deutsch, hatte Mengele ihn mit der Aufsicht über die Knabenbaracke und der schriftlichen Erfassung aller eingelieferten Zwillinge betraut, Unterlagen, die später ans Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin geschickt wurden, Abteilung für Genetik.
Wenn sich über Mengele ein Gutes sagen lässt, so war dieses eine wohl, dass er Zwillingsvater auf seinen Posten ernannt hatte. Die Jungen liebten ihn, sie hingen an seinen Lippen, wenn er ihnen Unterricht gab – vor allem in Deutsch und Geographie –, und er bolzte mit ihnen, bei den wenigen Gelegenheiten für ein kurzes Spiel, einen Lumpenball kreuz und quer über den Fußballplatz. Es gab Mütter von neugeborenen Mehrlingen, die im Zoo leben durften, um die Entwicklung ihrer Babys voranzubringen, und die schwärmten alle für Zwillingsvater und behaupteten, eines Tages werde er ein wunderbarer Familienvater sein. Er selbst aber zuckte bei solchen Lobesworten zusammen und machte einfach weiter auf seine sanfte und tatkräftige Art. Wir Mädchen, die unter Ochses Fuchtel standen, neideten den Jungen diesen Verbündeten. Von Ochse erfuhren wir nichts über den Ort, an dem wir waren. Von anderen Mädchen in den Baracken hörten wir, dass Mengeles Zoo früher unweit des Zigeunerlagers gewesen war. Doch nun waren die Zigeuner tot, vollzählig ausgelöscht am 2. August 1944; die Lager-SS, ungehalten darüber, wie sehr Krankheit und Hunger unter ihnen grassierten, hatte ihre Beseitigung als unumgänglich angesehen. Der Hunger war angeblich kein Problem der Nahrungsknappheit gewesen – die Erwachsenen enthielten den Kindern eindeutig Nahrung vor. Zigeuner sangen und tanzten lieber den ganzen Tag, als dass sie gegen ihren eigenen Schmutz ankämpften. So ein Volk konnte nur ausgelöscht werden.
Es ging das Gerücht, Mengele habe einzugreifen versucht. Ob das stimmte oder nicht, wusste niemand. Wir wussten nur, dass die Zigeuner vergast worden waren und wir, die Zwillinge von Auschwitz, blieben. Direkt vor unserer Unterkunft war ein leeres Stück Land, wo die Deutschen die Toten und Fast-Toten sammelten und das sich mit schrecklicher Regelmäßigkeit füllte und wieder leerte. Das war unser täglicher Anblick.
Wir sahen aber auch Birken in den Wäldern hinter dem vier Meter hohen elektrischen Zaun. Und wir sahen weibliche Gefangene auf dem Feld dahinter arbeiten; wenn die Mädchen ihre Mütter erkannten, konnten sie ihnen ihr Brot hinüberwerfen und hoffen, dass sie es nicht zurückwarfen, denn unsere Rationen waren größer als irgendwo sonst im Lager. Auch die Labore sahen wir, diese zweistöckigen Ziegelgebäude, in die wir dienstags und donnerstags und samstags gebracht wurden; doch ansonsten war unser Gesichtsfeld beschränkt. Wenn jemand Grund hatte, uns abzuholen und irgendwohin zu bringen, konnte es sein, dass wir mehr über Auschwitz erfuhren. Was wir jedoch nicht sahen, war Kanada: jene Reihe von Lagerhäusern, die so überquollen von den angehäuften Herrlichkeiten, dass die Häftlinge diesen Abschnitt des Lagers nach einem Land benannt hatten, das in ihren Augen für Reichtum und Luxus stand. In Kanadas Bauten türmten sich stapelweise unsere einstigen Habseligkeiten, unsere Brillen, unsere Mäntel, unsere Musikinstrumente, unsere Koffer, alles; selbst unsere Zähne, unser Haar, alles, was für das Menschsein als notwendig gelten konnte. Wir sahen nicht die Sauna, wo die Häftlinge sich ausziehen mussten, oder das weiß verputzte Bauernhäuschen, dessen Räume als Duschen bezeichnet wurden. Wir sahen nicht die Luxusunterkünfte der SS, wo Feste stattfanden, zu denen die Frauen aus dem Puff geholt wurden, damit sie tanzten und auf Nazischößen saßen. Wir sahen vieles nicht und dachten deshalb, wir wüssten bereits das Schlimmste. Wir konnten uns nicht vorstellen, wie grenzenlos das Leiden war, wie raffiniert und methodisch es sein, wie es Familien auseinanderreißen konnte, eine nach der andern, oder mit einem einzigen bestialischen Überfall einem ganzen Dorf das Antlitz des Todes zeigen konnte.
Am Tag nach unserer Ankunft machte sich Zwillingsvater tüchtig und stoisch an unsere Registrierung, aber es gab auch Momente, in denen seine Zweifel an die Oberfläche zu kommen schienen, wenn er die Tragweite jeder Antwort und ihre Folgen für unser Leben bedachte. Ich sah seine Hand unschlüssig zwischen dem einen und dem anderen Kästchen schweben, ehe er einen zögernden Haken setzte.
»Also«, sagte er. »Welche von euch ist älter?«
»Ist das wichtig?« Stasia hatte diese Frage noch nie leiden können.
»Für ihn ist alles wichtig. Meine Schwester Magda und ich wissen nicht, wer von uns zuerst auf die Welt kam. Aber wir sagten, dass ich es war, nur um ihn zufriedenzustellen. Also sag mir, Perle, wer kam zuerst?«
»Ich«, gab ich zu.
Während der Zwillingsvater und ich mit den Einzelheiten weitermachten, richtete Stasia ihre Fragen an Dr. Miri, die auf die ausgefüllten Formulare wartete, um sie ins Labor zu bringen. Dr. Miri war eine schöne Ärztin – wie eine Lilie, sagten die Leute gern, eine feierliche und nachdenkliche Blume. Mit ihrem dunklen Haar und den zu großen Augen, dem schiefen Mund erinnerte sie uns ein bisschen an Mama, aber sie war puppenhafter, und ihr Mienenspiel kam mir oft sehr sonderbar vor, weil es so fern war, so distanziert. Ein bisschen so, wie wenn man tief unter Wasser die Turbulenzen der Wellen an der Oberfläche beobachtet.
Noch bemerkenswerter als Dr. Miris Schönheit war der Umstand, dass Mengele sie unversehrt ließ. Die meisten Schönheiten, die in Mengeles Blickfeld gerieten, gingen sehr verändert daraus hervor, weil er es nicht ertragen konnte, sie zu bewundern. Schönheiten schickte er auf einen von zwei Wegen, entweder den Ibiweg oder den Orliweg. War man auf dem Orliweg, so war man womöglich am Tag der Ankunft schön gewesen, doch schon tags darauf wurde man verwandelt – Mengele ließ einem den Bauch aufquellen oder die Beine wurstförmig anschwellen, ließ die Haut wächsern werden und brachte sie mit schwärenden Stellen zum Zerfließen. War man auf dem Ibiweg, konnte man im Puff arbeiten, konnte sich, flatternd wie ein seltener bunter Vogel, aus dem Fenster lehnen und hören, wie die Puffmutter mit den anklopfenden Männern den Preis aushandelte. Dr. Miris Weg, der Weg einer von Mengele respektierten jüdischen Ärztin, war der allerseltenste von allen.
Orli und Ibi waren Dr. Miris Schwestern. Sie sah sie nicht oft. Wenn man Miri weinen sehen wollte, musste man nur Ibi und Orli erwähnen. Mengele tat es von Zeit zu Zeit, wenn er mit ihrer Arbeit im Labor nicht zufrieden war oder sie zwingen wollte, etwas zu tun, was sie ablehnte. In der folgenden Zeit sollte ich solche Wortwechsel häufig miterleben, doch an jenem ersten Tag stand nur Dr. Miri da und wartete auf unsere Akte.
»Wann gehen wir wieder weg von hier?«, fragte Stasia. Ein Zögern schwebte in der Luft.
»Dafür gibt es Pläne«, sagte Dr. Miri schließlich, nachdem sie mit Zwillingsvater einen Blick gewechselt hatte, einen von der Sorte, wie ihn sich Erwachsene zuwerfen, wenn die Sprache auf ein heikles Thema kommt, das sie schon viele Male angegangen sind, ohne es je abschließend klären zu können. »Wir haben mit den Plänen begonnen, aber wir wissen nicht …«
Die Antwort blieb ihr erspart, denn jetzt erschien eine Frau im Eingang der Baracke, die ihre zwei Kinder im Arm hielt, zwei Bündel aus grauem Stoff, die Gesichter verborgen.
Clothilde war eine von den Müttern, die im Zoo leben und als Kinderfrauen arbeiten durften. Jeder wusste, wer Clothilde war, weil ihr Mann einen SS-Mann getötet hatte – er hatte die Pistole eines Aufsehers an sich gerissen, einen tödlichen Schuss abgegeben und den kurz aufflackernden Gefangenenaufstand angeführt. Drei SS-Männer wurden niedergestreckt, bevor diese Belagerung zu Ende ging, und es wurde dafür Sorge getragen, dass jeder der Hinrichtung des Aufrührers am Strang beiwohnte. Doch anstatt Furcht zu nähren, wurde sein Tod zur Heldenlegende. Ihre Kinder hätten jetzt für immer dieses Vermächtnis, behauptete Clothilde gern, doch der väterliche Ruhm war den Babys anscheinend kein Trost. Sie wimmerten und traten mit den Füßchen in ihren schmuddeligen Wickeltüchern, als ob sie noch immer gegen das gewaltsame Ende ihres Familienoberhaupts protestierten.
Stasia trat auf Clothilde zu und versuchte, die Bündel zu inspizieren. Ich fürchtete, sie könnte fragen, ob sie die Babys halten dürfe – sie hielt sich oft für geschickter, als sie in Wirklichkeit war –, aber zum Glück ging ihr Interesse nicht über ihre Fragen hinaus.
»Was essen wir?«, fragte sie Clothilde, die Dr. Miri eines ihrer Babys reichte, damit sie es bewunderte. Ich sah, dass die Ärztin sich beim Anblick des Kindes versteifte, doch Clothilde schien von dieser Reaktion zum Glück nichts bemerkt zu haben, weil sie zu sehr damit beschäftigt war, Stasia im Tonfall pädagogischer Bitterkeit zu antworten.
»Suppe, die keine Suppe ist!«, verkündete sie schadenfroh.
»Von so einer Suppe habe ich noch nie gehört. Was ist da drin?«
»Heute? Gekochte Wurzeln. Morgen? Gekochte Wurzeln. Übermorgen? Gekochte Wurzeln und ein bisschen nichts. Klingt das gut?«
»Könnte besser klingen.« Stasia deutete mit einer Kopfbewegung auf die Babys. »Ihre Zwillinge können von Glück sagen, dass sie keine solche Suppe essen müssen.«
»Dann bete um was Besseres«, sagte Clothilde. »Und wenn deine Gebete nicht erhört werden, dann iss sie auf. Beten allein kann satt machen.« Die Babys erkannten, wie absurd das alles war, und ihr Wimmern steigerte sich zu einem markerschütternden Gebrüll.
»Wir beten nicht«, sagte Stasia mit erhobener Stimme, um das Geschrei zu übertönen.
Wir hatten im Winter 1939, am 12. November, zu beten aufgehört. Wie bei vielen, denen es so erging, war es ein Familienereignis gewesen, ausgelöst durch ein Verschwinden. Obwohl ich, um genau zu sein, sagen sollte, dass das Beten einen plötzlichen Aufschwung erlebte, eine Woche lang, dann zwei, und erst mit Einsetzen des Tauwetters vollständig abstarb. Und als die Glockenblumen im Garten ihre Köpfe durch die Erde stießen, war das Beten tot und begraben.
Ich hatte nicht vor, das alles Clothilde zu erklären, die uns bereits mit einem verächtlichen Stirnrunzeln musterte. Sie betrachtete die Köpfe ihrer Babys und bedeckte sie mit ihrem Schal, als wären sie damit vor unserem mangelnden Glauben geschützt.
»Darüber werdet ihr anders denken, wenn ihr erst mal hungrig genug seid«, murmelte sie, woraufhin sie und Zwillingsvater ein paar Worte auf Tschechisch wechselten, die wir nicht verstanden, doch war mein Eindruck von diesem scharfen Wortwechsel, dass sie sich gegenseitig sonst wohin wünschten. Als die Debatte lauter wurde, trat ein furchtsamer, hin- und hergerissener Ausdruck in Dr. Miris Gesicht – er erinnerte mich an die Miene eines Kindes, wenn es seine Eltern streiten sieht –, und sie trat zwischen die beiden Kontrahenten.
»Aber vielleicht«, sagte sie zu uns, und ihr Ton war einnehmend, obwohl sie schreien musste, um sich Gehör zu verschaffen, »vielleicht könntet ihr wünschen, statt zu beten. Das tut ihr doch, oder? Hier könnt ihr so viel wünschen, wie ihr wollt.«
Sie trat so ausgeglichen, so routiniert auf, dass ich dachte, Dr. Miris Arbeit im Zoo habe viel damit zu tun, Konflikte ähnlicher Art zu lösen. In diesem Fall hatte sie Erfolg. Clothilde gab ihre Kapitulation zu erkennen, indem sie auf den Boden spuckte, und Zwillingsvater lächelte ein bisschen darüber, wie abstrus der Lösungsvorschlag war, dann nahm er unsere Befragung wieder auf.
»Wo habt ihr gewohnt?«, wollte er wissen. »Weitere Geschwister? Eure Eltern – beide polnische Juden, ja? Eure Geburt – natürlich? Kaiserschnitt? Irgendwelche Komplikationen?«
Wir hörten die Feder über das Papier kratzen, während er unsere Auskünfte sortierte, und als wir fast fertig waren, marschierte ein Trupp Wärter vorbei. Staub wirbelte auf, die Hunde bellten, und Zwillingsvater warf seinen Stift mit einer Heftigkeit auf den Boden, die uns zusammenzucken ließ. Das Heulen der Babys wurde lauter. Der Mann nahm seinen Kopf in beide Hände, und wir dachten, er schläft womöglich für immer ein; wir dachten, dass er in diesem Moment beschlossen hatte, nicht mehr zu leben, einfach so. Wir hatten gehört, dass hier so etwas häufiger vorkam. Doch nachdem wir eine Zeitlang seinen vorzeitig ergrauten Kopf von oben betrachtet hatten, blickte er wieder zu uns auf und war noch sehr lebendig.
»Verzeiht«, sagte er mit einem matten Lächeln. »Mir ist die Tinte ausgegangen, das ist alles. Mir geht ständig die Tinte aus. Mir ist ständig –«, eine Sekunde lang sah es so aus, als sackte er gleich wieder in sich zusammen, doch ebenso plötzlich wie zuvor richtete er sich wieder auf, lächelte uns breit an und schickte uns mit einer Geste fort. »Geht jetzt, zum Appell.«
Gehorsam wollten wir uns von ihm abwenden, doch er rief uns noch einmal zurück. Er blickte uns eindringlich in die Augen. Es war klar, dass er das, was jetzt kam, sehr oft sagte, zu jedem Kind, das ihm zuhörte.
»Eure erste Hausaufgabe ist es, die Namen der anderen Kinder zu lernen. Sagt sie einander vor. Wenn ein neues Kind kommt, lernt auch diesen Namen. Wenn ein Kind uns verlässt, müsst ihr euch den Namen merken.«
Ich schwor, daran zu denken. Stasia schwor ebenfalls. Und dann fragte sie ihn nach seinem echten Namen.
Zwillingsvater starrte eine, vielleicht zwei Minuten lang auf seine Papiere. Er schien in die Antworten vertieft, die er so sorgfältig niedergeschrieben hatte, als hätten all die Häkchen und Kästchen, die er in Schwarz ausgefüllt hatte, auch ihn verfinstert, und gerade, als wir aufgeben und ohne Antwort gehen wollten, blickte er zu uns auf.
»Ich war mal Zwi Singer«, sagte er. »Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr.«
__________
In diesem frühmorgendlichen Licht waren wir zum Appell angetreten, und unsere Nasen zuckten vor Anstrengung, den Gestank nach Asche und Ungewaschenheit zu verdrängen. In der Luft hing die Septemberhitze, die in Wellen von uns zurückprallte und uns in eine Gloriole aus Staub einhüllte. Bei diesem Appell sah ich zum ersten Mal alle Versuchspersonen Mengeles an einem Ort versammelt: die Mehrlinge, die Riesen, die Liliputaner, die Arm- und Beinlosen, die Juden, die er ihrem Erscheinungsbild nach kurioserweise für arisch hielt. Manche betrachteten uns arglos, andere starrten uns misstrauisch an, und mir kam der Gedanke, wie lange wir wohl als Zugänge betrachtet würden. Wir bemühten uns, die Blicke zu ignorieren, während wir unsere harten Brotkanten zerbissen und unseren trüben Kaffeeersatz tranken. Ich überließ Stasia den größten Teil meiner Brotration, doch den falschen Kaffee leerte ich vollständig; sauer schmeckte er – wie in einem alten Schuh auf dem Grund des Flusses gebrüht, befand meine Schwester. Als Stasia ihn kostete, nahm ihre Kehle es übel, und sie musste ihn weit ausspucken. Leider waren dort die Rabinowitzens versammelt, sie standen für ihr Frühstück an, und Stasias Spucke beleidigte den ältesten Sohn der Familie, weil sie direkt auf dem Revers seines Jacketts landete.
Die Rabinowitzens waren Liliputaner. Sie waren eine komplette Familie mitsamt einem stockschwingenden Patriarchen, und sie gingen alle noch immer in Samt und Seide, ihren Bühnenkostümen: farbenfrohe Gewänder mit Spitze und goldenen Litzen und baumelnden Quasten. Die Frauen trugen ihr Haar hochgetürmt, und die wallenden Bärte der Männer wehten wie Fahnen bei einer Parade: ein pompöser Anblick. Auch wenn ich die allgemeine Stimmung nicht teilte, erkannte ich doch, warum sie schlecht angesehen waren. Der eine Grund: Wo sonst fand man in Auschwitz eine intakte Familie? Und der andere war, dass sie zu den größten Nutznießern von Mengeles Aufmerksamkeit zählten. Er war fasziniert von dieser Familie, und das hatte dazu geführt, dass sie sich als etwas Besseres fühlten, zumal sie dadurch einen eigenen, recht weitläufigen Raum im Krankenbau bekommen hatten. Noch dazu quoll ihr Quartier über von allen möglichen Annehmlichkeiten wie Tischdecken aus Spitze und rosa Rüschengardinen vor dem Fenster. Es gab ein Teeservice mit Weidenmuster. Einen Miniatursessel aus feinem Leder, groß genug für ein Lamm. Mengele hatte ihnen sogar ein Radio spendiert, das dem ältesten Sohn anvertraut war, dem halbwüchsigen Mirko. Der sang immer mit, selbst wenn die Musik keinen Text hatte – dann erfand er eben einen, damit er etwas zu singen hatte. Er war es, den Stasias Spucke zu unserem Unglück getroffen hatte.
»Pass bloß auf, wen du hier anspuckst, Zugang«, stieß Mirko zwischen den Zähnen hervor.
Ich bat ihn um Entschuldigung und versuchte, ihm die Jacke abzuwischen, doch er wich zurück, wie erst recht gekränkt durch meine Bemühungen, und widmete sich dem Stoff mit einem Schlag seiner Hutkrempe. Stasia starrte ihn unterdessen unverwandt an, ihre Augen wurden größer, als ich es unseren Augen je zugetraut hätte, sie wuchsen, wie um gleichsam mehr Raum für die Begutachtung dieser Kuriosität zu schaffen, und ihre Einschätzung war so deutlich, dass sie ans Ungezogene grenzte.
»Habt wohl noch nie solche wie mich gesehen?«, fauchte Mirko.