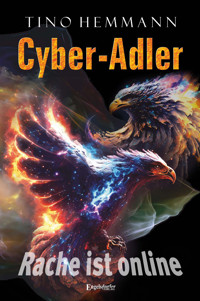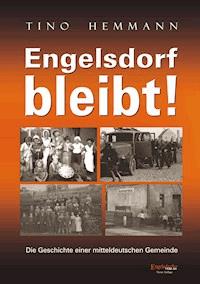Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Engelsdorfer VerlagHörbuch-Herausgeber: Thono Audio Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Maximilian erwacht im heimischen Bett. Es herrschen Dunkelheit, Geräuschlosigkeit und einsame Leere. Hier und da tauchen in Blitzesschnelle sterbende Menschen auf. Der Neunjährige durchkämmt die tote Stadt und gerät in ein skurriles Einkaufszentrum, das ihm einst vertraut war. Dort begegnet er dem Studenten Franko, der sich selbst Iwa nennt. Mit seiner Hilfe kehrt zunächst nur bruchstückhaft die Erinnerung in Maximilians Gehirn zurück, bis das schreckliche Puzzle ein Bild ergibt. Es ist der zweite Sonntag nach Ostern: Misericordias Domini – eine für Maxi nicht enden wollende Horrornacht. »Der Autor entwickelt die Handlung in einem spannenden Geflecht von Drama, Krimi und Fiktion und führt sie zu einer unvorhersehbaren Apokalypse.« (ZeitPunkt Kulturmagazin) Zweite überarbeitete Auflage des Buches »Leipziger Nächte sind lang« .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tino Hemmann
Misericordias Domini
2. überarbeitete Auflage des Buches
„Leipziger Nächte sind lang“
Bibliografische Information durch
die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
2. überarbeitete Auflage des Buches
„Leipziger Nächte sind lang“
Titelbild © sellingpix - Fotolia.com
Foto Buchrückseite © Jean-Luc GADREAU – Fotolia.com
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Inhalt
Wer sagt, es gibt nur sieben Wunder auf der Welt, hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles,
hat nie ein Kind lächeln gesehen. Wer sagt, diese Welt ist nicht mehr zu retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten.
(Honoré de Balzac)
Misericordias Domini plena est terra.
(Psalm 33, 5)
Der Güte des Herrn voll ist die Erde.
1
Eine abnorme Stille herrscht. Realitätsfern wie das Tauchen in den unerreichbaren Tiefen des Meeres. Eine Illusion? Wenigstens der Druck auf den Trommelfellen sollte doch ein Rauschen erzeugen.
Von einem Kind gezeichnete Gestalten schwirren über die Zimmerdecke, kämpfen miteinander und umarmen sich. Säbel treffen aufeinander, Funken bersten. Ein Klirren jedoch ist nicht zu hören.
Für einen Moment zuckt ein Lichtblitz höchster Elektrizität blendend durch den Traum, verbrennt die Lider zu schwingenden Aschefetzen. Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Das Piepen eines Überwachungsautomaten zerfetzt die Ruhe. Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Das sehnsüchtig erwartete Rauschen des Atems bleibt aus. Noch einmal: Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Weiße Laken flattern im Sturm, fangen blutige Flecken ein. Lang, lang, kurz, kurz, kurz. Lang, durchgehend lang. Der Piepton verliert sich in der Unendlichkeit. Die kindgemalten Gestalten an der Zimmerdecke verharren. Und sie verneigen sich vor ihrem Gebieter.
Die abnorme Stille kehrt mit brachialer Gewalt zurück.
Selbst der Atem des Jungen ist nicht zu hören.
Er liegt auf dem Rücken, Beine und Arme von sich gestreckt, die Bettdecke im Genick zusammengeknüllt. Er trägt nur diese dünne karierte Pyjamahose, so dass die Rippen im schmächtigen und bebenden Oberkörper zu sehen sind.
Dieser Junge erhielt Sekunden nach der Geburt den Namen Maximilian. Und da der Vater mit Nachnamen Kramer hieß, heißt nun auch der Sohn Kramer.
Bis zum siebten Lebensjahr wurde er Maxi gerufen. Von da an aber hat er sich geweigert, auf die Verniedlichungsform des Namens zu reagieren. Seine Haare sind kurz geschnitten und dunkel. Über den geschlossenen Augen liegen lange schwarze Wimpern. Die Haut des Jungen ist hell und blass, die Füße wirken schmutzig.
Noch schläft er friedlich, obgleich seine Augenlider bereits zu zucken beginnen.
Auf einem kleinen, purpurrot lackierten Beistelltisch am Kopfende des Bettes stehen ein Quarzwecker, dessen Zeitanzeige sich nicht ändert, eine Nachttischlampe mit einem Mickymaus-Schirm und daneben ein leerer Trinkbecher. Das Bettzeug ist mit Logos der Bundesligavereine bedruckt.
Im Zimmer ist es dunkel.
Es ist der zweite Sonntag nach Ostern.
Misericordias Domini.
Ein ohrenbetäubendes Kreischen lässt das Kind erwachen. Maximilian fährt brüllend hoch, setzt sich auf die Bettkante und lauscht der eigenen Stimme nach. Mit den Füßen sucht der die Hausschuhe, dann räkelt er sich, zieht die Schlafanzughose höher und kratzt sich den Kopf. Seine Hand tastet nach dem kleinen Knopf der Nachttischlampe, der Daumen drückt ihn, doch die Lampe leuchtet nicht.
›Warum geht die Lampe nicht? Und warum habe ich geschrien?‹, fragt sich Maximilian verwundert.
Stur und in sich gekehrt schaut er in die Dunkelheit. Allmählich erwacht das Gehirn. Maximilian sucht. Jedoch ist da kein Traum, an den er sich erinnert. Mit einer Hand hält der Junge die rutschende Schlafanzughose am Saum fest, schleicht durch das Zimmer, tritt auf ein Matchbox-Auto und sucht mit einer Hand die Wand ab, bis er den Lichtschalter findet. Es bleibt dunkel. Mehrmals betätigt er den Schalter.
»Mami?«, flüstert er. Maximilian sucht den Türrahmen, öffnet die Tür ein wenig und steckt den Kopf aus dem Kinderzimmer. »Hallo Mami«, flüstert er.
Im Haus ist es ruhig, zu ruhig. Eine gespenstische Stille. Nicht der kleinste Lichtschein ist zu sehen, denn auch der Flur liegt im Dunkeln. Das Kind schleicht an der Wand entlang, bis sein Knie die Kommode berührt, an der es sich festhält, um zur anderen Seite des Flurs zu wechseln. Dort ist wieder ein Lichtschalter, den der Junge immer gut gesehen hat, weil eine kleine Diode rot leuchtete. Heute aber leuchtet sie nicht. Maximilian drückt auch diesen Schalter. Wieder und wieder. Es bleibt dunkel.
Er zieht zum wiederholten Male die Schlafanzughose hoch und geht vorsichtig weiter.
Mit dem rechten Bein ertastet er die erste Stufe der Treppe, hält sich am Geländer fest und steigt vorsichtig hinunter. Auf der zweiten Stufe liegen Bücher. Der Junge tritt versehentlich auf das oberste Buch, rutscht ab, verliert den Halt und stürzt.
Benommen findet Maximilian sich auf dem kalten Parkett wieder, das wegen der Fußbodenheizung im Wohnzimmer warm sein müsste. Er setzt sich auf und sieht sich um. Das Fenster zum Garten ist sonst immer beleuchtet. Jetzt aber nicht. Das Geräusch der Aquariumpumpe ist sonst immer zu hören. Warum heute nicht? Alles in diesem Zimmer ist dunkel.
Der Junge kriecht auf allen vieren vorwärts und zieht sich an dem Schränkchen hoch, auf dem das Aquarium steht. Im untersten Fach des Schränkchens liegen Mamis Zigaretten, direkt daneben finden Maximilians Finger das Feuerzeug. Der Junge dreht einige Male an dem Rädchen, das an dem Feuerstein reibt. Doch es entstehen keine Funken, keine Flamme taucht die Umgebung in das erwartete schwache Licht.
Allmählich gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit. Ungläubig betrachtet Maximilian das Aquarium. Er sieht keinen Fisch, obwohl am Vorabend beim Füttern noch alle siebzehn Rotkopfsalmler munter im Wasser geschwommen sind.
Wieder rutscht die Schlafanzughose. Er geht an der Couchgarnitur vorbei und betritt die amerikanische Küche. Das Summen des Kühlschrankes ist verstummt. Der Junge zieht am Griff, bis der Gummi nachgibt und die Kühlschranktür sich lautlos öffnet. Das Licht im Kühlschrank geht nicht an, und obwohl er nichts sehen kann, fühlt Maximilians Hand, dass der Kühlschrank leer ist.
»Bestimmt haben wir einen Stromausfall«, flüstert er und wirft einen Blick aus dem Fenster. Auch draußen liegt alles in tiefer Dunkelheit, doch die Augen gewöhnen sich allmählich daran. »Bestimmt haben wir einen großen Stromausfall«, wiederholt er.
Erneut erinnert er sich an den eigenen Schrei.
»Warum habe ich geschrien?«, flüstert Maximilian und ruft laut: »Mami? Mami!« – Keine Antwort.
Die Beine des Jungen sind weich. Er verlässt die Küche und blickt sich dabei nervös um. Sein Atem wird hektischer. Die Tür zum Schlafzimmer der Mutter ist angelehnt. Maximilian schiebt die Finger in den Spalt und öffnet die Tür vorsichtig.
»Mami?«, flüstert er. »Schläfst du, Mami?«
Das Schlafzimmer ist dunkel und leer.
*
Maximilian schluckte. Die Zunge klebte am Gaumen, der Mund war wie ausgetrocknet. Durst hatte ihn geweckt. Zunächst glitten seine Beine aus dem Bett. Er griff zur Tasse, aber es war kein Tee mehr darin. Die Hand tastete nach dem Schalter der Nachttischlampe, sein Daumen drückte ihn und der Mickymaus-Schirm leuchtete. Der Junge rieb sich mit einer Hand die geblendeten Augen, suchte mit den Füßen die Hausschuhe, schlüpfte hinein und erhob und streckte sich.
Maximilian griff zur leeren Tasse, schlich aus dem Zimmer und die Treppe hinunter zur Küche. Dort goss er Tee aus der großen Kanne in die Tasse und schlürfte sie gierig leer. Anschließend schlich er zurück. Im Wohnzimmer, vor der ersten Stufe der Treppe, blieb er stehen und lauschte einige Sekunden.
Jemand stöhnte. Das Stöhnen kam aus dem Schlafzimmer der Mutter. Der Junge ging zur Schlafzimmertür, drückte die Klinke bedächtig nach unten und blickte erstaunt in den Raum.
»Was macht ihr da?«, flüsterte er müde.
Conrad lag nackt auf Maximilians Mutter, die unter ihm stöhnte.
Die Anwesenheit des Kindes sorgte sogleich für Unruhe. Conrad kroch eilig unter seine Bettdecke und drehte sich zum Fenster.
Maximilian ging zum Bett der Mutter, legte sich neben sie und kuschelte sich an sie heran. Die Mutter zog die Decke über sich und den Jungen und streichelte seine Wangen.
»Schaust du schon lange zu, Maxi?«, fragte sie.
Der Junge schüttelte leicht den Kopf. »Noch nicht so lange, Mami.«
»Das ist doch zum Kotzen!«, hörte Maximilian Conrads Stimme. »Es kotzt mich an! Nie hat man seine Ruhe! Nicht mal in Ruhe ficken kann man!« Laut und deutlich: ficken. Den Sinn des schlechten Wortes glaubte Maximilian zu kennen.
An den Körper der Mutter gekuschelt schlief der Achtjährige schon bald ein.
Am darauffolgenden Morgen – die Mutter hatte bereits das Haus verlassen – wurde Maximilian von Conrad beim Schnüren der Schuhe angerempelt. Der Junge stieß mit dem Gesicht gegen eine Kante der Flurkommode. Seine Lippe platzte auf, die Wange wurde dick, rot und später blau. Auf dem Schulweg weinte er bitterlich.
Während des Unterrichts an jenem Morgen beobachtete die Lehrerin Maximilian argwöhnisch, bis sie endlich fragte: »Was ist denn mit deinem Gesicht passiert?«
Sie stellte die Frage vor der ganzen Klasse! Dass sie ihn nicht zur Seite nahm und stattdessen vor den Mitschülern ausfragte, passte dem Jungen nicht. Er antwortete laut und in einem aggressiven Ton: »Ich habe meine Mami und ihren neuen Freund beim Ficken gestört. Die blauen Flecken sind die Rache von Conrad, dem Freund meiner Mutter.«
Es folgte ein Gespräch zwischen Lehrerin und Mutter, dessen Inhalt Maximilian nie erfahren sollte. Als Folge des Gespräches gab es am Abend eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Conrad und der Mutter. Das Schlafzimmer blieb von nun an in manchen Nächten verschlossen.
*
Die Augen gewöhnen sich mehr und mehr an die Dunkelheit. Maximilian geht zum Bett der Mutter und sucht mit der Hand unter der Decke. Ihr Bett ist kalt und leer.
Er tritt ans Fenster und zieht den Vorhang zur Seite. In anderen Nächten erhellt ein sanfter Lichtschein das Schlafzimmer. Heute aber bleibt alles dunkel.
Die Schlafanzughose rutscht erneut.
»Mami?«, flüstert er fragend, sich dessen wohl bewusst, dass die Mutter nicht anwesend ist. Das Bettzeug liegt akkurat auf der Matratze. Auch Conrads Bett scheint unberührt.
Der Radiowecker zeigt keine Zeit an.
Prophylaktisch betätigt Maximilian den Lichtschalter, dann den Schalter der kleinen Nachttischlampe neben dem Bett der Mutter. – Kein Licht.
Sinnierend bleibt der Junge stehen, hebt die Hände an seine Ohren und drückt die Handflächen darauf. Er blinzelt mit den Augen. Kein Rauschen ist zu hören, nicht der leiseste Ton.
Maximilian verlässt das Schlafzimmer und kehrt ins Wohnzimmer zurück.
Dort nimmt der Junge all seine Kraft zusammen und schreit mit weit geöffnetem Mund: »Mami! Wo bist du?«
Er lauscht in die Dunkelheit. Vergeblich wartet er auf eine Antwort. Er beißt sich auf die Lippen und rennt los. Er reißt jede Tür auf und schreit: »Mami!« Dann steigt er die Treppe hinauf, versucht zwei Stufen mit einem Schritt zu nehmen. Das Badezimmer! – Er zerrt auch diese Tür fieberhaft auf. – Nichts!
Hektisch atmend beugt sich Maximilian vor, stützt sich auf den Knien ab und schüttelt den Kopf.
›Sie ist mit Conrad ausgegangen. Bestimmt.‹
Im selben Moment erinnert er sich an die Zigarettenschachtel im Wohnzimmer. Ihre Zigaretten würde Mami niemals zu Hause vergessen.
Noch einmal hastet er die Treppe hinunter, verliert dabei fast die Schlafanzughose. Er läuft zur Haustür und betätigt den Lichtschalter im Eingangsbereich des Hauses. Es bleibt dunkel.
Sie hätte es ihm gesagt! Sie sagt es ihm immer, wenn sie in der Nacht fortgeht. Immer!
Maximilian schaut vorsichtig um die Ecke. Im Carport stehen zwei Autos. Das kleine weiße von Mami und das rote von Conrad.
Er hüpft zur Straße und hält dabei die Hose fest. Er betrachtet lange die Fahrbahnen, schaut erst nach links, dann nach rechts. Kein Mensch ist zu sehen. Kein Auto fährt. Die Ampeln an der Kreuzung sind ausgeschaltet.
Er blickt nach oben. Auch die Straßenlampen sind dunkel.
Maximilian spürt keine Kälte, die ihn zittern ließe. Er macht kehrt und läuft zurück ins Haus.
Sein Blick streift über den großen Schlüsselhalter an der Flurwand, an dessen Häkchen die Schlüsselbunde hängen. Mit den Fingern berührt er das Schlüsselbund der Mutter.
Die Haustür fällt währenddessen geräuschlos ins Schloss.
Dunkelheit.
»Die Taschenlampe!« Der Junge reißt das untere Fach des Schuhschrankes auf und fühlt hinein. Kurz darauf hält er eine Stabtaschenlampe in der Hand, betätigt erwartungsvoll den kleinen Schalter, aber auch die Taschenlampe bleibt dunkel.
»So ein Mist«, sagt er wütend. »Die Batterien sind schon wieder alle!«
Unschlüssig steht Maximilian vor der Kellertür. Er weiß, sie ist verschlossen. Doch heute steckt der Schlüssel im Zylinder. Oft hat er den Auftrag von Conrad erhalten, eine Flasche Bier aus dem Keller zu holen.
Der Junge drückt zögernd die Klinke nach unten. Kurz darauf ist die Tür geöffnet. Er hält sich an den Wänden fest, während er Stufe für Stufe mit den Füßen ertastet und hinuntersteigt. Die Treppe ist gefährlich glatt.
Im Keller kommt es ihm noch dunkler vor als oben. Maximilian zittert, atmet hastig. Das Licht lässt sich auch hier nicht einschalten.
»Mami?«, fragt er erneut. »Hast du dich hier versteckt?«
Die Therme der Gasheizung ist still. Maximilian kennt ihr Summen und Zischen, denn er hilft seiner Mutter mitunter bei der Wäsche.
Er schlürft zum Waschraum, in dem die Waschmaschine und der Wäschetrockner stehen. In diesem Raum gibt es kein Fenster. Hinter Maximilian schließt sich die Tür geräuschlos und ohne sein Zutun.
Der Junge läuft durch den gefliesten Raum. Völlige Stille herrscht auch hier unten. Bis ...
... ein gellender Schrei die Ruhe zerreißt. Gleißendes Licht lässt für wenige Momente Schatten zappeln. Maximilian springt erschreckt zur Seite, er ahnt, dass von oben etwas herabstürzen wird. Voller Entsetzen sieht er, dass der Körper eines Mannes mit dumpfem Schlag auf den Boden prallt. Er fällt aus dem Nichts, trägt eine blaue Arbeitskombination und schreit. Für einen Moment erkennt Maximilian, dass die Fliesen verschwunden sind, der Mann liegt vor ihm auf dem bloßen Beton und ringt nach Atem. Aus Mund und Nase läuft ihm Blut. Er krümmt sich und streckt die Arme nach dem Jungen aus.
»Hilf mir ...«, röchelt seine Stimme, heiser und kaum hörbar. Dann starren seine leeren Augen Maximilian wenige Sekunden lang an.
»Was ist?«, will der Junge fragen. Er greift nach der Hand des Mannes, dessen Finger verkrampft einen Zollstock umklammern.
Maximilian tappt ins Leere, er fühlt die glatten Fliesen und die Dunkelheit. Der Mann ist verschwunden. Ebenso der Schrei und das Licht.
Nervös atmet der Junge ein und aus. Er steht eilig auf, läuft zur Tür, durch den Keller, die Treppe hinauf, durch den Flur und das Wohnzimmer, dann weiter hinauf in sein Kinderzimmer, schaut sich noch einmal um.
Die Decke liegt ordentlich zusammengelegt vor dem Kissen. Zwischen den beiden Kissenecken sitzt Carlo, Maximilians Teddybär, gerade so, als sei der Junge nicht vor wenigen Minuten in ebendiesem Bett erwacht.
Vorsichtig nimmt er den Kuschelbären zur Hand, legt sich auf den Rücken und hält ihn über sich.
»Was ist das?«, flüstert er, als erwarte Maximilian tatsächlich, das Stofftier würde ihm erklären, warum sich alles verändert hat.
Der Teddybär brummt nicht einmal, als der Junge ihn neben sich bettet.
Maximilian weint und zittert. Hin und wieder ist ein »Mami, wo bist du?« zu hören. Einschlafen kann er nicht. – Was nur ist aus seiner Welt geworden?
Die letzten Gedanken lassen Erinnerungen entstehen. Er sieht die Lehrerin vor sich ...
*
Frau Plaschke ging mit herbem Blick durch die Reihen ihrer Schulklasse. Sie teilte die Deutscharbeiten aus.
Maximilians Blicke folgten ihr argwöhnisch.
»Henrietta«, lobte die Lehrerin das lächelnde Mädchen, das neben ihm in der Bank saß. Er hatte nie neben diesem Mädchen sitzen wollen! Doch Frau Plaschke hatte ihn eines Tages von Leon weg und ausgerechnet neben diese Henrietta gesetzt. »Das hast du sehr schön geschrieben. Für deine Arbeit erhältst du zwei Einsen. Eine für den Inhalt und eine für die Schönschrift.« Sie fuhr dem Mädchen sanft durch die Haare. »Henrietta hat sich einen Ausflug mit ihren Barbies in den Zoo ausgedacht«, erklärte die Lehrerin mit einem Blick in die Klasse.
Einige Jungen zeigten Henrietta einen Vogel, das Mädchen streckte ihnen dafür die Zunge entgegen.
Maximilian hielt eine zitternde Hand mit der anderen fest. Frau Plaschke stand nun genau vor ihm. Ihre Blicke wollten ihn förmlich durchbohren. Sie ließ das Blatt Papier fallen, das gemächlich auf den Tisch schwebte und vor Maximilian liegen blieb. Der Junge sah die Sechs rot leuchten.
»Maximilian Kramer. – Das soll einer verstehen ...«, raunte die Lehrerin. »Form vier, Inhalt sechs.«
Maximilians Gesicht färbte sich rot. Ungläubig hielt er das Blatt in den Händen und betrachtete die Noten. Tränen traten ihm in die Augen.
Frau Plaschke stand bereits vor der nächsten Bank.
Er drehte sich zu ihr und flüsterte: »Warum?«
Die Lehrerin wandte sich zu ihm. »Was hast du gesagt, Maximilian?« Ihre ohnehin großen Augen wirkten durch die Brillengläser wesentlich größer.
»Warum eine Sechs?«, wollte Maximilian wissen. Tränen liefen ihm über die Wangen. »Das ist unfair! Das ist gemein!« Seine Stimme klang laut und fordernd.
»Unfair? – Hör bitte auf!«, sagte die Lehrerin künstlich lächelnd. »Gemein? – Das Thema war: ›Meine schöne Welt‹. Du hast das Thema völlig verfehlt, Maximilian.«
Der Junge hielt den Zettel noch immer in den Händen. »Das ist aber meine schöne Welt! Sie haben das nicht kapiert! Für dämliche Barbie-Puppen-Geschichten gibt’s eine Eins, dabei sind Barbie-Puppen kein bisschen unsere Welt!« Maximilian knüllte die Arbeit zusammen, warf sie von sich und ließ sein Gesicht auf die Arme sinken. Er schluchzte.
Die Lehrerin zog Maximilians Hausaufgabenheft unter der Federmappe hervor. »Über dieses Verhalten werde ich mit deinen Eltern reden müssen!« Dann gab sie die restlichen Arbeiten aus. Erst später schrieb sie den Eintrag ins Hausaufgabenheft.
Maximilians Knie waren weich. Mami hatte Spätdienst. Sein Heimweg dehnte sich.
Zu Hause empfing Conrad den Jungen. »Hast du Hausaufgaben auf?«
Maximilian nickte.
»Dann mach sie gefälligst. Und sei ja still dabei!«
Im Kinderzimmer warf der Junge den Ranzen in die Ecke, setzte sich auf das Bett und schaute aus dem Fenster. Er träumte.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Conrad stand mit zornigem Gesicht im Zimmer. Maximilian sah den Stiefvater misstrauisch an. Bevor er aber einen Arm schützend vor den Kopf halten konnte, schlug Conrad bereits zu.
»Bist du bekloppt?«, schrie er dabei. »Wie kannst du nur! Deine Mutter muss deinetwegen in die Schule kommen.« Und wieder schlug er kräftig zu.
Erneut weinte Maximilian. Er sagte aber nichts.
»Stubenarrest!«, brüllte Conrad. »Bis auf Weiteres! Kein Fernsehen, kein Computer!«
Die Tür fiel krachend ins Schloss.
Der Junge warf sich auf das Bett. Nur ein Schluchzen war zu hören. Bis er geschwächt einschlief.
Jemand rüttelte sanft an seiner Schulter. »Maxi! – Maxi, wach auf!«
Maximilian schlug die Augen auf. Draußen war es dunkel, im Zimmer brannte Licht. Er kniete sich auf das Bett und umarmte seine Mutter.
»Was war denn wieder los, Maxi?«
»Frau Plaschke war gemein zu mir«, flüsterte er. »Und Conrad auch.«
Die Mutter drückte den Jungen an sich und streichelte ihm den Kopf. »Zeigst du mir die Arbeit, Maxi?«
Er löste sich von der Mutter, ging zum Ranzen und zog das Hausaufgabenheft heraus. Zwischen den Seiten klemmte die zerknitterte Arbeit. Maximilian wies auf den Eintrag.
»Liest du mir deinen Aufsatz vor, Maxi? – Bitte.«
»Soll ich wirklich?«
»Ja. Bitte.«
Der Junge nickte, setzte sich neben die Mutter. Noch einmal schluchzte er und begann: »Meine schöne Welt. – Die Welt ist nicht sehr schön. In der Zeitung war ein Bild mit toten Kindern. Sie wurden erschossen in Palästina. Im Fernsehen war ein Film über den Krieg. Und ein Film über ein Erdbeben. Alles war kaputt. Alle waren tot. Mein Papi ist nicht mehr da. Ich denke, für die Großen ist es einfacher, die ganze Welt kaputt zu machen, als die kaputte Welt wieder ganz. Für die Großen ist es auch einfacher, wenn alle weinen, und nicht, dass alle lachen. Überall auf der Welt. Das finde ich sehr traurig.« – Maximilian sah die Mutter abwartend an.
Die drückte den Jungen an sich und streichelte ihn. »Bin ich auch eine von den Großen?«, flüsterte sie.
Maximilian schüttelte den Kopf. »Nein, du bist doch meine Mami.«
»Ich komme morgen früh mit in die Schule und kläre das mit Frau Plaschke. – Okay?«
»Okay, Mami.«
»Machst du noch die Berichtigung?«
Der Junge nickte.
»Was magst du in deiner Welt?«, fragte die Mutter plötzlich. »Gibt es was, das dir gefällt, Maxi?«
»Wenn du bei mir bist, Mami. Oder wenn ich bei meinem richtigen Papi bin. Das mag ich. Und Leon mag ich, weil er mein Freund ist.«
»Mach die Berichtigung und dann komm abendessen.« Sie strich Maximilian sanft über die rechte Wange.
»Ist Conrad da?«, fragte der.
»Ja, Maxi.«
»Dann ... Bringst du mir was zu essen? – Ich will nicht runterkommen.«
Die Mutter stoppte kurz. »Hat er dich wieder gehauen? – Ich werd noch wahnsinnig! – Okay, Maxi, ich bringe dir was. Es tut mir leid«, flüsterte sie und fuhr ihrem Sohn erneut durch die Haare.
Ganz spät am Abend, als Maximilian in seinem Bett lag und nicht einschlafen konnte, hörte er laute Stimmen. Conrad und die Mutter stritten sich.
Am darauffolgenden Tag besuchte die Mutter den Schuldirektor, in der Pause nach der ersten Stunde kam es zu einer Aussprache im Sekretariat. Frau Plaschke musste die Note für den Inhalt in eine Drei ändern. Der Direktor wollte es so.
Damit war der Junge zufrieden.
*
Dicht unter der Zimmerdecke schwebt die MiG-29, das Modell eines russischen Kampfjets, das Papi in seiner Jugend gebastelt hat. Maximilian durfte es behalten, als Papi ihn verließ.
Jetzt betrachtet er den Flieger.
›Warum nur habe ich geschrien?‹, fragt er sich erneut. »Das Telefon!«, flüstert er, weil ihm ein neuer Gedanke kommt.
Er springt vom Bett, hält die Schlafanzughose fest und läuft die Treppe hinunter. Zielstrebig geht er auf das Telefon zu, nimmt das Mobilteil zur Hand und lauscht. – Heute ist kein Piepton zu hören!
›Wenn der Strom weg ist, geht das Telefon nicht‹, erinnert er sich an die Erklärung seiner Mutter, als das Telefon schon einmal nicht funktioniert hat.
Der Junge läuft zum Einbauschrank, öffnet eine der großen Schubladen und zieht das alte Telefon heraus.
»Die analogen Telefone gehen auch ohne Strom«, murmelt er. Das Kabel zieht er hinter sich her, kniet neben dem Telefonanschluss, zieht den Stecker der Station heraus und steckt mit zitternden Händen den des unmodernen, grünen Telefons hinein. Er greift zum Hörer. – Nichts. Auch das analoge Telefon schweigt.
»Ich bin blöd!«, schreit der Junge. »Was ist nur mit mir? – Warum will ich Papi anrufen? Er kann nicht mehr ans Telefon gehen!«
Der Junge schluchzt, dann wählt er die Handynummer der Mutter. Wieder schweigt das Telefon, nicht einmal ein leises Knacken oder Knirschen ist in der Leitung zu hören.
Er wirft den Hörer wütend auf das Parkett, das alte, grüne Telefon folgt dem Hörer geräuschlos.
Der Junge hält den Kopf zwischen beiden Händen.
›Was ist das nur?‹ Er geht zum Fernseher und schaltet ihn ein. – Nichts! Nicht einmal die kleine rote Standby-Diode leuchtet heute. Maximilian lässt die Fernbedienung auf den Sessel fallen.
Hektisch atmet er, eilt erneut zur Haustür und dann zur Straße. Er hält die Schlafanzughose fest, während er lauscht.
Von der Autobahn kommt kein Laut. Sonst hört man sie immer. Doch heute Nacht ist alles still.
Er schleicht zögernd zurück, schaut sich immer wieder um. ›Jemand muss doch unterwegs sein!‹
Maximilian wirft die Haustür zu. Er geht zwei Schritte durch den Flur, dann wendet er sich erstaunt um. Er läuft noch einmal zur Tür, reißt sie auf und stößt sie erneut mit aller Kraft zu.
Er drückt die Handflächen gegen die Ohren. Er hat das Krachen der Tür nicht gehört! Maximilian schreit. Die eigene Stimme vernimmt er deutlich. Noch einmal öffnet er die Haustür und knallt sie zu. – Kein Krachen, kein Knirschen, einfach nichts ist zu hören!
Er rennt hinauf in sein Zimmer, verliert erneut fast die Hose, wirft sich auf das Bett und betrachtet wieder die schwebende MiG-29.
»Warum habt ihr mich allein gelassen?«, wimmert der Junge und schiebt das Kissen unter seinen Kopf. Er beginnt zu weinen. Tränen kriechen über die Wangen.
Maximilian weint oft. Er weint, wenn Conrad gemein zu ihm ist. Dann heult er heimlich und versteckt sich. Und manchmal weint Maximilian nachts, wenn ihm die Träume den kleinen Hannes zeigen.
Hannes Kliem.
Er drückt erneut mit beiden Händen gegen den Kopf. Erinnerungen durchfluten ihn.
*
Leon war Maximilians bester Freund.
Mit einem echten Freund musste man streiten und kämpfen können, ohne dass die Freundschaft daran zerbrach. Ein richtiger Freund musste Geheimnisse für sich behalten können. Ein richtiger Freund würde seine kräftigste Yu-Gi-Oh-Karte für ein wichtiges Duell verleihen. Ein solcher Freund war Leon für ihn.
Leon ging in Maximilians Klasse. Die Ohren standen ihm entsetzlich ab und seine Haare sahen stets wüst aus. Die Kleidung war nie die neueste und manchmal wirkte er ein wenig verwahrlost. Den Unterricht empfand er als nervend. Er war eines der Kinder der Integrationsklasse. Doch mit Integration war nicht viel. Die Lehrer ließen Leon links liegen. Der Nachhilfeunterricht fiel praktisch immer aus, weil die Lehrer keine Zeit für Integrationskinder fanden. Immerhin war Leon nicht versetzungsgefährdet, irgendwie mogelte er sich stets durch. Und Maximilian half ihm oft beim Mogeln.
Wenn Leon zu Besuch kam und zum Abendbrot bei ihm blieb, dann aß er immer sehr viel. Maximilians Mutter wunderte sich darüber, denn Leon war viel schmächtiger als der eigene Sohn.
Die beiden gingen gemeinsam durch dick und dünn. Und manchen Blödsinn, bei dem sie erwischt wurden, nahm Leon auf sich, damit Maximilian keinen Ärger mit Conrad bekam.
Im Sommer, während der Ferien, setzte sich Leon auf den Gepäckträger von Maximilians Fahrrad und sie radelten zur alten Scheune. Die Scheune stand auf einem großen, verwilderten Feld, auf dem jemand Häuser bauen wollte. Ein großes Schild verriet: »HIER ENTSTEHT IHR TRAUMHAUS!«
Maximilian ließ das Fahrrad fallen, Staub wirbelte auf. Leon, der nur eine kurze Hose trug und barfuß lief, hob einen Stein vom Boden auf und warf ihn mit voller Wucht gegen das Schild. Es krachte und kurz darauf klaffte dort, wo vorher das erste »A« von »TRAUMHAUS« gestanden hatte, ein großes Loch.
Maximilian kniete sich in den Dreck, damit man ihn von der Straße aus nicht sehen konnte. »Spinnst du?«
Der Freund hielt bereits den nächsten Stein in der Hand. »Die lügen! Die sind pleite! Wer will schon hier wohnen!« Krachend durchbrach der Stein das Firmenlogo.
»Pleite?«, rief Maximilian. »Wer sagt das?«
»Mein großer Bruder, der hat bei denen gearbeitet.«
»Und jetzt?«
»Drei Monate hat Frank für umsonst gearbeitet.« Leon zielte und traf. Ein Teil der Werbefläche zerbarst. »Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Vielleicht müssen wir ausziehen. Und mein Fahrrad kriege ich nie!«
Maximilian ängstigte sich vor Leons großem Bruder Frank. Leons Familie bestand aus dessen Mutter und den vier Geschwistern. Wenn Frank danach war, dann schlug er mächtig zu. »Einer muss euch ja erziehen!«, pflegte er zu sagen.
»Du bist aber nicht mein Er-zie-hungs-be-rech-tig-ter!«, brüllte Leon meist zurück.
Frank war gerade achtzehn geworden.
»Komm!«, forderte Leon seinen Freund auf, ihm zu folgen.
Der hob das Fahrrad auf und schob es durch das hohe, trockene Gras. Über dem Feld flimmerte die Luft in der Mittagshitze. Maximilian fühlte unter seinen Fußsohlen lose, warme Erde in den Sandalen.
Das Dach der alten Scheune war längst zusammengebrochen. Trotzdem gab es einen Eingang, hinter dem sich das Versteck der beiden Jungen befand. Dort war es etwas kühler, dafür aber sehr stickig. Maximilian ließ das Fahrrad fallen und kroch Leon hinterher. Der machte es sich in dem engen Hohlraum bequem, fummelte einen Zigarettenstummel aus der Hosentasche, bog ihn gerade, nahm ein Feuerzeug zur Hand, steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen, zündete sie an und blies den Qualm in das Gesicht des Kumpels. »Willste auch mal?«
Maximilian schüttelte den Kopf. »Wenn Conrad riecht, dass ich geraucht habe, bin ich tot.«
»Ach, komm schon. Du musst eben nachher Zahncreme essen. Dann riecht er’s nicht.« Leon hielt ihm die Zigarette vor die Lippen. Maximilian griff zögernd zu, zog daran und verschluckte hustend den Rauch.
»Du darfst die ersten Züge nicht auf Lunge nehmen«, flüsterte Leon und lachte über den Hustenanfall. Er nahm die Zigarette wieder an sich. »Rauch mit der Backe. Das ist gesünder.«
Maximilian schwieg. In seinem Magen rumorte es.
»Wir müssen bloß aufpassen, dass hier nichts ankokelt. Was meinst du, wie das lodern würde?«
Minutenlang saßen sie schweigend nebeneinander.
»Ich soll mir eins malen«, flüsterte Leon plötzlich.
»Was malen?«, fragte Maximilian.
»Ein Fahrrad.«
Leons größter Wunsch war ein eigenes Fahrrad. Vor der Schule hatte mal eins gestanden. Das hatte er mitgenommen und er war ziemlich viel damit herumgefahren. Doch der Besitzer, einer der größeren Schüler, hatte ihn irgendwann erwischt und ihm ein blaues Auge gehauen.
»Frank hat gesagt, es gibt keins.« In der kommenden Woche würde Leon Geburtstag haben. Das Fahrrad war sein einziger Wunsch, schon seit Jahren.
»Es tut mir leid«, meinte Maximilian und kroch aus der Scheune.
»Wo willst du hin?«
»Ich muss mal.« Er ging ein paar Schritte weiter und strullte in das vertrocknete hohe Gras. Die Sonne brannte ihm auf den Rücken.
Leon kam ebenfalls herausgekrochen, suchte einen Stock und arbeitete sich durch die Wildnis. Abrupt blieb er stehen. »Maxi! Schnell!«, schrie er. »Schnell, komm her!«
Maximilian verschloss den Hosenstall und lief zu seinem Freund. »Ach du liebe Scheiße«, flüsterte er. »Was ist denn das?«
Leon drückte mit einem Stock das braune Gras zur Seite. »Oh Scheiße, Mann! Und wie das stinkt!«
Tausend Fliegen stoben auseinander. Maximilian riss die Augen weit auf, dann wendete er sich ab und übergab sich.
»Schnell, komm mit!«, forderte Leon, während sich sein Freund mit dem Handrücken die Lippen abwischte.
Maximilian lief zum Fahrrad, hob es auf und rannte Leon hinterher. Sein Gesicht war kalkweiß.
Kurz darauf schwangen sich beide auf das Fahrrad und Maximilian trat kräftig in die Pedale. Zu Hause brachte er das Rad in den Carport und dann hockten sich beide in den Schatten einer der Hecken auf die Terrasse hinter dem Haus.
Maximilian zitterte am ganzen Körper. »Wir müssen unbedingt zur Polizei gehen«, flüsterte er.
»Dann denken die womöglich, wir waren das«, antwortete Leon. »Außerdem wissen die dann, dass wir in der Scheune geraucht haben.«
»Wer war das?«
Leon zuckte mit den Schultern. »Bin ich Moses? Wächst mir Gras ...«
»Hör auf. – Das war ein kleines Kind!«
»Ein Junge, ich hab’s gesehen. Vielleicht fünf oder sechs.«
»Irgendjemand findet ihn, dann findet die Polizei auch unsere Spuren.«
»Quatsch. Den findet dort keiner.«
»Wir haben ihn doch auch gefunden.« Maximilian stand auf und lief unruhig umher.
Leon schwieg lange Zeit. »Wie spät ist es jetzt?«, fragte er dann.
Der Freund sah prüfend auf die Armbanduhr. »Halb vier.«
»Was, schon? – Ich muss los! Ich muss Frank noch helfen.« Leon sprang auf und lief ohne ein weiteres Wort davon.
Maximilian blickte ihm leidend hinterher. Plötzlich fühlte er sich mutterseelenallein.