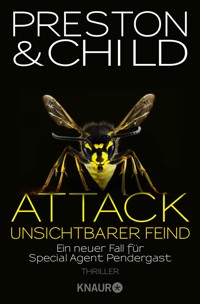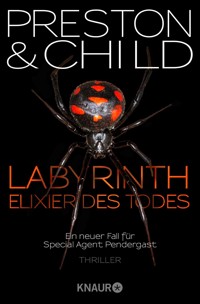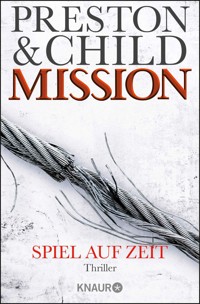
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Gideon Crew
- Sprache: Deutsch
Er ist brillant. Er kennt keine Angst. Und er ist eine tickende Zeitbombe: Der geniale Stratege und Gelegenheitsgauner Gideon Crew hat ein Aneurysma im Gehirn, das ihn jederzeit töten kann. Doch gerade das macht ihn zum idealen Agenten für eine Geheimorganisation, die immer dann zu ermitteln beginnt, wenn ein Fall für die US-Behörden zu brenzlig wird – denn Gideon hat nichts zu verlieren und setzt sich bereitwillig auch der größten Gefahr aus. Sein erster Auftrag: Er soll herausfinden, was ein chinesischer Wissenschaftler soeben ins Land geschmuggelt hat. Ist der Mann ein Überläufer – oder plant er den Bau einer Superwaffe, um Amerika anzugreifen? Bei seinen Ermittlungen merkt Gideon schnell, dass noch jemand anderer hinter dem Wissenschaftler und seinem Geheimnis her ist – und bereit, über Leichen zu gehen … Mission - Spiel auf Zeit von Douglas Preston · Lincoln Child: Spannung pur im eBook
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Mission
Spiel auf Zeit
Aus dem Amerikanischen von Michael Benthack
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Er breitete die Unterlagen aus. Der Moment der Wahrheit war gekommen. Eine Wahrheit, die ihn entweder befreien würde – oder das genaue Gegenteil. Er ist brillant. Er kennt keine Angst. Und er ist eine tickende Zeitbombe: Gideon Crew hat ein Aneurysma im Gehirn, das ihn jederzeit töten kann. Doch gerade das macht ihn zum idealen Agenten für eine Organisation, die immer dann ermittelt, wenn ein Fall für die US-Behörden brenzlig wird – denn Gideon hat nichts zu verlieren und setzt sich auch der größten Gefahr aus … So faszinierend wie Special Agent Pendergast: Der neue Ermittler der Bestsellerautoren Preston & Child!
Inhaltsübersicht
Wir widmen dieses Buch [...]
I.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
II.
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Epilog
ANMERKUNGEN DER AUTOREN
DIE PENDERGAST-ROMANE
Unsere anderen Romane
Ein neuer Held: Gideon Crew
Wir widmen dieses Buch unserem exzellenten literarischen Agenten Eric Simonoff.
I.
Melvin Crew
1
August 1988
Seine Mutter fuhr ihn im Plymouth-Kombi von der Tennisstunde nach Hause. Es war ein heißer Tag, weit über dreißig Grad, so heiß, dass die Kleidung auf der schweißfeuchten Haut klebte und die Sonne eine sengende Kraft entfaltete. Gideon hatte die Lüftungsschlitze im Armaturenbrett auf sein Gesicht eingestellt und genoss den kühlen Luftstrom. Sie fuhren gerade auf der Route 27, an der langen Betonmauer entlang, hinter der der Nationalfriedhof von Arlington lag, als zwei Polizisten auf Motorrädern ihren Wagen anhielten. Mit heulenden Sirenen und eingeschaltetem Blaulicht setzte sich das eine Motorrad vor, das andere hinter sie. Der vordere Polizist zeigte mit seiner schwarzbehandschuhten Hand in Richtung Ausfahrt Columbia Pike, und sobald sie auf der Ausfahrt waren, machte er Gideons Mutter das Zeichen, rechts ranzufahren. Nichts erinnerte an das bedächtige Vorgehen, wie man es von einer routinemäßigen Verkehrskontrolle kannte. Stattdessen sprangen beide Polizisten von ihren Motorrädern und kamen herbeigelaufen.
»Folgen Sie uns«, sagte der eine und beugte sich zum Seitenfenster herab. »Sofort.«
»Worum geht’s?«, fragte Gideons Mutter.
»Ein Notfall, nationale Sicherheit. Halten Sie sich dicht hinter uns. Wir werden schnell fahren und eine Gasse freimachen.«
»Ich verstehe nicht …«
Aber da liefen die Polizisten bereits zu ihren Motorrädern zurück.
Unter Sirenengeheul eskortierten sie Gideon und seine Mutter auf dem Columbia Pike bis zum George Mason Drive, drängten dabei die anderen Verkehrsteilnehmer links und rechts zur Seite. Weitere Motorräder, Streifenwagen und schließlich ein Krankenwagen schlossen sich ihnen an, eine Fahrzeugkolonne, die durch die stark befahrenen Straßen raste. Gideon wusste nicht, ob er nun freudig erregt oder verängstigt sein sollte. Als sie in den Arlington Boulevard einbogen, konnte er sich denken, wohin sie fuhren: zur Arlington Hall Station, denn dort arbeitete sein Vater für das nachrichtendienstliche und Sicherheits-Hauptkommando der US Army (INSCOM).
Vor dem Eingang zu dem Gebäudekomplex waren Sperrgitter errichtet, die allerdings rasch zur Seite geschoben wurden, damit die Wagenkolonne passieren konnte. Mit kreischenden Sirenen fuhren die Fahrzeuge den Ceremonial Drive entlang und kamen vor einer zweiten Reihe von Absperrungen zum Stehen, neben einer Vielzahl von Feuerwehrfahrzeugen, Streifenwagen und Kleintransportern für Spezialeinheiten. Hinter den Bäumen erblickte Gideon das Gebäude, in dem sein Vater arbeitete, die imposanten weißen Säulen und die Backsteinfassade zwischen den smaragdgrünen Rasenflächen und gestutzten Eichen. Früher hatte das Haus ein Mädchenpensionat beherbergt – und es sah immer noch so aus. Davor war eine große Fläche geräumt worden. Hinter einer Bodenwelle auf dem Rasen lagen zwei Scharfschützen, ihre Gewehre auf Zweibeinstative gestützt.
Seine Mutter drehte sich zu ihm um und sagte in scharfem Ton: »Du bleibst im Auto. Und steigst nicht aus, egal, was passiert.« Dass ihr Gesicht so grau und angestrengt wirkte, machte ihm Angst.
Seine Mutter stieg aus. Die Phalanx der Polizisten stürmte durch die Menschengruppe, die sich unmittelbar vor ihr befand, und sie verschwanden darin.
Sie hatte vergessen, den Motor auszuschalten. Die Klimaanlage lief immer noch. Als Gideon das Seitenfenster herunterkurbelte, drangen die Geräusche von Sirenen, Walkie-Talkie-Gesprächen und Rufen ins Wageninnere. Zwei Männer in blauen Anzügen liefen an ihm vorbei. Ein Polizist rief lauthals irgendetwas in ein Funksprechgerät. In der Ferne ertönten weitere Sirenen, sie kamen aus allen Richtungen.
Aus einem elektronischen Megaphon ertönte eine plärrende, verzerrte Stimme. »Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus.«
Die Leute verstummten augenblicklich.
»Sie sind umstellt. Sie haben keine Chance. Lassen Sie Ihre Geisel frei und kommen Sie sofort raus.«
Wieder Stille. Gideon blickte sich um. Die Aufmerksamkeit der Leute war auf die Eingangstür des Gebäudes gerichtet. Dort spielte sich, so schien es, das Entscheidende ab.
»Ihre Frau ist hier. Sie möchte mit Ihnen sprechen.«
Aus der Lautsprecheranlage ertönte ein Knistern, dann das elektronisch verstärkte Geräusch eines kurzen Schluchzers, grotesk und fremdartig. »Melvin?« Noch ein erstickter Ruf. »MELVIN?«
Gideon zuckte zusammen. Das ist die Stimme meiner Mutter.
Es kam ihm alles vor wie ein Traum, in dem nichts einen Sinn ergab. Völlig irreal. Er legte die Hand auf den Türgriff, drückte die Tür auf und trat in die Gluthitze.
»Melvin …« Ein Schluchzen. »Bitte komm heraus. Niemand wird dir etwas antun, ich verspreche es. Bitte lass den Mann gehen.« Die Stimme aus dem Megaphon klang schroff und fremdartig – und war doch unverkennbar die seiner Mutter.
Gideon drängelte sich durch die Grüppchen der Polizeibeamten und Armeeoffiziere nach vorn. Niemand schenkte ihm Beachtung. Er ging bis zur äußeren Absperrung und legte eine Hand auf das rauhe, blau gestrichene Holz. Er blickte in die Richtung der Arlington Hall, konnte aber weder vor der idyllischen Fassade noch auf dem nahe gelegenen Gelände, das von allen Leuten geräumt worden war, irgendeine Bewegung erkennen. Das Haus, das in der Hitze flirrte, wirkte wie ausgestorben. Draußen hingen die Blätter schlaff von den Ästen der Eichen, der niedrige Himmel war wolkenlos und so blass, dass er fast weiß wirkte.
»Melvin, wenn du den Mann gehen lässt, wird man dir zuhören.«
Wieder erwartungsvolles Schweigen. Dann bewegte sich auf einmal irgendetwas in der Eingangstür. Ein rundlicher Mann im Anzug, den Gideon nicht kannte, trat stolpernd aus dem Gebäude. Er blickte sich einen Augenblick lang orientierungslos um, dann rannte er auf seinen dicken Beinchen los, auf die Absperrungen zu. Vier Beamte mit Helmen auf dem Kopf stürmten mit gezückten Waffen hervor, packten den Mann und zerrten ihn hinter einen Kleintransporter der Spezialeinheiten.
Gideon duckte sich unter der Absperrung hindurch und drängelte sich durch die Gruppen der Polizisten, der Männer mit Walkie-Talkies, der Männer in Uniform. Niemand bemerkte ihn, keiner interessierte sich für ihn. Alle Blicke richteten sich auf den Vordereingang des Gebäudes.
Und dann ertönte hinter der Eingangstür eine leise Stimme. »Es muss Ermittlungen geben!«
Das war die Stimme seines Vaters. Gideon blieb stehen. Das Herz schlug ihm bis zum Hals.
»Ich verlange eine Untersuchung! Sechsundzwanzig Menschen haben ihr Leben verloren!«
Ein gedämpftes, elektronisch verstärktes Knistern, dann ertönte eine Männerstimme aus der Lautsprecheranlage. »Dr. Crew, Ihre Anliegen werden berücksichtigt werden. Aber Sie müssen jetzt mit erhobenen Händen herauskommen. Verstehen Sie? Sie müssen sich ergeben.«
»Sie haben nicht auf mich gehört«, erschallte die bebende Stimme. Sein Vater klang verängstigt, fast wie ein Kind. »Menschen sind umgekommen, aber man hat nichts dagegen unternommen! Ich verlange eine Untersuchung.«
»Wir versprechen es Ihnen.«
Gideon war an die innerste Absperrung gelangt. An der Vorderseite des Gebäudes war noch immer alles ruhig, aber inzwischen stand er nahe genug davor, um erkennen zu können, dass die Tür halb offen stand. Es war ein Traum; bestimmt würde er gleich daraus erwachen. Ihm war schwindlig wegen der Hitze, und er hatte einen kupferähnlichen Geschmack im Mund. Es war ein Alptraum, der in der Realität spielte.
Und da sah er, wie die Tür nach innen schwang und sein Vater im schwarzen Rechteck des Türrahmens erschien. Vor der eleganten Fassade des Gebäudes wirkte er furchtbar klein. Mit erhobenen Händen, die Handflächen nach vorn weisend, trat er einen Schritt vor. Das glatte Haar klebte ihm an der Stirn, seine Krawatte hing schief, der blaue Anzug war zerknittert.
»Das ist weit genug«, ertönte die Stimme. »Halt.«
Melvin Crew blieb stehen und blinzelte ins helle Sonnenlicht.
Die Schüsse fielen so kurz hintereinander, dass es sich anhörte, als knatterten Feuerwerkskörper, gleichzeitig wurde er jählings zurück ins Dunkel der Eingangstür gestoßen.
»Dad!«, schrie Gideon, sprang über die Absperrung und lief über den heißen Asphalt des Parkplatzes. »Dad!«
Hinter ihm ertönten Schreie, Rufe wie »Wer ist der Junge?« und »Feuer einstellen!«.
Er sprang über den Kantstein und rannte mitten über die Rasenfläche auf den Eingang zu. Männer liefen los, um ihn zurückzuhalten.
»Verdammt noch mal, haltet ihn auf!«
Er glitt auf dem Rasen aus, stürzte auf Hände und Knie, stand wieder auf. Er sah bloß die beiden Schuhe seines Vaters, sie ragten aus dem dunklen Türrahmen ins Sonnenlicht, die abgewetzten Schuhsohlen zeigten nach vorn, so dass alle sehen konnten, dass eine Sohle ein Loch hatte. Es war ein Traum, ein Alptraum – und dann war das Letzte, was Gideon sah, bevor er zu Boden gerissen wurde, wie sich die Füße bewegten, zweimal zuckten.
»Dad!«, schrie er ins Gras und versuchte, sich aufzurappeln, während sich das Gewicht der Welt auf seinen Schultern auftürmte. Aber er hatte doch gesehen, dass sich die Füße bewegten, sein Vater lebte, er würde aufwachen, und alles wäre wieder gut.
2
Oktober 1996
Gideon Crew war mit einem Nachtflug aus Kalifornien gekommen, und das Flugzeug hatte geschlagene zwei Stunden auf dem Rollfeld des Los Angeles International Airport gestanden, bis es schließlich in Richtung Dulles abhob. Er hatte den Bus in die Innenstadt genommen und war anschließend mit der Metro so weit wie möglich gefahren, bevor er in ein Taxi wechselte. Das Letzte, was seine Finanzen gebraucht hatten, war die unerwartete Ausgabe für das Flugticket. Er hatte beängstigend schnell Geld verbrannt, war überhaupt nicht sparsam gewesen. Außerdem stand dieser letzte Job, den er erledigt hatte, stärker als sonst im Fokus der Öffentlichkeit, so dass die Ware schwer an den Mann zu bringen war.
Als der Anruf ihn erreichte, hatte er zunächst gehofft, es handle sich um einen weiteren falschen Alarm, eine weitere hysterische Attacke, ein erneutes alkoholseliges Flehen um Aufmerksamkeit. Doch gleich nach seiner Ankunft im Krankenhaus hatte ihm der Arzt kühl und unumwunden erklärt: »Die Leber Ihrer Mutter macht es nicht mehr lange, und wegen ihrer medizinischen Vorgeschichte kommt Ihre Mutter für eine Transplantation nicht in Frage. Es könnte Ihr letzter Besuch sein.«
Sie lag auf der Intensivstation, das blondierte Haar auf dem Kopfkissen ausgebreitet, die dunklen Haaransätze durchschimmernd, die Haut vom Alter gezeichnet. Irgendjemand hatte den traurigen, dilettantischen Versuch unternommen, Lidschatten aufzutragen. Es sah aus, als hätte man die Fensterläden eines Spukhauses gestrichen. Gideon hörte ihr röchelndes Atmen durch die Nasenkanüle. Das Licht im Zimmer war gedämpft, das leise Piepen elektronischer Geräte ständig anwesend. Plötzlich schlugen sein schlechtes Gewissen und sein Mitleid wie eine riesige Welle über ihm zusammen. Er hatte sich ganz auf sein Leben konzentriert, statt sich um seine Mutter zu kümmern. Doch jedes Mal, wenn er es früher mal versucht hatte, hatte sie getrunken und sich ihm entzogen, und am Ende hatten sie gestritten. Dennoch: Es war nicht fair, dass ihr Leben so endete. Es war einfach nicht fair.
Er fasste ihre Hand und wollte sie ansprechen, aber es fielen ihm keine passenden Sätze ein. Schließlich brachte er ein lahmes »Wie geht es dir, Mutter?« heraus und hasste sich ob der dümmlichen Frage, kaum dass er sie gestellt hatte.
Sie starrte ihn an. Das Weiße ihrer Augen hatte die Farbe überreifer Bananen. Mit ihrer knochigen Hand ergriff sie seine – eine schlaffe, zittrige Berührung. Schließlich regte sie sich ein wenig. »Tja, das wär’s dann wohl gewesen.«
»Mom, bitte sag nicht so etwas.«
Sie winkte ab. »Du hast doch mit dem Arzt gesprochen. Du weißt also, wie es um mich steht. Ich habe eine Leberzirrhose, samt all den netten Nebenwirkungen – von der Herzinsuffizienz und dem Lungenemphysem nach dem jahrzehntelangen Rauchen ganz zu schweigen. Ich bin ein Wrack, und es ist mein eigener verdammter Fehler.«
Gideon wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Natürlich hatte seine Mutter recht, und unverblümt war sie sowieso. War es immer gewesen. Trotzdem fand er es irritierend, dass eine so starke Frau so schwach war, was Alkohol anging. Nein, es sollte ihn nicht verwirren. Sie war ein Suchttyp – so wie er selbst.
»Die Wahrheit macht frei«, sagte sie, »aber zunächst macht sie dich unglücklich.«
Das war ihr Lieblingsspruch, den sie immer benutzte, wenn sie etwas zum Ausdruck bringen wollte, das ihr schwerfiel.
»Die Zeit ist gekommen, dir eine Wahrheit anzuvertrauen …«, sie holte, so gut es ging, Luft, »… die dich zunächst unglücklich machen wird.«
Er wartete, während sie wieder einige Male schnaufend einatmete.
»Es geht um deinen Vater.« Sie blickte mit ihren leberkranken Augen zur Tür. »Mach mal zu.«
Seine Angst wuchs. Sanft schloss er die Tür und trat zurück ans Bett seiner Mutter.
Wieder umfasste sie seine Hand. »Golubzi«, flüsterte sie.
»Wie bitte?«
»Golubzi – eine russische Roulade.« Sie hielt inne, um durchzuatmen. »So lautete der sowjetische Codename für die Operation. Die Roulade. In einer Nacht sind sechsundzwanzig Maulwürfe ›eingerollt‹, verhaftet worden. Und spurlos verschwunden.«
»Warum erzählst du mir das?«
»Thresher.« Sie schloss die Augen, atmete schnell. Es kam ihm vor, als könne sie jetzt, nachdem sie beschlossen hatte, das Risiko einzugehen, die Worte gar nicht schnell genug herausbekommen. »Das ist das andere Wort. Das Projekt. An dem dein Vater bei INSCOM gearbeitet hat. Es handelte sich um ein neuartiges Verschlüsselungsverfahren … streng geheim.«
»Bist du dir sicher, dass du darüber sprechen darfst?«, fragte Gideon.
»Dein Vater hätte mich nicht einweihen sollen. Aber er hat’s getan.« Ihre Augen blieben geschlossen, und ihr Körper wirkte ganz eingefallen, so als würde sie im Bett versinken. »Thresher musste gründlich geprüft werden. Getestet. Darum hat man deinen Vater eingestellt. Und deshalb sind wir nach Washington, D. C., umgezogen.«
Gideon nickte. Für einen Siebtklässler war der Umzug von Claremont, Kalifornien, nach Washington kein Spaß gewesen.
»Neunzehnhundertsiebenundachtzig hat INSCOM Thresher zur abschließenden Beurteilung an die Nationale Sicherheitsbehörde geschickt. Das Projekt wurde genehmigt. Und implementiert.«
»Ich habe noch nie etwas davon gehört.«
»Dann erfährst du eben jetzt davon.« Sie schluckte, was ihr wehtat. »Es hat nur einige Monate gedauert, dann hatten die Russen den Code geknackt. Am fünften Juli achtundachtzig – am Tag nach dem Unabhängigkeitstag – haben sie all diese US-Spione auffliegen lassen.«
Sie stieß einen langen Seufzer aus. Die medizinischen Geräte piepten leise, das Geräusch verband sich mit dem Zischen des Sauerstoffgeräts und den gedämpften Lauten des Krankenhausbetriebs jenseits der Tür.
Gideon hielt weiterhin ihre Hand und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Man hat deinem Vater die Schuld an dem Fiasko gegeben …«
»Mutter.« Gideon drückte ihre Hand. »Das ist doch alles längst vorbei.«
Sie schüttelte den Kopf. »Diese Leute haben sein Leben kaputt gemacht. Und darum hat er das getan – diese Geisel genommen.«
»Was spielt das jetzt für eine Rolle? Ich habe längst akzeptiert, dass Dad einen Fehler gemacht hat.«
Plötzlich öffnete sie die Augen. »Nein, er hat keinen Fehler begangen. Er hat als Sündenbock gedient.«
Sie betonte das Wort abfällig, so, als wollte sie sich von etwas Unangenehmem befreien.
»Was meinst du damit?«
»Vor der Operation Golubzi hat dein Vater ein Gutachten geschrieben. Darin steht, dass Thresher im Ansatz fehlerhaft ist. Dass es womöglich eine Hintertür gibt. Man hat nicht auf ihn gehört. Aber er hatte recht. Und dann sind sechsundzwanzig Menschen ums Leben gekommen.«
Sie atmete geräuschvoll ein und krallte die klauenähnlichen Hände vor lauter Anstrengung in die Bettdecke. »Thresher war geheim, deswegen konnten diese Leute behaupten, was sie wollten. Es war niemand da, der ihnen hätte widersprechen können. Dein Vater war ein Außenseiter, ein Professor, ein Zivilist. Und dass er einmal wegen Depressionen in Behandlung gewesen war, konnte passenderweise wieder ausgegraben werden.«
Gideon stutzte. »Du meinst also, dass es gar nicht sein Fehler war?«
»Im Gegenteil. Die haben die Beweise vernichtet und ihm die Schuld an dem Golubzi-Desaster gegeben. Darum hat er die Geisel genommen. Und darum hat man ihn erschossen, obwohl er die Hände oben hatte. Er sollte zum Schweigen gebracht werden. Es war kaltblütiger Mord.«
Gideon hatte das seltsame Gefühl, gewichtslos zu sein. Aber so erschreckend die Geschichte auch war, er spürte, wie eine Last von ihm abfiel. Sein Vater, dessen Name öffentlich verunglimpft worden war, seit Gideon zwölf war, war gar nicht der depressive, psychisch labile, stümperhafte Mathematiker gewesen. All die Spötteleien und die Schikane, die er über sich hatte ergehen lassen müssen, das Flüstern und Kichern hinter seinem Rücken – es steckte nichts dahinter. Und nun wurde Gideon langsam klar, welch ungeheuerliches Verbrechen gegen seinen Vater verübt worden war. Er erinnerte sich noch ganz deutlich an jenen Tag, an die Versprechen, die gemacht wurden. Und daran, dass man ihn aus dem Gebäude ins Sonnenlicht gelockt hatte. Nur um ihn dann zu erschießen.
»Aber wer …?«
»Lieutenant General Chamblee Tucker. Der stellvertretende Chef von INSCOM. Gruppenleiter des Projekts Thresher. Er hat deinen Vater zum Sündenbock gestempelt, um sich selbst zu schützen. Er war damals dort, in der Arlington Hall Station. Er hat den Schießbefehl gegeben. Merke dir den Namen: Chamblee Tucker.«
Seine Mutter verstummte. Schweißgebadet und keuchend lag sie da im Bett, als hätte sie gerade eben einen Marathonlauf absolviert.
»Danke, dass du es mir erzählt hast«, sagte er gleichmütig.
»Ich bin noch nicht fertig.« Wieder schweres Atmen. Gideon blickte auf den Herzmonitor an der Wand: Der Puls lag bei knapp über vierzig Schlägen in der Minute.
»Sprich nicht mehr«, sagte er. »Du musst dich ausruhen.«
»Nein«, entgegnete sie, plötzlich sehr bestimmt. »Ich kann mich später immer noch ausruhen.«
Gideon wartete.
»Du weißt ja, was als Nächstes passiert ist. Du hast das alles ja auch durchgemacht. Die ewigen Umzüge, die Armut. Die … Männer. Ich hab’s einfach nicht auf die Reihe bekommen. Mein wahres Leben ist an jenem Tag zu Ende gegangen. Danach habe ich mich innerlich wie tot gefühlt. Ich war eine schreckliche Mutter. Und du … du warst so verletzt.«
»Keine Sorge, ich hab’s überlebt.«
»Bist du sicher?«
»Na klar.« Doch tief im Inneren verspürte Gideon einen Stich.
Seine Mutter atmete langsamer, und da fühlte er, wie sie den Griff löste. Als er sah, dass sie eingeschlafen war, zog er behutsam ihre Hand aus seiner und legte sie auf die Bettdecke. Doch als er sich vorbeugte, um ihr einen Kuss zu geben, zuckte ihre Hand mit den klauenartigen Fingern wieder hoch und packte ihn am Kragen. Sie schaute ihm ganz fest in die Augen und sagte heftig, fast manisch: »Begleich die Rechnung.«
»Wie bitte?«
»Tu mit Tucker das, was er mit deinem Vater getan hat. Vernichte ihn. Und sorg dafür, dass er weiß, warum es ihm widerfahren ist – und wer es gewesen ist.«
»Großer Gott, was verlangst du da von mir?«, flüsterte Gideon und blickte sich plötzlich hektisch um. »Mutter, du weißt ja nicht, was du da redest.«
Jetzt war ihre Stimme nur noch ein Flüstern. »Lass dir Zeit. Studiere. Mach dein Examen. Warte. Du wirst schon einen Weg finden.«
Langsam entspannte sich ihre Hand. Dann schloss seine Mutter wieder die Augen, und der Atem schien für immer aus ihr zu entweichen wie ein letzter Seufzer. Und in gewisser Weise war das auch der Fall. Sie fiel ins Koma und verstarb zwei Tage später.
Das waren ihre letzten Worte, Worte, die ihm immer wieder durch den Kopf gehen sollten: Du wirst schon einen Weg finden.
3
Gegenwart
Gideon Crew trat zwischen den Gelb-Kiefern hervor auf die große Wiese vor der Hütte. In der einen Hand hatte er eine Aluminiumröhre mit seiner Fliegenrute darin; über die Schulter geschlungen trug er einen Beutel aus Segeltuch, in dem zwei Forellen in einem Nest aus feuchtem Gras lagen. Es war ein wunderschöner Tag Anfang Mai, die Sonne schien ihm mild in den Nacken. Mit seinen langen Beinen wischte er durch das Wiesengras, dass die Bienen und Schmetterlinge davonflogen.
Die Hütte stand am anderen Ende: mit der Hand geschlagene Holzstämme und Lehmziegel, ein rostiges Blechdach, zwei Fenster und eine Tür. Auf dem Dach war unauffällig ein Gestell mit Sonnenkollektoren angebracht, daneben eine Breitband-Satellitenschüssel.
Hinter der Hütte fiel der Berghang zum riesigen Piedra-Lumbre-Bassin ab, und die fernen Gipfel des südlichen Colorado säumten den Horizont wie blaue Zähne. Gideon arbeitete auf »dem Hügel« – im Nationalen Laboratorium in Los Alamos – und verbrachte die Abende in der Woche in einem billigen Regierungsapartment in einem Haus an der Ecke Trinity und Oppenheimer. Die Wochenenden – und sein echtes Leben – verbrachte er hingegen in dieser Hütte in den Jemez Mountains.
Er schob die Tür auf und betrat die Kochnische. Er legte den Segeltuchbeutel ab, holte die ausgenommenen Forellen heraus, säuberte sie und tupfte sie trocken. Dann griff er zum iPod, der in der Basisstation steckte, und wählte nach kurzem Überlegen ein Stück von Thelonius Monk aus. Aus den Lautsprechern ertönten die eindringlichen Klänge von Green Chimneys.
Gideon verrührte Zitronensaft und Salz, gab ein wenig Olivenöl und frisch gemahlenen Pfeffer hinzu und legte die Forellen in die Marinade. Dann ging er in Gedanken die übrigen Zutaten von truite à la provençale durch: Zwiebeln, Tomaten, Knoblauch, Wermut, Mehl, Oregano und Thymian. Normalerweise nahm er nur eine Mahlzeit am Tag zu sich – die allerdings von höchster Qualität und von ihm selbst zubereitet war. Essen war für ihn fast eine Zen-ähnliche Übung, sowohl was die Zubereitung als auch den langsamen Verzehr betraf. Waren mehr Nährwerte notwendig, behalf er sich mit Kuchenstücken, Maischips und Coffee to go.
Nachdem er sich die Hände gewaschen hatte, ging er in den Wohnzimmerbereich und stellte die Fliegenrutentasche in einen alten Regenschirmständer in einer Ecke. Anschließend ließ er sich auf das alte Ledersofa sinken und legte die Beine hoch, um sich zu entspannen. In dem großen Natursteinkamin knisterte ein Feuer, das er entfacht hatte, weil es so schön flackerte, und nicht, um den Raum zu heizen. Die Nachmittagssonne tauchte die beiden Elchgeweihe über dem Kamin in gelbliches Licht. Den Fußboden bedeckte ein Bärenfell, an den Wänden hingen alte Backgammon- und Schachbretter. Auf Beistelltischen und auf dem Boden stapelten sich Bücher, eine Wand mit Regalen am anderen Ende des Zimmers war so mit Bänden vollgestopft, dass kein einziger freier Platz mehr übrig war.
Er warf einen Blick auf die zweite Nische, die sich hinter einem improvisierten Vorhang aus einer alten Hudson’s-Bay-Wolldecke befand. Lange Zeit saß Gideon völlig regungslos da. Er hatte seinen Computer seit einer Woche nicht mehr angerührt und verspürte auch jetzt keinerlei Neigung dazu. Er war müde und freute sich aufs Abendessen. Doch weil das regelmäßige Nachschauen so lange schon eine selbstauferlegte Pflicht war, dass sie ihm zur Gewohnheit geworden war, raffte er sich schließlich auf, strich seine langen schwarzen Haare nach hinten und trottete zur Decke hinüber, hinter der ein leises Summen zu hören war.
Ein wenig widerstrebend zog er den Vorhang zur Seite, denn dem schummrigen Raum entströmte ein schwacher Geruch nach Elektronik und warmem Kunststoff. Man sah einen Schreibtisch aus Holz und ein Computer-Regal. Leuchtdioden blinkten im Dunkel. Im Rack standen vier Computer verschiedener Marken und Größen, alle No-name- oder Nachahmer-Geräte, keines jünger als fünf Jahre: ein Apache-Server und drei Linux-Maschinen. Für Gideons Zwecke mussten die Rechner nicht schnell sein, aber stabil und zuverlässig. Das einzige brandneue und vergleichsweise teure Gerät war ein leistungsstarker Breitband-Satellitenrouter.
Über dem Computer-Regal hing eine kleine, erlesene Bleistiftzeichnung von Winslow Homer: Felsen an der Küste von Maine. Es war der einzige Kunstgegenstand, den er aus seinem vorigen Beruf herübergerettet hatte, das einzige Kunstwerk, das zu verkaufen er nicht übers Herz gebracht hatte.
Er zog einen wackligen Bürostuhl auf Rollen zurück und setzte sich an den kleinen Schreibtisch, legte die Füße darauf, plazierte eine Tastatur auf den Oberschenkeln und fing an zu tippen. Ein Fenster erschien, darin eine Zusammenfassung der Suchergebnisse, die ihn darüber informierte, dass er sich seit sechs Tagen nicht mehr eingeloggt hatte.
Er scrollte in dem Fenster mit den Suchergebnissen und erkannte sofort, dass er einen Treffer erzielt hatte.
Er starrte auf den Monitor. Im Laufe der Jahre hatte er seine Suchmaschine verfeinert und verbessert, und die letzte Falschmeldung lag fast ein Jahr zurück.
Als er die Füße vom Tisch nahm, hämmerte ihm mit einem Mal das Herz in der Brust. Über den Schreibtisch gebeugt, tippte er wie verrückt. Der Treffer stammte aus einer vom Nationalen Sicherheitsarchiv an der George Washington University herausgegebenen Inhaltsübersicht. Das eigentliche Archivmaterial unterlag der Geheimhaltung, aber das Inhaltsverzeichnis war frei zugänglich, Teil einer groß angelegten, fortlaufenden Freigabe von Dokumenten aus der Zeit des Kalten Krieges gemäß der Durchführungsverordnung 12 958.
Der Treffer bestand aus dem Namen seines Vaters: L. Melvin Crew. Und der Titel des archivierten, immer noch geheimen Dokuments lautete: Zur Kritik des Diskreten Logarithmus- Verschlüsselungsverfahrens EVP-4Thresher. Eine Angriffsstrategie auf Grundlage einer theoretischen Backdoor-Kryptoanalyse unter Verwendung einer Gruppe von φ-Torsionspunkten einer elliptischen Kurve in der Charakteristik φ.
»Heilige Mutter Gottes«, sagte Gideon leise und starrte auf den Monitor. Das war nun wirklich keine Falschmeldung.
Seit Jahren versuchte er schon, irgendetwas zu finden. Aber das hier war mehr als »irgendetwas«. Es könnte sich um den Schlüssel zu allem handeln.
Es war unfassbar, unglaublich. Konnte es sich um ebenjenes Gutachten handeln, mit dem sein Vater Thresher kritisiert hatte, jenes Gutachten, das General Tucker angeblich vernichtet hatte?
Es gab nur einen Weg, das herauszufinden.
4
Mitternacht. Die Hände in den Hosentaschen, die Baseballkappe verkehrt herum aufgesetzt, das schmutzige Hemd lose unter einem speckigen Trenchcoat und die weite Hose tief über den Hintern hängend, schlurfte Gideon Crew über die Straße und dachte, was für ein Glück er doch hatte, dass heute im Washingtoner Vorort Brookland der Müll abgeholt wurde.
Er bog um die Ecke der Kearny Street und ging an dem Haus vorbei, einem schäbigen Bungalow mit zu hohem Rasen davor, umgeben von einem weißen, lediglich teilweise gestrichenen Lattenzaun. Und natürlich mit einer wunderbar überquellenden Mülltonne am Ende der Zufahrt, so dass ein entsetzlicher Gestank nach vergammelten Garnelen in der schwülheißen Luft hing. Gideon blieb neben der Mülltonne stehen und sah sich verstohlen um. Dann griff er mit einer Hand hinein und grub in dem Müll. Er bekam etwas zu fassen, das sich wie Pommes frites anfühlte, und zog eine Handvoll heraus, stellte fest, dass es sich tatsächlich um Pommes handelte, und warf sie in die Tonne zurück.
Plötzlich nahm er eine Bewegung wahr. Aus einer Hecke kam eine struppige, einäugige Katze hervor.
»Hast du Hunger, Partner?«
Die Katze miaute leise und schlich herüber, ihr Schwanz zuckte misstrauisch. Gideon bot ihr eine Pommes frites an. Die Katze schnupperte daran, fraß sie, dann miaute sie wieder, lauter.
Gideon warf ihr eine kleine Handvoll hin. »Mehr gibt’s nicht, Kleine. Weißt wohl nicht, wie ungesund gehärtete Fette für dich sind.«
Die Katze setzte sich und verputzte die Pommes.
Gideon steckte den Arm nochmals in die Mülltonne und förderte diesmal einen Packen weggeworfener Papiere zutage. Rasch sah er sie durch. Es handelte sich um die Mathematik-Hausaufgaben eines Kindes – nur Einser, wie er anerkennend feststellte. Warum hatte man die Seiten weggeworfen? Müsste man einrahmen.
Er stopfte die Blätter in die Mülltonne zurück, fischte einen Hähnchenschenkel heraus und legte ihn für die Katze beiseite. Er griff nochmals hinein, diesmal mit beiden Händen, schob sie schlängelnd nach unten und ertastete irgendetwas Schleimiges, dann kramte er weiter unten, wobei seine Finger zu verschiedenen halbfesten Gegenständen vordrangen, bis sie schließlich wieder auf Papiere stießen. Er packte die Blätter, zog sie nach oben und sah, dass es genau das war, wonach es aussah: weggeworfene Rechnungen. Und darunter befand sich die obere Hälfte einer Telefonrechnung.
Jackpot!
»He!« Gideon hörte jemanden rufen und hob den Kopf. Der Eigentümer höchstpersönlich, Lamoine Hopkins, ein kleiner, dürrer Afroamerikaner, der aufgeregt mit dem Finger auf ihn zeigte. »He! Verschwinde von hier!«
Ohne Eile und froh über die unerwartete Gelegenheit, mit einer seiner Zielpersonen zu sprechen, steckte Gideon die Papiere ein. »Ist es verboten, sich was zu essen zu besorgen?« Er hielt den Hähnchenschenkel hoch.
»Hau ab, iss irgendwo anders!«, zeterte der Mann. »Das hier ist ein anständiges Viertel! Der Müll gehört mir!«
»Na kommen Sie, seien Sie doch nicht so.«
Der Mann holte sein Handy hervor. »Siehst du das hier? Ich rufe jetzt die Polizei.«
»Ach Mensch, ist doch nicht schlimm.«
»Hallo?«, sagte der Mann und sprach theatralisch ins Handy. »Ich habe hier einen Eindringling auf meinem Grundstück, der in meinem Müll stöbert! Fünfzehn-siebzehn Kearny Street Northeast!«
»Tut mir leid«, murmelte Gideon und schlurfte mit dem Hähnchenschenkel in der Hand davon.
»Schicken Sie mir einen Einsatzwagen, auf der Stelle!«, schrie der Mann. »Der Kerl versucht zu flüchten!«
Gideon warf den Hähnchenschenkel der Katze hin, trottete um die Ecke und fiel dann in Laufschritt. Rasch wischte er sich mit seiner Baseballkappe so gründlich wie möglich Arme und Hände sauber, warf die Mütze weg, wendete den Heilsarmee-Mantel – worauf ein tadelloser blauer Trench zum Vorschein kam –, zog ihn wieder an, steckte das Hemd in die Hose und kämmte sich schließlich das Haar nach hinten. Als er einige Nebenstraßen entfernt an seinem Mietwagen eintraf, kam ihm ein Streifenwagen entgegen, aber die Beamten warfen ihm nur einen kurzen Blick zu. Er stieg ein, drehte die Zündung und freute sich über sein großes Glück. Nicht nur hatte er bekommen, was er wollte, sondern war sogar Mr. Lamoine Hopkins höchstpersönlich begegnet. Und er hatte nett mit ihm geplaudert.
Das würde sich noch als sehr nützlich erweisen.
Am nächsten Morgen rief Gideon von seinem Motelzimmer aus die Nummern auf Hopkins’ Telefonrechnung an. Er arbeitete sich durch eine Reihe von Hopkins’ Freunden, bis er beim fünften Anruf einen Volltreffer landete.
»Einkaufszentrum Heart of Virginia, technischer Kundendienst«, ertönte eine Stimme. »Kenny Roman am Apparat.«
Technischer Kundendienst. Rasch schaltete Gideon ein digitales Aufzeichnungsgerät ein, das in einen Line-Splitter in der Telefonleitung eingestöpselt war. »Mr. Roman?«
»Ja?«
»Mein Name ist Eric, ich rufe im Auftrag der Sutherland Finance Company an.«
»Ja? Und was wollen Sie?«
»Es geht um den Kredit auf Ihren Dodge Dakota Baujahr null-sieben.«
»Was für einen Dakota?«
»Die Raten wurden seit drei Monaten nicht mehr bezahlt, Sir, und ich fürchte, die Sutherland Finance …«
»Was reden Sie denn da? Ich besitze gar keinen Dakota.«
»Mr. Roman, ich verstehe ja, es sind schwierige Zeiten, aber wenn wir den ausstehenden Betrag nicht bis …«
»Hören Sie, mein Freund, haben Sie Bohnen in den Ohren? Sie haben es mit der falschen Person zu tun. Ich besitze gar keinen Pick-up. Und jetzt lecken Sie mich am Arsch.« Es machte klick, und die Leitung war unterbrochen.
Gideon legte auf und schaltete das Aufzeichnungsgerät aus. Dann hörte er sich das Gespräch, das er soeben geführt hatte, dreimal an. »Was reden Sie denn da? Ich besitze gar keinen Dakota«, sprach er laut nach. »Hören Sie, mein Freund, haben Sie Bohnen in den Ohren? Sie haben es mit der falschen Person zu tun. Ich besitze gar keinen Pick-up.« Gideon wiederholte die Sätze mehrmals in unterschiedlicher Reihenfolge, bis er das Gefühl hatte, Betonung, Tonfall und Satzmelodie genau hinzubekommen.
Er nahm den Hörer zur Hand und wählte nochmals, diesmal die IT-Abteilung in Fort Belvoir.
»IT«, lautete die Antwort. Lamoine Hopkins’ Stimme.
»Lamoine?«, sagte Gideon im Flüsterton. »Ich bin’s, Kenny.«
»Kenny, was zum Teufel?« Hopkins wurde sofort misstrauisch. »Was soll denn das Geflüster?«
»Ich habe ’ne Scheißerkältung. Und … was ich zu sagen habe, ist heikel.«
»Heikel? Was soll das heißen?«
»Lamoine, du hast ein Problem.«
»Ich? Ich habe ein Problem? Was meinst du damit?«
Gideon blickte auf einen Zettel mit Notizen. »Ich habe einen Anruf von einem gewissen Roger Winters erhalten.«
»Winters? Winters hat dich angerufen?«
»Ja. Er hat gesagt, dass es ein Problem gibt. Hat mich gefragt, wie oft du mich aus dem Büro angerufen hast, solche Sachen.«
»Oh, mein Gott.«
»Ja.«
»Er wollte wissen«, fragte Gideon alias Kenny, »ob du mich von deinem Büro-Computer aus angerufen hast, über VoIP oder Skype.«
»Verdammt, das wäre ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften! So etwas mache ich nicht!«
»Er behauptet aber, dass du’s getan hast.«
Gideon hörte Lamoine schwer atmen. »Aber das stimmt nicht!«
»Das habe ich ihm auch gesagt. Hör zu, Lamoine, da drüben bei dir wird eine Security-Prüfung durchgeführt, darauf kannst du Gift nehmen, und irgendwie haben die dich auf dem Kieker.«
»Und was soll ich jetzt machen?«, fragte Hopkins ziemlich weinerlich. »Ich habe nichts Unrechtes getan! Ich meine, ich könnte gar keinen VoIP-Anruf von hier tätigen, selbst wenn ich das wollte!«
»Und warum nicht?«
»Wegen der Firewall.«
»Es gibt Wege, eine Firewall zu umgehen.«
»Machst du Witze? Wir unterliegen der Geheimhaltung!«
»Es gibt immer einen Weg.«
»Verdammt noch mal, Kenny, ich weiß, dass es keinen Weg gibt. Ich arbeite im IT-Bereich, weißt du noch? Genau wie du. Es gibt nur einen herausgehenden Port im gesamten Netzwerk, und der lässt auch nur mit einem Passwort verschlüsselte Datenpakete an besonderen Knotenpunkten durch, von denen alle sicher sind. Und selbst dann dürfen die Datenpakete nur durch bestimmte externe IPs versendet werden. Sämtliche geheimen Dokumente in diesem Archiv sind digitalisiert, und man ist hier superparanoid, was die elektronische Sicherheit angeht. Es besteht absolut keine Möglichkeit, dass ich per Skype nach draußen telefonieren kann! Ich kann nicht mal eine E-Mail rausschicken!«
Gideon hustete, schnaubte, schneuzte sich. »Du kennst nicht zufällig die Port-Nummer?«
»Doch, natürlich, aber ich hab keinen Zugang zu den wöchentlich erneuerten Passwörtern.«
»Hat dein Chef, Winters, Zugang?«
»Nein. Nur die obersten drei Leute in der Organisation erhalten das Passwort – der Direktor, der stellvertretende Direktor und der Sicherheitschef. Ich meine, mit dem Passwort könnte man ziemlich mühelos jedes Geheimdokument hier drin nach draußen mailen.«
»Generiert nicht ihr in der IT-Abteilung die Passwörter?«
»Machst du Witze? Die kriegen wir von denen da oben in einem Sicherheitskuvert. Ich meine, die bringen den Umschlag zu Fuß hier rüber. Das Passwort wird in keinem der elektronischen Systeme gespeichert, es wird von Hand auf einem dämlichen Blatt Papier notiert.«
»Das Problem ist die Port-Nummer«, sagte Gideon. »Ist die niedergeschrieben?«
»Die Nummer wird in einem Tresor aufbewahrt. Aber viele Leute kennen sie.«
Gideon hüstelte. »Klingt in meinen Ohren so, als wollte man dir was anhängen. Könnte sein, dass einer von den Oberen Mist gebaut hat und nach jemandem sucht, der den Kopf dafür hinhält. ›Schieben wir’s Lamoine in die Schuhe!‹«
»Unmöglich.«
»So was passiert andauernd. Es sind immer die Kleinen, die eins reingewürgt bekommen. Du musst dich schützen, Alter.«
»Und wie?«
Gideon zog das Schweigen noch ein wenig in die Länge. »Ich habe da eine Idee … Könnte eine richtig gute sein. Wie hieß die Port-Nummer noch gleich?«
»Sechs-eins-fünf-eins. Aber warum willst du die überhaupt wissen?«
»Ich checke mal ein paar Sachen und ruf dich heute Abend wieder an. Bis dahin erwähne niemandem gegenüber unser Gespräch, wart einfach ab, mach deine Arbeit, halt den Ball flach. Ruf mich nicht an – deine Anrufe werden garantiert abgehört. Wir reden, sobald du zu Hause bist.«
»Ich begreife das alles nicht. Hör mal, danke, Kenny. Echt.«
Gideon hustete noch einmal. »Aber dafür sind Freunde doch da.«
5
Nachdem Gideon aufgelegt hatte, kleidete er sich rasch aus. Er schob die Tür zum begehbaren Kleiderschrank auf und legte einen Kleidersack aufs Bett. Er holte ein duftendes, maßgeschneidertes Turnbull-&-Asser-Hemd daraus hervor, streifte es über seinen schlanken Oberkörper und knöpfte es zu. Als Nächstes kam ein blauer Anzug von Thomas Mahon dran. Er zog die Hose an, schloss den Gürtel, band sich eine geblümte Krawatte von Spitalfield (woher hatten die Engländer bloß diese Namen?), zog den Knoten mit kurzem Ruck zu und streifte die Jacke über. Er gab etwas Haargel auf die Handflächen und strich sich das Haar nach hinten. Zum Abschluss kämmte er ein ganz klein wenig graue Haartönung in die Koteletten, was ihn im Handumdrehen fünf Jahre älter aussehen ließ.
Er drehte sich um und betrachtete sich im Spiegel. 3200 Dollar für das neue Ich – Hemd, Anzug, Schuhe, Gürtel, Krawatte, Haarschnitt –, 2900 für Reisekosten, Motel, Auto und Chauffeur. Bezahlt hatte er das alles mit vier brandneuen Kreditkarten, die er sich zu ebendiesem Zweck besorgt und bis auf den letzten Dollar ausgereizt hatte, wobei allerdings so gut wie keine Hoffnung bestand, dass die Kredite je zurückgezahlt werden würden.
Willkommen in Amerika.
Der Wagen wartete bereits vor dem Motel, ein schwarzer Lincoln Navigator. Gideon setzte sich in den Fond und nannte dem Chauffeur die Adresse. Er ließ sich ins weiche Nappaleder sinken, während der Wagen anfuhr, fasste sich und versuchte, nicht an den Preis, nämlich 300 Dollar pro Tag, zu denken. Und übrigens auch nicht an den sehr viel höheren Preis, den er zu zahlen hätte, sollte man ihn bei seinem Schwindel erwischen …
Weil nur leichter Verkehr herrschte, bog der Wagen eine halbe Stunde später auf die Zufahrtsstraße von Fort Belvoir, in dem das Direktorium für Informationsmanagement von INSCOM untergebracht war: ein niedriges, außerordentlich hässliches Gebäude aus den sechziger Jahren inmitten von Robinien und umgeben von einem extrem großen Parkplatz.
Irgendwo in dem Gebäude saß Lamoine Hopkins und schwitzte bestimmt schon Blut und Wasser. Und an irgendeiner anderen Stelle in dem Haus befand sich das geheime, von Gideons Vater verfasste Gutachten.
»Fahren Sie vor den Haupteingang und warten Sie auf mich«, sagte Gideon. Seine Stimme klang, wie ihm selbst auffiel, ein wenig piepsig vor lauter Nervosität.
»Entschuldigen Sie, Sir, aber das da ist ein Halteverbotsschild.«
Gideon räusperte sich und entgegnete ruhig und selbstbewusst: »Wenn jemand fragt, sagen Sie, Kongressabgeordneter Wilcyzek ist mit General Moorehead in einer Besprechung. Aber wenn darauf bestanden wird, machen Sie keine Szene, fahren Sie einfach weiter und stellen den Wagen irgendwo ab. In spätestens zehn Minuten dürfte ich hier fertig sein.«
»Ja, Sir.«
Gideon stieg aus und ging den Fußgängerweg entlang, schob die Eingangstür auf und steuerte auf den Empfangs-/Informationstresen zu. Die weiträumige Lobby war voll von militärischem Personal und wichtigtuerischen Zivilisten, die mit langen Schritten hin und her eilten. Mein Gott, wie sehr er Washington hasste.
Kühl lächelnd trat Gideon vor die Frau an einem der Empfangstresen. Sie hatte sorgfältig frisiertes, bläulich gefärbtes Haar und sah aus wie aus dem Ei gepellt; eindeutig eine Prinzipienreiterin – eine, die ihre Arbeit extrem wichtig nahm. Konnte nicht besser sein. Wer sich strikt an die Vorschriften hielt, war besonders leicht zu berechnen.
Er lächelte und sagte dabei nur ein paar Zentimeter über ihren Kopf hinweg: »Kongressabgeordneter Wilcyzek, ich bin mit dem Stellvertretenden Kommandanten General Thomas Moorehead verabredet. Ich bin …«, er sah auf die Uhr, »… drei Minuten zu früh dran.«
Blitzartig richtete sie sich auf. »Selbstverständlich, Herr Kongressabgeordneter, einen Augenblick bitte.« Sie nahm den Telefonhörer zur Hand, drückte einen Knopf, sprach einen Moment. Dabei warf sie Gideon einen kurzen Blick zu. »Entschuldigen Sie, Herr Kongressabgeordneter, aber könnten Sie bitte Ihren Namen buchstabieren.«
Er seufzte ein wenig verärgert und kam ihrem Wunsch nach, wobei er ihr überdeutlich zu verstehen gab, dass sie den eigentlich kennen müsste. Mehr noch: Er zeigte das Gebaren eines Mannes, der erwartete, erkannt zu werden, eines Menschen, der nichts als Verachtung für all jene empfand, die ihn nicht kannten.
Sie schürzte die Lippen und sagte erneut etwas in den Telefonhörer. Es folgte ein kurzes Gespräch, dann legte sie auf. »Herr Kongressabgeordneter, es tut mir schrecklich leid, aber der General ist heute nicht im Hause, und seine Sekretärin hat keinen entsprechenden Eintrag in ihrem Terminkalender gefunden. Sind Sie sicher …?« Sie stockte, als Gideon sie mit strengem Blick fixierte.
»Ob ich sicher bin?« Er hob eine Augenbraue.
Inzwischen waren die Lippen der Empfangsdame vollständig geschürzt, und ihre blaustichigen Haare bebten beinahe vor unterdrücktem Beleidigtsein.
Er sah auf die Uhr und blickte dann zu der Empfangsdame auf. »Mrs. …?«
»Wilson.«
Er zog ein Blatt Papier aus der Hosentasche und reichte es ihr. »Sehen Sie selbst.«
Die E-Mail hatte er sich ausgedacht, angeblich geschrieben von der Sekretärin des Generals. Darin wurde der Termin mit dem General, von dem Gideon bereits wusste, dass er nicht anwesend sein würde, bestätigt. Mrs. Wilson las sie und reichte ihm das Blatt Papier zurück. »Es tut mir sehr leid, aber er ist offenbar nicht im Hause. Soll ich seine Sekretärin noch einmal anrufen?«
Gideon blickte sie weiterhin böse an, musterte sie mit eiskaltem Blick. »Ich möchte gern selbst mit seiner Sekretärin sprechen.«
Die Empfangsdame gab klein bei, nahm den Hörer von der Gabel und reicht ihn Gideon, aber vorher wählte sie noch die Nummer.
»Entschuldigen Sie, Mrs. Wilson, aber es handelt sich um eine Geheimsache. Ich muss doch sehr bitten.«
Jetzt wurde ihr Gesicht, das nach und nach errötet war, vollends puterrot. Schweigend stand sie auf und trat einen Schritt vom Informationstresen weg. Gideon legte den Hörer ans Ohr. Es klingelte, aber dann drückte er, während er sich umdrehte, um der Empfangsdame den Blick zu verstellen, einen Knopf und wählte, fast unmerklich, eine andere Nummer – die Durchwahl zur Sekretärin des Direktors General Shorthouse.
Nur die obersten drei Leute in der Organisation erhalten das Passwort – der Direktor, der stellvertretende Direktor und der Sicherheitschef …
»Büro des Direktors«, ließ sich die Stimme der Sekretärin vernehmen.
Leise und rasch sagte Gideon, in der Stimmlage des Mannes, den er am Vorabend an der Mülltonne angesprochen hatte: »Lamoine Hopkins aus der IT-Abteilung. Ich erwidere den Anruf des Generals. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit – eine Sicherheitslücke.«
»Einen Augenblick bitte.«
Er wartete. Nach einer Minute war General Shorthouse am Apparat. »Ja? Wo liegt das Problem? Ich habe Sie nicht angerufen.«
»Es tut mir leid, General«, sagte Gideon in Hopkins’ Tonfall, aber jetzt mit leiser, salbungsvoller Stimme, »dass Sie heute einen so schlechten Tag haben.«
»Wovon reden Sie, Hopkins?«
»Ihr System hat sich aufgehängt, Sir, aber der Ersatzrechner ist nicht eingesprungen.«
»Mein System hat sich nicht aufgehängt.«
»General? Unsere Rechner zeigen, dass sich Ihr gesamtes Netzwerk aufgehängt hat. Damit liegt ein Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen vor, Sir, und Sie wissen ja, was das bedeutet.«
»Das ist doch lächerlich. Mein Computer ist momentan eingeschaltet und funktioniert tadellos. Und warum rufen Sie mich vom Empfang aus an?«
»General, das ist Teil des Problems. Die Telefonie-Matrix ist mit dem Computer-Netzwerk verknüpft und zeigt falsch an. Loggen Sie sich bitte aus und wieder ein, während ich die Sache verfolge.« Gideon blickte zur Empfangsdame hin, die immer noch ein wenig abseits stand und sich gewissenhaft bemühte, nicht zu lauschen.
Gideon hörte Tastaturgeklapper. »Fertig.«
»Komisch, ich sehe unter Ihrer Netzwerk-Adresse keine Aktivität von Datenpaketen. Versuchen Sie noch mal, sich abzumelden.«
Wieder Tastengeklapper.
»Nichts, General. Sieht so aus, als könnte Ihre ID-Nummer gefährdet sein. Das ist schlimm – das dürfte einen Bericht erfordern, eine Untersuchung. Und es betrifft Ihr System. Es tut mir sehr leid, Sir.«
»Wir wollen nicht vorschnell sein, Hopkins. Ich bin mir sicher, wir kriegen das wieder hin.«
»Tja … wir könnten es versuchen. Aber dazu muss ich einen Neustart durchführen und anschließend Ihren Account von unserer Abteilung aus abfragen. Dafür brauche ich bitte Ihre ID-Nummer und Ihr Passwort.«
Pause. »Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen die geben darf.«
»Möglicherweise ist es Ihnen nicht bewusst, aber im Fall eines Netzwerk-Neustarts wird das Passwort automatisch verändert, also dürfen Sie es intern an die IT-Abteilung weitergeben. Wenn Sie sich damit unwohl fühlen, Sir, so verstehe ich das durchaus, aber dann muss ich die Nationale Sicherheitsbehörde anrufen, damit sie einer Aufhebung des Passworts zustimmt, es tut mir wirklich leid …«
»Na gut, Hopkins. Ich war mir dieser Bestimmung nicht bewusst.« Er nannte Gideon das Passwort und die ID-Nummer. Gideon notierte sich beides.
Nach einem Augenblick sagte er, mit riesengroßer Erleichterung in der Stimme: »Toll, der Neustart hat geklappt, Sir. Anscheinend hatte sich nur Ihr Bildschirm aufgehängt. Kein Sicherheitsverstoß. Damit wäre die Sache erledigt.«
»Ausgezeichnet.«
Gideon hob den Finger von der Taste und drehte sich zu der Empfangsdame um. »Entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen so viel Mühe gemacht habe.« Er reichte ihr den Hörer. »Es ist alles geklärt.« Und damit verließ er schnellen Schritts das Gebäude in Richtung des wartenden Autos.
Eine halbe Stunde später war Gideon wieder zurück in seinem Motelzimmer. Er legte sich aufs Bett und verband seinen Laptop mit einem ungesicherten Computer in den Tiefen der General Service Administration, in den er sich gehackt hatte. Er hatte sich entschlossen, die GSA ins Visier zu nehmen – die riesige Agentur, die US-Behörden mit Büromaterial, Telekommunikationsausstattung und Transportkapazitäten versorgte –, weil sie ein relativ leichtes Ziel bot, aber trotzdem innerhalb des Sicherheitskordons der Regierung lag.
Hopkins hatte ihm – unwissentlich – gesagt, dass INSCOM lediglich Dokumente an zuvor autorisierte IP-Adressen verschicken könne, die sich aber leider ebenfalls überwiegend innerhalb des Kordons befänden, der geheime Dokumente schützte … Mit einer Ausnahme: die National Security Archives der George Washington University. Das private Archiv, das größte der Welt neben der Bibliothek des US-Kongresses, sammelte Riesenmengen an Regierungsdokumenten, darunter praktisch alles, was routinemäßig unter das gesetzlich vorgeschriebene Programm zur Aufhebung des Geheimschutzes von Dokumenten fiel. Und in dieses Archiv strömte Tag für Tag ein wahrer Amazonas von Informationen.
Über den Computer der GSA schickte Gideon über den Port 6151 eine automatisierte Anfrage an das geschützte Archiv von INSCOM an der George Washington University mitsamt der Anweisung, dass über den gleichen Port eine PDF-Datei eines bestimmten als geheim eingestuften Dokuments verschickt werden solle. Diese Anweisung war durch das Shorthouse-Passwort autorisiert, und so landete das Dokument auf der Müllhalde der vom Geheimschutz befreiten Dokumente aus der Zeit des Kalten Krieges, die als Batch-Dateien Tag für Tag an die National Security Archives geschickt wurden. Die Datei wurde ordnungsgemäß übermittelt; sie passierte die Firewall des einzigen autorisierten Ports, wo das Passwort geprüft und genehmigt wurde. Und so wurde das Dokument schließlich zusammen mit Millionen anderer an die George Washington University weitergeleitet und in einer der Datenbanken des Archivs eingelagert.
Gideon hatte damit erfolgreich für die irrtümliche Aufhebung des Geheimschutzes einer Verschlusssache gesorgt und diese in dem riesigen Strom jener Daten versteckt, die den Sicherheitsbereich des Regierungssystems verließen. Jetzt blieb nur noch eines zu tun: Er musste das geheime Dokument herausholen.
Tags darauf um elf Uhr betrat ein ungepflegt aussehender, jedoch unbestreitbar reizender Gastprofessor mit Namen Irwin Beauchamp, bekleidet mit einer Tweedjacke, einer farblich nicht dazu passenden Cordhose, ausgetretenen Budapester Schuhen und einer Strickkrawatte (32 Dollar; Heilsarmee) die Gelman Library der George Washington University und bat um die Herausgabe mehrerer Dokumente. Er war noch nicht als ständiger Leser angemeldet und hatte seinen befristeten Bibliotheksausweis verloren, aber eine freundliche Sekretärin erbarmte sich des schusseligen Burschen und gestattete ihm den Zugang zum System. Eine halbe Stunde später verließ Beauchamp das Gebäude mit einer schmalen Aktenmappe unter dem Arm.
Zurück im Hotel, breitete Gideon Crew mit zittrigen Händen die in der Mappe befindlichen Papiere aus. Der Augenblick der Wahrheit war gekommen, der Wahrheit, die ihn frei machen würde – oder nur noch unglücklicher.
6
Zur Kritik des Diskreten Logarithmus-Verschlüsselungsverfahrens EVP-4 Thresher: Eine Angriffsstrategie auf Grundlage einer theoretischen Backdoor-Kryptoanalyse unter Verwendung der φ-Torsionspunkte einer elliptischen Kurve in der Charakteristik φ.
Gideon hatte an der Universität und später am Massachusetts Institute of Technology zwar zahlreiche Mathematikseminare besucht, aber die Mathematik in diesem Aufsatz war ihm doch ein wenig zu hoch. Trotzdem verstand er genug, um zu erkennen, dass er einen »Rauchenden Colt« in Händen hielt. Es handelte sich um das Gutachten, mit dem sein Vater Thresher kritisiert hatte, um jenes Gutachten, das laut seiner Mutter vernichtet worden war.
Doch es war gar nicht vernichtet worden. Am wahrscheinlichsten war, dass der verantwortliche Dreckskerl – weil er es für zu schwierig oder riskant hielt, das Dokument vollständig zu vernichten – den Artikel in einem Archiv versteckt hatte, von dem er annahm, dass es alle Sachen für immer unter Verschluss halten würde. Denn welcher amerikanische General in der Ära der Berliner Mauer hätte denn gedacht, dass der Kalte Krieg je zu Ende geht?
Gideon las mit klopfendem Herzen weiter, bis er schließlich zum letzten Absatz kam. Er war in Fachchinesisch abgefasst, aber der Inhalt war reines Dynamit.
Fassen wir zusammen: Es ist die Ansicht des Verfassers, dass das vorgeschlagene Verschlüsselungsverfahren EVP-4Thresher,das auf der Theorie der diskreten Logarithmen basiert, fehlerhaft ist. Auf Grundlage der Theorie der elliptischen Funktionen, die über die komplexen Zahlen definiert sind, wurde die Existenz einer potenziellen Klasse von Algorithmen nachgewiesen, welche bestimmte diskrete Logarithmusfunktionen in Echtzeit-Computing-Parametern lösen können. Zwar sah sich der Autor bislang noch nicht imstande, gesonderte Logarithmen zu identifizieren, doch hat er auf den vorliegenden Seiten nachgewiesen, dass dies möglich ist.
Das vorgeschlagene Verfahren Thresher ist daher angreifbar. Sollte es übernommen werden, würden nach Einschätzung des Verfassers angesichts der hohen Qualität der mathematischen Forschungen in der Sowjetunion aus diesem Standard entwickelte Codes binnen eines vergleichsweise kurzen Zeitraums entschlüsselt werden.
Der Autor empfiehlt daher dringend, das Verschlüsselungsverfahren EVP-4Thresher in seiner derzeitigen Form nicht zu übernehmen.
Das war’s. Der Beweis, dass man seinen Vater hereingelegt hatte. Um ihn dann zu ermorden. Gideon Crew wusste bereits alles über den Mann, der das begangen hatte: Lieutenant General (a.D.) Chamblee S. Tucker, derzeit Vorstandschef von Tucker and Associates, einer der bekanntesten Lobbyfirmen der wehrtechnischen Industrie in der K Street. Das Unternehmen repräsentierte viele der größten Waffenlieferanten des Landes, und Tucker hatte Schulden aufgenommen, um sein Geschäft zu finanzieren. Er scheffelte Millionen, die er wegen seines extravaganten Lebensstils allerdings umgehend wieder zum Fenster hinauswarf.
Für sich genommen besagte das Dokument nicht viel. Gideon wusste, dass alles gefälscht beziehungsweise vermeintlich gefälscht werden konnte. Das Dokument stellte keinen Endpunkt dar, sondern den Ausgangspunkt für die kleine Überraschung, die er für Chamblee S. Tucker vorbereitet hatte.
Mittels des Computers, in den er sich zuvor in die General Services Administration gehackt hatte, entzog Gideon dem Dokument die Wasserzeichen, welche es als geheim auswiesen, und schickte es an ein Dutzend große Computerdatenbanken auf der ganzen Welt. Nachdem er das Dokument auf diese Weise vor der Vernichtung geschützt hatte, sandte er von seinem eigenen Computer eine E-Mail an [email protected], mit dem Dokument als Anhang. Der Text der E-Mail lautete:
General Tucker!
Ich weiß, was Sie getan haben. Und ich weiß auch, wie Sie es angestellt haben.
Am Montag schicke ich die beigefügte Datei an verschiedene Redakteure der Post, der Times, von AP und von mehreren Nachrichtensendern – mit einem erläuternden Text.
Ihnen ein schönes Wochenende.
Gideon Crew
7
Chamblee S. Tucker saß hinter einem riesigen Schreibtisch im mit Eichenholz getäfelten Arbeitszimmer in seinem Haus in McLean, Virginia, und wog nachdenklich einen fast zwei Kilo schweren Briefbeschwerer aus Murano-Glas in der Hand. Für sein Alter von siebzig Jahren war er fit – und stolz darauf.
Er legte den Briefbeschwerer in die andere Hand und drückte ein paarmal.
Es klopfte.
»Herein.« Äußerst behutsam legte er den Briefbeschwerer wieder hin.
Charles Dajkovic betrat das Arbeitszimmer. Er war in Zivil, aber sein Gebaren und seine Haltung verrieten, dass er ein Militär war: kürzester Haarschnitt mit rasierten Seitenpartien, kräftiger Nacken, aufrecht wie ein Ladestock, stahlblaue Augen. Das einzige Zugeständnis an das zivile Leben war sein grauer, kurz geschnittener Schnurrbart.
»Guten Morgen, General.«
»Guten Morgen, Charlie. Nehmen Sie Platz. Wenn Sie Kaffee möchten …«
»Danke.« Dajkovic ließ sich auf dem angebotenen Stuhl nieder. Tucker wies auf einen Beistelltisch in der Nähe, auf dem ein Silbertablett mit Kaffeekanne, Zucker und Sahne und Tassen stand. Dajkovic bediente sich.
»Lassen Sie mich überlegen …« Tucker hielt inne. »Wie lange arbeiten Sie nun schon für Tucker and Associates, zehn Jahre?«
»Das ist ungefähr richtig, Sir.«
»Aber Sie und ich, wir arbeiten schon sehr viel länger zusammen, kennen uns schon lange.«
»Ja, Sir.«
»Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Operation Unbändiger Zorn. Und genau deshalb habe ich Sie ja auch eingestellt. Weil das Vertrauen, das auf dem Schlachtfeld entsteht, das edelste Vertrauen ist in dieser verrückten Welt. Männer, die nicht gemeinsam gekämpft haben, kennen eben nicht die volle Bedeutung der Worte Vertrauen und Loyalität.«
»Das ist wohl wahr, Sir.«
»Und eben darum habe ich Sie gebeten, zu mir nach Hause zu kommen. Weil ich Ihnen vertrauen kann.« Der General machte eine Pause. »Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Sie hat eine Moral, aber die müssen Sie selbst herausfinden. Ich darf nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie werden sehen, warum.«
Ein Nicken.
»Haben Sie schon einmal von John Walker Lindh gehört?«
»Der ›amerikanische Taliban‹?«
»Genau der. Und von Adam Gadahn?«
»Ist das nicht der Bursche, der al-Qaida beigetreten ist und für Bin Laden die Videos dreht?«
»Genau. Ich bin in den Besitz einiger hochgeheimer Informationen bezüglich eines dritten US-amerikanischen Überläufers gelangt – nur ist dieser sehr viel gefährlicher.« Wieder hier Tucker inne. »Der Vater dieses Burschen hat für INSCOM