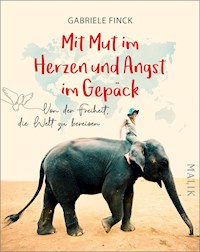
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gabriele Finck leidet an einer Angststörung. Mit zwanzig wurde sie von der Angst in einen kleinen Radius gezwängt, ans Haus gefesselt, jeder Ausflug wurde zur Herausforderung. Doch man muss keine Angsterkrankung haben, um sich vor der Fremde zu fürchten – Reisen ist für viele nur eine Sehnsucht. Die Autorin erklärt, wie sie es geschafft hat, wieder loszugehen, wie man die Furcht in den Koffer packt und mit ihr aufbricht. Sie macht Mut und zeigt, dass es sich lohnt, an Träumen von Abenteuern und Reisen festzuhalten. Denn im Auf und Ab zwischen Angst und Lebensfreude spüren wir, dass wir leben. Dieses Buch ist für Menschen, die: - immer wieder unter Ängsten leiden - manchmal wegen Panikattacken zu Hause bleiben - auf Reisen gestresst sind - Angst vor dem Reisen haben, aber von fremden Ländern und Abenteuern träumen - gerne mehr wagen würden, aber von unbekannten Situationen schnell überfordert sind Das ultimative Anti-Angst-Programm fürs Reisen Survival-Kit gegen Panikattacken
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Den mutigen Angsthasen
Mit 39 Abbildungen
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Fabian Bergmann
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Hugh Sitten/Contributor/Getty Images; stock.adobe.com; iStock by Getty Images
Illustrationen: Andrea Köster
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Vorab
Wohin soll die Reise gehen?
Warum ich dieses Buch schreibe
Auf einmal war da Angst
Angst vermiest den Urlaub
Gar nichts geht mehr
Der Traum vom Reisen
Auf zur Reise! Fertig? Los!
Die kleinen Reisen vor der großen Reise
Angst zu versagen
Mutig zur Welt hinaus – in die Welt hinein!
Wenn der Schritt sich zu bedrohlich anfühlt
Sei dein eigener Kompass
Reisen – eine Liebeserklärung ans Leben
Den Schritt wagen
Der Ruf nach Abenteuer und die Vorbereitung darauf
Pläne schmieden, Koffer packen
Checklisten und Reisetagebuch
Sicherheitsvorkehrungen
Minimalistisch packen
Ein kleines Festessen
Ein Dach über dem Kopf
Muffensausen
Endlich (wieder) unterwegs
Angsthase on the road
Ein Ja zu dem, was kommen mag
Hallo, ich bin Hypochonder
Übersensibel und überdramatisch
Hypochondrie ist gefährlich
Was soll schon passieren?
Aber was, wenn …
Ich habe Angst – was hilft mir jetzt?
Sei gut zu dir
Alarmstufe Rot
Der heilsame Atem
Gedankenkreisel
Beobachten, wie die Panik wieder geht
Hör auf damit!
Lass es raus
Angstgedanken sind nur Gedanken
Auf Irrwegen in Marseille
Deine Stimme klingen lassen
Mit allen Sinnen
Kleine Körperkunde
Botschafter an deiner Tür
Liebevolles Selbstgespräch
Bring es zu Papier
Läuft. Rückwärts und bergab. Aber läuft.
Bahnhofswirren
Nachtzug-Strapazen
Weiter nach Süden
Anders als erhofft
Mutig ist, überhaupt loszugehen.
Alles ist veränderlich.
Schöner »scheitern«
Baustellen im Leben
Lass gut sein
Vor der Angst weglaufen
Inmitten des Sturms
Meine Angst und die anderen
Und ich will segeln gehen
Du bist nicht allein!
Wie man einem Freund/einer Freundin mit Ängsten helfen kann
Den Wolf zähmen
Lust auf Leben
Einfach losgehen
Ich freu mich über Post von dir
Vorab
Liebe Leserin, lieber Leser,eine kleine Info vorweg: Ich weiß noch zu gut, wie ich in Phasen größter Angst Hilfe in Büchern suchen wollte, aber mich aus lauter Furcht davor, dass darin vielleicht Sachen stehen könnten, die mich verunsichern würden, manchmal gar nicht an die Lektüre traute. Alle beispielhaften Beschreibungen von Angstzuständen und Körperempfindungen, die in solchen Momenten auftreten können, musste ich immer überblättern. Man spricht im Fachjargon von sogenannten Triggern, wenn einen Wörter oder Bilder an die eigenen unverarbeiteten Probleme erinnern und dadurch unbeabsichtigt in Panik versetzen. Deswegen gibt es in diesem Büchlein hie und da liebevolle Monsterchen – die sehen so aus:
Sie stehen immer in der Nähe eines solchen möglichen Triggers. Ich habe versucht, meine Geschichte und meine Sprache möglichst triggerfrei zu halten – wenn ihr also mutig seid, könnt ihr euch trotzdem an die Texte wagen, die markiert sind. Die kleinen Monster beißen nicht, versprochen!
Wohin soll die Reise gehen?
»Es ist ganz wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den andern Satz, dass vorwärts gelebt werden muss.«
Søren Kierkegaard
Die Abenteuer sind irgendwo da draußen, und sie warten nur auf mich – habe ich immer gedacht. Mit großen Augen saß ich am Fenster und schaute voller Sehnsucht hinaus in die Welt. Eine Welt, die mich lockte, vor der ich aber auch Angst hatte. War sie nicht riesig und gefährlich, unvorhersehbar und furchteinflößend? Zwar wollte ich raus, dahin, wo das Leben lockte, aber ich war überzeugt: Dort draußen würde ich Angst haben, Panik schieben, mich gar nicht mehr wohlfühlen. Im Grunde hielt mich die Angst vor der Angst fest hinter meinem Fenster. Nicht die Welt da draußen machte mir Schwierigkeiten, sondern die Welt in meinem Innern. Ich war gefangen in mir. Ich war angstgestört.
Diese Sehnsucht nach dem Reisen habe ich trotzdem über all die Jahre niemals verloren. Für mich war Reisen ein Symbol für Mut, Freiheit und Unabhängigkeit. Würde ich endlich wieder reisen, wäre das der Beweis, dass ich meine Angsterkrankung überwunden hätte. So dachte ich zumindest. Schrittweise lernte ich, mich wieder dem Leben zuzuwenden, mir mehr zuzutrauen, und meine Angststörung ließ langsam nach. Gleichzeitig musste ich feststellen, dass es bei dieser Sache mit der Angst nicht nur Schwarz oder Weiß gibt, auch wenn ich das gern gehabt hätte. Jedes Mal, wenn ich zögerliche Schritte in Richtung Freiheit und Reisen unternahm, suchten mich auch wieder die Ängste heim. Darum schreibe ich dieses Buch – für alle, die das tiefe Tal der Angst kennen und die nun allmählich wieder bereit sind, sich die Welt und das bunte Leben zurückzuerobern.
Die Angst ist zwar noch da, aber du bist über die Phase hinaus, dass sie dich total lähmt. Mit diesem Buch möchte ich dir Mut machen. Mut, dich aufzumachen und deine Sehnsüchte zu leben – auch wenn du jetzt noch Ängste hast. Warte nicht auf den Moment, bis du endlich wieder »total angstfrei« bist. Gehe los, mit der Angst im Gepäck! Lass dich auf die Erfahrungen ein, ganz gleich, was da kommen mag. Ich möchte dir mit meinem in vierzehn Jahren gesammelten Erfahrungsschatz hilfreich zur Seite stehen und dir mit diesem Buch einen kleinen Begleiter an die Hand geben, der dich auch in schwierigen Situationen versteht und trägt. Sag Ja zu dem Abenteuer, das sich Leben nennt!
Warum ich dieses Buch schreibe
Durch meine Zeit mit der Angststörung habe ich enorm viele Bücher gelesen, die sich mit Selbsthilfe bei Angst und Panik, aber auch dem ganzen Rattenschwanz an dazugehörigen psychologischen Themen beschäftigten. Dabei griffen mir die meisten Autoren einfach zu kurz. Entweder wurde eine schnelle Lösung propagiert: simple Lach-doch-mal-wieder-Techniken, beschrieben von Leuten, die das volle Ausmaß körperlicher Angst gar nicht erfassen konnten und die unter Angst lediglich »Bammel« und subtiles Unwohlsein verstanden. Oder ich stieß auf zentnerschwere, komplizierte Fachliteratur, die im Bemühen, die Psychologie der Angst zu ergründen, kalt und teilnahmslos wirkte. Viele Ratgeber stammen von Therapeuten, also »Menschen vom Fach«. Wer nun allerdings die körperlich spürbare Form von Angst nur aus dem Studium und von Erzählungen der Patienten kennt, der neigt möglicherweise dazu, Angst als etwas abzutun, was nur im Kopf beginnt und dementsprechend auch dort wieder ganz leicht beendet werden kann.
Ich wollte mehr von einem Buch. Ich wollte eines, das mir hilft! Ein Buch, das mich begleitet, dessen Worte mir guttun, auch in unmittelbaren Momenten der Angst, das mich versteht, aufbaut und mir Hoffnung macht. Da ich so ein Buch nicht fand, schreibe ich es nun selbst. Ich schreibe es für dich, um dich zu unterstützen, gleichzeitig aber auch für mich. Denn das Schreiben hilft mir, mich immer wieder an meine innere Weisheit zu erinnern. Ich komme dabei mir selbst auf die Schliche und finde zu größerer Klarheit.
Meine Ratschläge laufen am Ende vielleicht sogar auf dieselben Tipps wie die der »Menschen vom Fach« hinaus. Ich hoffe jedoch, dass ich vermitteln kann, wie gut vertraut mir Ängste sind. Über viele Jahre musste ich lernen, dass eine Angststörung (wie jede andere Krankheit auch) nicht auf magische Weise durch ein Fingerschnippen verschwindet. Natürlich gibt es Atem-, Klopf- und Entspannungstechniken. Es gibt auch Medikamente und Spritzen. Und sicherlich entfaltet jede Methode ihre Wirkung, besonders, wenn du wirklich daran glaubst. Die Angst ist jedoch kein gebrochenes Bein, das zurechtgerückt, geschient, geschont und trainiert werden muss, bis es wieder funktionstüchtig ist. Angst kann Teil deiner Wesensart und dein ganz persönliches Ventil sein, um innere Belange auszudrücken, sichtbar zu machen. Angst ist so viel mehr als ein ärgerlicher Störfaktor! Vielleicht hast du mehr Glück, und deine Angst hat dich nicht so tief gepackt wie meine mich all die Jahre. Aber im Grunde ist das egal. Tatsache ist, dass ein Übermaß an Ängsten deine Lebensqualität gewaltig einschränkt. Auch dir scheinen die friedvolle Leichtigkeit und die fröhliche Lebendigkeit abhandengekommen zu sein.
Damit du dir ein Bild von meinen Erfahrungen mit Angst und Panik machen kannst, möchte ich ein bisschen ausholen und meine Geschichte erzählen.
Auf einmal war da Angst
Ich war noch keine zwölf Monate von zu Hause fort und absolvierte mein freiwilliges Jahr in einem Filmzentrum, denn ich wollte unbedingt Regisseurin werden und Dokumentarfilme drehen. Gerade zwanzig geworden, reiste ich gern in der Weltgeschichte herum, lud oft Freunde zu mir nach Hause ein und war bereit, die Welt zu erobern. Ich hatte viel vor im Leben und ahnte nicht, dass ich bald total ausgebremst werden würde. Jetzt im Nachhinein sehe ich die Vorboten meiner Angststörung ganz deutlich. So hatte ich mich ein paar Monate vorher intensiv mit dem Thema »Sterben« auseinandergesetzt. Die aufkommende Verzweiflung über die eigene Endlichkeit hatte ich jedoch einfach weggedrückt. In Wahrheit rumorte aber ein lang anhaltendes Trauma in mir, das sich in meiner Kindheit durch meine gesundheitlichen Erfahrungen und zahlreiche Krankenhausaufenthalte entwickelt hatte.
An einem Tag im September saß ich ahnungslos bei der Arbeit, war am Computer beschäftigt, als ich plötzlich spürte, wie mein Herz stolperte. Das Blut begann in meinen Ohren zu rauschen, und mir war auf einmal ganz seltsam und benommen zumute. Instinktiv legte ich mich neben dem Schreibtisch auf den Fußboden, zittrig und verwirrt. Ich dachte, meine letzte Stunde sei gekommen. Mein Chef sah mich da liegen und meinte etwas ungehalten, dass ich doch im Ruheraum das Sofa nehmen solle, wenn ich mich nicht gut fühlte. Keine Ahnung, wie ich es dorthin geschafft habe. Da lag ich dann, vollkommen fertig mit der Welt – zutiefst aufgewühlt und unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Ein guter Freund hatte sich neben mich gesetzt. Er schaute mich mit großen traurigen Augen an, weil er vielleicht ähnlich erschrocken und besorgt war wie ich. Wie man sieht, bin ich damals nicht gestorben. Ich wurde noch zum Arzt gefahren, der nur wenig einfühlsame Worte für mich übrig hatte, dann lag ich krankgeschrieben zu Hause in meinem Bett und telefonierte verheult mit meinem Freund. Das ist nun über zehn Jahre her. Inzwischen weiß ich, dass noch viel schlimmere und stärkere Panikattacken auf mich warteten, und dass ich auch diese überlebt habe.
Die Abwärtsspirale
Zum Studieren zog ich mit meinem Freund zusammen. Kaum hatten die Vorlesungen begonnen, sah ich mich wieder mit Panikattacken konfrontiert.
Die ganze Zeit beobachtete ich meinen Körper skeptisch, jede Regung, jede Abweichung von einer selbst festgelegten Norm wurde von mir registriert und überdramatisch interpretiert. Ich hatte Angst, dass etwas mit mir nicht in Ordnung sei. Dass ich vielleicht eine Krankheit hätte, die gefährlich sei. Dass ich nicht mehr lange zu leben hätte. Ich hatte solche Angst, bald zu sterben, obwohl mir jeder rein äußerlich wohl nur beste Gesundheit bescheinigt hätte. Ich versuchte mit aller Macht, meine Ängste zu verdrängen, aber sie tauchten immer wieder auf – und jedes Mal fühlte sich alles bedrohlicher an als vorher. Ich verstand diesen komischen Zustand, mich selbst nicht.
Ich klapperte alle möglichen Ärzte ab, weil ich sofort von meinen Sorgen befreit werden wollte. Die »Götter in Weiß« waren zwar in der Lage, mich für kurze Zeit zu beruhigen, doch die Angst kehrte immer wieder.
In der Hoffnung auf eine Lösung ging ich zum Unipsychologen.
Der kleine Raum war muffig und wenig einladend. Der Mitarbeiter des Psychosozialen Diensts bot mir ein Glas Wasser an. »Wo drückt denn der Schuh?« Stammelnd suchte ich nach Worten. Dann beschrieb ich ihm einfach meine letzte Panikattacke: Ich sitze im Hörsaal, höre den Professor über Emile Durkheim und soziale Normen referieren, als mich plötzlich der Schlag trifft.
Meine ich zumindest. Von einem Moment auf den anderen fängt mein Herz an zu rasen, mir ist total schwindlig, und es fiept im rechten Ohr. Ich ringe um Luft. Ich kriege eine Krise! Irgendwie schaffe ich es, meine Sachen zu packen und aus der Vorlesung zu fliehen. Draußen auf dem Gang sitze ich auf einer Bank und bin mir ganz sicher, dass ich ins Krankenhaus muss. Stattdessen fange ich an zu heulen. Soziale Norm bin ich schon mal nicht!
So kam ich ins Reden, meine Gefühle sprudelten nur so hervor. Der Unipsychologe hörte sich alles wenig beeindruckt an, nickte dann, als hätte er das alles schon einmal gehört, und sagte, er wolle mir mal einen Ratschlag geben. Ich setzte mich aufrecht hin, war gespannt, ja voller Hoffnung. Da meinte er trocken zu mir: »Duschen Sie kalt!« Wie bitte? »Sie müssen einfach jeden Morgen kalt duschen. Der Rest legt sich von alleine.« Er verabschiedete mich mit einem wohl freundlich gemeinten Zwinkern. Ich fühlte mich so rein gar nicht verstanden. Ich spürte ja, dass etwas nicht in Ordnung mit mir, mit meiner Psyche war.
Aber ich verlor den Mut nicht. Mir war klar, dass der Unipsychologe wohl nicht seinen besten Tag oder ich einfach das Pech gehabt hatte, an die falsche Person geraten zu sein. Denn ich wusste ganz sicher, dass ich professionelle Hilfe brauchte. Doch viele Psychologen haben eine so lange Warteliste, dass es schier zum Verzweifeln ist. Ich wollte jetzt einen Rat und nicht erst in acht Monaten! Ich recherchierte, bis mir der Kopf rauchte, und fand schließlich eine »Psychologin in Ausbildung«. Hier war sofort ein Termin frei, denn ich war ihre erste Klientin überhaupt – und sie meine erste Therapeutin. Mit ihr war es menschlich wunderbar, aber unsere Gespräche glichen mehr einem Kaffeekränzchen. Ich war so »clever«, recht bald herauszufinden, was ich sagen musste, damit die Therapeutin mit mir zufrieden war. Als sie mich fragte, wann ich denn mein Problem überwunden haben möchte, sagte ich im vollen Ernst: »Nächsten Sommer wäre schön!« Meine ganze Misere begriff ich nur auf der Kopfebene. Wahrscheinlich war ich noch nicht bereit, mir die wirklich dunklen Stellen meines Seelenlebens anzuschauen.
Angst vermiest den Urlaub
Als mir meine Angststörung noch fast neu war, sah ich mich noch nicht gezwungen, Dinge anders als zuvor anzugehen. Ich machte weiter wie bisher und hoffte einfach, dass mich keine Panikattacke erwischen würde. So gesehen war das noch eine gute Zeit, da die Angst vor der Angst mich noch nicht in ein Vermeidungsverhalten getrieben hatte (und ich nur noch zu Hause verheult und Däumchen drehend herumsaß).
Also stand ich mir bei der Urlaubsplanung mit meinem Freund Micha und seinem besten Freund auch nicht selbst im Wege. Wir waren jung und abenteuerlustig, wollten so viel wie möglich sehen, hatten aber natürlich kaum Geld in der Tasche. Unsere Wahl fiel auf Italien. Wir hatten nicht lange überlegt, wo genau wir eigentlich hinwollten. Ganz nach dem Motto: Hauptsache, in die Toskana und ans Mittelmeer! Die Zusagen der Couchsurfer bestimmten unsere Route: Dort, wo wir bleiben dürften, würden wir auch landen. Nach einem regen E-Mail-Verkehr mit einer Handvoll Leuten stand unser Reiseziel endlich fest: auf nach Marina di Grosseto!
So tourten wir – vollbepackt mit schweren Rucksäcken, an denen Isomatte und Sonnenhut baumelten – mit dem Schönen-Wochenende-Ticket von Nord nach Süd quer durch die Republik und übernachteten ausschließlich auf Sofas und Klappbetten. Je weiter südlich wir kamen, desto geringer wurde der Komfort der Bleibe – was uns aber kein bisschen störte. Zumal die unbequemsten Übernachtungsstätten seltsamerweise immer von den großzügigsten und herzlichsten Menschen zur Verfügung gestellt wurden. In München zum Beispiel durften wir unser Quartier noch in einem Gartenhäuschen beziehen. Der Altersunterschied zu unseren Gastgebern allerdings bewirkte wohl, dass wir kaum gemeinsame Interessensgebiete entdecken konnten. Die Gespräche plätscherten höflich vor sich hin, aber so richtig warm wurde leider keiner mit dem anderen. Nachdem wir Italien erreicht hatten, bestand unsere Unterkunft im vom Verkehr überfüllten Padua hingegen lediglich aus einem Durchgangszimmer – dafür bereitete uns Gastgeber Roberto eigens Sushi zu, und es gab viel zu erzählen und zu lachen.
Tags darauf setzten wir unsere Fahrt mit dem Bus fort. Die Fenster standen offen und ließen eine weiche frische Brise durch unsere Haare wehen. Ansonsten war es heiß und sonnig. Die dunstblauen Hügel am Horizont, einzeln stehende, sich zwischen Zypressen schmiegende lachsrosa Landhäuser und vorbeiziehende Sonnenblumenfelder machten klar, dass wir in der Toskana angekommen waren. In Marina di Grosseto erwartete uns Federico, ein Bär von einem Mann, wie aus der »Baywatch«-Serie entsprungen: Er lief stets mit roten Badeshorts und freiem – natürlich muskulösem und sonnengebräuntem – Oberkörper herum. Um seine Hüfte trug er lässig eine Gürteltasche. Sein Haar war kurz geschoren und sein Gesicht geprägt von einem strahlend weißen, ständigen Lächeln. Eigentlich hatte er Bildhauerei an der Kunstakademie in Mailand studiert. Nun aber machte er seinen lang gehegten Traum wahr: Direkt an der Promenade, direkt am Strand sollte ein Beach Resort entstehen, mit Restaurant, Badezubehör-Verleih und Strandduschen. Der Rohbau stand schon, der Wasseranschluss war bereits gelegt – aber Türen gab es noch keine. Und wir durften bereits vor der Eröffnung darin übernachten. Was für ein Glücksgriff!
Zunächst einmal galt es, das Gepäck abzustellen und die Gegend zu erkunden. Der Strand wirkte wie aus einem Urlaubsprospekt: Liegen so weit das Auge reichte! Jeder Strandklub hatte seine eigenen Stühle und Schirme, die sich alle farblich von den anderen unterschieden. In unserem Bereich waren die weiß-gelb gestreiften Schirme, direkt neben den lilafarbenen des Nachbarn. Vom schönen Sandstrand selbst war nicht mehr viel übrig, fast bis ans Wasser war der Küstenstreifen mit Liegestühlen zugepflastert. Dazwischen Volleyballnetze, kleine hölzerne Wachtürme der Rettungsschwimmer und Kinderspielplätze mit Plastikrutschen. Unseren Nachmittag verbrachten wir damit, Melonen zu essen, am Ufer zu planschen und durch den Ort zu streifen. In dieser Holiday-Atmosphäre hätte ich eigentlich entspannt und gelassen sein können – so wie die anderen um mich herum. Doch entlang der Strandpromenade wurde ich immer wieder von unguten Gefühlen eingeholt.
Vor meinen Augen verschwammen die Konturen der Umgebung. Alles drehte sich in meinem Kopf, als würde ich gleich in Ohnmacht fallen. Ich war wie gehetzt, ohne dass ich einen Grund dafür erkennen konnte. Während die Menschen um mich herum dahinbummelten, nach Sonnencreme rochen und ihr unbeschwertes Urlaubslachen erklingen ließen, starb ich innerlich tausend kleine Tode. Der Kampf gegen die immer wieder aufkeimende Panik erschöpfte mich. Damals kam mir nicht einmal im Traum in den Sinn, den anderen von meinem inneren Zustand zu erzählen. Ich machte alles mit mir aus, biss die Zähne zusammen und ließ nichts von meiner Überforderung durchblicken.
Am späten Abend lud uns Federico noch auf eine Pizza ein. Wir saßen auf den knallbunten Plastikstühlen auf seiner steinernen Veranda, umsäumt von riesigen Blumenpötten mit Sukkulenten und Palmfarnen, den Blick direkt aufs Meer. Meine Freunde und er tranken: Ein Bierchen löste das andere ab, es wurde gewitzelt und erzählt und diskutiert. Ich jedoch war müde. Der Abend war nett, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich war froh drum, nicht alleine zu reisen – so konnte ich die Gespräche meinen Freunden überlassen. Schließlich verabschiedete Federico sich, indem er uns noch seine Telefonnummer – »für alle Fälle« – notierte und ließ uns in seinem offenen Haus allein. Nachts war der Strand grell beleuchtet, riesige Strahler wie von einem Fußballstadion erhellten die ganze Umgebung. Die Liegestühle lagen in Reih und Glied, daneben standen die zugeklappten Sonnenschirme Spalier. Wir räumten unsere Isomatten in eine Ecke im Obergeschoss, schlüpften in die Schlafsäcke und freuten uns auf eine erholsame Nacht. Doch es sollte anders kommen.
Mitten in der Nacht schreckten wir plötzlich hoch, weil unten im Haus Geräusche zu vernehmen waren. »Hörst du das? Da ist doch wer!«, zischte mein Freund und stieß mich an. Ich habe sowieso einen leichten Schlaf und war daher augenblicklich hellwach. Wir lauschten angestrengt. Etwas polterte, zwei Männer unterhielten sich auf Italienisch. Der Lichtschein einer Taschenlampe erfasste den Treppenaufgang. Gleich würden sie hier oben bei uns sein. Mein Freund setzte sich kerzengerade auf, sein Kumpel schaute verwirrt aus der Wäsche, ich selbst blieb wie unbeteiligt liegen. In diesem Moment erreichten die Italiener unseren Schlafplatz. Sie hatten sichtlich nicht mit uns gerechnet, denn mit einem Mal schrien sie wild und erschrocken herum und hatten ihre Hände schon an den Waffen, die sie im Gürtel trugen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis wir begriffen, dass das irgendeine Art Sicherheitspersonal war, auf seiner nächtlichen Patrouille. Die Männer redeten laut und hektisch auf uns ein, wovon wir natürlich kein Wort verstanden. Mein Freund versuchte, sich auf Englisch zu erklären, und hob beschwichtigend die Hände. Als die Streife unsere deutsche Herkunft erkannte, ließ der Druck auf uns augenblicklich nach. Einer der beiden versuchte sogar, bei seinem Kollegen Eindruck zu schinden, und sprach uns auf Deutsch an. Doch konnten wir beim besten Willen kein Wort verstehen. Wir erklärten die Situation, gaben ihnen Federicos Nummer zum Beweis, mussten noch unsere Pässe vorweisen, dann ließen sie uns endlich in Ruhe. Was für eine Nacht! Nachdem wir das Geschehene noch einmal durchgekaut und analysiert hatten, siegte endlich die Müdigkeit, und wir rollten uns wieder in unsere Schlafsäcke zusammen.
Bemerkenswert für mich an der Erfahrung war, dass ich draußen beim Promenadenbummel mehr Ängste gehabt hatte als hier in einer wirklich brenzligen Situation. Mein Freund war sichtlich mitgenommen und gestresst – ich allerdings blieb die Ruhe in Person, ohne die geringste Sorge, dass uns etwas geschehen könnte. In einem Moment, in dem Panik vielleicht sehr gut nachvollziehbar gewesen wäre, blinzelte ich nur und rieb verschlafen meine Augen, während meine Freunde eilends zu ihren Rucksäcken liefen, um die nötigen Dokumente zusammenzusuchen. Rückblickend wurde mir später klar, dass meine Ängste vor allem nach innen gerichteter Natur waren: Ich selbst, mit meinem Misstrauen in meinen Körper, war mir der Feind, die Bedrohung. Meine äußeren Umstände meinte ich immer mitsteuern zu können und glaubte, dadurch irgendwie die Kontrolle zu behalten – nur das, was in meinem Körper vorging und mir so dermaßen Angst machte, schien nicht im Mindesten von mir beeinflussbar zu sein.
Gar nichts geht mehr
Aus meinem Tagebuch:
Ich bin ausgepowert, kraftlos und müde, weine die ganze Zeit. Ich schreie und schluchze. Meine Beine sind lästige Bleiklumpen. Ich steh nicht gerne, ich beweg mich nicht gerne. Im Liegen allerdings überkommen mich alle Gefühle – ich bin allein im großen stürmischen Ozean. Wellen drohen mich zu erschlagen, und ich gebe mir alle Mühe, nicht zu ertrinken, schnappe verzweifelt nach Luft.
Ich bin eigentlich nur noch ein einziger verzweifelter Schrei nach Hilfe. Ich möchte weglaufen und all das Quälende von mir abschütteln. Doch es ist, als wäre ich unter einer dumpfen Glasglocke gefangen, als hätte mich eine eisige starre Hand gepackt und ließe mich nicht mehr los.
Durch den Dauerstress und die ständigen Panikattacken (ich hatte aufgehört zu zählen) wurde ich nach und nach immer labiler. Ich aß nicht genug und weinte viel, sodass ich bald wie ein Hungerhaken aussah. Mir fiel das erst auf, als eine Freundin mich darauf aufmerksam machte. Anfangs versuchte ich noch, mein Leben so weiterzuleben wie zuvor.
Doch nach und nach ließ ich alles bleiben, was mich in Angst versetzte – oder in Angst versetzen könnte. Der Gang zum Supermarkt wurde zur Qual, die Universität sah ich nur noch selten von innen. Freunden sagte ich immer wieder ab, bis sie nicht mehr nach einem Treffen fragten, und ich wurde einsam und zutiefst verzweifelt. Das alles passierte im ersten Jahr meiner Angststörung. Dann kehrte mein Freund eines Tages früher als geplant von seinem Zivildienst nach Hause zurück und erlebte zum ersten Mal einen meiner Nervenzusammenbrüche mit. In diesem Moment wurde ihm erst klar, wie ernst mein Zustand eigentlich war, von dem ich immer nur erzählt hatte, als wäre es eine vorübergehende schlechte Stimmung. Kurzentschlossen half er mir, eine psychotherapeutische Klinik zu finden, die mich dann auch zwei Monate später aufnahm. Zunächst war es eine unglaubliche Entlastung für mich, nicht mehr »funktionieren« zu müssen. Ich stellte fest, dass es mich unheimlich Kraft gekostet hatte, mein »Soll« im System zu erfüllen, Leistung zu erbringen, das zu tun, was von mir erwartet wurde, obwohl ich keine Energie dafür hatte. Ich hatte mich jeden Tag als Versager gefühlt, wenn ich es nicht mehr in die Uni schaffte. Nun war ich von den gesellschaftlichen Verpflichtungen losgelöst, in einer kleinen Blase von Schutz und Sicherheit. Ich musste mich nicht mehr um meine täglichen Aufgaben kümmern, mir keine Gedanken um Essenszubereitung, Einkauf oder Studium mehr machen. Ich durfte einfach da sein und mich meinem seelischen Ballast und meiner Genesung widmen. Zu Beginn weinte ich unglaublich viel, fühlte mich wie in einem Meer von Tränen. Durch die angebotenen Therapien lernte ich allmählich, die psychologischen Muster hinter meinen Panikattacken zu verstehen.
Auf der Suche nach Lösungen
Die zwei Monate in der Klinik waren überaus wichtig für mich und legten den Grundstein für meine spätere Heilung. Doch ich muss zugeben, dass es nach der Klinik leider nicht aufwärtsging, sondern erst noch tiefer abwärts.
Mein Vermeidungsverhalten wurde grenzwertig, ich verließ kaum noch die Wohnung und litt unter Brechanfällen, wenn die Angst zu groß wurde. Meine körperlichen Probleme summierten sich: unerträgliche Rückenschmerzen, ständige Verdauungsbeschwerden, immer wieder Hautprobleme … ganz zu schweigen von monatelangem Herzstolpern. All das raubte mir den letzten Nerv. Ich war ein Wrack und kämpfte mich irgendwie durch die Tage.
Mein Zustand verbesserte sich erst allmählich mit dem Wechsel zu einer neuen Therapeutin. Sie fing mich nicht nur auf und gab mir Halt, sondern sie hielt mir auch den Spiegel vor und rückte meine Selbstverantwortung in den Mittelpunkt. Nach jeder Therapiestunde ging ich gestärkt und mit neuen Erkenntnissen nach Hause, und ich bin ihr bis heute unendlich dankbar. Ich lernte all die Situationen erkennen, in denen ich mir selbst nicht treu war; Situationen, in denen ich meine eigenen Bedürfnisse überhörte – zugunsten anderer. Gleichzeitig begriff ich langsam, dass die Angst in diesen Momenten eine Art unangenehmer Freund von mir war, der mich wachrütteln und mir helfen wollte.
Der Traum vom Reisen
In all den Jahren meiner Angstzustände habe ich nie aufgehört, Bücher und Blogs von Leuten zu lesen, die um die Welt reisten. Für mich war deren Leben der absolute Gegensatz zu meinem eigenen. Ich wollte so werden wie sie: frei und lebensfroh und mutig. Voller Abenteuerlust, Stärke und Entdeckerdrang! Jedoch: Irrte ich mich vielleicht? Ja, auf den ersten Blick wirken Weltreisende mutig und völlig unkompliziert. Ich bin mir aber inzwischen sicher, dass viele von ihnen ihr ganz eigenes Päckchen zu tragen haben. Stete Rastlosigkeit, die Suche nach Sinn und Identität im Außen, Bindungsängste und ein unbewusstes Getriebensein sind nur ein paar Punkte, die mir dazu einfallen. Nicht jeder, der frohgemut durch die Welt reist, ist automatisch auch mutig. Im Gegenteil! Mutig ist nicht, wer keine Angst verspürt (denn der hat es ja in diesem Punkt viel leichter). Mutig bist du, wenn du dich trotz deiner Angst auf den Weg machst. Wenn du Dinge wagst, von denen du weißt, dass sie dich weiterbringen.





























