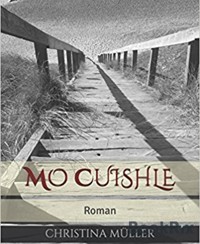
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wird aus dem Leben, wenn persönliche Werte auf Manipulation treffen, Liebe auf Gleichgültigkeit, Hingabe auf Berechnung?
Es ist Liebe auf den zweiten Blick, denn Katharina und Tom finden sich nach der ersten Begegnung eigentlich unsympathisch. Doch als sie eines Abends wie vom Blitz getroffen wird und Tom ihre Liebe erwidert, beschließen sie, den Balanceakt zwischen Liebe und Job zu wagen: Zwei starke Persönlichkeiten mit Vorleben, die nicht schwieriger und unterschiedlicher sein könnten, kämpfen nun für ihre gemeinsamen Ziele, Träume und Wünsche.
Doch intuitiv spürt Katharina, dass Tom anders liebt, als sie glaubt, wie Liebe sich anfühlen sollte. Angst vor dem Verlust des guten Gefühls und ihr sehnlicher Wunsch nach einer wertvollen Beziehung steuern ihren Kampf um die Liebe. Doch Tom geht seine eigenen Wege – bis Katharina entdeckt, welche das sind. Sie gerät in einen Sog aus Lügen und Intrigen.
Schlagartig entscheidet sie sich für einen letzten Kampf – den für sich selbst. Sie setzt sich mit dem Geschehenen auseinander und erkennt, dass sie den größten Schatz in sich selbst trägt.
Eine spannende, tiefgründige Geschichte von den Risiken und Nebenwirkungen einer Liebe ohne Netz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Über die Autorin
Das Buch
Widmung
Inspiration
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Christina Müller
Mo Cuishle
Roman
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
1. Auflage Dezember 2016
Originalausgabe
Copyright © 2016 Christina Müller
ISBN: 978-3-9398-6105-8
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin. Personen und Handlung sind frei erfunden, etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen, Unternehmen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Markennamen sowie Warenzeichen, die in diesem Buch verwendet werden, sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Eigentümer.
Christina Müller
c/o Kanzlei Baumann
Alter Markt 7
32052 Herford
Der direkte Kontakt zu den Lesern und Leserinnen meines Buches liegt mir sehr am Herzen. Darum freue ich mich jederzeit über Anregungen, konstruktive Kritik und Austausch unter: [email protected]
Besuchen Sie mich auf Facebook:
www.facebook.com/christinamüller/autorin oder @MuellerTalk
Über die Autorin
Christina Müller wurde 1969 in Hamburg geboren. Mit der Veröffentlichung ihres Debütromans geht ein Herzenswunsch in Erfüllung.
Das Buch
Was wird aus dem Leben, wenn persönliche Werte auf Manipulation treffen, Liebe auf Gleichgültigkeit, Hingabe auf Berechnung?
Es ist Liebe auf den zweiten Blick, denn Katharina und Tom finden sich nach der ersten Begegnung eigentlich unsympathisch. Doch als sie eines Abends wie vom Blitz getroffen wird und Tom ihre Liebe erwidert, beschließen sie, den Balanceakt zwischen Liebe und Job zu wagen: Zwei starke Persönlichkeiten mit Vorleben, die nicht schwieriger und unterschiedlicher sein könnten, kämpfen nun für ihre gemeinsamen Ziele, Träume und Wünsche.
Doch intuitiv spürt Katharina, dass Tom anders liebt, als sie glaubt, wie Liebe sich anfühlen sollte. Angst vor dem Verlust des guten Gefühls und ihr sehnlicher Wunsch nach einer wertvollen Beziehung steuern ihren Kampf um die Liebe. Doch Tom geht seine eigenen Wege – bis Katharina entdeckt, welche das sind. Sie gerät in einen Sog aus Lügen und Intrigen.
Schlagartig entscheidet sie sich für einen letzten Kampf – den für sich selbst. Sie setzt sich mit dem Geschehenen auseinander und erkennt, dass sie den größten Schatz in sich selbst trägt.
Eine spannende, tiefgründige Geschichte von den Risiken und Nebenwirkungen einer Liebe ohne Netz.
Dieses Buch widme ich dem Leben,
das mir die Erkenntnis vermittelt hat,
dass Intuition und Tiefgründigkeit nicht nur Gaben,
sondern auch Bürden sind.
Anfang und Ende einer Liebe kündigen sich dadurch an,
dass man sich scheut, mit dem anderen allein zu sein.
Jean de la Bruyere, franz. Autor (1645-1696)
Kapitel 1
Wünsche im Nebel
Weiß jemand, wo es diese speziellen Glaskugeln gibt? Die, in denen man die Zukunft sehen kann. Nur eine, dann würde ich wissen, nicht hoffen. Die Bilder vor Augen, ich weiß doch, was ich will. So bleibt mir nur ein unvollständiger Tagtraum, der mich, mit all seinen symbolischen Botschaften, begleitet.
* * *
Endlich ist es soweit. Durch das Küchenfenster sehe ich, wie sie auf denParkplatz vorfährt. Ich renne ihr entgegen. Nach all der Zeit schließe ich meine Freundin Helene wieder in die Arme. In Bruchteilen von Sekunden ist es so, als wäre sie gar nicht fort gewesen. Vertraut.
„Ich kann es noch gar nicht glauben!“
„Hola. Ja, komm, lass dich drücken. Endlich wieder mal in Alemania.“
„Ich freue mich so, dass du da bist.“
„Meine Siebensachen hole ich später. Erst zeigst du mir alles von deinem Glück.”
* * *
„Oh, traumhaft! Hier ist ja schon fast alles fertig. Toll, was du schon alles geschafft hast. Das ist ja mit den Bildern, die du mir geschickt hast, kein Stück mehr zu vergleichen. Hier hast du wirklich Platz genug, um dich kreativ auszutoben. Und wie läuft´s mit dem Hofcafé?“
„Ich bin zufrieden, vor allem aber macht es mir Spaß. Hier gibt es nur eines im Umkreis von dreißig Kilometern“, sage ich schmunzelnd.
„Klasse. Muy bien.”
„Ja, dieses Mal stand mein Neustart unter einem guten Stern. Ich fühle mich richtig wohl hier. Mit dem ersten Tag, an dem ich hier mit dem Möbelwagen vorgefahren bin, standen schon die Nachbarn vorm Tor. Nicht aus Neugier, sie haben ihre Hilfe angeboten. Das ist eine Dorfgemeinschaft, die wirklich gelebt wird. Ohne deren Unterstützung wäre ich noch nicht so weit gekommen. Nach all den Jahren stehe ich wieder in meiner Mitteund ich hab gedacht, ich schaffe es nicht mehr.“
„Ich habe mir damals wirklich Sorgen um dich gemacht. Wer kann so viel Mist über so viele Jahre lang einfach so hinter sich lassen? Ich bin so stolz auf dich.“
* * *
„Wollen wir uns mit einem leckeren Bordeaux vor den Kamin setzen? Ist doch bestimmt noch ein bissel frisch für dich am Abend, oder?“
„Ja, gern.“
Ich öffne die Weinflasche, nehme zwei Gläser aus der Vitrine, und wir wandern von der Küche ins Wohnzimmer.
„Wie schön. Einer für dich, und einer für mich“, sagt sie begeistert, als sie die beiden Ohrensessel erblickt.
„So, hab ich es mir gewünscht. Du und ich vor einem offenen Kamin. Helly, es bedeutet mir viel, dass du heute da bist. Wie lange bleibst du denn?“
„Ach, ich habe nur ein One-Way-Ticket gebucht. Ich bin total flexibel. Gut, ich will nicht meckern.Andalusien ist ein Traum, aber wieder in der Heimat zu sein, ist doch was Besonderes. Vielleicht so drei Wochen, wenn du es so lange mit mir aushältst?“
„Na dann! Uns wird bestimmt nicht langweilig. So lange …“
„So lange ich mag. Ja, ich weiß. Danke.“
„So, und jetzt reden wir mal von was anderem.“
„Okay. Ach, ich hab da noch so eine klitzekleine Überraschung für dich.“
Helly überreicht mir ein kleines Geschenk.
„Mach auf!“
„Jaaa, mache ich doch. Ich werd verrückt! Sporen mit einem Dorn aus Metall!“
„Hier die Karte. Hab ich ganz vergessen. Lies sie in Ruhe.“
Helly überreicht mir die Karte und ich fange an, ihre Zeilen zu lesen.
Meine liebe Kathy,
wer in Zeiten, in denen noch Ritter um Ruhm fochten, guter Herkunft war und zu diesen Auserwählten gehören wollte, musste eine jahrelange Ausbildung durchlaufen, meist schon von Kindesbeinen an, um sich frühzeitig an die ritterlichen Sitten und Gebräuche zu gewöhnen. Bewährte sich der Knappe, zeigte er Mut, Wille, Treue und Geschick, wurde er feierlich zum Ritter geweiht. Da neben dem Langschwert auch die Sporen zählten, wurden dem neuen Ritter ein paar Sporen überreicht. Diese Sporen musste sich der Neuling nachträglich verdienen.
Kathy, du nicht. Du hast genug Schlachten gekämpft.
Deine Freundin Helly
Tränen laufen mir über das Gesicht. „Danke!“
„Meine Zuckerpuppe. Alles Liebe zu deinem Fünfzigsten. Ich freue mich so sehr für dich. Du siehst wieder richtig gesund aus.“
„Ja, ich bin wieder ganz gesund. Komm, lass uns anstoßen. Auf dich.“
„Salud! Auf uns.“
* * *
Was noch nicht ist, kann ja noch werden.
Kapitel 2
Im Hier und Jetzt
Die letzten sieben Jahre sind das wohl wichtigste Kapitel in meinem Leben. Sie haben mich zu dem Menschen geformt, der ich heute bin: verletzt, ohne Selbstvertrauen, mit Schutzmechanismen, die mein Leben nicht lebenswert machen, ohne Perspektive. Seit jenem Mittwoch, dem 14. August 2013, dem Tag meiner Flucht, suche ich einen neuen Pfad in meinem Leben. Jemand, der sehen will, was das Schicksal ihm noch zu bieten hat. Eine Suchende, immer noch.
Alles ist fremd: Die Couch, auf der ich sitze, das Wohnzimmer, das Haus, die Stadt. So lebe ich nun seit einem Jahr, Tag für Tag. Zeitweise mit Medikamenten ruhiggestellt, um Risiken psychischer Szenarien auszuschließen. Mein Spiegelbild ist mir fremd. Die Haare fallen mir aus, und meine Schilddrüse wird von Antikörpern zerfressen.
Es ist Vormittag. Genaue Uhrzeit? Keine Ahnung. Nein, ich lasse mich nicht gehen. Es ist, Moment, ich schaue auf die Uhr, halb elf. Der Wochentag? Mittwoch. Ich werde mir einen Kaffee machen. Es stimmt: Ich trinke zu viel von dem Zeug. Eigentlich müsste ich mehr Wasser trinken. Und regelmäßig essen. Dennoch fühle ich keinen Hunger. Ich bin satt, ohne zu essen. Wie viel Kaffee trinke ich eigentlich zwischen den vielen geistigen Auszeiten, die den Tag bestimmen? Zehn Tassen, eher mehr.
Ich schlafe und wache nach zwei Stunden auf. So geht es den ganzen Tag. Vor drei Monaten habe ich die Psychopharmaka abgesetzt, aber manchmal fühle ich mich, als hätte ich welche genommen. Dieser Zustand macht mich wahnsinnig.
„Du bist das, was du isst.“
Ich esse nichts, also bin ich nichts. Ohne Energie, schlapp, müde, in Trance, nur phasenweise aufgedreht. Ich grüble permanent nach Lösungen, finde trotzdem keine einzige. Manchmal schwirren mir so viele Gedankenschnipsel im Kopf herum, dass ich keinen einzigen von ihnen festhalten kann.
Ich sitze auf der Couch, schaue aus dem Fenster. Jeden Tag. Zwar istmir alles fremd, jedoch ist es eine Umgebung, in der ich mich sicher fühle, wo ich Ruhe vor der Welt da draußen habe, wo ich so sein kann, wie ich bin: erschöpft vom Leben, vom Dasein. Eine Erschöpfung, die nicht aufhören will, so sehr ich auch will, so sehr ich auch gegen sie ankämpfe.
Ich war bei einem Arzt, einem Psychiater. Nach Wochen oder Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, wollte er mich nicht mehr krankschreiben: „Sie können doch wieder arbeiten.“ Einer von der Sorte, die Menschen ruhigstellen. Ich stände wahrscheinlich heute noch unter dem Einfluss starker Beruhigungsmittel, wenn meine innere Stimme sich nicht wieder und wieder in mein gelähmtes Bewusstsein gedrängt hätte. In einem der Momente, in dem ich sie hörte, entschied ich mich, die Einnahme zu beenden. Ich wollte raus aus diesem Zustand der Teilnahmslosigkeit, der Lethargie. Allerdings habe ich das Risiko unterschätzt, dass meine Gedanken dann verrückt spielen.
Okay, ich habe es überstanden. Etwas Glück war wohl auch dabei. Mein Bewusstsein ist schon wieder klarer. Die Frage, ob ich Selbstmordgedanken habe, konnte ich gestern verneinen. Nein, dafür bin ich nicht so weit gegangen, alles Hinschmeißen kommt für mich nicht infrage.
Ich lege mich auf die Couch, starre in den Fernseher. Er läuft Tag und Nacht. Ich bekomme gar nicht mit, was läuft. Ich brauche die Geräusche, die Reize, damit mein Schädel ausgeht, die Gedanken eine andere Richtung bekommen. Leider funktioniert es meistens nicht. Die Grübelattacken leisten starken Widerstand gegen Außenreize und Ablenkungen. Ichbin ihnen ausgeliefert. Meine Lider geben nach, werden schwer, immer wieder zwinge ich mich, sie aufzureißen. Jetzt nicht schon wieder schlafen, ich hab doch schon die ganze Nacht geschlafen, heute Morgen zwei Stunden! Ich bin trotzdem müde, schlafe wieder ein, mache den Kopf zu.
Ich wache auf, benommen. Jetzt aber! Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee, setze mich auf den Sessel, starre aus dem Fenster. Ich will das finden, was noch auf mich wartet, was ich noch nicht gefunden habe, auch, wenn ich vielleicht am Ende meines Lebens erkenne, dass ich eine ewig Suchende war. Dass ich das Glück für mich, den Frieden in mir, nicht gefunden habe.
Alle meine bisherigen Versuche, zufrieden zu sein, glücklich, sind gescheitert. Genau das treibt mich an, lässt mich weitergehen, wenn auch in kleinen Schritten. Mittlerweile sogar in Demut. Denn ich habe körperliche und seelische Grenzen kennengelernt, von denen ich nie dachte, dass sie einmal so dauerhaft zu mir gehören würden.
Meine Sehnsucht nach dem Leben ist so groß. Ich will heilen, und ich werde heilen. Aber da ist auch so viel Angst vor dem Leben, der Zukunft, den Menschen, vor mir selbst. Luftleerer Raum. Was ich hier tue? Nichts. Was kann ich tun? Ich will etwas tun, aber was? Multiple Frakturen, ja, so fühlt es sich an. Alle Knochen gebrochen. Bruchlandung. Flügel gebrochen.
Alles, was mir wichtig war, fehlt: mein Zuhause, meine Hunde, meine Pferde, meine Möbel, meine Ordnung, der Raum für Kreativität, mein Job, mein Alltag, meine vielen Rituale, meine wenigen Menschen. Dennoch: Vieles habe ich überlebt, durchgestanden, was andere, wie ein Freund sagt, nicht in drei Leben schaffen.
Nichts in diesem Haus ist von mir. Doch, ein Koffer mit Kleidung, eine Reisetasche mit persönlichen Unterlagen. Klar, kann man auch mit wenig leben. Dennoch, ein Zuhause ist auch Identität. Meine ist nun im Lager, zwanzig Kilometer entfernt. Da sind meine Möbel und fünfzig Umzugskartons unter Verschluss.
Ich spüre tiefe Dankbarkeit gegenüber dem Menschen, den ich als Engel auf Erden bezeichne und der mir so gern ein Zuhause geben würde. Rettung vor drohender Obdachlosigkeit in letzter Sekunde. Doch ich spüre immer mehr: Dies ist nicht mein Zuhause.
* * *
Die Menschen, die ich treffe, sind nicht meine Menschen. Sie leben ihr Leben, das normaler ist als meins. Auf Feiern fühle ich mich nicht wohl. Zu viele Menschen. Die Themen, über die sie sprechen, für mich uninteressant. Sie haben Alltagssorgen, die nicht meine sind, haben eine Leichtigkeit, die ich nicht mehr habe. Meine Themen, das, was mich bewegt, sprengt jede Feier. Deshalb schweige ich. Ich bin fremd, kenne keinen von ihnen. Es sind mühsame Versuche, einen neuen Platz zu finden.
Die wenigen Momente, in denen ich zum Thema werde, sich jemand traut, mich zu fragen, wie es mir geht, was mich bewegt, sind kurz. Wenn ich ehrlich sein darf, ehrlich bin, reagieren die Menschen schockiert, überfordert, ungläubig, nach dem Motto: Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Oder aber: So, wie sie aussieht, kann es doch nicht so schlimm sein, als dass man die Probleme nicht in den Griff bekommen könnte. Gern folgen dann noch ein paar liebgemeinte Ratschläge ohne Substanz, mehr so aus Verlegenheit.
Immer wieder gern genommen: Die Pseudohilfe, so nenne ich es. Aneinandergereihte Wörter, die zu schön klingenden und Hoffnung weckenden Sätzen werden – mehr eben auch nicht.
Manche Menschen halten sich für besonders einfühlsam und schlau. Doch in Wirklichkeit verurteilen sie mich, das spüre ich. Sie hinterfragen nicht. Sie haben keinen Respekt, packen mich in die Schublade der Menschen, deren Zugehörigkeit zur Gesellschaft außer Kraft gesetzt ist, sie rümpfen die Nasen, unterbrechen mich, wenn ich den Versuch unternehme, zu erklären. Und merken dabei nicht, dass sie sich damit selbst disqualifizieren. Manchmal frage ich mich, was mich noch erwartet, wenn ich den Weg zurück ins Leben nicht mehr schaffe. Wenn ich tatsächlich Hartz IV beantragen muss.
Auf solchen Feiern haben die Menschen das Glück, sich ohne Anstrengung aus der Situation mit mir befreien zu können. Denn die unangenehme Situation, die durch ehrliche Reaktion meinerseits entsteht, wenn man mit Floskeln, wie: „Geht’s dir gut? Du siehst gut aus. Lange nicht gesehen“, auf mich zugeht, schreckt ab. Schreck bedeutet Rückzug, sich schnell abwenden, wieder unter die Herde mischen. Mit einem gezwungenen Lächeln wird gerade noch der Anstand gewahrt: „Na, da wünsche ich dir viel Glück. Du schaffst das schon!“
Genau, ich schaffe das, was auch immer. Allein. Allein?
Manchmal empfinde ich ein Grüppchen von zehn oder weniger Menschen als so beklemmend, dass ich die Veranstaltung verlasse, flüchte. Mir wird das Gerede zu viel, zu laut. Ich muss dann raus, raus an die frische Luft. Das Kuriose daran: Keiner merkt, was mit mir los ist. Sie ist eben so, sie geht. Was ist bloß mit mir passiert? Früher habe ich selbstsicher vor hundert Menschen gestanden, habe frei referiert.
* * *
Manchmal frage ich mich, ob ich inzwischen neidisch bin, verbittert. Nein, ich hasse einfach oberflächliche Menschen, da bin ich lieber mit mir allein. Zu ihrer Entschuldigung muss ich sagen: Sie können nichts dafür, dass sie nicht sehen, nicht fühlen, so wie ich es brauche. Vielleicht bin ja auch ich diejenige, die nicht mehr sieht, nicht mehr fühlt, wie sie es brauchen, die ihre Mauer zu hoch gezogen hat.
Wie konnte es so weit kommen?
Warum schaffe ich es nicht, sesshaft zu werden, anzukommen, obwohl ich zeit meines Lebens nichts anderes will, während aus dem oberen Kolben meiner Sanduhr die Körner langsam in den unteren rieseln? Wie groß ist meine Sanduhr? Wie groß die Sandmenge, die von Geburt an für mich vorgesehen ist? Wie viel Sand ist noch im oberen Kolben? Wie viele Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden?
Man sagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Was kann ich, gelähmt, wie ich bin, überhaupt ändern? Welchen Anteil habe ich an meiner Situation?
Wie geht meine Reise weiter?
Der Herr ist mein Hirte, mir wird es an nichts mangeln– mein selbst gewählter Spruch aus dem Konfirmationsunterricht. Leider ist mein damals beginnender Glaube durch Erschütterungen auf der Strecke geblieben, und eigentlich eher durch bis dahin Erlebtes erst gar nicht aufgekeimt.
Wie viele Züge sind ohne mich gefahren, weil der Aufwand des Anhaltens für nur eine Person zu groß war, sie nicht halten wollten, ich zu spät kam, die Türen schon geschlossen waren, ich das falsche Ticket löste, ich nicht genug Geld in der Tasche bei mir trug, oder ich freiwillig nicht einstieg, weil mich die Menschenmassen zu erdrücken drohten?
Sehende, fühlende, verstehende, ohne Eigennutz helfende Weggefährten sind dieser Tage rar, ein Sechser im Lotto. Ihnen in der auferlegten, vielleicht selbst gewählten Isolation zu begegnen, gleicht einem Wunder. Aber genau die soll es ja immer wieder geben.
Gedanken und Bilder besetzen meine Seele. Tag und Nacht, ununterbrochen. Sie hören nicht auf, sich den Platz zu nehmen, den sie bestimmen. Flugdatenschreiber, Stimmenrekorder – Black Box.
Ich gehe spazieren. Plötzlich stolpere ich auf meinem Lebensweg, falle in ein Loch, wo sich hundert giftige Schlangen auf mich stürzen. Ihr Gift fließt durch meine Adern, dreht seine Runden durch meinen Körper, aber ich sterbe nicht. Blutkreislauf – Teufelskreis. Ich bin vergiftet. Gefäße und Zellen geschädigt. Alles schmerzt. Das Gegenmittel: unauffindbar. Keiner kennt es. Ich existiere, aber ein Leben ist es nicht.
Das Licht am Ende des Tunnels, für mich unsichtbar. Manchmal tauchen ganz hinten schwache Blitze auf, doch so schnell, wie sie gekommen sind, verschwinden sie schon wieder in der Dunkelheit und lassen Hoffnungslosigkeit zurück. Doch irgendwann, wann auch immer, wird es auch bei mir wieder hell werden.
Was mich am Leben hält, sind meine Träume – so wie der am Anfang, der Besuch von Helly in meinem zukünftigen Hofcafé. In ihnen sind alle Probleme, die mich umgeben gelöst, bin ich wieder ein Teil der Gesellschaft. Ja, tief in mir ist der Wille, all das durchzustehen. Und am Ende wieder ein lebenswertes Leben zu führen.
Kapitel 3
Damals – vor neun Jahren
Ende Oktober 2006: Ich stecke in einem Dilemma, beruflich und privat – einem Dilemma, das ich nicht will. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen, ganzheitlich, ohne Fassade. Wo komme ich her, was habe ich erlebt, was habe ich erreicht? Ich bin eine Frau von siebenunddreißig Jahren, fünfunddreißigmal umgezogen. Ein Kinderwunsch ging trotz der Hoffnung auf diesen einen magischen Zufall nicht in Erfüllung, und so ist diese Bitte auf meinem Wunschzettel an das Leben gestrichen. Drei Partnerschaften, jede für sich die große Liebe, dennoch gescheitert.
Seit einem Jahr Single. Mein Aussehen weist genetisch sichtbare Merkmale einer slawischen Abstammung auf. Mittlerweile fünf Jahre selbstständige Unternehmensberaterin in Hamburg.
Keine Familie. Eltern? Die Frage ist erwartungsgemäß eindeutig zu beantworten: Meine Mutter schied vor sechsundzwanzig Jahren nach einem geglückten zweiten Suizidversuch freiwillig aus dem Leben. Mein Vater, sechs Jahre in Algerien in der Fremdenlegion, gab mir genug Anlässe, den Kontakt zu ihm vor zwölf Jahren abzubrechen, aus freien Stücken.
Geschwister? Zu meinem Halbbruder, sechs Jahre älter, seit dem Tod unserer Mutter kein Kontakt mehr. Er hat mich über vier Jahre im Alter zwischen sieben und elf Jahren sexuell missbraucht. Für jene Handlungen ist er, dies nur am Rande, nie zur Rechenschaft gezogen worden.
Meinem Lebenslauf hinzufügen kann ich vielschichtige Erfahrungen mit drei Stiefmüttern und drei Stiefbrüdern.
Die Empfehlung für das Gymnasium half mir nicht. Mein Vater bestand zum Ende der neunten Klasse darauf, dass ich auf die Realschule wechselte. Seine Begründung: „Du nimmst anderen, die besser sind als du, den Platz weg.“ Elf Worte, die mich ein Leben lang prägen sollten.
Die nachteilige Ausgangsposition der Kindheit und Jugend ließ einen recht eigenwilligen Teenager heranwachsen. Ich erwartete mehr vom Leben, als es mir bis dahin geboten und auferlegt hatte.
Als ichsiebzehn war, zog ich nach einem schwerwiegenden Streit aus, suchte mir einen Ausbildungsplatz und begann eine Ausbildung zur Bürokauffrau in einem Steuerbüro. Mit Nebenjobs in einer Bäckerei und auf dem Wochenmarkt sowie mit Putzen in einer Anwaltskanzlei stellte ich meinen Lebensunterhalt sicher. Zu meinem achtzehnten Geburtstag finanzierte ich mir einen Führerschein und mein erstes eigenes Auto – ein ausgedienter Kübelwagen der Bundeswehr, Volkswagen Typ 181.
Nach der Ausbildung baute ich zielstrebig Stück für Stück meine Karriere auf. Ich startete in einem Unternehmen im Personalwesen als Bürokauffrau, in anderen Firmen wurde ich als Personalsachbearbeiterin eingestellt. Wenn es Projekte und Überstunden zu verteilen gab, war ich immer die Erste, die Hier! schrie. Neugierde und Wissenshunger trieben mich an. Ich wollte lernen, wollte Erfolg. Ich wollte es schaffen, wollte für meine Zukunft sorgen. Ich wechselte die Arbeitgeber, wenn ich keine Perspektiven mehr sah. Konsequent.
Jeder Arbeitsplatzwechsel bedeutete so ganz nebenbei auch immer mehrere hundert Euro (einige noch in DM) mehr Gehalt. Mit neunundzwanzig wurde ich in einem deutschen Unternehmen der Dentalbranche Personalreferentin, zwei Jahre darauf folgte die absolute Auszeichnung: Der Vorstand bot mir die Leitung des Ressorts Personal an – ohne Studium. Ich hatte es geschafft: mit dreiunddreißig Jahren ein stattliches Jahreseinkommen von achtzigtausend Euro zuzüglich einer Tantieme von vierzigtausend Euro, ein schickes 3er-BMW-Cabrio, freie Entfaltung im Job, Anerkennung, Respekt und einen Mentor, der mich sowohl forderte als auch förderte, mir Vertrauen schenkte und an mich glaubte.
Der Weg dorthin war zwar steinig, aber auch geprägt von Ehrgeiz, Engagement und Identifikation mit mir selbst. Da ich ohne Anhang war, den Rückhalt der Familie, für den ich andere immer wieder beneidete, nicht hatte, war mir klar, dass ich für mich selbst sorgen musste. Ich sparte den größten Teil des verdienten Geldes, kaufte zwei vermietete Immobilien zur Altersvorsorge und investierte siebzigtausend Euro in eine Beteiligung an einer AG. Ich war weit entfernt davon, mein Geld für Schuhe von Manolo oder Handtaschen von Gucci auszugeben. Immer blieb ich mir meiner Herkunft bewusst. Mir waren persönliche Werte, die sich nicht durch Banknoten messen ließen, immer wichtiger als Materielles. Deshalb hatte ich auch keine Sorge, nicht bodenständig zu bleiben.
Durch eine Investorengruppe verursachte Umstrukturierungen hatten Sparmaßnahmen zur Folge – der Zeitpunkt für meinen Ausstieg war gekommen. Ich handelte einen brillanten Beratervertrag aus, der mir den Einstieg in die Selbstständigkeit ermöglichte, und im Mai 2002 startete ich in die Selbstständigkeit: Unternehmensberaterin im Bereich Personal- und Organisationsberatung. Die Gedanken an eine eigenständige Existenz kreisten schon lange in meinem Kopf.
Im ersten Jahr konnte ich neben dem Beratervertrag parallel erste kleine eigenständige Projekte akquirieren: Der Start in die Selbstständigkeit war mir geglückt. Auch in den Folgejahren arbeitete ich an interessanten Projekten, die mich in verschiedenste Branchen hineinschnuppern ließen.
Etwas Besonderes war die Saison 2003 auf Sylt, denn ich lebte und arbeitete auf der Insel. Damals trennte ich mich von einem Mann, mit dem ich fünf Jahre zusammen gewesen war. Ich entdeckte, dass er mich über einen längeren Zeitraum mit mehreren Frauen betrogen hatte. Kaum vorstellbar, aber ich habe nichts gemerkt. Er war selbst Unternehmer, ständig auf Dienstreisen, die es ihm leicht machten, zu betrügen und zu vertuschen.
Dass wir vor sechs Monaten zusammen ein von der Bank finanziertes Haus gekauft hatten, stand auf einem anderen Blatt. Mir blieb nichts anderes übrig, als wegzufahren und nachzudenken. Eine Lösung für das Haus war erforderlich.
Vor dem Hintergrund der Trennung kam mir das Projekt ganz recht: Ich packte meine Siebensachen, nahm meine Hündin Joe und machte mich mit dem Autozug auf ins Abenteuer Sylt. Eine Saison lang übernahm ich die Personalverantwortung für vier Hotel- und Gastronomiebetriebe. Neben freier Kost und Logis stellte ich meinem Auftraggeber monatliche Honorare zwischen sieben- und zehntausend Euro in Rechnung. Ein richtig schönes Leben und mir ging es rundherum gut.
Zum Ende der Saison kehrte ich zurück nach Hamburg. Das Haus wurde mit dem Vorbesitzer rückabgewickelt. Um den ehemaligen Eigentümern die Rückabwicklung schmackhaft zu machen, legte jeder von uns fünfzigtausend Euro auf den Tisch. Viel Geld, aber uns blieb keine andere Wahl.
Geld kann man neu verdienen, und eine gescheiterte Beziehung kann man verarbeiten, dachte ich. Das Leben ist bunt. Was meine beiden vermieteten Immobilien anging, so stellte sich leider heraus, dass sie erhebliche bauliche Mängel aufwiesen. Neben notwendigen Reparaturen hatte dies die Geltendmachung von Mietminderungen und kurze Zeit darauf, nach Kündigung der Mieter, komplette Mietausfälle zur Folge. Ich stopfte die Lücken von meinem Ersparten und bediente brav die Darlehen bei der Bank bis, ja, bis meine Ersparnisse sich so langsam, aber sicher aufbrauchten und die Konten ins Minus rutschten, denn nach Sylt wollten trotz enormer Anstrengung partout keine geschäftlichen Aufträge ans Licht kommen.
Der fehlende Erfolg brachte unbezahlte Rechnungen mit sich, Verbindlichkeiten, für die ich geradezustehen hatte. Erste Mahnungen flatterten mir in den Briefkasten. Dieses Gefühl kannte ich bis dahin nicht. Ich fühlte mich klein und erfolglos. Zwar fand ich Wege, die Gläubiger in Schach zu halten und mit Ratenzahlungen zu beruhigen, aber das funktionierte nur, wenn man diese dann auch kontinuierlich leistete. Bald hangelte ich mich von einem Tag zum nächsten, immer in der Hoffnung, dass alles wieder in den grünen Bereich kommen würde. Mir war klar: Durststrecken gehören zur Selbstständigkeit dazu. Deshalb kam Aufgeben für mich nicht infrage, und so versetzte ich alles Wertvolle wie Schmuck und Möbel, um die Ratenzahlungen zu bedienen und von irgendetwas zu leben. Nach vielen Höhen und Tiefen kam ich auf dem beruflichen und persönlichen Tiefpunkt an.
Meine Miete konnte ich nur noch durch den Antrag von Arbeitslosengeld bezahlen, und meinen heiß und innig geliebten schwarzen Land Rover musste ich an die Leasinggesellschaft zurückgeben. Die erforderliche Mobilität stellte jetzt ein kleiner, schwarzer Ford Fiesta für siebenhundert Euro sicher, wie ihn Achtzehnjährige fahren – ein Auto, bei dem einem die technischen Mängel schon beim Einsteigen ansprangen und das alles ausstrahlte, nur nicht Sicherheit im Straßenverkehr. Ein Vehikel, mit dem jede Fahrt die Letzte hätte sein können, aber es erfüllte seinen Zweck: Fahren von A nach B, ein wenig Unabhängigkeit. Liebevoll nannte ich es Hutschefiedel.
Ich bekam nicht das Geringste auf die Beine gestellt, um meinen Lebensunterhalt sicherzustellen. Meine Ersparnisse waren aufgebraucht. Hinzu kam die drohende Insolvenz, weil sich meine beiden Immobilien mittlerweile in der Zwangsversteigerung befanden. Die wenigen Freunde, die mich umgaben, waren mit meinen Problemen überfordert, verstanden mich nicht – jedenfalls empfand ich es so.
Ich versank in meinem Kummer, zog mich von ihnen zurück, auch wenn sie es gut mit mir meinten. Den einzigen Halt gab mir meine nun fünfjährige schwarze Labradorhündin Joe, die immer an meiner Seite war, seit ich sie mit sechzehn Wochen auf einem Bauernhof bei Bremen aus einem Wurf von neun Welpen ausgesucht hatte. Egal, was ich auch erlebte, sie war bei mir, verzieh mir auch billiges Hundefutter, tröstete mich in den vielen dunklen Stunden.
Kapitel 4
Fieberhaft suchte ich nach Alternativen, nach Perspektiven, um mich aus meiner finanziellen Misere zu befreien. Es musste eine Lösung her, mit der ich wenigstens meine monatlichen Kosten bestreiten konnte!
Einmal blätterte ich wieder mal in der Samstagsausgabe des Hamburger Abendblattes in den Stellenanzeigen. Klassische Angebote für Festanstellungen kamen für mich nicht mehr infrage – ich wollte meine Selbstständigkeit auf keinen Fall wieder aufgeben. Es musste nur eine Überbrückung in Form eines Nebenverdienstes her, bis ich wieder neue Aufträge generieren würde. Also blätterte ich im hinteren Teil der Rubrik in der Sparte Nebenverdienst – und stieß dort auf die Kleinanzeige eines Finanzdienstleisters.
Es war eine fünfzeilige Fließtextanzeige, die ich in meinem alten Leben als Personalleiterin als unprofessionell bewertet hätte, weil sich das Unternehmen wenig bis gar nicht präsentierte, mit Aussagen recht bedeckt hielt und entweder nicht über genug Kapital verfügte, um eine seriöse Anzeige zu schalten oder nicht bereit war, mehr als achtzig Euro zu investieren. Kurz: ein Fünfzeiler, den man im Volksmund als Nepper, Schlepper, Bauernfänger bezeichnen würde, ein Lockangebot, bei dem man erst investieren muss, um dann den Traum von Geld nachzulaufen.
Ich wusste: Auf solche Anzeigen reagieren in der Regel Menschen, die ein geringes Selbstvertrauen haben, sich in einer schlechten finanziellen Situation befinden und kein stabiles privates Umfeld haben. Menschen, die hoffen, die auf der Suche nach einer letzten Chance sind. Die sich in einer kritischen Lebensphase befinden, die eine tiefe Sehnsucht nach einem kleinen Stück Glück in sich tragen – und zu diesen Menschen gehörte ich selbst, als ich auf diese Anzeige aufmerksam wurde:
Wir suchen Sie als Partner!
Wir bieten Ihnen Einarbeitung in ein einzigartiges Konzept.
Kein Verkauf! Fixum 1.800 EUR, KFZ, stornofreies Geschäft.
Wie? Rufen Sie uns an, damit wir uns kennenlernen.
Wir vermitteln keine Versicherungsverträge. Tel.: …
Trotz meiner Verzweiflung war mir nur zu bewusst, um welche Art von Angebot es sich hier handeln musste. Ich mochte solche Anzeigen nicht, fand sie abstoßend, billig.
Dennoch wählte ich zwei Tage später, am Montag, die Nummer, einfach so nach dem Motto: Mal in Erfahrung bringen, was dahintersteckt! Sowohl tausendachthundert Euro monatlich als auch ein Auto hätten schon einige meiner Probleme gelöst …
Es meldete sich ein Herr Filip, dem ich meine Skepsis frontal entgegenwarf. Verlieren konnte ich ja nichts. Aber es war eigenartig, er reagierte keineswegs aggressiv oder beleidigt. Im Gegenteil: Alles, was mein Gesprächspartner im Verlauf des Telefonats über das Konzept preisgab, klang neuartig, anders als all das, was ich bislang in der Branche kennengelernt hatte.
Filip war ausgebildeter Bankkaufmann, seit Jahren selbstständig im Bereich Immobilienverkauf. Dann fand er einen väterlichen Freund namens Rolf Landmann aus Schwaben, der ihn von dem Konzept überzeugte. Filip erzählte mir, dass ihm der Verkauf von Immobilien nicht mehr den gewünschten Zuspruch gebracht und er Probleme als Einzelkämpfer gehabt habe. Seine Entscheidung für ein Team und ein neuartiges Konzept – Trenne Risiko vom Sparen – war damit gefallen.
Das alles klang interessant, erfolgversprechend. Darüber hinaus sah ich Parallelen zu mir selbst: Ich war ebenfalls Einzelkämpferin, und meine Selbstständigkeit lief alles andere als erstklassig. Das Fazit der ersten Tuchfühlung: Wir vereinbarten einen Termin zu einem persönlichen Kennenlernen in seinem Büro.
Schon einen Tag später war es dann so weit. Herr Filip war eine Erscheinung, nach dem ersten Eindruck sogar ein angenehmer Mensch: hochgewachsen, an die einsneunzig groß, blond, gutgekleidet, smarte Ausstrahlung, eben ein typischer Hanseat, ein Hamburger Kaufmann, der mit seinem Charme auch bei Schwiegermüttern punktet.
Wir unterhielten uns gut zwei Stunden, und ich bekam immer mehr das Gefühl, dass diese Tätigkeit eine Lösung für mich sein könnte. Nach allen Informationen hatte ich ein gutes Bauchgefühl.
Für die Einarbeitung sollte ich am folgenden Wochenende auf ein Grundseminar, um die Firma, die Macher und das Konzept kennenzulernen. Die Gebühr inklusive Übernachtung dafür betrug hundertneunzehn Euro. Okay, die konnte ich gerade noch so aufbringen. Weitere Vorabinvestitionen waren nicht vorgesehen. Also was sollte mir schon passieren? Außer, dass ich nach dem Wochenende zu dem Ergebnis kam, dass diese Firma nichts für mich war.
* * *
Noch einige Tage bis zum Seminar. Herr Filip rief mich noch einmal an und bot mir eine Mitfahrgelegenheit an. Ich freute mich auf das Wochenende. Als ich jedoch am Samstagmorgen aufstand, stand mit mir auch mein innerer Schweinehund auf. Er war an diesem Morgen besonders ausgeschlafen, begann seinen Frühsport mit fiesen, zugleich schwer abwehrbaren Methoden, machte sich mit fettgedruckten Buchstaben in meinen Hirnzellen breit: Das schaffst du sowieso nicht. Das ist nichts für dich. Du hast gar kein Geld mehr für die kommende Woche. Wer weiß, wann du da ins Geldverdienen kommst. Lass es bleiben!
Man soll seinem inneren Schweinehund ja eigentlich den Kampf ansagen, aber dieses Mal gewann er, weil er in mir keinen Gegner sah. Rückblickend war es wohl meine Intuition, die mich vor Schlimmeren bewahren wollte.
„Sehr geehrter Herr Filip. Es tut mir leid, ich werde nicht am Seminar teilnehmen. Ich weiß, dass ich damit meine Chance verspielt habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzliche Grüße Katharina Milberg“, schrieb ich ihm, um wenigstens abzusagen.
Kurze Zeit später erhielt ich eine Reaktion: „Hallo, Frau Milberg, ich habe mir so etwas schon gedacht. Wollen wir Anfang der kommenden Woche einen Kaffee zusammen trinken?“
Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Normalerweise ist man nach so einer Nummer raus aus dem Spiel. Die nächsten Tage machte ich mir Gedanken darüber, ob ich mir nicht doch eine Chance geben sollte und sagte zu.
Wir trafen uns noch einmal, und zu meinem Erstaunen war Herr Filip weder sauer noch bekundete er weniger Interesse an einer Kooperation. Im Gegenteil, er zeigte Verständnis für meine Reaktion, nicht zuletzt, weil er meine Situation kannte. Ich war also nach wie vor im Boot. Mein innerer Schweinehund meldete sich nicht wieder.
Das Grundseminar sollte Anfang Dezember stattfinden. Jetzt galt es, diese Zeit zu überbrücken. Bis dahin trafen Herr Filip und ich uns noch ein paar Mal, und ich erfuhr schon etwas mehr über die tägliche Arbeit und das Vertriebskonzept. Es handelte sich um Anlagemöglichkeiten, wie sie sonst nurVermögendenzugänglich waren – dies bereits ab fünfzig Euro monatlich. Das klang gut für mich. So hätte ich mein Geld (das sich mittlerweile leider nicht mehr in meinen Händen befand) auch gern investiert! Dann wäre gewiss vieles anders gekommen und ich stünde jetzt nicht in dieser finanziellen Sackgasse. Da hatte sich jemand offenbar mal richtig Gedanken gemacht und hatte dem Normalbürger die Möglichkeit verschafft, so zu profitieren, wie es sonst nur die Reichen taten …
Die Gespräche taten mir gut. Ich hatte das Gefühl, dass das Geschäftsmodell etwas für mich sein könnte. Ich wollte die Menschen erleben, die hinter dieser Philosophie standen. Nicht zuletzt war ich gespannt darauf, meine persönlichen Chancen kennenzulernen.
* * *
Nach einigen Wochen war es endlich so weit: Mein erstes Grundseminar in Kassel. Im Laufe der Fahrt dorthin bot Herr Filip mir das Du an. Er hieß Axel.
Was an diesem Wochenende folgte, war das, was auf Vertriebsseminaren zu Beginn üblich ist: Die Neuen wurden den Teilnehmern von den Mitbringenden vorgestellt. Unterschiedlichste Motive hatten sie zur Teilnahme bewegt. Zum einen waren es Finanzmakler, die ein alternatives Produkt zum Eigenvertrieb suchten oder Probleme in der Selbstständigkeit lösen wollten, zum anderen Quereinsteiger aus fremden Berufen, die Ausschau nach einem Nebenverdienst hielten.
Der erste Tag: Firmenvorstellung, Marktsituation, Ausgangssituation der Kunden, Zielsetzung und -planung, Beantwortung von Fragen, gegenseitiges Kennenlernen, gemeinsames Abendessen, Treffen an der Hotelbar zum Small Talk, Rundgang der Geschäftsleitung, um sich näher auszutauschen. Es herrschte eine familiäre Atmosphäre. Alles in allem ein gelungener erster Tag und viele Eindrücke. Ich ging zufrieden und erwartungsvoll schlafen.
Am nächsten Tag wurden die Themen Terminvereinbarung, Karriereplan und Kundenanalyse präsentiert. Die Kundenanalyse war ein Formular, mit dem man die Daten beim Kunden aufnehmen sollte. Im Kundengespräch sollten dem Kunden vorab zwei Fragen gestellt werden: Wo wollen Sie hin? Und was haben Sie bereits dafür getan?
Des Weiteren sollten die Ziele, Träume und Wünsche des Kunden in dieses Formular eingetragen werden, damit ein Experte mit der Übersicht einen Anlagevorschlag erarbeiten konnte. Der Höhepunkt des Tages, die Verdienstmöglichkeiten, auch wenn die Anzeige noch positiver klang. Denn erst nach fünfhunderttausend Euro Umsatz erhielt man ein Fixum von eintausendachthundert Euro und ein Auto zur freien Verfügung.
Einer der Referenten beendete das Seminar mit Geschichten, die emotionale Schwerpunkte bei den Teilnehmern setzen sollten. Es diente dem Zweck, zu verdeutlichen, dass wir auch einen Preis für die Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen zahlen müssten. Es fielen Begriffe wie Fleiß, Ausdauer, Glaube, Wille, Einstellung, Begeisterung und Liebe. Dem Großteil der Teilnehmer war klar, dass es nur so funktionieren kann. Einige Anwesende waren begeistert, andere euphorisch und anderen wiederum war das Wochenende aus unterschiedlichen Gründen zu viel des Guten. Zu viel Vertriebsstimmung, zu viel Arbeit oder persönliche Gründe führten bei ihnen dazu, dass sie sich mit dem Wunsch nach einer Überlegungszeit von den Referenten verabschiedeten.
Zu diesen Menschen wollte ich nicht gehören. Wenn mir eines in meinem Leben klargeworden war: Wer etwas in seinem Leben erreichen will, muss auch bereit sein, dafür hart zu arbeiten. Mir war bis dahin noch keiner über den Weg gelaufen, dem ein Vermögen nur durch einen Achtstundenjob bzw. mit der Pflege eines Hobbys in den Schoß gefallen war – ausgenommen Erben, Lottogewinner und Betrüger.
Kapitel 5
Nach dem Seminar war ich von den Eindrücken psychisch und physisch erschlagen. Ich ließ das Erlebte sacken, sortierte meine Gedanken.
Das Konzept, das Produkt, die Köpfe – alles wirkte verheißungsvoll. Eine GmbH, die von den Herren gleichberechtigt geführt wurde. Die Vision: deutschlandweite Expansion. Ein Produktnehmer einer Schweizer Aktiengesellschaft, die wiederum den Geschäftszweck der Vermögensverwaltung von Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Pensionskassen, Universitäten und anderen Großanlegern erfüllte. Die AG agierte im weltweiten Kapitalanlagemarkt und hatte dabei speziell für Kleinanleger ein Produkt im Portfolio.
Die GmbH vertrieb das Produkt als Strukturvertrieb. Die Bezeichnung hatte in der Gesellschaft zwar keinen guten Ruf, aber hier wurde die Vertriebsform in der Art und Weise gewählt, wie sie auch bei Banken, Bausparkassen, Versicherungen oder anderen Anbietern aus Direktvertrieben vorzufinden war und diese war eher positiv. In den Medien waren die Vertriebe aufgefallen, bei denen vorsätzlicher Betrug der Mitarbeiter zum Nachteil der Kunden (Anleger) oder Veruntreuung von Kundengeldern nachgewiesen werden konnte. Und dies waren meistens Strukturvertriebe. Schon dadurch wurde der schlechte Ruf dieser Vertriebsform verursacht. Hinzu kam, dass mangelhafte Kundenberatung, Ausnutzung von Vertriebsmitarbeitern, die die meiste Arbeit machten, aber am wenigstens verdienten, weil sie den Löwenanteil an die überstellten Vorgesetzten weiterreichen mussten, bei vielen Vertriebsgesellschaften ebenfalls auf der Tagesordnung standen. Deshalb starteten einige große Unternehmen und Verbände bereits Initiativen, die sie in ein positives Licht rücken sollten.
Dazu gab Herr Keller, einer der Geschäftsführer, uns ein Sinnbild:
„Wissen Sie, es ist wie mit einem Messer: In der Hand eines Chirurgen rettet es Leben. In der Hand eines Mörders nimmt es Selbiges.“
Allen Teilnehmern war klar, dass die Vertriebsform für sich genommen in Ordnung ist, sie also immer nur davon abhängt, wie sie von den Köpfen eines Unternehmens umgesetzt wird. So hatte ich das bislang noch nicht gesehen.
Der Strukturvertrieb des Unternehmens gestaltete sich so, dass jede Hierarchiestufe direkt an der untergeordneten verdiente. Die Vermittler in den unteren Rängen behielten aber den größten Teil ihrer Provisionen. Okay. Das klang bei diesem Unternehmen fair. Bei anderen Vertriebsgesellschaften hatte ich das anders herum erlebt: Die unten verdienten den kleinen Teil und die oben steckten sich den höheren Teil der Provision ein.
Daraus resultierten zwei grundlegende Ziele der Berater, der mobilen Banker: Zum einen die aktive Akquise von Neukunden und Neugeschäft (denn jeder Abschluss brachte Provision), zum anderen die Anwerbung von so vielen neuen Mitarbeitern wie möglich, denn jeder Mitarbeiter sollte bare Münze wert sein. Nicht nur, dass jeder Vertrag jedes geworbenen Mitarbeiters Provision abwerfen sollte, auch die von ihm geworbenen Mitarbeiter brachten in der zweiten, dritten, vierten und fünften Ebene, Geld ein.
Für meine Verdienstmöglichkeiten sah ich daher auch eine positive Perspektive. Ich sah für meine finanzielle Misere das erste Mal Licht am Ende des Tunnels, auch wenn das Ende des Tunnels noch weit entfernt schien.
Die Produktphilosophie wurde präsentiert mit der markanten Überschrift: Trenne Risiko von Sparen. Es hieß nicht – Trenne Risiko vom Sparen, warum auch immer, es störte keinen. Wie sich später herausstellte, kein Rechtschreibfehler, sondern beabsichtigt, warum auch immer. Das Produkt, das dahinter stand, war eine Kapitalanlage, die sich Genussrecht nannte. Was Genussrechte genau waren, sollten wir nach dem Grundseminar in den regionalen Workshops und in der weiteren Ausbildung erfahren.
* * *
Mir war wichtig, dass das, was dem Kunden als Produkt angeboten wurde, für ihn echten Nutzen brachte. Woran ich dabei dachte? Wenn ich selbst nach all meinen finanziellen Fehlinvestitionen noch einmal zu Geld kommen sollte, das ich dann anlegen wollen würde, definierte ich drei Kriterien, damit ich noch einmal meine Unterschrift unter einen Vertrag setzen würde: Erstens eine Rendite, die mehr einbrachte als die marktüblichen Zinsen, zweitens Liquidität, sodass ich das Geld im Notfall kurzfristig zu Bargeld umwandeln könnte und drittens die Sicherheit, dass mein Geld nicht verloren ging.
Auf dem Seminar lernte ich nun das Magische Dreieck der Vermögensanlage der Finanzwissenschaft kennen. Hier fand ich meine Anlagewünsche nach Rendite, Liquidität und Sicherheit wieder, bis, ja bis der Referent darstellte, dass diese Ziele untereinander konkurrierten.
Sicherheit bedeutet Erhalt des Vermögens, zum Beispiel durch Streuung des Vermögens. Liquidität drückt aus, wie schnell ein investierter Betrag wieder zu Bargeld umgewandelt werden kann beziehungsweise wie hoch die Kosten dafür sind. Je kleiner der Umwandlungszeitraum, umso liquider die Vermögensanlage. Rentabilität beschreibt den Ertrag, der aus einer Investition in eine Anlage resultiert. Erträge können durch Dividenden, Zinszahlungen, Wertsteigerungen, Kursveränderungen oder sonstige Ausschüttungen erzielt werden. Dann kam der Referent auf die wechselseitigen Abhängigkeiten der Ziele zu sprechen, indem er Rendite, Liquidität und Sicherheit als Eckpunkte eines Dreiecks symbolisierte. Das Dreieck versinnbildlichte, dass immer nur zwei der drei Ziele erreichbar sind. Geldanlagen mit hoher Sicherheit und hoher Liquidität bzw. schneller Verfügbarkeit (zum Beispiel Sparbücher ohne Bindung) sind zwangsläufig wenig rentabel. Solche mit hoher Rentabilität und hoher Sicherheit (etwa langfristige Anleihen oder Sparverträge) sind zwangsläufig nicht liquide bzw. nicht schnell verfügbar, und solche mit hoher Rentabilität und schneller Verfügbarkeit (Aktien, Optionen) sind riskant.
Zu erörtern blieb das nicht zu unterschätzende Risiko einer möglichen Insolvenz der Schweizer Aktiengesellschaft. Es wurde mit dem Argument entkräftet, dass Großanleger wie Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Pensionskassen und Universitäten ihr Vermögen kaum bei einer GmbH anlegen würden, sondern ihr Geld ausgewählten und geeigneten Vermögensverwaltungen zur Verfügung stellen, um das Risiko eines Verlustes zu minimieren. Es wurde aber auch erwähnt, dass es für nichts und niemanden absolute Sicherheit gab. Keiner wisse, wohin sich die Märkte bzw. die Politik künftig entwickeln würden.
Zwei Alternativen standen dem Kunden dabei zur Auswahl: die Zahlung eines einmaligen Betrags oder eine regelmäßige monatliche Rate für eine bestimmte Laufzeit. Dafür erzielte er entweder einen über den derzeit üblichen Marktzinsen garantierten Zins zwischen sechs bis acht Prozent p. a. oder erhielt die (mit einem höheren Risiko verbundene) Chance auf eine noch höhere Rendite. Auch konnte er seinen Vertrag schneller in eine höhere Rendite bringen, wenn er zuvor entweder seine Lebensversicherung kündigte und das Kapital in seinen neu gezeichneten Vertrag einzahlte oder zu Beginn der Laufzeit eine Einmalzahlung in Höhe von fünf bis zwanzig Prozent der Anlagesumme vornahm.





























