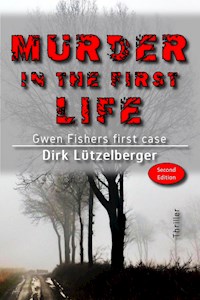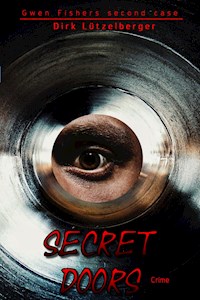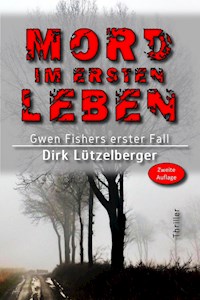
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Anonyme Gestalten surfen tagtäglich im Internet, um unerkannt ihren geheimen Fantasien nachzugehen. Wie eng die virtuelle und die reale Welt zusammenhängen, muss Hauptkommissarin Gwen Fisher in ihrem ersten Fall erfahren. Die alleinerziehende Mutter, die erst vor kurzem ihren geliebten Mann verloren hat, versucht ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, als der Täter das erste Mal zuschlägt. Mit Hilfe ihres 14-jährigen Sohnes erfährt sie Dinge aus einer virtuellen Parallelwelt im Internet, die sie nicht für möglich gehalten hatte. Spärliche Hinweise deuten auf Zusammenhänge hin, die sie zuerst nicht richtig zu deuten vermag. Zu spät bemerkt sie, dass der Killer bereits in der realen Welt die Fährte zu ihrer Familie aufgenommen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mord im ersten Leben
Von Anfang anSamstag, 17. November 2012, 23:45Samstag, 17. November 2012, 23:59Sonntag, 18. November 2012, 03:20Sonntag, 18. November 2012, 11:10Montag, 19. November 2012, 06:45Montag, 19. November 2012, 06:45Dienstag, 20. November 2012, 18:30Dienstag, 20. November 2012, 18:30Freitag, 23. November 2012, 19:05Sonntag, 25. November 2012, 08:57Dienstag, 27. November 2012, 22:45Mittwoch, 28. November 2012, 15:15Mittwoch, 28. November 2012, 14:30Donnerstag, 29. November 2012, 07:05Freitag, 30. November 2012, 09:00Sonntag, 02. Dezember 2012, 14:00Sonntag, 02. Dezember 2012, 18:00Montag, 03. Dezember 2012, 15:00Dienstag, 04. Dezember 2012, 19:00Mittwoch, 05. Dezember 2012, 17:50Donnerstag, 06. Dezember 2012, 12:30Donnerstag, 06. Dezember 2012, 10:30Samstag, 08. Dezember 2012, 19:00Sonntag, 09. Dezember 2012, 10:30Montag, 10. Dezember 2012, 18:30Dienstag, 11. Dezember 2012, 09:30Dienstag, 11. Dezember 2012, 18:30Mittwoch, 12. Dezember 2012, 08:45Mittwoch, 12. Dezember 2012, 20:00Donnerstag, 13. Dezember 2012, 09:00Freitag, 14. Dezember 2012, 19:45Sonntag, 16. Dezember 2012, 15:45Montag, 17. Dezember 2012, 14:45Donnerstag, 20. Dezember 2012, 19:30Freitag, 21. Dezember 2012, 09:00Samstag, 22. Dezember 2012, 14:00Sonntag, 23. Dezember 2012, 16:00Sonntag, 23. Dezember 2012, 18:00Montag, 24. Dezember 2012, 09:00Montag, 24. Dezember 2012, 19:00Montag, 24. Dezember 2012, 17:00Dienstag, 25. Dezember 2012, 00:00Mittwoch, 26. Dezember 2012, 13:45Donnerstag, 27. Dezember 2012, 09:00Freitag, 28. Dezember 2012, 16:00Sonntag, 31. Dezember 2012, 18:00Donnerstag, 10. Januar 2013, 17:00Donnerstag, 10. Januar 2013, 17:45Freitag, 11. Januar 2013, 17:00Samstag, 12. Januar 2013, 16:15Sonntag, 13. Januar 2013, 10:15Montag, 14. Januar 2013, 09:30Dienstag, 15. Januar 2013, 07:00Dienstag, 15. Januar 2013, 19:45Mittwoch, 16. Januar 2013, 09:30Mittwoch, 16. Januar 2013, 18:30Freitag, 18. Januar 2013, 08:30Montag, 21. Januar 2013, 07:15Donnerstag, 24. Januar 2013, 19:20Freitag, 25. Januar 2013, 12:20Samstag, 26. Januar 2013, 18:03Samstag, 26. Januar 2013, 18:05Samstag, 26. Januar 2013, 18:30Samstag, 26. Januar 2013, 19:00Samstag, 26. Januar 2013, 19:00Samstag, 26. Januar 2013, 19:25Samstag, 26. Januar 2013, 19:27Samstag, 26. Januar 2013, 19:29Samstag, 26. Januar 2013, 19:30Freitag, 01. Februar 2013, 20:11Leseprobe aus dem zweiten BuchKapitel 1DanksagungMord im ersten Leben
Thriller
Zweite Auflage
Dirk Lützelberger
© 2020 Dirk Lützelberger
Vom gleichen Autor sind ebenso erschienen:
Murder in the first life (English Edition) Roadtrip in Australien (deutsche Ausgabe) Road trip Australia (English Edition) Hintertüren (deutsche Ausgabe) Secret doors (English Edition)
Printed in Germany Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.Impressum Texte: © Copyright by Dirk Lützelberger Umschlag: © Copyright by Dirk Lützelberger Verlag: Dirk Lützelberger Am Sorgfeld 14 22587 Hamburg [email protected] Druck: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Anonyme Gestalten surfen tagtäglich im Internet, um unerkannt ihren geheimen Fantasien nachzugehen. Kriminalhauptkommissarin Gwendolyn Fisher, eine alleinerziehende Mutter, hat erst vor kurzem ihren geliebten Mann verloren. Sie versucht ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen, als der Täter das erste Mal zuschlägt. Zusammen mit ihrem Partner Kriminaloberkommissar Stefan Schick versucht sie die Fährte des Killers aufzunehmen, als dieser bereits ein weiteres Mal tötet. Ungewöhnliche Leichenfundorte und sehr unterschiedliches Vorgehen bei den Morden, lassen keinen Zusammenhang erkennen, aber doch erahnen die beiden sehr bald, dass es sich hierbei um einen Serienmörder handeln muss. Verzweifelt versucht Gwen die Untersuchungen voranzubringen und setzt dabei auch auf die Unterstützung ihres 14-jährigen Sohnes, dem der Tod seines Vaters sehr zu schaffen macht. Zusammen dringen sie in eine virtuelle Parallelwelt im Internet ein, die beide bisher noch nicht kannten. Liegt hier der Schlüssel zur Lösung des Falles? Der Killer hat in der realen Welt die Fährte zu ihrer Familie bereits aufgenommen. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Für Chrissi
Samstag, 17. November 2012, 23:45
So hatte er sich das nicht vorgestellt obwohl er schon mehrfach davon geträumt hatte, nackt und eingesperrt in einem engen Metallkäfig zu sitzen. In dieser kalten Novembernacht hatte es aber überhaupt nichts Erregendes mehr. Enttäuscht sackte er tief in sich zusammen.
Wie war er in diese Situation überhaupt gekommen, überlegte Kay. Unter anderen Umständen wäre es genau das gewesen, wonach er sich sehnte, aber in diesem Augenblick war es einfach nur unangenehm. Die Gitterstäbe hinterließen mittlerweile sehr schmerzhafte Abdrücke an seinem ganzen Körper. Ein eisiger Windzug glitt über seinen nackten Körper und er bekam Gänsehaut. Etliche Stunden saß er nun in seinem Gefängnis und er fröstelte. Das machte nun wirklich keinen Spaß mehr. Hatte es als Spaß begonnen? Kay wusste nichts mehr. Irgendwie war seine Erinnerung ausgelöscht. Es war an der Zeit, dieses Spiel hier zu beenden. Aber wie? Warum er, warum jetzt, fragte sich Kay. Aber je mehr er darüber nachdachte, desto weniger hatte er eine Antwort auf seine Fragen.
Seine Sinne waren durch die Dunkelheit geschärft und er begann seine Umgebung zu erkunden. Es roch leicht nach Benzin. Nicht penetrant, mehr so, als wenn jemand einige Tropfen Benzin verschüttet hätte, welches nun verdunstete. Die Luft war klamm und feucht. Er spürte hin und wieder einen Luftzug, der über seine Haut strich. Wo war er? Kay konnte sich an nicht sehr viel erinnern, egal, wie sehr er es auch versuchte. Jemand hatte ihn von hinten gegriffen. Er war gerade nach Hause gekommen und hatte seinen Wagen abgestellt. Der Fremde hatte ihm ein Tuch auf Mund und Nase gedrückt. Nach was hatte es gerochen? Kay erschauderte bei der Erinnerung an den Krankenhausgeruch. Dann ein Abgrund, ein schwarzes Loch. Seine Beine gaben nach und… hier verließ ihn seine Erinnerung. Als er aufwachte, war es hell. Der nächste Tag? Oder schon der Übernächste? Machte das irgendeinen Unterschied? Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Er musste hier raus und zwar schnell. Seine Beine, sein Rücken und sein Hintern schmerzten mittlerweile unerträglich. Er kannte das Phänomen. Auf seinen Reisen im Internet hatte er davon gelesen. Der menschliche Körper muss sich von Zeit zu Zeit ausstrecken können. Die Muskeln müssen sich lockern, dehnen und wieder zusammenziehen. In einer Position kann der Körper nicht sehr lange verweilen. Wird er gezwungen, weil er zum Beispiel gefesselt war, verursacht dies nach kurzer Zeit höllische Schmerzen und die Muskeln fangen dann an sich zu verkrampfen. Kay verspürte den nächsten Krampfanfall in seinem Oberschenkel, da er sich seit Stunden kaum rühren konnte. Seine gewaltige Fülle wurde ihm nun zum Verhängnis. Sein schwabbeliger Körper füllte das kleine Gefängnis seitlich vollkommen aus, wodurch er zur Bewegungsunfähigkeit verdammt war. Er musste so ausharren bis Hilfe kam. Zu allem Überfluss, dachte er, waren seine Hände auch noch hinter seinem Rücken mit Handschellen an den Gitterstäben angekettet. Seine Beine waren zwar nicht gefesselt, aber er musste sie wegen der Enge im Käfig angewinkelt abstellen und konnte sie keinesfalls ausstrecken.
Die nahegelegene Turmuhr schlug. Kay zählte die Schläge. Noch eine halbe Stunde bis Mitternacht.
Er hatte sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt und seine Pupillen waren weit geöffnet. Schattenhaft konnte er seine Umgebung wahrnehmen, aber weiter als bis zu den Gitterstäben konnte er keine Details erkennen. Es musste Neumond sein, denn auch durch das kleine Fenster hinter ihm fiel kein Licht ein, was ihm die Orientierung im Raum erleichtert hätte.
Ohne Vorwarnung wurde das Licht eingeschaltet und seine Augen schmerzten. Es war gleißend helles Licht, was seine Netzhaut unvorbereitet traf und er kniff reflexartig seine Augen zusammen. Schritte! Schritte, die auf ihn zukamen. Langsam blinzelte Kay, aber er erkannte keine Details. Er konnte nur die schwarzen, schattenartigen Umrisse einer Person wahrnehmen.
»Wie geht es Dir?«, fragte die Person mit sanfter Stimme. Kay war verwirrt von der ruhigen Tonlage seines Peinigers. »W-w-warum tun Sie das? Was w-w-wollen Sie von mir?« Seine Stimme zitterte.
»Du wolltest es so haben«, säuselte der Unbekannte wieder in der gleichen monotonen Tonlage. Er überlegte kurz und fuhr dann weiter fort: »Ich erfülle Dir nur Deine Träume!«
Hatte er richtig gehört? Das musste ein schlimmer Traum sein, dachte Kay.
»Das ist doch Wahnsinn! Wie kommen Sie darauf, dass ich von so etwas hier geträumt hätte? Machen Sie mich sofort los!« Mittlerweile hatten sich seine Augen an das helle Licht gewöhnt und er konnte sie normal öffnen. Kay musterte sein Gegenüber. Kannte er ihn? Wieso sagte er dann, dass er ihm seine Träume erfüllen wolle. Was war das für ein Kerl? »Bitte – bitte lassen Sie mich gehen. Meine Frau sucht bereits nach mir. Ich erzähle es auch niemandem weiter. Bestimmt nicht. Bitte!«
»Ich glaube nicht, dass Deine Frau bereits nach Dir sucht«, entgegnete ihm der Unbekannte monoton. »Schließlich vertragt ihr euch nicht mehr so gut wie früher! Warum sollte sie nach Dir suchen, wenn Du immer die Nächte fort bleibst und kein Wort darüber verlierst, wo Du Dich herumgetrieben hast?«
Woher wusste der Kerl alle diese Einzelheiten über ihn, über sein Leben und seine Familie? Kay schauderte am ganzen Körper, als der Unbekannte um den Käfig herum ging und hinter ihm stehen blieb. Suchend wandte Kay seinen Blick nach rechts und links und erkannte, dass er in einer Garage war, wie der Benzingeruch ihn schon hatte vermuten lassen. An der einen Wand hingen allerlei Werkzeuge und auf einem Regal an der anderen Wand standen verschiedene Kanister mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Der Mann hinter ihm kramte in seiner Werkzeugbank. Die Geräusche, die Kay vernahm, verhießen nichts Gutes. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Er befürchtete, der Fremde könnte es Schlagen hören.
»Wir werden eine kleine Reise unternehmen«, fuhr der Unbekannte fort und Kay vernahm jetzt das Geräusch, das Klebeband beim Abziehen von einer Rolle machte. Es ging alles sehr schnell und ehe Kay genau verstand, griffen Hände von hinten durch die Gitterstäbe. Mit flinken Fingern versiegelte die Gestalt Kays Lippen.
»Wir wollen doch nicht, dass Du die Nachbarn aufweckst, oder?«
Kay konnte das grässliche Lächeln geradezu hören. Er atmete heftig durch seine Nase ein und aus, schüttelte sich, wollte das Klebeband loswerden, aber es klebte bereits perfekt auf seiner Haut. Panik stieg in ihm auf. So sehr er sich auch bemühte, seine Lippen brachte er keinen Millimeter mehr auseinander. Kay riss die Augen auf, als der Käfig nach hinten gekippt wurde und sein Kopf gegen die Stangen schlug. Er rollte los. Der Kerl schob ihn tatsächlich mit samt dem Käfig auf einer Sackkarre durch die Garage.
»Die Fahrt wird nicht lange dauern. Mach es Dir bequem.«
Samstag, 17. November 2012, 23:59
»Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf«, zählte Gwendolyn Fisher begeistert an und zusammen mit Elisabeth Robinson und Stefan Schick beendeten sie gemeinsam den Countdown, »vier, drei, zwei, eins!«
Dann stimmten alle anderen Gäste mit ein und sie sangen zusammen: »Happyyy Bööörthday, tooo you – Happy Bööörthday to youuuuu.«
Paul Fisher bekam bei den schrägen Tönen eine Gänsehaut, aber er lächelte tapfer, als er seine Freunde singen hörte. Es war schön sie wiederzusehen und alle waren sie an seinem Ehrentage der Einladung gefolgt. In seinen sechsundvierzigsten Geburtstag hineinzufeiern war Gwendolyns Idee, oder Gwen, wie sie eigentlich von allen genannt wurde. Sie hatte immer so tolle Ideen und war jederzeit für eine Überraschung gut, dachte Paul und sah verliebt in ihr Gesicht. Die jugendliche Ausstrahlung seiner Frau lag sicherlich an ihren grünen Augen, die voller Begeisterung wie Smaragde leuchteten. Sie war von Anfang an Pauls Traumfrau gewesen, seit er ihrem Lächeln und ihren Blicken bei ihrer ersten Begegnung erlegen war. Gwen warf ihre langen, lockigen, roten Haare zurück, als sie ihrem Mann um den Hals fiel. Paul konnte sich kaum auf den Beinen halten, als Gwen ihm einen Geburtstagskuss auf den Mund drückte, um den ihn jeder anwesende Mann beneidete.
Gwen lachte aus vollem Halse: »Nun bist Du schon in Deinem siebenundvierzigsten Lebensjahr, Du alter Sack, während ich erst zweiundvierzig bin!«
Die Partygäste amüsierten sich, obwohl sie den Spruch jedes Jahr hören mussten. Es war Gwens spezielle Art die Fakten zu interpretieren und positiv für sich zu deuten. Sie war ein Naturtalent für Frohsinn und Freude.
»Ich will auch gratulieren«, zwängte sich Phillip durch die Gruppe auf seinen Vater zu und schlang seine Arme um ihn. »Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Bleib, wie Du bist, so liebe ich Dich.« Paul schluckte schwer bei der Umarmung seines vierzehnjährigen Sohnes, der von allen nur Phil genannt werden wollte. Er erinnerte ihn so sehr an sich selbst, als er noch klein war, und gleichermaßen sah er in ihm viel von seiner Frau. Den vorwitzigen, schelmischen Blick und die wachen blauen Augen hatte er von seinem Vater, die unverkennbaren roten Haare von seiner Mutter. Er selber hatte sich vor einigen Jahren mit sich selbst auf eine Glatze geeinigt, als seine Haare grau wurden und auszufallen begannen. Das war zumindest sehr pflegeleicht, überlegte Paul, und es wirkte in den Augen seines Sohnes auch ›cool‹. Ein bisschen wie der Held in ›Stirb langsam‹, hatte er immer wieder gesagt. Paul lächelte bei dem Gedanken daran.
»Nun macht mal Platz für eure alte Mutter!« Eigentlich hieß sie Elisabeth, aber der Name war ihr zu altmodisch gewesen, daher nannten sie alle nur Beth oder auch mal Lisbeth, wenn es sein musste. Sie schlängelte sich, trotz ihrer zweiundsiebzig Jahre noch gewandt durch die Menge und erreichte ihren Schwiegersohn. Sie neigte sich zu seinem Ohr. »In meinem Alter verträgt man es schlecht, wenn die Kinder einem Sorgen bereiten. Daher bleibst Du am besten gesund und munter, damit wir noch viele, schöne Partys zusammen feiern können.« Dann küsste sie ihn auf die Wange.
»Nun lasst uns endlich mal anstoßen, bevor wir verdursten!«, schlug Michael Peters vor und hob sein Glas. Dr. Peters war ein langjähriger Freund der Familie und arbeitete schon viele Jahre mit Gwen im Landeskriminalamt Kiel zusammen. Er war in der forensischen Abteilung mit der Untersuchung von Tatorten und Hinweisen betraut. Gwen war mittlerweile zu einer Kriminalhauptkommissarin befördert worden und zusammen mit ihrem Kollegen, Kriminaloberkommissar Stefan Schick, waren die beiden ein eingespieltes Team.
Alle drei prosteten Paul zu, als dieser plötzlich kraftlos und unerwartet zu Boden sank.
»Paul, was ist mit Dir?«, schrie Gwen und versuchte den fallenden Körper noch aufzuhalten. Aber die neunzig Kilogramm glitten unaufhaltsam zu Boden, wo Paul regungslos liegen blieb. Die umherstehenden Gäste waren wie paralysiert, als sich Michael als erster der Situation bewusst wurde und neben Paul auf die Knie sank. Sofort schüttelte er ihn an den Schultern: »Paul, kannst Du mich hören?«
Michael legte sein Ohr an Pauls Nase und beobachtete, ob sich der Brustkorb noch bewegte. Die Gäste um ihn herum wagten selber kaum zu atmen. Nach einigen Sekunden formten seine Lippen ein langsames ›Schei…ße‹, dann richtete sich Michael auf und war in seinem Element. Er hatte solche Situationen schon viele Male erlebt.
»Stefan, ruf sofort den Notarzt an!«, kommandierte er. »Sie sollen sich beeilen, er hat wahrscheinlich einen Herzinfarkt!«
»Gwen, Du kommst gleich mit! Zieh Dir eine Jacke an und Beth, bitte versorge die Gäste und bleibe bei Phil, bis wir uns aus dem Krankenhaus melden. Und jetzt bitte alle Mann raus hier!« Michael, riss Pauls Hemd auf, fing unmittelbar mit der Herzdruckmassage an, um den Kreislauf seines Freundes aufrecht zu erhalten. Er musste die Zeit überbrücken, bis der Rettungswagen kam.
♦♦♦
Dr. Peters kannte das Notarztteam sehr gut, welches nach wenigen Minuten ins Wohnzimmer kam. Er rief ihnen aus der Entfernung zu, ohne die Herzdruckmassage zu unterbrechen: »Den Defi, schnell!« Er wusste, dass Paul bei seinen ehemaligen Kollegen in guten Händen war und konnte in diesem Moment nichts weiter für ihn tun. Ein Defibrillator, der den Herzrhythmus durch einen gezielten Stromstoß wieder in geordnete Bahnen bringen würde, war das Einzige, was nun noch helfen konnte. Da war sich Michael sicher.
Als die Sanitäter übernommen hatten, stand er auf und umarmte Gwen. Atemlos beobachteten sie die Bemühungen der Ärzte. Hoffnung keimte in Gwens Augen auf, als die Notärzte in Hektik ausbrachen.
»Wir haben wieder einen Puls!«, jubelte der jüngere der beiden Ärzte. »Er muss sofort ins Krankenhaus!«
Auf dem Weg zum Krankenwagen rief Michael Gwen zu: »Steig vorne ein, ich bleibe hinten bei Deinem Mann!« Während Gwen nach vorne hastete, rief Michael zu Stefan: »Wir fahren ins Bundeswehrkrankenhaus, das ist am nächsten.« Er ergänzte seine Anweisungen: »Halte Du uns im Streifenwagen den Weg frei!«
Stefan rannte zu seinem Ford Focus Turnier, in dem er direkt nach Beendigung seiner Schicht zu Pauls Geburtstag gefahren war. Er schaltete das Blaulicht ein und wartete mit laufendem Motor, dass sich auch der Notarztwagen endlich in Bewegung setzte.
Sie verließen Gwens Grundstück über die Schottereinfahrt und fuhren zunächst links in Richtung Hauptstraße. Warum musste Gwen auch so weit ab vom Schuss wohnen, grübelte Stefan, während er an die Kreuzung heranfuhr, um nach rechts abzubiegen. Er blickte in den Rückspiegel. Sie waren hinter ihm.
Gar keine Frage, dies war eine wunderschöne Gegend, ein paar Kilometer nordöstlich von Kiel, aber am Arsch der Welt. Nichts als Felder, Wanderwege und Ruhe, hatte ihm Gwen einmal vorgeschwärmt. Jetzt hätten sie sich bestimmt ein Krankenhaus in der Nähe gewünscht und nicht knapp acht Kilometer entfernt. Sie waren alleine auf der Hauptstraße und Stefan gab Gas. Er war nicht mal fünfzig Jahre alt, hoffentlich überlebt er das, überlegte Stefan, während er im Rückspiegel den Krankenwagen sah. Er fixierte die zwei Fernlichter, die mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zu rasten. Krampfhaft hielt Stefan das Lenkrad seiner Barbarix umklammert während die Lichter immer näher kamen. Barbarix, so nannten er und Gwen liebevoll ihren blau-weißen Streifenwagen. Sie beide waren ungefähr im gleichen Alter und unterhielten sich oft, während sie zusammen auf Streife waren. Irgendwann erzählte ihm Gwen, dass sie in ihren Kindheitstagen ein Fan von Barbapappa war. Eine Sendung, die regelmäßig im Kinderprogramm lief. Barbarix war darin der schlaue Blaue. Irgendwie passte dies zu ihnen, meinte Gwen, und so tauften sie ihr Gefährt einfach Barbarix. Zusammen hatten sie schon viele aufregende Zeiten erlebt und auch viele schwierige Fälle gelöst. Sie waren beide ebenso schlau, wie damals Barbarix.
Dieser Idiot wird sich noch umbringen, grollte Stefan zu sich selbst, als er merkte, dass der Wagen hinter ihnen mit einer irren Geschwindigkeit dabei war, den Notarztwagen und ihn selbst zu überholen. Im Bruchteil einer Sekunde war der Wagen an ihnen vorbeigeschossen. Ein roter Porsche, war ja klar, dachte Stefan und schrie aufgebracht dem davonbrausenden Wagen hinterher: »Du Penner, muss das denn sein?«
Da bremste dieser abrupt ab, als wenn er es gehört hätte, und bog scharf links in die Seitenstraße ein, wo er sich plötzlich einem Kleintransporter gegenüber sah. Nur eine Vollbremsung der beiden Wagen konnte einen Zusammenstoß vermeiden. Reifen quietschten und eine graublaue stinkende Wolke von verbranntem Gummi umgab die beiden Fahrzeuge, als sie zum Stillstand kamen.
Stefan riss erschrocken die Augen auf und erfasste im Bruchteil einer Sekunde die Situation. Er erkannte wie der rote Porsche und ein weißer Lieferwagen mit Aufschrift an den Seiten, im Abstand von nur wenigen Metern voreinander, zum Stillstand gekommen waren. Beide Fahrer saßen erschrocken in ihren Fahrzeugen und schienen unverletzt. Seine Ladung wird der Transporter erst einmal neu sortieren dürfen, dachte Stefan und offensichtlich brauchten sie seine Hilfe im Moment nicht. Gerne wäre Stefan ausgestiegen, um dem Porschefahrer seine Meinung zu sagen, aber dazu war jetzt keine Zeit. Sein Freund brauchte dringend einen Arzt. Das war das Wichtigste. Stefan deutete dem Notarzt hinter ihm durch ein Handzeichen aus dem Fenster an, dass sie weiterfahren würden und gab Gas.
♦♦♦
Die verbleibende Fahrt zum Krankenhaus dauerte keine zehn Minuten. Mit quietschenden Reifen kamen der Streifenwagen und der Notarztwagen vor der Notaufnahme zum Stehen. Die Ärzte im Bundeswehrkrankenhaus waren informiert und warteten bereits. Mit sorgenvoller Miene entstieg Gwen dem Wagen und stolperte hektisch in Richtung Eingang der Notaufnahme. Dr. Michael Peters öffnete die hinteren Türen des Notarztwagens, lief zu Gwen und nahm sie in die Arme. Er drückte sie fest an sich und sie wandten sich von ihrem Mann ab, der bereits auf der Trage und auf dem Weg in den Untersuchungsraum war.
»Du musst nun sehr tapfer sein, Gwen«, flüsterte Michael und fuhr fort. »Dein Mann hatte während der Fahrt einen weiteren Herzstillstand erlitten. Wir konnten nichts mehr tun und die letzte Hoffnung liegt bei den Ärzten hier im Krankenhaus.«
Gwen ließ ihren Gefühlen freien Lauf und schluchzte laut auf. Michael drückte sie noch fester an sich und strich ihr mit einer Hand über ihr langes Haar. Gwen konnte ihre Tränen nicht mehr halten und sackte in Michaels Armen zusammen. Mehrere Minuten standen sie so da und Michael versuchte, Gwen durch sanfte Worte und Streicheln ihres Nackens zu beruhigen.
»Lasst uns doch reingehen, ihr erkältet euch noch«, sagte Stefan und mit den Worten: »Ich fahre kurz den Wagen auf den Parkplatz«, verschwand er auch gleich wieder.
Minuten darauf trafen sich Michael, Gwen und Stefan im Warteraum wieder. Es war ein kalter und steril wirkender Raum. Ohne Atmosphäre und das Weiß an den Wänden war alles andere als beruhigend. Lediglich das Bild eines Sonnenunterganges hing an einer Seite des Raumes, der ansonsten nur mit Plastikstühlen an den Wänden und einem Tisch in der Ecke bestückt war.
Gwen hatte sich etwas beruhigt und wandte sich mit fragendem Blick an Stefan.
»Was soll nur werden, wenn Paul jetzt stirbt? Wie soll ich ohne ihn weiterleben? Was wird aus Phil? Wie soll ich das alleine alles unter einen Hut bringen?«
Stefan trat einen Schritt auf Gwen zu und umarmte sie. »Soweit muss es nicht kommen Gwen, die Ärzte bemühen sich um Paul so gut es geht. Du darfst die Hoffnung nicht verlieren.«
Stefans Worte waren noch nicht ganz ausgesprochen, als sich die Tür zum Untersuchungszimmer öffnete und ein Arzt mit Unheil verkündender Miene herauskam. Stefan und Michael ahnten nichts Gutes, für Gwen war es bereits in diesem Moment Gewissheit. »Neeeeeiiiiiin!«, schrie sie auf und ihre Beine versagten ihren Dienst. Stefan fing sie gerade noch auf, bevor sie auf dem Boden aufschlug. Er setzte sie auf dem nächsten Stuhl ab. Der Arzt nickte Dr. Peters zu, um Gwens Vermutung wortlos zu bestätigen. Dann wandte er sich an Gwen, die ihr Bewusstsein gerade noch behalten konnte.
»Es tut mir sehr leid, Frau Fisher, wir konnten nichts mehr tun.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Mein herzliches Beileid für Sie.«
Ärzte waren auch nicht die geborenen Redner, aber was hätte er in dieser Situation groß sagen sollen, dachte Stefan, während er weiterhin versuchte, Gwen zu beruhigen. Stefan deutete Michael durch ein Nicken an, er solle heranrücken, denn schließlich würden sie ohne Paul zurück nach Hause fahren müssen, um auch Beth und letztendlich Phil die schlechte Nachricht zu überbringen.
Schweigend fuhren sie im Streifenwagen die wenigen Kilometer zurück nach Felm, einem kleinen Örtchen, den Paul und Gwen schon vor einigen Jahren als Wohnort für ihre Familie auserkoren hatten. Umgeben von Reiterhöfen, Wald und Feldern ein wunderbarer Ort für einen Heranwachsenden, um sich auszutoben sowie exzellenter Erholungswert am Abend und Wochenende für die Erwachsenen mit ihren anstrengenden Jobs unter der Woche. Das Gymnasium Kronshagen, welches Phil besuchte, lag auf halben Weg zu Gwens Arbeit, so dass sie es immer gut verbinden konnte, ihren Sohn zur Schule zu bringen.
Gwen hatte während der gesamten Fahrt nichts gesagt. Was würde nun aus dieser Idylle werden, dachte sie. Wie soll es nun ohne Paul weitergehen? Gwen brach erneut in Tränen aus. Michael nahm sie abermals in den Arm, während Stefan den Wagen ruhig durch die Nacht gleiten ließ. Sie kamen an der Stelle vorbei, an der sich auf der Fahrt zum Krankenhaus fast ein Unfall ereignet hatte. »Zum Glück ist wohl nichts passiert«, murmelte Stefan in sich gekehrt, als er sah, dass die beiden Fahrzeuge nicht mehr da waren.
Phil war bereits seit einigen Stunden im Bett, als Beth ihre Tochter an der Eingangstür des Hauses in Empfang nahm. Ihr geblümter Morgenmantel war kein Schutz vor der Novemberkälte und sie zitterte schon am ganzen Körper, als sie ins Freie trat. Ein Blick in die Augen ihrer Tochter sagte alles und ihr Zittern verstärkte sich nur noch mehr, als sie Gwen umarmte. »Sag mir, dass das nicht wahr ist!«, flehte sie.
»Sie konnten leider nichts mehr für Paul tun«, erklärte Michael, dem klar war, dass Gwen in diesem Moment zu keiner Antwort fähig war. »Es tut mir so leid für Sie beide. Lassen Sie uns reingehen. Es ist sehr kalt heute Nacht.«
Sonntag, 18. November 2012, 03:20
›Jeden Tag eine gute Tat‹, hatten ihm seine Eltern eingebläut. Mark Stein war glücklich und in einem Zustand größter innerer Zufriedenheit. Obwohl es spät war, hatte er seine gute Tat für heute endlich vollbracht. Nun war er müde. Nachdem er seinen Wagen in der Garage abgestellt hatte, wollte er nur noch nach Hause und ins Bett. Mark war groß, ca. 1,90 Meter und kräftig gebaut, nicht dick, und gut trainiert. Seine langen Beine trugen ihn schnellen Schrittes zurück in die Siedlung, in der sich seine kleine Wohnung befand. In den alten Bauten gab es noch keinen Luxus wie eine Tiefgarage oder Stellplätze. Wer zuerst kam, mahlte zuerst, und konnte einen der wenigen Parkplätze an der Straße ergattern. Dieses Glück war Mark selten beschert und es hatte ihn schon immer geärgert, auch im Winter und bei schlechtem Wetter erst zu seiner Garage laufen zu müssen, bevor er mit seinem Wagen zur Arbeit fahren konnte.
Weit nach Mitternacht betrat Mark seine Einzimmerwohnung fast lautlos, um die Nachbarn im Haus nicht zu wecken. Es war eine kleine, aber sehr ordentliche Zuflucht mit allem, was man zum Leben brauchte. Ein kleines Bad, spartanisch eingerichtet mit weißen Möbeln aus dem Supermarkt, ein kombiniertes Wohn-/Schlafzimmer mit einer Ausziehcouch und eine kleine Küche. Mark lebte alleine, seitdem er bei seinen Eltern ausgezogen war. Eine Frau an seiner Seite konnte er sich zurzeit nicht vorstellen. Er lebte für seinen Beruf. Tagein, tagaus immer der gleiche Trott, aber er erfüllte ihn mit Stolz und Befriedigung. Er konnte hier wirklich etwas Gutes tun, und das jeden Tag.
Obwohl Mark müde war, entschloss er sich, noch einen kleinen Moment mit seinen Freunden im Internet zu verbringen. Schließlich hatte er sie die letzten Tage etwas vernachlässigt. Aber es war ja für einen guten Zweck gewesen. Nachdem Mark seine Wohnung betreten hatte, ging er sofort zu seinem Computer auf dem kleinen Arbeitstisch und schaltete ihn ein. Während die alte Kiste hochfuhr, konnte er sich in Ruhe die Hände waschen, etwas Bequemeres anziehen und ein Bier aus dem Kühlschrank holen. Mark setzte sich in seinen alten Bürostuhl vor den Rechner, der nun bereits auf die nächsten Kommandos wartete. Routiniert bewegte er die Maus auf das Symbol und startete das Programm. Mark rieb seine Augen, reckte sich und als er wieder auf den Bildschirm schaute, hatte sich die schillernde Welt des Internets bereits auf seinem Monitor aufgebaut und er konnte sich einloggen.
Seine Hände huschten in schlafwandlerischer Sicherheit über die Tastatur, als er seinen Benutzernamen und sein Passwort eingab. Dies hatte er bereits einige hundert Mal getan und seine Finger kannten die Bewegungen auswendig, ohne dass ihnen ein Fehler unterlief.
Benutzername: Miss Gore
Passwort: ********
Das Programm begrüßte ihn.
Willkommen zurück Miss Gore.
Ihr letzter Besuch war vor 3 Tagen und 6 Stunden.
Ein Lächeln ging von Marks Lippen aus, als er die Begrüßung las. Sein vollständiger Avatarname war Miranda Gore. Das war ihm aber zu lang und er hatte seinen Benutzernamen auf Miss Gore gekürzt, um auch seiner dominanten Art Ausdruck zu verleihen. Miranda war der Name seiner Mutter. Von ihr hatte er so viel gelernt. Wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hatte, was man tat und zu lassen hatte und dass man jeden Tag eine gute Tat vollbringen musste. Seinen Eltern, und speziell seiner Mutter, hatte er jeden Wunsch von den Augen abgelesen und sich immer so verhalten wie sie es von ihm erwarteten. Schon in seiner Schulzeit war er seinen Lehrern nie zur Last gefallen. Er hatte immer seine Hausaufgaben gemacht, war pünktlich zum Unterrichtsbeginn in der Klasse, hatte nie gestört und war immer sehr hingebungsvoll in den Aufgaben vertieft, die ihm seine Lehrer stellten. Gerne erinnerte er sich an die Biostunde, in der sie einen Frosch sezieren sollten. Einige der Mädchen hatten geweint und sich geweigert, mitzumachen. Andere Jungs hatten sich übergeben, als sie einen Tropfen Blut sahen. Mark lächelte bei dem Gedanken daran wie er den ersten Schnitt gesetzt hatte und die Lehrerin ihn vor der ganzen Klasse lobte. Irgendwie machte ihm das Blut und alles drum herum nichts aus, denn er hatte ja eine Aufgabe zu erfüllen. Gerne wäre er Arzt geworden, aber seine Schulnoten erlaubten diesen Schritt am Ende seiner Schulzeit nicht, so dass er sich stattdessen in eine Ausbildung stürzte. An das Lob der Lehrerin konnte er sich heute noch gut erinnern und dies war auch ausschlaggebend für den zweiten Teil seines Benutzernamens. ›Gore‹ stand im englischen für geronnenes Blut und den Akt des Aufschneidens. Dies erinnerte ihn immer an den armen Frosch und seinen offenen Bauch, nachdem er den ersten Schnitt präzise gesetzt hatte.
Dann wollen wir doch mal sehen, wer um diese Zeit noch wach ist, sprach Mark zu sich selber und fing an zu tippen.
[Miss Gore]: Guten Abend, ist jemand anwesend?
Eine Minute verging, dann noch eine weitere. Schließlich kam die erhoffte Antwort.
[Priscilla]: Oh ja, meine Herrin, Ihre Dienerin ist anwesend.
Mit Priscilla hatte Mark bereits einige Wochen Spaß. SIE war in Wirklichkeit ein ER. Mark hatte dies schnell herausgefunden, zumal er auch im falschen Geschlecht unterwegs war und die Indizien kannte, mit denen sich die Kerle meistens verrieten. Er selber hatte nie einen Hehl aus seinem wahren Geschlecht gemacht. Ganz im Gegensatz zu seinen Mitspielern, denn sie gaben keinen Namen, keinen Hinweis auf das wirkliche Geschlecht und auch keine Informationen aus ihrem realen Leben preis. Aber zu Mark schlossen sie schnell Vertrauen und das löste mit der Zeit auch ihre Zungen. Erstaunlich, wie viel die Menschen von sich preisgaben, wenn sie sich im Schutz der Anonymität im Internet sicher fühlten.
[Miss Gore]: Willkommen meine Sklavin. Du bist ja noch wach?
[Priscilla]: Ja, Herrin. Ihr Mädchen konnte nicht schlafen und musste immerzu an Sie denken.
[Miss Gore]: Das ist schön zu hören, aber warum kannst Du nicht schlafen?
[Priscilla]: Meine Gedanken kreisen immerzu um ein Thema.
[Miss Gore]: WAS HABE ICH DIR BEIGEBRACHT? DU UNNÜTZES STÜCK!
[Priscilla]: Herrin, bitte nicht böse sein. Sie haben Ihrer Sklavin beigebracht, dass ihr nichts gehört. Auch nicht ihre Gedanken. Es hätte heißen müssen: »Die Gedanken Ihres Mädchens kreisen immerzu um ein Thema.«
Die Antwort ließ auf sich warten.
[Priscilla]: Herrin, bitte seien Sie nicht böse mit Ihrer Sklavin, es ist schon spät.
[Miss Gore]: DU STÜCK DRECK, versuchst Du jetzt, Deine Haut auch noch mit Ausreden und Rechtfertigungen zu retten?
[Priscilla]: Herrin, Ihre Sklavin war sehr ungehorsam und verdient eine Lektion dafür.
[Miss Gore]: Endlich ein Stück Wahrheit aus Deinem Munde. Bevor ich mir eine Lektion für Dich ausdenke, lass mich hören, was Deine Gedanken waren.
[Priscilla]: Diese Sklavin muss immerzu daran denken von Herrin Gore gegessen zu werden.
Mark war wieder hellwach. Hatte er richtig gelesen? Ja, tatsächlich, Priscilla träumte von Kannibalismus. Instinktiv fühlte Mark, dass er diesem Menschen helfen musste. Wer auch immer dies in Wirklichkeit war, Mark musste es herausfinden.
[Miss Gore]: Meine Sklavin, Du weißt, dass ich Dir helfen kann, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen?
[Priscilla]: Ja Herrin. Bitte! Damit Ihr Mädchen wieder gut schlafen kann.
Mark dachte fieberhaft nach. Es musste einen Weg geben, um herauszubekommen, wer am anderen Ende der Leitung wirklich war. Dass er in Norddeutschland wohnte, hatte Mark schon zu anderen Gelegenheiten in Erfahrung gebracht. Nach dieser Willensäußerung war es nun an der Zeit, die genaue Adresse zu ermitteln. Vielleicht war die Strafe, nach der er geradezu bettelte, der beste Weg dies zu tun.
[Miss Gore]: Nun gut, dazu musst Du Dich aber noch ein wenig gedulden. Für heute wirst Du noch eine Aufgabe bekommen, die Dich gut schlafen lässt. Und sie wird Dich lehren, immer den Anweisungen Deiner Herrin zu folgen.
[Priscilla]: Alles, was Herrin Gore möchte, wird Ihr Mädchen tun.
[Miss Gore]: Das freut mich zu hören. Ich erwarte von Dir ein Foto, auf dem Du Dich selber verletzt. Nimm ein Foto mit Deinem Handy auf und sende es mir zu. Die E-Mail-Adresse kennst Du ja. Ritze Dich mit einem scharfen Messer in den Oberschenkel. Ich will Blut sehen!
Ob das wohl zu forsch war, überlegte Mark, während er auf die Antwort von Priscilla wartete. Er hatte schon viele solche Unterhaltungen geführt. Sie liefen alle nach dem gleichen Schema. Ein Vergehen wurde gestanden oder sogar bewusst provoziert. Mark musste dann die empörte Herrin spielen und durfte sich eine Strafe ausdenken. Meistens waren es Aufgaben, die sowohl im realen Leben als auch im Spiel umgesetzt werden konnten. Aber egal, Mark konnte in beiden Fällen davon ausgehen, dass seine Mitspieler im richtigen Leben an sich herumspielten und erregt waren. Daher dauerten die Antworten schon mal ihre Zeit. Dann endlich wurde wieder getippt und die Reaktion erschien auf seinem Bildschirm.
[Priscilla]: Natürlich, Herrin. Darf Ihre Sklavin jetzt gleich die Aufgabe umsetzen?
[Miss Gore]: Ja, verschwinde und komme erst wieder, wenn Du mir das Foto geschickt hast.
Mark lehnte sich in seinem Stuhl genüsslich zurück, während er sich ausloggte. Er reckte und streckte sich, sah auf die Uhr und stellte fest, dass es wieder spät geworden war. Aber er hatte heute wieder alle seine Aufgaben zu Ende gebracht. Mit gutem Gefühl schaltete er den Rechner aus und ging zu Bett.
♦♦♦
Sven Honnick fuhr sich mit der Hand durch seinen Dreitagebart und überlegte, was er nun tun sollte. In seinem Beruf als Filialleiter einer Sparkasse erwartete man die ganze Woche über, dass er den Ton angab. Nun erteilte ihm dieses Luder aus dem Internet Befehle. Aber das war genau das, wonach er sich sehnte. Nicht immer auf alles eine Antwort wissen und die nächsten Schritte vorausbedenken, sondern sich auch selbst einmal führen zu lassen. Zu oft hatte er sich dies schon gewünscht und nun hatte er endlich jemanden gefunden, die ihm die Richtung vorgab. Er wollte sie nicht enttäuschen. Sven stand auf und ging leise in die Küche, um seine Frau und seinen kleinen Sohn nicht zu wecken.
Galant bewegte sich Sven lautlos voran. Er war gut in Form, Mitte vierzig und sah noch fast zehn Jahre jünger aus. Seine junggebliebene Art kam von jeder Menge Sport, die er in seiner Freizeit trieb. Am liebsten waren ihm die endlosen Laufstrecken um die nahegelegenen Seen. Er wohnte mit seiner Familie etwas abseits gelegen in einem Einfamilienhaus in Norddeutschland, vor den Toren der Landeshauptstadt Kiel. Sven und Lara Honnick waren vor acht Jahren hierher gezogen, um eine Familie zu gründen. Der angebotene Posten als Filialleiter war für sie beide ausschlaggebend gewesen. So brauchten sie sich nur noch um einen neuen Job für Lara zu bemühen. Sie fand ihre neue Anstellung als Erzieherin in einer nahegelegenen Kindertagesstätte. Vor zwei Jahren kam ihr Sohn Lukas zur Welt. Laras Job hatte den Vorteil, dass sie sich keine Tagesmutter für den Kleinen suchen mussten, sondern Lukas täglich mit seiner Mutter in der Kindertagesstätte zusammen war.
Sven kam in der Küche an und inspizierte den Messerblock. Zielstrebig ergriff er ein langes, schlankes Ausbeinmesser, welches er erst vergangenes Wochenende geschärft hatte. Auf dem Rückweg durch das Badezimmer zu seinem Arbeitszimmer machte Sven wiederum keinerlei Geräusche, so dass er Minuten später, nackt und sichtlich erregt, auf seinem Schreibtischstuhl saß. Vor sich auf der Tischplatte hatte er das Messer, ein Taschentuch und ein Pflaster aus dem Bad, sowie sein Handy bereit gelegt. Er atmete langsam ein und aus und strich dabei immer wieder langsam über seinen steifer werdenden Penis. Seine Herrin hatte gefordert, dass er sich einen Schnitt an seinem Oberschenkel zufügen sollte. Musste er groß oder tief sein, überlegte Sven, entschied sich dann aber für die leichte Variante. Er aktivierte die Handykamera in seiner linken Hand und nahm das Messer in die andere. Dann setzte er die Klinge vorsichtig auf seinem Oberschenkel auf. Sven atmete tief ein und zog die scharfe Klinge langsam über seine Haut. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihn und sein Glied zuckte durch die Erregung auf. Sven drückte den Auslöser der Kamera. Einmal, zweimal, dreimal. Dann legte er die Kamera und das Messer ab, tupfte die Bluttropfen mit dem Taschentuch fort und massierte seinen erregten Schwanz. Er brauchte nur noch wenige Bewegungen, bevor Sven sich in das Taschentuch ergoss und befriedigt im Stuhl zusammensank.
Seine Erregung ließ rasch nach und er realisierte zielstrebig die nächsten Schritte, die er als Priscilla noch zu erledigen hatte. Im Nu waren die Bilder von seinem Handy auf seinen Rechner verschoben und eine elektronische Nachricht an [email protected] gesandt. Erleichtert fuhr Sven den Rechner herunter, entsorgte das blutige Taschentuch und stellte das gesäuberte Messer in den Messerblock zurück. Dann legte er sich zu seiner Frau ins Bett und starrte an die Decke. Was werden wohl die nächsten Aufgaben sein, freute sich Sven und schlief darüber nachdenkend ein.
Sonntag, 18. November 2012, 11:10
Gwen saß am Bett ihres Sohnes. Wie sollte sie es ihm sagen? Was würde sie ihm antworten, wenn er wissen wollte, wie es nun weiterging? Nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus hatte Beth berichtet, dass Phil erst am frühen Morgen eingeschlafen war. Jetzt war es fast Sonntagmittag und die tiefstehende Novembersonne durchflutete ihr Haus. Es wäre langsam Zeit zum Aufstehen, überlegte Gwen und strich ihrem Sohn behutsam über seinen Kopf. Er gab ein Murren von sich und blinzelte ihr verschlafen entgegen. Als sich die Erinnerungen der vergangenen Nacht den Weg durch seinen Kopf bahnten, schreckte Phil hoch und war hellwach.
»Wo ist Papa?«
Gwen stockte der Atem. Sie hätte nicht gedacht, dass er so schnell auf den Punkt kommen würde. Langsam fing sie an zu berichten. »Wir waren in der Nacht in der Notaufnahme. Die Ärzte handelten alle sehr schnell, aber Papa hatte keine Chance. Papa wird nicht mehr nach Hause kommen, mein Schatz. Jetzt gibt es nur noch Dich und mich.«
»Du lügst! Das kann nicht sein! Papa hatte doch erst Geburtstag und ist doch erst sechsundvierzig!«
»Phil, es ist für mich genauso schwer dies zu akzeptieren wie für Dich, aber Papa ist wirklich… tot.« Gwen schluckte, um nicht aus Verzweiflung zu weinen. Sie musste nun stark sein. Phil brachte kein Wort mehr heraus und drückte sein Gesicht in sein Kissen. Gwen legte ihre Hand auf seine Schulter.
»Lass mich in Ruhe! Du hättest ihn retten müssen. Du warst mit im Krankenhaus!« Phil schluchzte tief. »Dein Doktor-Freund war doch auch mit dabei. Warum habt ihr ihn sterben lassen?« ›Doktor-Freund‹ hatte Phil Michael genannt. Dabei war da nichts zwischen ihnen beiden. Wie kam er nur auf solche Gedanken?
»Liebling, Michael hatte sofort gehandelt. Du darfst ihm keinen Vorwurf machen. Und Stefan ist sogar dem Notarzt vorausgefahren, um die Straßen frei zu machen. Wir alle haben getan, was wir konnten. Wir hatten keine Chance. Bitte versteh das!«
»Geh weg! Lass mich in Ruhe!« Gwen warf ihrem Sohn einen besorgten Blick zu und erhob sich.
»Ich mache uns ein leckeres Frühstück. Wenn Du Hunger hast, komm einfach runter in die Küche.« Phil sagte nichts und vergrub sein Gesicht nur noch tiefer in sein Kopfkissen.
Gwen saß emotionslos auf der Couch im Wohnzimmer und starrte die Vitrine an der gegenüberliegenden Wand an, als Phil aus seinem Jugendzimmer trat und die Treppe hinunter schlich. Mit roten verquollenen Augen erblickte er seine Mutter und ging wortlos in die Küche. Gwen überlegte kurz, ob sie ihn ansprechen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Er sollte sich erst einmal beruhigen. Sie hörte ein Klappern in der Küche und sah, wie Phil sich mit einer Scheibe Brot wieder in Richtung seines Zimmers begab und sie hörte wie er die Tür hinter sich schloss. Wie paralysiert saß sie weiterhin auf der Couch und überlegte, wie es nun weitergehen sollte. Die Stunden vergingen quälend langsam und Gwen konnte sich nicht aufraffen, irgendetwas zu tun oder auch nur einen klaren, konzentrierten Gedanken zu fassen.
Gegen 18:00 Uhr beschloss Gwen, einen weiteren Annäherungsversuch zu unternehmen. Sie klopfte zaghaft an Phils Zimmertür an. Als sie keine Antwort bekam öffnete sie vorsichtig die Tür.
»Phil? Wie geht es Dir? Was machst Du?«
Phil saß am Computer an seinem Schreibtisch und spielte. Er schaute nicht hoch, als seine Mutter den Raum betrat.
»Schätzchen, lass uns bitte reden.«
»Davon wird er auch nicht wieder lebendig!«, murmelte Phil zurück. »Und ich will ohne ihn auch nicht mehr weiterleben.«
»So etwas darfst Du nicht sagen. Wir müssen nun zusammenhalten. Wir beide, Du und ich. Wir sind jetzt das Team und müssen uns durchbeißen. Ich brauche Dich!«
»Ich brauche Dich aber nicht. Ich will, dass mein Vater wieder da ist. Du kannst mir nicht helfen.«
»Das geht aber nicht«, antwortete Gwen zärtlich, und sprach weiter. »Das weißt Du auch. Was kann ich tun, um Dir zu zeigen, dass ich immer für Dich da bin?«
»Ich will heute nicht darüber sprechen«, antwortete Phil resigniert, ohne von seinem Spiel aufzusehen. »Ich bin müde und muss morgen früh wieder zur Schule. Ich gehe bald ins Bett.«
»OK, sag mir bitte, wenn Du etwas brauchst und wenn ich etwas tun kann. Ich liebe Dich.«
Gwen verließ das Zimmer, um sich wieder auf der Couch im Wohnzimmer in eine Decke einzurollen. In sich gekehrt und müde starrte sie wieder die Vitrine an und dachte dabei an morgen. Dabei schlief sie ein.
Montag, 19. November 2012, 06:45
Das Display zeigte 06:45 Uhr, als der Wecker erst leise, dann immer lauter werdend Mark aus dem Schlaf erwachen ließ. Zielstrebig startete er seinen Rechner und machte sich dann im Bad frisch, während der Computer bootete. Das Symbol für neue Post erschien und zauberte Mark ein Lächeln in sein müdes Gesicht. Während er hastig eine Scheibe Brot verschlang, öffnete er erwartungsvoll die neue Nachricht.
Priscilla hatte den Auftrag ordnungsgemäß ausgeführt und ihm ein Foto geschickt. Nun hängt er an der Angel, dachte Mark, speicherte das Bild auf seiner Festplatte ab und druckte es aus.
»Dann wollen wir doch mal sehen, ob Du Dich mit Technik auskennst«, murmelte Mark leise zu sich selbst und rief die erweiterten Eigenschaften des Bildes auf. Ein verschmitztes Lächeln umspielte seinen Mund als er fand, wonach er gesucht hatte. Mobiltelefone speicherten oftmals die Koordinaten des Ortes, wo sie aufgenommen worden waren. So hilfreich dies beim späteren Zuordnen der Bilder zu Aufnahmeorten auch sein mochte, wenn man nicht wollte, dass jemand anderes diese Informationen in die Hände bekam, sollten sie nicht in den Bildern sein. Priscilla hatte offensichtlich nicht daran gedacht oder kein so weitreichendes Verständnis. Gut so, dachte Mark, kopierte die Standortdaten des Bildes und fügte sie in die Suchmaske bei Google Maps wieder ein. Nur Sekundenbruchteile später öffnete sich die Kartenansicht mit der Markierung des Aufnahmeortes. Perfekt! Mark grinste. Es war ein Einfamilienhaus in der Nähe seines eigenen Wohnortes.
Darum würde er sich später kümmern. Nun musste er sich beeilen, um zu seiner Arbeit zu kommen und den Menschen dort zu helfen. Er stellte fest, dass er immer noch im Schlafanzug vor dem Rechner saß. Mark lachte, schaltete den Computer aus und warf sich seine Arbeitsklamotten über. Seine kurzen hellbrauen Haare brauchte er sich nicht zu kämmen, da sie fast von selber in Form fielen. Schnell packte er noch etwas Obst für den Tag ein und trat hastig in den Flur hinaus. Der Weg zu seiner Garage war sehr rutschig, da der Boden immer noch gefroren war. Dies war aber gut so, dachte Mark, denn so brauchte er sich keine allzu großen Gedanken zu machen, ob die Polizei die Reifenspuren finden würde, die er zwangsläufig am Tatort hinterlassen hatte. Er war sehr gespannt, wie lange es dauern würde, bis sie sein Werk finden würden und schloss die Wohnungstür ab.
Montag, 19. November 2012, 06:45
Auch Gwens Wecker zeigte 06:45 Uhr, als der Alarm in voller Lautstärke im Schlafzimmer startete. Vom Wecker nebenan geweckt, wankte Phil schlaftrunken aus seinem Zimmer und verschwand im Schlafzimmer seiner Mutter. Er stellte den Wecker aus und realisierte nun erst das leere Bett. Wahrscheinlich war sie wieder im Wohnzimmer vor dem Fernseher eingeschlafen, wie so oft. Phil schlich ins Wohnzimmer im Erdgeschoss und sah seine Mutter auf der Couch liegen.
»Mama! Der Wecker hat geklingelt!«, zu mehr war Phil am frühen Morgen noch nicht in der Lage. Er wankte zurück ins Obergeschoss und ins Bad.
Gwen war furchtbar müde. Wie lange hatte sie geschlafen? Sie hatte vom Krankenhaus geträumt und davon, dass Paul gestorben war. War alles nur ein böser Traum gewesen? Sie kam zu sich und es traf sie mit aller Härte der Realität. Sie war Witwe, alleinerziehende Mutter eines pubertierenden Jugendlichen. Warum hatte es das Schicksal so ernst mit ihr gemeint?
»Mama, Du musst auch aufstehen!«, rief Phil aus dem Obergeschoss, der mittlerweile im Bad fertig war und wieder in seinem Zimmer verschwand.
»Ja, mein Schatz, ich bin wach. Danke Dir.«
Nachdem Gwen sich auch im Bad frisch gemacht hatte, bereitete sie in der Küche das Frühstück für sie beide vor. Die Einbauküche hatten sie sich zu ihrem zwanzigjährigen Hochzeitstag gegönnt. Paul wünschte sich damals ein Kochfeld, um welches man herumgehen konnte. Da ihre Küche eine entsprechende Größe hatte, war dies ohne Probleme möglich gewesen. An der einen Seite war eine Art Tresen angebracht, den sie oft nutzten, um im Stehen oder auf den Bistrohockern sitzend zu frühstücken. So mussten sie nicht immer alle Frühstücksutensilien in das nebenan liegende Esszimmer bringen.
»Phil, wo bleibst Du? Das Frühstück ist fertig und wir müssen gleich los!«
Paul hatte immer sehr gerne gekocht, was eine riesige Erleichterung für Gwen darstellte. Wenn er abends nach Hause kam, hatte er oftmals noch spontan kleine Leckereien eingekauft und köchelte ein Mahl für die Familie. Nichts Aufwendiges, aber immer wieder spannend, lecker und ausgefallen. Gwen war nie eine große Köchin gewesen und machte auch nie einen Hehl daraus. Dafür war sie eine begnadete Bäckerin. Sie liebte es, Kuchen, Torten und Plätzchen zu backen. In der Weihnachtszeit lief sie immer zu Höchstformen auf, aber dieses Jahr würde alles anders werden. Die Adventszeit stand kurz bevor und es hatte alles so besinnlich werden sollen. Nun musste Gwen sich erst einmal auf andere Aufgaben konzentrieren.
»Phil! Hallo? Verdammt, wir kommen noch zu spät!« Phil trottete die Treppe hinunter, seine Schultasche schlurfte am langen Arm hinter ihm her.
»Hier, Dein Brot für die Pause. Wir haben jetzt keine Zeit mehr. Tu mir den Gefallen und iss das eine Brot noch vor Beginn der Schulstunde. Du brauchst etwas im Magen!« Hektisch verließ Gwen das Haus und schob ihren trägen Sohn vor sich her zum Auto, welches in der Auffahrt parkte. Sie drehte den Zündschlüssel im Schloss und hörte – nichts! Nochmal. Nochmal. »So eine Scheiße!«, entglitt es ihr. Ihr, die sich sonst immer so unter Kontrolle hatte. »Das darf doch wohl nicht wahr sein. Als wenn sich heute alles gegen uns verschworen hätte.«
»Mama, ich muss zur Schule«, merkte Phil zaghaft an.
»Herrgott, ich mach ja alles möglich, aber zaubern kann ich leider auch nicht. Die Karre springt nicht an! Das merkst Du doch auch, oder?« Dies war allerdings mehr eine rhetorische Frage, auf die Gwen nicht wirklich eine Antwort erwartete und auch nicht erhoffte. Sie war schon aufgebracht genug.
Sie schnappte sich ihr Handy und startete seine Kurzwahl. Nach zwei Mal klingeln nahm er ab.
»Guten Morgen Gwen, hier ist Stefan, was gibt es denn um diese Zeit?«
»Hallo Stefan, gut, dass ich Dich erreiche. Es hat sich alles gegen uns verschworen. Phil muss dringend zur Schule, wir sind spät dran, ich komme zu spät zur Arbeit und nun springt auch noch diese verflixte Karre nicht an.« Gwen atmete durch und ergänzte den Tränen nahe: »… und Paul ist nicht mehr da, um uns zu helfen.«
»Nun beruhige Dich erst einmal. Ich komme gleich vorbei und helfe euch. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit.«
»Das ist ganz toll von Dir. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.«