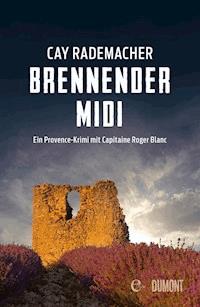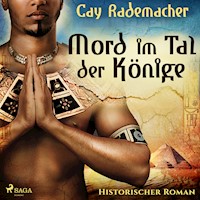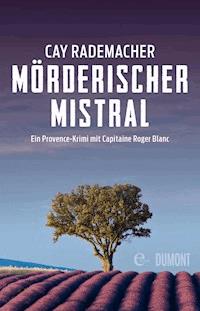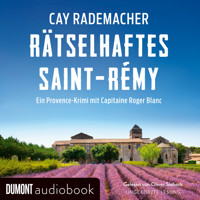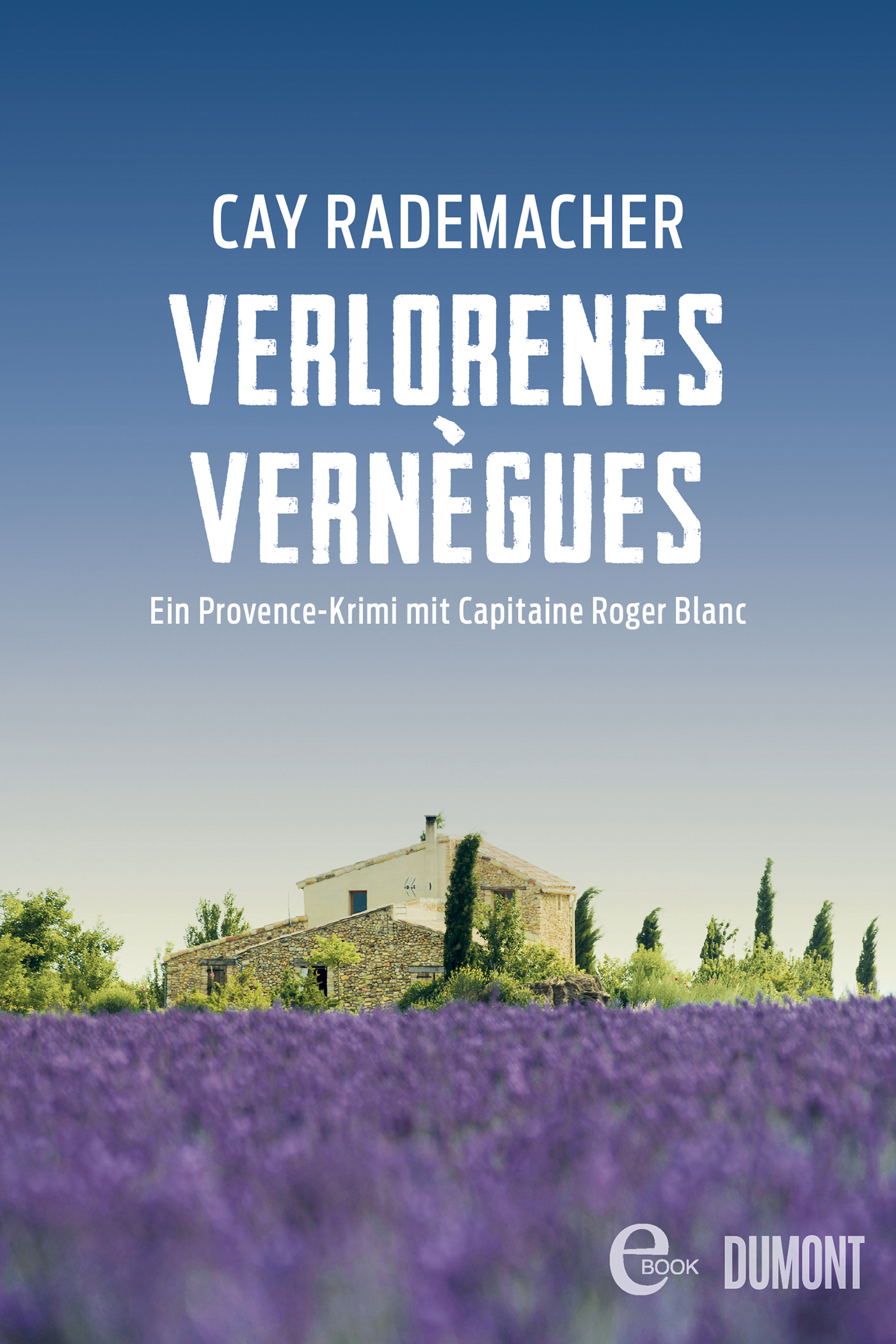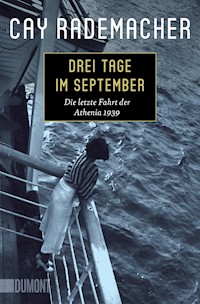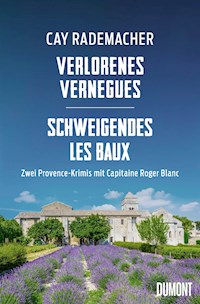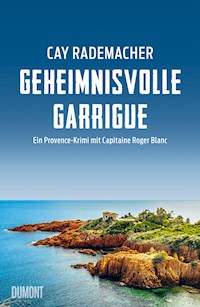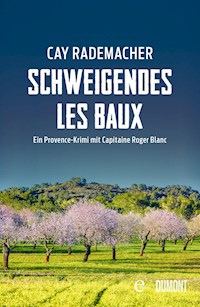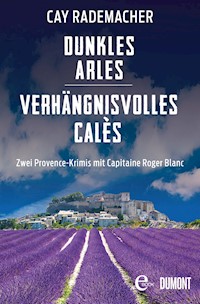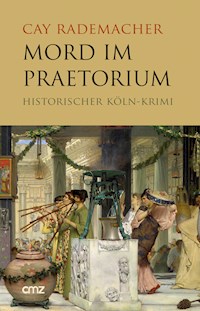
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: cmz
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Leider muß der Bibliothekar Aelius Cessator auf die Freuden des Saturnalienfestes im römischen Köln verzichten – im Keller des Praetoriums wird ein Toter gefunden, und ausgerechnet er soll den Mörder finden. Ironisch und mit leichter Hand schildert Rademacher die lebensechten Figuren des Romans in ihrer historischen Umgebung, in der schließlich den Täter sein verdientes Schicksal ereilt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autoreninfo
Cay Rademacher, Jahrgang 1965, Studium von Geschichte und Philosophie in Köln und Washington. Redakteur bei GEO Epoche. Seit 2013 lebt er mit seiner Familie in der Nähe von Salon-de-Provence in Frankreich.
Haupttitel
Cay Rademacher
MORD IM PRAETORIUM
Historischer Köln-Krimi
Überarbeitete Neuausgabe
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe 2015–2016 by CMZ-Verlag
An der Glasfachschule 48, 53359 RheinbachTel. 02226-9126-26, Fax 02226-9126-27, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagabbildung:Lawrence Alma-Tadema (1836–1912), The Vintage Festival, 1870; Öl auf Leinwand, 177 × 77 cm; Privatbesitz
Umschlaggestaltung:Lina C. Schwerin, Hamburg
eBook-Erstellung:rübiarts, Reiskirchen
ISBN 978-3-87062-168-1 (Paperback)ISBN 978-3-87062-186-5 (eBook epub)ISBN 978-3-87062-192-6 (eBook kindle)
20160717
www.cmz.de
Motto
Für Françoise
Inhalt
Die verlorene Liebesnacht
Der gläserne Reichtum
Gerüchte
Ein toter Informant und ein ahnungsloser Teilhaber
Die trauernde familia
Konkurrenten
Eine alte Geschichte
Galeria
Friedhofsliebe
Ein Verdacht
Tolbiacum
Ein neuer Imperator
Glossar
Die verlorene Liebesnacht
Es regnete, der Himmel war so grau wie der Rhein, der sich träge an der Stadt vorbeiwälzte, und ich wünschte, ich wäre in Rom. Heute morgen war ich noch im Tempel des Mercurius Augustus gewesen, einem bescheidenen Heiligtum, das man in die nordöstliche Ecke der Stadt gequetscht hatte, weitab vom Zentrum. An diesem Ort war ich um diese Zeit vollkommen allein, und so konnte ich ungehindert den Gott anflehen, den alten Marcus Cocceius Nerva endlich in den Hades einzulassen. Natürlich ist es ein Frevel, ausgerechnet im Tempel des Mercurius Augustus für den Tod des Kaisers zu beten, doch ich wußte mich in edelster Gesellschaft: Unser aller Herr, der ruhmreiche Konsul, Feldherr und Senator Marcus Ulpius Trajan, wartete so ungeduldig auf die Nachricht vom seligen Entschlafen des Imperators und Adoptivvaters wie ein ausgehungerter Löwe darauf wartet, daß sich das Tor zur Arena endlich öffnet, damit er an Majestätsbeleidigern, Vergewaltigern, Christen, Dieben und anderen Verbrechern seinen Hunger stillen kann.
Denn wenn Nerva stirbt, dann wird Trajan Kaiser. Und wenn Trajan Kaiser wird, dann eilt er nach Rom. Und wenn Trajan nach Rom eilt, dann eilen alle seine Freunde, Berater, Klienten, Freigelassenen und Sklaven mit. Und meine Wenigkeit, Aelius Cassator, Freigelassener von Trajans Schützling Publius Aelius Hadrian, gehört dazu. Und damit könnte ich endlich diese gräßliche Provinzstadt mit ihrem pompösen Namen verlassen: Colonia Claudia Ara Agrippinensium – nur als Abkürzung zu ertragen. Eine sehr schöne, sehr logische Gedankenkette. Doch Logik ist nichts für Götter, kleine Frevel bestrafen sie sofort.
Ich hatte mich sehr darauf gefreut, hier im praetorium die Saturnalien zu feiern und den einen oder anderen geharzten Weinschlauch zu leeren. Vielleicht wäre es mir sogar gelungen, die schöne Lubentina vor ihren anderen zahlreichen Liebhabern abzuschirmen und das große Fest auf höchst angenehme Weise in ihrem Bett zu beenden. Doch ich hatte meine Rechnung ohne Mercurius Augustus gemacht. Statt mir schweren Wein und eine sinnliche Sklavin zu verschaffen, legte er mir einen ärgerlichen Mann vor die Füße. Er war ungefähr 45 Jahre alt, klein und dürr, mit einem unattraktiven, durch einen verbitterten Ausdruck entstellten Gesicht – und er war tot.
Sechs Tage hatten wir die Saturnalien bereits gefeiert, sechs Tage, in denen die Menschen fröhlich waren, sich gegenseitig beschenkten und auf Gelagen an Festem und Flüssigem in sich hineinstopften, was nur hineinging. Sechs Tage lang gab es keine Unterschiede zwischen Herren und Sklaven – was für mich ein seltsames Gefühl war, da dies meine ersten Saturnalien waren, die ich nicht als Sklave feierte. Sechs Tage, an denen selbst ein so mieses Nest wie die CCAA im verregneten Dezember erträglich ist. Der siebte Tag sollte den Höhepunkt des Festes bringen, die größte Orgie fand im praetorium statt – allerdings jetzt ohne mich. Der Abend war noch nicht weit fortgeschritten, ich war noch so gut wie nüchtern und würde es auch bleiben müssen. Und den begehrten Platz in Lubentinas Bett würde ein Glücklicherer erobern. Es war zum Heulen.
Das praetorium ist der Amts- und Wohnsitz des kaiserlichen Legaten und aller hohen Tiere, die ein ungnädiges Schicksal zur CCAA verschlägt. Ein langgestreckter, braunroter Bau hart an der östlichen Mauer der Stadt, dessen passabel verzierte Front dem Rhein zugewendet ist, damit die Barbaren, die jenseits des großen Stromes hausen, eine Ahnung von Roms Größe bekommen. Fast die ganze CCAA ist auf einem Plateau erbaut, wenige Meter höher als die unmittelbare Flußniederung. Das praetorium liegt an der Grenze dieses Plateaus, die prachtvolle Front ragt sogar darüber hinaus. Also gibt es unten am Hang Abstützungen: gewaltige Kellergewölbe mit schönen Ziegelmauern, die in den letzten Jahren noch kräftig erweitert wurden. Oben besteht die Anlage aus einem zentralen Empfangs- und Festsaal, in dem gerade der öffentliche Teil des Gelages gefeiert wurde, und diversen Arbeits- und Wohnräumen, Schreibstuben, Archiven und ähnlichem im Nord- und im Südflügel. Den Geräuschen nach zu urteilen, fand hier der intimere Teil der Ausschweifungen statt.
Das Angenehmste am praetorium war die Hypokaustenheizung der meisten oberen Räume, die einem half, das nieselig-kalte Wetter zu vergessen. Die Fußbodenheizung ist die beste Waffe des Römers bei der Eroberung Galliens, Germaniens und Britanniens gewesen. Ohne sie wären wir hilflos, mit ihr beeindrucken wir die Barbaren mehr als durch unsere gut gedrillten Legionen. Unten dagegen war es kühl. Die großen Kellergewölbe dienten als Vorrats- und Verkaufsräume für Fisch-, Fleisch-, Wein-, und Gemüsehändler sowie für Läden, in denen man feine Stoffe, Glas oder Keramik kaufen konnte. Da ihre Besitzer zuhause oder bei Freunden ihre eigenen Orgien feierten und es hier keine Fußbodenheizung gab, die ein schnelles winterliches Liebesspiel erleichtert hätte, waren die Kellergewölbe um diese Zeit fast menschenleer.
Nur ein paar Sklaven huschten hier herum, die die Hypokaustenheizung zu befeuern oder sonstige Besorgungen zu erledigen hatten – trotz der angeblichen Gleichheit zwischen Herren und Sklaven während der Saturnalien. Einer von ihnen hatte den Toten entdeckt. Er war ermordet worden und lag am großen Becken unter dem Nordflügel, in das das Abwasser vom höhergelegenen Plateau floß, um dann von dort durch einen Kanal in den Rhein geleitet zu werden. Der Mann kannte sich im praetorium offensichtlich gut aus, denn die meisten Bürger und Sklaven der CCAA wußten sicherlich nichts von diesem architektonischen Detail. Eingeweihte dagegen benutzten es gerne, um sich ungestört zu erleichtern, vor allem an Feiertagen wie diesem, an denen die Latrinen durch Dutzende von Betrunkenen belegt und durch das, was diese dort hinterließen, auch unerträglich verschmutzt waren.
Der verängstigte Sklave hatte zunächst einen Dekurio der Wache alarmiert, der wiederum einen Boten zu Trajan schickte. Unser Herr zog sich für ein paar Augenblicke diskret vom Gelage zurück und besah sich angewidert den Toten. Die Leute sind immer wieder überrascht, wenn man ihnen sagt, daß während der großen, fröhlichen Feiern wie den Saturnalien und privaten wie Hochzeiten oder Geburtstagen mehr Menschen umgebracht, vergewaltigt oder bestohlen werden als an gewöhnlichen Tagen. Trajan war noch aus anderen Gründen indigniert, denn einen Mord zu wagen, während er nur wenige Schritte enfernt feierte, faßte er als persönliche Beleidigung auf.
Es dauerte nicht lange, bis die Wache herausgefunden hatte, wer der Tote war: Calpurnius Repentinus, ein geladener Gast, der Besitzer einer der größten Glasmanufakturen der CCAA.
»Glas?« fragte unser Herr.
»Trinkgläser, Salben- und Parfumfläschchen und dergleichen«, antwortete der Dekurio. »Diese Stadt ist im ganzen Imperium für ihre feinen Gläser bekannt, Herr.«
»Glas?« sinnierte Trajan wieder, allerdings hatte seine Stimme einen anderen Tonfall bekommen. Er war Soldat, die meisten Männer seiner Umgebung waren Soldaten, hinzu kamen Schreiber, Magazinverwalter und weitere überaus nützliche, aber leider vollkommen kulturlose Männer. Er schlenderte wieder nach oben zum Gelage und diskutierte das Problem kurz mit Hadrian. Mein ehemaliger Herr hatte mich nicht ganz freiwillig freigelassen und nutzte darum jetzt jede Gelegenheit, um mir eins auszuwischen. Was er übrigens in der CCAA zu tun hatte, während er eigentlich in Mogontiacum stationiert war, wußte ich nicht. »Mein Aelius Cessator kennt sich in der Kunst der Glasherstellung aus«, sagte er wie nebenbei. Das war eine grobe Übertreibung, mindestens. Doch damit wurde an diesem Abend nicht nur das Schicksal des Calpurnius Repentinus ein- für allemal besiegelt, sondern auch meins.
Nur ahnte ich das damals noch nicht.
Ich stand deshalb kurz nach Trajans Befehl, mich »um diese Sache zu kümmern«, neben dem Dekurio am Wasserbecken und sah verdrießlich zu, wie vier Sklaven sich an dem Toten zu schaffen machten. Der Soldat spuckte ins Becken. Er war ebenfalls mißmutig, denn auch ihm entging natürlich die Orgie. Gemeinsames Leiden verbindet, und so empfanden wir ein gewisses grimmiges Zusammengehörigkeitsgefühl.
»Immerhin war es eine saubere Arbeit«, sagte ich.
Der Dekurio nickte düster. Die weiße Narbe an seinem Kinn, die vom jahrelangen Tragen des Helmgurtes herrührte, wippte bestätigend auf und ab. »Würde mich nicht wundern, wenn es einer meiner Kameraden war. Das da sieht nach Legionärs- oder vielleicht auch Gladiatorenhandwerk aus. Ein Zivilist kriegt so etwas nur mit viel Glück hin.«
Calpurnius Repentinus war durch einen einzigen Stich direkt ins Herz getötet worden.
Der Dekurio gebot den Sklaven durch eine Geste Einhalt und beugte sich zu dem Toten hinab. »Der Größe der Wunde nach zu urteilen, war es ein gladius«, sagte er.
Ich ging ebenfalls in die Knie.
Repentinus’ weiße Toga war im ganzen Brustbereich blutverschmiert, aber weiter unten sauber.
»Tja, er ist offensichtlich nicht beim Pissen mit einem Kurzschwert niedergestochen worden, sondern davor oder danach«, kommentierte der Soldat meine Suche. »Ich stelle mir das so vor: Er ist fertig, richtet seine Toga, dreht sich um und, zack!, wird ohne Vorwarnung umgelegt. Seine Hände sind unverletzt, er hat nicht gekämpft.«
Ich nickte. »Kann aber auch sein, daß sein Mörder ihm irgendwo im praetorium mit gezücktem Schwert auflauerte und ihn zwang, bis hierhin hinabzusteigen, wo er ihn dann gefahrlos in den Hades schicken konnte«, entgegnete ich. »Außerdem wüßte ich zu gerne, warum man ihm Charons Fährpassage spendiert hat.« Ich deutete auf die Hände des Opfers, an deren Fingern einige breite goldene, edelsteinbesetzte Ringe steckten. »Ein Raubmord war es auf jeden Fall nicht.«
Wir untersuchten den Toten genauer und entdeckten einen fein gearbeiteten, edelsteinbesetzten Dolch, den er gut versteckt unter seiner Toga getragen hatte.
»Schöne Arbeit«, kommentierte der Dekurio fachmännisch. »Nicht von hier. Nur in Rom selbst gibt es Waffenschmiede, die so etwas hinkriegen.« Er schnalzte zugleich bewundernd und bedauernd mit der Zunge. Es tat ihm offensichtlich leid, daß er diesen Dolch – jetzt, da man ihn vor Zeugen gefunden hatte – nicht heimlich einstecken konnte.
»Es ist den Gästen verboten, auf Feiern wie diesen versteckte Waffen zu tragen«, meinte ich entrüstet. »Warum hat Repentinus so etwas gewagt?«
Der Dekurio spuckte wieder verächtlich ins Wasserbecken. »Ein Provinzler! Hier in der CCAA hält man sich grundsätzlich nicht an die Gesetze. Jeder, der hier auch nur ein bißchen was auf sich hält, hat eine Waffe versteckt. Aber das ist alles nur pure Prahlerei. Keiner von denen traut sich jemals, blankes Eisen zu ziehen!« Ich schüttelte spöttisch den Kopf. »Einer hat es heute abend schon gewagt«, entgegnete ich.
Zusammen mit dem Dekurio verbrachte ich dann den Rest des Abends damit, alle im praetorium stationierten Soldaten auszufragen – zumindest alle, die noch nüchtern genug waren, um unsere Fragen verstehen zu können. Die Männer, die Wache stehen mußten, waren dankbar für jede Abwechslung und erzählten uns in aller Ausführlichkeit allen möglichen Unsinn, die anderen unterbrachen wir beim Trinken oder beim Liebesspiel, weshalb ihre Antworten entsprechend knapp und unfreundlich ausfielen. Doch als ich mich endlich müde auf mein Lager werfen konnte, war ich so klug wie zuvor. Niemand hatte etwas gesehen, niemand hatte etwas gehört, niemand wußte etwas über das Opfer, niemand hatte sich durch irgend etwas verdächtig gemacht. Ich befürchtete bereits, daß der Dekurio Unrecht hatte. Wer immer Calpurnius Repentinus in den Hades geschickt hatte – einer der Soldaten im praetorium war es mit ziemlicher Sicherheit nicht. »Wenn du nicht weißt, wer es war, dann mußt du wissen, warum er es war!« Dieser Satz zeugte von schlechtem Latein und guter Menschenkenntnis. Er stammte von meinem ehemaligen Sklavenaufseher, der nach diesem Motto verfuhr, wenn irgendeiner von uns Sklaven etwas ausgefressen hatte und er sich daran machte, den Übeltäter aufzuspüren. Ich beschloß, mich am nächsten Tag umzuhören. Vielleicht stieß ich dabei auf jemanden, der Calpurnius Repentinus so feindlich gesonnen war, daß er nicht einmal die Saturnalien abwarten konnte, um ihn in die Unterwelt zu schicken.
Der gläserne Reichtum
Viele Freigeborene stellen sich das Leben eines Sklaven ziemlich schrecklich vor, wenn sie überhaupt einmal an Sklaven denken: Der rechtlose Besitz eines anderen Menschen. Wie eine Vase oder ein Pferd, nur billiger. Das stimmt natürlich im Prinzip, doch stehen dem einige gravierende Vorteile gegenüber – vorausgesetzt, man hat den richtigen Herrn. Mein Herr Hadrian war ein Günstling unseres zukünftigen Kaisers und als solcher alles andere als arm. Außerdem hatte er Geschmack. Das bedeutete zunächst einmal, daß er es haßte, Leute mit zerschlagenen Gesichtern oder verrenkten Gliedern zu sehen, weshalb wir Sklaven nur in einem alles in allem sehr erträglichen Rahmen gezüchtigt werden durften. Und wir wohnten in seiner villa, in bescheidenen Zimmern in einem Nebengebäude, aber immerhin.
Dies kam mir jeden Morgen als erstes schmerzhaft zu Bewußtsein, wenn ich die Augen aufschlug und meine neue, erbärmliche Bleibe ansehen mußte. Die ersten Wochen nach meiner Freilassung durfte ich noch bei Hadrian wohnen, doch als wir alle zusammen im Gefolge unseres Trajan in die CCAA zogen, hatte ich mir gefälligst selbst etwas zu suchen. Aus war’s mit dem Villenleben. Ich lebte jetzt in einer Wohnung, zwei Blocks nördlich des Decumanus Maximus im Nordwesten der Stadt, die sich großsprecherisch »Haus der Diana« nannte. Damit Mietshäuser nicht, wie es früher andauernd vorkam, wegen Schlamperei bei der Errichtung einfach so in sich zusammenstürzten, galt im ganzen Imperium eine Höhe von vierzig Ellen als Maximum, alles darüber wurde von den kaiserlichen Beamten verboten. Das »Haus der Diana« hatte vier Stockwerke und war offiziell genau vierzig Ellen hoch. Ich hatte aber den begründeten Verdacht, daß es tatsächlich ein paar mehr waren. Hier in der CCAA hielt man auch den strengsten kaiserlichen Befehl nur für eine Art Schätzwert, dem man sich im Rahmen großzügiger Toleranzen zu nähern hatte.
Da sich die Straßen der CCAA aus mir unerfindlichen, aber irgendwie typischen Gründen nicht rechtwinklig schnitten (so, wie es sich für eine richtige römische Stadt eigentlich gehörte), sondern in einem stumpfen Winkel, hatten alle Grundstücke die Form eines Parallelogramms. Unser Wohnblock war ein Ziegelbau. Im Erdgeschoß waren Tuch- und Gewürzläden untergebracht, so daß es im ganzen Haus recht passabel roch. Davor überspannten Laubengänge den Bürgersteig. Sie stützten gleichzeitig den Balkon ab, der sich im ersten Stock rund um das Gebäude zog. Hier lagen die teuren, halbwegs komfortablen Wohnungen; im zweiten Stock waren die Räumlichkeiten bereits bedeutend bescheidener; ganz oben waren es je nur zwei einfache Zimmer mit kleinen Fenstern. Fast überflüssig zu erwähnen, in welchem Stockwerk ich wohnte. Von meinen neuen Mitbewohnern wurde ich allgemein beglückwünscht, daß ich im Winter eingezogen sei, denn im Sommer würde es dort oben unter dem nur leicht schräggestellten Ziegeldach schlicht unerträglich heiß sein. Ich hoffte inständig, daß bis dahin Nerva im Reich der Schatten und ich wieder in Rom sein würde.
In der Mitte unseres Blocks lag ein langgestreckter Innenhof. Hier befanden sich eine Zisterne und ein großes Becken, so daß wir Mieter unser Wasser nicht von einem der öffentlichen Brunnen herschleppen mußten. Den Hauptzugang bildete ein dunkler, gewölbter Gang, der von der Straße zum Innenhof führte. Von ihm zweigten die engen hölzernen Stiegen zu den oberen Stockwerken ab, außerdem befand sich hier die Latrine des Hauses. Mein Nachbar, ein verdrießlicher hellenischer Hauslehrer, war oft zu faul und manchmal auch zu betrunken, um bei einem dringenden Bedürfnis die drei Stockwerke hinunterzusteigen. Er füllte lieber einen Bronzeeimer und entleerte ihn gelegentlich auf die Straße, was ihm schon mehrere Morddrohungen und im Haus den Beinamen »der Dachscheißer« eingebracht hatte.
Im Innenhof hing eine einfache, grob gearbeitete Tontafel, die die Göttin der Jagd zeigte – daher der Name unseres Mietshauses. In einem dunklen Raum an der Nordseite des Erdgeschosses war ein unauffälliges Mithraeum eingerichtet worden: ein kleiner, in die Wand eingelassener Altar, auf dem eine bescheidene Mithrasstatue stand.
Diesen unüblichen religiösen Schmuck hatte unser Haus der Besitzerin zu verdanken. Julia Famigerata war die Witwe eines Zenturio, der vor seinem Tod in einer Wirtshausschlägerei irgendwie an so viele Sesterze gekommen war, daß er sich ein Mietshaus kaufen konnte. Sie war ungefähr vierzig, dick, geschwätzig, berechnend bis zum Geiz und so fromm, daß sie dem Lieblingsgott ihres Mannes ein kleines Heiligtum geweiht hatte, obwohl es sich dabei nur um einen obskuren persischen Gott handelte, den außer einigen Legionären eigentlich niemand verehrte. Als sie hörte, daß ich, wenn auch nur auf der zweituntersten Ebene, zum Gefolge des Trajan gehörte, vermietete sie mir bereitwillig eine Wohnung. Wahrscheinlich stellte sie sich vor, daß kraft meiner Anwesenheit das Haus besser vor Einbrechern geschützt wäre oder so etwas Ähnliches.
Noch nie in meinem Leben war ich am Morgen nach den Saturnalien so leicht und nüchtern aufgewacht wie heute – eine Tatsache, die mich in eine gelinde Verzweiflung stürzte. Meine Laune wurde auch nicht dadurch verbessert, daß ich mich langsam wieder an den Auftrag erinnerte, den Trajan mir am letzten Abend verpaßt hatte. Es konnte sicher nicht schaden, zur Abwechslung mal wieder zu beten.
Ich hatte mir in einer Ecke des Raumes ein bescheidenes lararium eingerichtet: eine Holzbank mit diversen Götterstatuetten aus bemaltem Ton. Mein Genius befand sich in der Mitte, ein Mann in der Toga mit verhülltem Haupt, einem opfernden Priester nachempfunden; links und rechts standen zwei Jünglinge mit Trinkhorn und Opferschale, meine Laren, davor lag eine heilige Schlange. Auf das einzige unübliche Detail dieses larariums war ich besonders stolz, auch wenn es mir jedesmal einen Stich versetzte, es anzusehen. Lubentina, die sonst jeden Sesterz, den sie durch Liebesdienste einnahm, eifersüchtig hütete, um sich irgendwann freikaufen zu können, hatte vor einem halben Jahr zu meinem fünfunddreißigsten Geburtstag tatsächlich ihre eisernen Prinzipien vergessen und mir etwas geschenkt. (Oder es war das Geschenk eines ihrer Liebhaber, das sie generös an mich weitergegeben hatte, was ungefähr auf das gleiche hinauslief.) Es war eine kleine Venusstatue. In einem durch zwei winzige Säulen und einen Giebel angedeuteten Tempelchen stand die Göttin in aufreizender Pose da, ihr Gewand mit der linken Hand graziös vom Körper streifend. Es war nicht schwer zu erraten, daß Lubentina selbst dem unbekannten Künstler für die Liebesgöttin Modell gestanden hatte.
Ich opferte vor den Götterstatuetten in einer Schale etwas Weihrauch und ein paar Tropfen Wein, die ich in dem irdenen Krug gefunden hatte, den ich vor zwei Tagen, als die Saturnalien noch fröhlich und unbeschwert waren, mit in meine Wohnung genommen hatte.
Diese Handlung erleichterte mich. Wenn ich ehrlich bin, so muß ich zugeben, daß ich nicht mehr an die Götter glaube – aber Opferhandlungen beruhigen mich noch immer. Nach diesem Ritual fühlte ich mich so weit gestärkt, daß ich mich in die nieselige CCAA hinauswagen konnte.
Was tun? Zunächst einmal mußte ich sicher aus dem Haus kommen. Julia Famigerata konnte mir hier überall auflauern. Ich konnte mich auf der Stiege befinden, im Innenhof, auf der Latrine, im Laubengang vor dem Haus – plötzlich stand meine Vermieterin vor mir wie ein Geist aus der Unterwelt, legte ihre Patschhände besitzergreifend auf meinen Unterarm und erzählte mir ihr Leben. Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie selbst es auf mich abgesehen hatte oder ob sie mich für eine Ehe mit einer ihrer beiden verzogenen, halbwüchsigen Töchter weichklopfen wollte – oder ob alles nur an ihrer hemmungslosen Klatschsucht lag und sie weiter keine Hintergedanken hatte. Mein Opfer vor dem lararium wirkte wenigstens an diesem Morgen – ich konnte mich unerkannt aus dem »Haus der Diana« schleichen.
Die Straßen der CCAA waren ziemlich breit und gut gepflegt – um ehrlich zu sein, übertrifft dieses elende Nest in dieser Hinsicht sogar die meisten Gassen Roms. Sie waren mit Steinen gepflastert, das Regenwasser lief in Rinnen in der Mitte ab. Die Bürgersteige zu beiden Seiten lagen eine Elle höher, damit die Fußgänger sich nicht durch Pferdemist und Straßenabfälle beschmutzten. An Kreuzungen bestanden die Bürgersteige nur aus einer Reihe niedriger plateauförmiger Erhebungen, ähnlich Steinen in einem Fluß, so daß Pferde und Fuhrwerke sie gut passieren konnten. Links und rechts der Straßen standen meistens Wohnblocks, deren Laubengänge die Bürgersteige durchgehend schützten. So wandelte man im Sommer im Schatten (sofern es hier jemals einen richtigen Sommer geben sollte), in der übrigen Jahreszeit war man halbwegs regensicher.
Ich hatte erwartet, am Morgen nach den Saturnalien durch eine Geisterstadt zu gehen, doch ich hatte mich getäuscht. In der Provinz ist man strebsamer, frommer, moralischer, kurz: in solchen Dingen verkniffener als in Rom, außerdem gab es hier viele Germanen, denen dieses Fest gar nichts bedeutete. Zu dieser frühen Stunde fuhren deshalb viele Ochsenkarren durch die Stadt, gelenkt von träge neben dem Joch hergehenden Bauern, beladen mit Gerste, halben Schweinen oder großen Wein- und Ölamphoren. Es waren die letzten Nachzügler auf dem Weg zum Forum. Während des Tages durften keine Fuhrwerke in die Stadt, weshalb es in der CCAA, wie in jeder ordentlichen römischen Gemeinde, nachts ebenso laut war wie tags: Ochsen, Esel, Pferde und ihre jeweiligen Kutscher oder Reiter veranstalteten ein gewaltiges Spektakel, bei dem man oft nicht sagen konnte, welches Gebrüll, Gewieher oder Muhen von den Tieren, welches von den Menschen stammte.
Die Bürgersteige waren voll von Menschen, deren Gesichter so grau waren wie der niedrige Himmel: Sklaven auf dem Weg zum Forum oder schon auf dem Rückweg, beladen mit den Vorräten fürs Mittagsmahl; griesgrämige Legionäre auf irgendwelchen Patrouillen oder Botengängen; fröhlich im Nieselregen herumtobende Kinder; Waschweiber auf dem Weg zum nächsten Brunnen; zwei verschlafene Priester, die zu einem Tempel eilten; hühnenhafte schwarze Träger aus Äthiopien, die eine verhangene Sänfte auf ihre furchteinflößenden Schultern geladen hatten und in diesem deprimierenden Wetter erbärmlich froren; Händler, die die Verschläge ihrer Läden öffneten und auf frühe Käufer hofften; dazu ein paar Betrunkene und Prostituierte sowie einige vornehm gekleidete, aber ziemlich derangierte Männer und Frauen, die sich aus den Häusern schlichen, in denen sie ihre heimlichen Ausschweifungen erlebt hatten. In den nächsten Tagen würde hier in der CCAA, wie überall im Imperium nach den Saturnalien, die Zahl der Eheschließungen und Scheidungen sprunghaft steigen.
Ich mußte niesen. »Bei Mars!« fluchte ich »Wie konntest du es zulassen, daß der vergöttlichte Gaius Julius Caesar solche ungesunden Provinzen eroberte?«
Ein betrunkener Alter, der zufällig in der Nähe stand, lallte irgend etwas, nickte mir zustimmend zu, drehte sich dann um und kotzte auf die Straße. Auch ein Kommentar.
Es wäre taktlos und wahrscheinlich auch wenig sinnvoll, gleich am Morgen nach dieser grauenhaften Tat die familia des Calpurnius Repentinus zu besuchen. Ich gehörte zwar zum Gefolge des Trajan, war aber doch nicht mehr als ein Freigelassener, während er ein Glashersteller und angesehenes Mitglied der CCAA gewesen war. Ich beschloß, erst einmal etwas mehr über das Opfer zu erfahren. Daß Repentinus Glas hergestellt hatte, war das einzige, was ich bis jetzt sicher wußte – also hatte ich vor, bei den Werkstätten herumzuschnüffeln.
Ich ging zwei Blocks weiter Richtung Rhein, bis ich den Cardo Maximus erreichte, wo ich mich nach links wandte. Es war nicht mehr weit bis zum Nordtor, wo mich zwei verschlafene Legionäre desinteressiert passieren ließen. Hier, unmittelbar vor den Mauern der Stadt, lag eine der Quellen für den Wohlstand der CCAA – vielleicht der Hauptgrund, warum dieses Nest noch nicht aufgegeben worden war, obwohl die Legionen, die ursprünglich hier stationiert gewesen waren, längst nach Bonna und Novaesium verlegt worden waren. Gläser aus der CCAA konnte man inzwischen sogar auf dem Forum Romanum kaufen.
Die im ganzen Imperium bekannten Glaswerkstätten waren eine Enttäuschung: Kleine, schäbige Ziegelbauten längs der großen Straße Richtung Norden nach Novaesium, aus deren hohen Kaminen es weiß oder rußschwarz qualmte. Auf einigen ungepflasterten Plätzen standen hohe, gedeckte zweiachsige Karren, die von je vier oder sechs riesigen Ochsen gezogen wurden. Ihre Ladung war schwer: Feinster Quarzsand, der wenige Meilen westlich der CCAA abgebaut, hierhin transportiert und verarbeitet wurde. Schwitzende Sklaven bildeten Schlangen, die den hellgelben Sand eimerweise in die Glasbläsereien schafften.
Ich schlenderte zum nächstgelegenen Gebäude und blickte durch das offene Tor ins Innere. Für einen Augenblick dachte ich, Trompeter mit Atemnot bei ihren verzweifelten Versuchen zu überraschen, doch dann erkannte ich, daß die pausbäckigen, rotgesichtigen Männer im Innern des Gebäudes an langen Rohren flüssiges Glas bliesen. Eine Hitzewelle schlug mir wie ein Hammer vor den Körper. Ich trat interessiert näher.
Das heißt, ich wollte interessiert näher treten, doch plötzlich stand mir ein menschliches Gebirge im Weg. Es war ein Germane, der so viele Köpfe größer war als ich, daß ich es lieber nicht schätzen wollte. Seine nackten Arme waren mit einem ganz lieblichen Flaum goldener Härchen bedeckt, doch die Muskelberge unter diesem natürlichen Fell waren alles andere als lieblich.
»Was suchst du hier?« Seine Stimme, irgendwo weit über mir, glich einem bedrohlichen Gewittergrollen.
Ich räusperte mich und versuchte, im Vergleich zu ihm nicht allzu kläglich zu klingen. »Ich bin aus Rom und nur für ein paar Tage in der CCAA. Das Glas dieser Stadt ist so berühmt, daß ich zu gerne einen Blick auf den Ort werfen würde, wo es hergestellt wird.«
»Hau ab!« Das Grollen klang jetzt einige Nuancen tiefer. Offensichtlich war sich dieser Riese nun ganz sicher, daß ich kein wichtiger Besucher war, auf den man eventuell Rücksicht zu nehmen hatte.
Ein Irrtum. Es war Zeit, ihn eines Besseren zu belehren. Ich bin nur mittelgroß und dünn, außerdem habe ich bereits stark gelichtetes Haupthaar – »eine hohe Stirn wie der vergöttlichte Caesar«, wie meine Lubentina lobte –, doch die Jahre in der nächsten Umgebung solcher Männer wie Trajan und Hadrian hatten mich gelehrt, arrogant und herrisch aufzutreten. Ich richtete mich zu meiner vollen Höhe auf und entgegnete betont kühl: »Ich gehöre zum Gefolge des Konsuls Marcus Ulpius Trajan, und ich wünsche, diese Werkstatt zu besichtigen. Und zwar sofort.«
Es wirkte nicht.
»Und wenn du der Imperator selbst wärest, du kämest nicht über die Schwelle dieses Hauses!« Plötzlich hielt dieser fleischgewordene Daimon eine Keule in seiner rechten Pranke, mit der man Mauern einschlagen konnte. Er hatte mich sofort überzeugt.
»Wenigstens benutzt du den Konjunktiv richtig«, sagte ich und verzog mich geschlagen.
Nach zwei Schritten hörte ich ein undefinierbares Rasseln und Pfeifen hinter mir und drehte mich um. Ich brauchte ein paar Augenblicke, um die Quelle dieser furchteinflößenden Geräusche zu erraten: Sie kamen offensichtlich aus der Lunge eines alten, schäbig gekleideten Mannes, der seinen zahnlosen Mund zu einem Grinsen verzogen hatte und mich unverfroren anstarrte.
»Du weißt wohl wenig über Glas, Herr?« keuchte er zwischen zweien seiner geräuschvollen Atemzüge hervor.
Alte Sklaven, die nicht mehr ganz richtig im Kopf sind, sind eine Plage in allen römischen Städten. Ich sah den Alten entgeistert an und suchte krampfhaft nach einer höflichen Erwiderung, mit der ich ihn elegant wieder loswerden konnte.
»Ich habe zwanzig Jahre lang Glas geblasen«, rasselte der Mann. »Deshalb ist meine Lunge jetzt auch löchrig wie ein Sieb.«
Das änderte natürlich alles. »Kann ich dich zu einem Becher Wein einladen?« fragte ich.
»Wurde ja auch Zeit«, gurgelte er.
Während wir langsam zur CCAA zurück gingen – wobei ich ständig befürchtete, den Alten neben mir mit einem Erstickungsanfall zu Boden sinken zu sehen –, erfuhr ich, daß mein neuer Bekannter Diatretus hieß und tatsächlich zwei Jahrzehnte als Sklave in einer der größten Glasbläsereien gearbeitet hatte. Vor kurzem hatte ihn sein Herr freigelassen, um die demnächst zu erwartenden Beerdigungskosten zu sparen.
Wir gingen in ein Wirtshaus, das zwischen dem Nordtor und dem Tempel des Mercurius Augustus lag. Es war ein schlicht ausgestatteter Raum. Direkt neben der Tür war die Wand für eine marmorne Theke durchbrochen worden, von der aus der Wirt Wein und einfache kalte und heiße Speisen direkt an die Fußgänger auf den Straßen verkaufen konnte. Da sich das jetzt noch nicht lohnte, lag ein schwerer Vorhang über der Theke und schützte den Innenraum mehr schlecht als recht gegen die nieselige Kälte. Die Wände waren innen weiß verputzt – bis auf die in der hintersten Nische, die ein primitiv ausgeführtes Fresko zierte. Ich hätte es für die Darstellung eines Huhns mit monströsen Schwanzfedern gehalten, wenn mir nicht der Name der Taverne – »Zum Pfau« – einen Hinweis darauf gegeben hätte, was der stümpferhafte Künstler eigentlich hatte darstellen wollen. Die gewohnheitsmäßigen Zecher, um diese frühe Stunde normalerweise die einzigen Gäste der Tavernen, waren von den Saturnalien noch so angeschlagen, daß sie nicht in der Lage waren, bis hierhin zu taumeln. So waren Diatretus und ich allein. Wir setzten uns an den Tisch, der dem großen, wärmenden Herdfeuer am nächsten stand.
Der Wirt sprang förmlich auf uns zu. Es war ein junger Mann, der zu der entnervenden Sorte Menschen gehörte, die schon am frühen Morgen fröhlich, optimistisch und voller Energie sind. »Salve, Diatretus!« brüllte er in einer Lautstärke, mit der Zenturionen normalerweise ihre Legionäre zum Appell riefen.
Ich zuckte zusammen, doch der Alte grüßte huldvoll wie Caesar. »Zwei Krüge Wein«, rasselte er.
»Hast du mal wieder einen Dummen gefunden, was?!« schrie der hektische Wirt, dann hielt er mir herausfordernd die offene Hand unter die Nase, bis ich begriff und zahlte. Erst dann knallte er zwei irdene Krüge auf den schäbigen Tisch. »Wein von hier!« kreischte er.
Ich nahm einen Schluck und würgte. »Das merkt man«, keuchte ich – ich hörte mich vorübergehend an wie Diatretus.
Der Wirt verzog sich und wischte am anderen Ende der Taverne Staub, schlug zwei Fässer an und machte auch sonst ziemlich viel Lärm.
Der Alte nahm einen tiefen Schluck. »Dieser Wein stopft die Löcher in meiner Lunge«, bemerkte er glucksend.
Mir war es völlig schleierhaft, wie Wein Löcher stopfen konnte, doch offensichtlich hatte der alte Sklave recht: Nachdem er den halben Krug intus hatte, hörte er sich beinahe wieder an wie ein Mensch.
»Warum hat mich dieser unverschämte Lümmel von einem Germanen nicht die Werkstatt sehen lassen?« fragte ich. Diatretus veranstaltete ein Spektakel, das als homerisches Gelächter begann und als veritabler Hustenanfall endete. Erneut fürchtete ich ernsthaft um sein Leben, beziehungsweise um meine Sesterze: Ich hatte ihm von meinen alles andere als kaiserlichen Geldmitteln einen Krug spendiert, doch er würde sterben, bevor er mir irgend etwas verraten konnte. Aber wunderbarerweise erholte er sich.