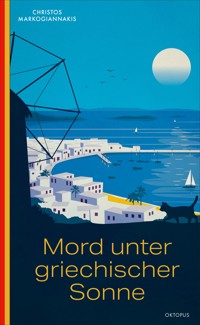
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein spätes Frühstück, ein Sprung ins türkisblaue Meer, eine Siesta am Mittag, Partys in der Nacht: Auf der griechischen Trauminsel Nissos will der Athener Kriminalkommissar Christophoros Markou gefühlte zwölf Monate Schlafmangel nachholen, verstörende Fälle und eine gescheiterte Liebesaffäre hinter sich lassen. Markous Sommertraum endet jäh, als auf einer Party die Leiche einer englischen Journalistin entdeckt wird. Noch dazu zieht ein Sturm auf, kein Helikopter kann auf der Insel landen, kein Schiff anlegen. Markou weiß: Auch der Mörder kann die Insel nicht verlassen. Und als Täter kommen nur die fünfzehn Partygäste infrage: wohlhabende Jetsetter aus aller Welt. Viele von ihnen hatten ein Interesse daran, Lucy Davis aus dem Weg zu räumen. Denn sie schrieb gerade an einem Enthüllungsroman, in dem es um sie alle ging - und ihre dunkelsten Geheimnisse. Wobei auf einer kleinen Insel ein Geheimnis nie lange ein Geheimnis bleibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christos Markogiannakis
Mord unter griechischer Sonne
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sepp Leeb
Oktopus
Hinweis des Autors
Die Insel Nissos ist fiktiv (ein Produkt meiner Phantasie), ein wirklichkeitsgetreues Amalgam der griechischen Inseln, die ich im Lauf meiner Besuche kennen und lieben gelernt habe. Sie steht für alle griechischen Inseln, die Jahr für Jahr von Millionen Touristen besucht und ins Herz geschlossen werden. Deshalb können Sie die in diesem Buch beschriebenen Strände, Gassen, Bilder, Klänge und Gerüche gern auf ihr Lieblingsurlaubsziel in der Ägäis projizieren.
Nicht anders als Nissos sind auch die Menschen mit all ihren Charakterzügen, Verhaltensweisen und Vorgeschichten fiktiv: ein Produkt meiner Phantasie, zum Leben erweckt, um die Handlung voranzutreiben – oder auch nicht …
Sollten Sie sich selbst oder einen Ihrer Freunde in diesem von heftigen Auguststürmen vom Festland abgeschnittenen Paradies wiedererkennen, berücksichtigen Sie etwas, das mir einer meiner Lieblingsautoren einmal gesagt hat: »Wenn Sie aus mir einen fiktiven Charakter machen wollen, dann bitte einen Bösewicht. Das sind immer die interessantesten.«
Bon voyage …
Alles ist voller Blut
Auf der Terrasse im ersten Stock des Hauses von Mariama Milandi, Chora, Nissos
Gehen die denn nie?, dachte Sophie.
Stirnrunzelnd schaute das zehnjährige Mädchen zu den Gästen auf der Terrasse und seufzte. Die wenigen, die noch geblieben waren, standen in kleinen Gruppen zusammen und machten keine Anstalten aufzubrechen.
Genau in dem Moment, als sie gähnen musste, drehte ihre Mutter den Kopf in ihre Richtung und ertappte sie mit offenem Mund. Immer wenn Sophie etwas falsch machte, merkte es ihre Mutter instinktiv, und als sie jetzt ihre missbilligend hochgezogenen Augenbrauen sah, hielt sie noch rasch die Hand vor den Mund, obwohl es eigentlich schon zu spät war.
Als sich Mariama Milandi mit einem zufriedenen Nicken wieder ihrer Gesprächsrunde zuwandte, wanderte Sophies Blick über ihre Mutter und die Gäste hinweg zum Gipfel des Hügels. Obwohl die Glocke des Klosters nach Sonnenuntergang nicht mehr schlug, wusste sie, dass es weit über ihre gewohnte Schlafenszeit hinaus war. In Genf ging sie immer um neun Uhr ins Bett, aber auf Nissos, wenn sie Gäste hatten oder bei Freunden eingeladen waren, durfte sie bis elf oder gar halb zwölf aufbleiben.
Bis zum Ende der Partys ihrer Mutter hatte sie bisher allerdings nie durchgehalten, sondern sich jedes Mal bei den ersten Anzeichen von Müdigkeit in ihr Zimmer im Erdgeschoss verzogen.
Aber an diesem Abend, der letzten Soiree vor ihrer Rückkehr in die Schweiz, hatte sie sich fest vorgenommen, so lange wach zu bleiben, bis der letzte Gast ging. Sie wollte ihrer Mutter beweisen, dass sie auf sie zählen konnte und dass sie eine perfekte Gastgeberin war.
Eine Stunde lang hatte sie gelangweilt auf der gemauerten Bank mit den bunten Kissen in der Ecke der Terrasse herumgesessen, wo ab und zu eine Bougainvillea-Blüte auf ihr Gesicht herabgeschwebt war, als wollte sie sie mit ihrer zarten Berührung wachkitzeln.
Früher war alles viel spannender, dachte Sophie und kämpfte mühsam gegen den Schlaf an.
Zu Beginn der Party stand sie neben ihrer Mutter an der Steintreppe, die zur Terrasse im Obergeschoss hinaufführte, und begrüßte die Gäste. Sie bedachte alle mit einem Lächeln, küsste sie auf die Wangen und stellte sich den wenigen, die sie nicht kannten, mit »Sophie, Mariamas Tochter« vor.
Sie freute sich über die Komplimente für ihr gutes Benehmen und beantwortete bereitwillig Fragen: In welche Klasse ging sie, was war ihr Lieblingsfach, gefiel es ihr auf der Insel, hatte sie hier Freundinnen?
Erwachsene haben echt keine Phantasie, dachte sie jedes Mal, wenn sie die immer gleichen Fragen gestellt bekam.
Diejenigen, die sie von früheren Sommern auf der Insel kannten, bemerkten anerkennend, wie groß und hübsch sie geworden war. »Eine richtige junge Dame bist du inzwischen«, fanden alle. Und sie war tatsächlich schon sehr reif für ihr Alter, wie ihre Mutter immer sagte. Mit ihren zehn Jahren war das auch ihr zehnter Sommer in dem Haus, das ihr Großvater vor vielen, vielen Jahren gekauft hatte: das geräumige weiße Haus mit den rotbraunen Türen und Fenstern und den Terrassen mit den Töpfen voll bunt blühender Pflanzen und Kräuter. Er rühmte sich immer, die Insel schon lange, bevor sie in war, entdeckt zu haben. Sophie verstand nicht recht, was »in« bedeutete. Aber sie vermutete, dass es mit all den Leuten zu tun hatte, die inzwischen jede Ritze von Nissos’ Hauptstadt Chora und den Hafen bevölkerten, jeden Quadratzentimeter der kleinen Strände besetzten und für Selfies posierten, die sie dann auf Instagram posteten.
»Nur Opi fehlt dieses Jahr«, seufzte sie.
Wegen seines Alters wurde das Reisen immer beschwerlicher für ihn, weshalb er dieses Jahr zum ersten Mal nicht auf die Insel mitgekommen war.
»Es ist eine anstrengende Reise«, hatte ihre Mutter gesagt.
»Zwei Flüge und die Überfahrt mit der Fähre«, hatte Sophie protestiert. »Was ist daran so wild?« Trotzdem, es war das erste Mal, dass ihr Großvater nicht dabei war. Aber auch ohne ihn war das Haus immer voller Leute.
Seit der Scheidung von Papa ist Mama nicht gern allein, dachte Sophie.
Tatsächlich hatten sie die letzten eineinhalb Monate nicht einen Abend ohne Gesellschaft verbracht. Immer gab es irgendein Essen, eine Party bei ihnen oder anderen, einen Bummel auf der Platia, dem Hauptplatz von Chora, und anschließend einen Café- oder Restaurantbesuch. Sophie trank dann immer eine Gazoza, die traditionelle griechische Limonade.
Angesichts dieser endlosen Aktivitäten fragte sie sich, ob ihre Mutter überhaupt ein wenig ausspannen konnte. Vor der Abreise aus Genf hatte sie erklärt, sie wolle nur auf der Chaiselongue liegen und einen Monat lang nichts tun. Abgesehen von ein paar gemeinsamen Stunden am Kalami Beach, schienen die Pläne ihrer Mutter jedoch nicht gefruchtet zu haben. Ihre Klagen am Telefon mit Sophies Großvater über »die ständigen gesellschaftlichen Verpflichtungen« klangen jedenfalls nicht nach Ruhe und Erholung.
Das an diesem Abend war die neunte Party, die Mariama Milandi seit ihrer Ankunft auf der Insel gab. Aber egal, ob es sich um ein Essen mit zehn Leuten oder ein rauschendes Fest mit fünfzig handelte, ihre Mutter erwies sich immer als perfekte Gastgeberin. Das war schließlich ihr Beruf. Hochzeiten, Empfänge und Social Events stand auf ihrer Visitenkarte.
Sophie senkte den Blick vom Kloster oben auf dem Hügel wieder auf die Gäste.
Alle schienen sich blendend zu amüsieren. Sie standen mit einem Glas oder einer Zigarette in der Hand auf der Terrasse, unterhielten sich und schauten auf den kleinen idyllischen Hafen hinab; andere bewegten sich inmitten zahlloser bunter Lampions und der Tontöpfe voll Blumen und Kräuter zum Rhythmus der Musik.
Wie bei den meisten Häusern auf Nissos befand sich die Hauptterrasse im Obergeschoss. Die im Haus ihres Großvaters war die größte von allen Häusern, in denen Sophie gewesen war. »Auf unserer haben locker fünfzig, sechzig Leute Platz«, hatte ihre Mutter einmal gesagt. Sogar achtzig, wenn man die zweite Terrasse dazunahm, die über eine Holztreppe zu erreichen war.
Aber an diesem Abend waren es weder sechzig noch achtzig. Es war eine Abschiedsparty »im engsten Kreis«. Sophie hatte zwanzig Gäste gezählt, aber wegen des ständigen Kommens und Gehens hatte sie vielleicht ein paar übersehen. Die meisten kannte sie von früheren Sommern, und nur wenige der Anwesenden sah sie an diesem Abend zum ersten Mal oder hatte sie erst in den letzten eineinhalb Monaten kennengelernt.
Sophie war offen für neue Bekanntschaften, im Gegensatz zu ihrer Mutter, die sich Freunden gegenüber immer wieder darüber beklagte. Alle fanden, dass zu viele Leute auf die Insel kamen und dass das Leben nicht mehr so war wie früher. Dass der Massentourismus ihr Paradies zugrunde richtete.
An diesem Abend wurden jedoch keine Klagen laut. Alle schienen sich zu amüsieren – bis auf einen.
Der Mann, der neben dem Jasmin sitzt, hat sich schon Stunden nicht mehr von der Stelle bewegt, dachte Sophie, als ihr Blick auf ihn fiel.
Er war zusammen mit Mike, dem DJ, früh gekommen und hatte sich nach einer kurzen Begrüßung allein auf die Bank gesetzt und sie seitdem nicht verlassen. Einige Gäste versuchten, mit ihm ins Gespräch zu kommen, doch gelang es keinem. Deshalb wurde er schließlich, reglos und still, wie er war, allein gelassen mit seinem Glas, das nie leer zu werden schien.
Sein Körper bewegte sich nicht, aber sein Blick flog wie ein gieriger Moskito von Gesicht zu Gesicht. Ihre Mutter hatte ihr erzählt, dass der fremde Mann Mikes Cousin war, ein Polizist aus Athen, der auf Nissos Urlaub machte.
Sophie beobachtete ihn mit skeptisch hochgezogenen Augenbrauen. Eigentlich konnte sie sich nicht vorstellen, dass er Polizist war. Er trug ja nicht mal eine Uniform. Andererseits machte er Urlaub, und Uniformen, vermutete sie, waren für den Winter und die Arbeit, genau wie Schuluniformen.
Und überhaupt, dachte sie. Griechische Polizisten sind wahrscheinlich anders als die in der Schweiz.
In diesem Moment drehte der griechische Polizist den Kopf, und sein Blick traf ihren. Trotz seines freundlichen Lächelns senkte sie den Kopf, als wäre sie bei etwas Verbotenem ertappt worden. Nach ein paar Sekunden beschloss sie, wieder hochzuschauen und sein Lächeln zu erwidern, aber er hatte sich bereits abgewandt.
Ein leises Miauen zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Die Nachbarskatze hatte sich auf die Terrasse geschlichen und strich ihr um die Füße. Sophie hob sie hoch und drückte sie fest an sich. Ihr weiches Fell wärmte sie gegen den frischen Wind, der inzwischen aufgekommen war.
Mit einer abrupten Bewegung befreite sich die Katze aus ihrer Umarmung und kuschelte sich in ihren Schoß. Sophie kraulte sie zwischen den Ohren, was sie sehr zu genießen schien, denn sie schloss die Augen und begann, genüsslich zu schnurren. Eigentlich sollte sie keine Katzen anfassen, aber Plato gehörte nicht zu den unzähligen Streunern auf der Insel. Sie hatte einen Namen, sie war geimpft, und sie hatte ein Zuhause und einen Besitzer. Auf dem silbernen Herz, das an einem roten Band um ihren Hals hing, stand Plato. Als Sophie behutsam die Hand auf den falben Rücken der Katze legte, dachte sie, dass es selbst in Griechenland unüblich war, dass weibliche Katzen Männernamen hatten.
Verrückt, dachte sie.
Eine Frau stellte ihr Glas auf die steinerne Bank, und von der Bewegung erschreckt sprang Plato aus Sophies Schoß und schlängelte sich zwischen den Beinen der Gäste hindurch zu der Steintreppe, die in den kleinen Hof hinabführte.
Sophie stand auf und lief Plato nach, als sie die Treppe hinunterhuschte. Mit einem Sprung von der vierten Stufe landete die Katze auf den Pflastersteinen vor den Schlafzimmern. Die große Holztür rechts von der Treppe, die in eine verlassene Gasse hinausführte, stand weit offen.
Es war schon spät, und alle geladenen Gäste waren da, dachte Sophie beim Anblick der offenen Tür. »Wird langsam Zeit, dass sie wieder gehen«, seufzte sie.
Die vier in hellem Rotbraun gestrichenen Türen auf der linken Seite des kleinen Innenhofs waren zu. Drei von ihnen führten in Schlafzimmer – ihres, das ihrer Mutter und das ihres Großvaters, das dieses Jahr als Gästezimmer benutzt wurde.
Hinter der vierten Tür befand sich die ehemalige Waschküche. Seit sie in der Küche eine Waschmaschine hatten, diente der Raum jedoch als Abstellkammer, in der sich im Lauf der Zeit ein wildes Sammelsurium an Gegenständen angehäuft hatte: kaputte Töpfe, die ihre Mutter aus unerfindlichen Gründen nicht wegwerfen wollte, Werkzeug, Gartengerätschaften, alte Möbel, Stoffreste, Dekorationsstücke.
Sophie blickte sich um. Plato war nirgendwo zu sehen. Wie in Griechenland üblich, lockte sie flüsternd »psi-psi-psi« – schließlich war Plato eine griechische Katze! – und schaute hinter jeden der großen Tonkrüge mit den Oliven- und Zitronenbäumchen. Dann öffnete sie eine Schlafzimmertüre nach der nächsten. Vielleicht war Plato ja durch ein Fenster oder einen Spalt unter der Tür geschlüpft. Nichts!
Als Letztes schaute sie in die Abstellkammer. Sie drückte den rostigen Griff der Tür neben dem offenen Fenster herunter und betrat den dunklen Raum. Plötzlich stand sie bis zu den Knöcheln in Wasser. Jemand hatte den Hahn neben der Tür nicht abgedreht, und der ganze Boden war überschwemmt.
O je, meine Sandalen!, war ihr erster Gedanke.
Als sie sich auf die Zehenspitzen stellte, um ihre weißen Wildlederschuhe noch halbwegs zu retten, sah sie im Halbdunkel Platos silbernes Herz aufblitzen. Auch die Augen der Katze leuchteten kurz auf, als sie von dem niedrigen Tischchen, auf dem sie stand, kurz zu Sophie schaute. Doch sie senkte sofort wieder den Kopf, um mit gerecktem Hals etwas auf dem Boden der Kammer zu beschnuppern.
Bloß nicht wieder einer dieser ekligen Tausendfüßler! Sophie musste an die widerlichen Kreaturen denken, die kürzlich in ihrem Bett herumgekrochen waren. Und schon gar keine Maus oder Schlange!
In der Hoffnung, Plato würde sie vor jedem Insekt, Reptil oder Nagetier beschützen, machte sie Licht – und stürmte im nächsten Moment panisch die Treppe zur Terrasse hinauf, wo sie, ihren Leopardenkaftan hinter sich herziehend, völlig atemlos auf ihre Mutter zustürzte.
»Sophie, wie oft soll ich dir noch sagen …«, begann Mariama. Doch das blasse Gesicht und die weit aufgerissenen Augen ihrer Tochter ließen sie abrupt verstummen.
»Was ist denn?«
Zuerst brachte das Mädchen kein Wort heraus, dann holte sie tief Luft und stieß wegen der lauten Musik kaum hörbar hervor: »Eine Frau. In der Abstellkammer … Alles ist voller Blut.«
Zwangsurlaub
Der Duft des Jasmins mischte sich mit den Parfums und dem Schweiß der Gäste, dem Rauch ihrer Zigaretten und dem beißenden Geruch der grünen Moskitospiralen, die in allen Ecken der Terrasse vor sich hin glommen. Im Wettstreit der Aromen siegten eindeutig letztere. Christophoros Markou erinnerte sich, irgendwo gelesen zu haben, dass der Rauch einer einzigen Moskitospirale die Lunge ähnlich stark schädigte wie hundert Zigaretten. Und das Schlimmste daran war, dass sie völlig umsonst vor sich hin qualmten. Die Moskitos waren offenbar längst immun gegen den erstickenden Geruch und stachen ihn unablässig, seit er die Terrasse betreten hatte.
Auf der Suche nach etwas frischer Luft drehte er den Kopf in die andere Richtung. Die Brise, die seine Nase klärte, war ein erster Vorgeschmack auf den angekündigten Sturm. Seine Wetter-App hatte ihn bereits gewarnt, dass die windstille Zeit auf der Insel vorbei war. Für die kommenden Tage, beginnend mit diesem Abend, wurden Windstärken zwischen neun und zehn erwartet.
Das machte Markou eigentlich nichts. Bestimmt würde er eine geschützte einsame Bucht finden, in der er schwimmen gehen und endlich einmal entspannen konnte. Sein Cousin Michalis – Mike, für die Fremden – war auf Nissos aufgewachsen und kannte jeden Winkel der felsigen, sonnenversengten Insel.
Sowohl Nissos als auch der Besuch bei Mike waren die Idee seiner Mutter gewesen. Die ersten vier Tage seines Zwangsurlaubs von der Athener Polizei, die Markou im Haus seiner Familie oben im Norden verbracht hatte, waren von unbehaglichem Schweigen und Small Talk geprägt.
Weitere zehn Tage hätten es meine Eltern garantiert nicht mit mir ausgehalten, dachte er.
Da er sich die meiste Zeit in seinem alten Kinderzimmer verkroch, wo er Krimis las, die Callas hörte und mindestens ein Jahr Schlafmangel nachzuholen versuchte, war er alles andere als eine gute Gesellschaft. Und wenn er seine Höhle doch einmal verließ, um in der Küche mit seiner Familie zu essen oder im Wohnzimmer mit ihnen zusammenzusitzen, machte er klar, dass er nicht über seine Mordfälle sprechen würde – deren zuverlässige Lösung ihm den Spitznamen »Mr Hundertprozent« eingetragen hatte. Damit waren die Themen auf den üblichen Familienklatsch beschränkt: Wer hatte vor Kurzem geheiratet, wie viele Kinder hatten seine Cousins und Cousinen oder Klassenkameraden und dergleichen mehr.
Das alles brachte seine Mutter zu dem unausweichlichen Schluss, dass »er dringend eine Frau an seiner Seite brauchte, wenn er nicht als einsamer und verbitterter alter Mann enden wollte«.
Sein Vater sagte zwar nichts dazu, nickte aber immer wieder zustimmend. Und je häufiger diese gezielten Anspielungen auf sein Privatleben wurden, umso mehr zog sich Christophoros Markou in sich zurück und schwieg. Er hatte zu dem Thema ja auch nichts zu sagen.
Er war ungebunden und wollte das auch bleiben, Punkt. Ein kleines Abenteuer mit einer Kollegin – was für eine ausgemachte Dummheit! – hatte schon zwei Wochen, nachdem es begonnen hatte, wieder geendet. Ein paar Tage vor Antritt des von seinem Chef angeordneten August-Urlaubs hatte er Schluss mit ihr gemacht. Sie hatte es locker genommen und keine Szene gemacht. Sie hatte ihn nicht einmal gefragt, warum.
Doch selbst dieses unspektakuläre Ende einer unspektakulären Affäre hatte ihm zugesetzt. Und die ständigen Sticheleien seiner Mutter wegen seiner wenig einnehmenden »altjüngferlichen« Art machten es nicht gerade besser. Deshalb hatten ihn seine Eltern auch nicht umzustimmen versucht, als er beiläufig fallen ließ, dass er überlegte, auf eine Insel zu fahren, um sich etwas zu erholen. Im Gegenteil. Obwohl sich seine Eltern am Telefon ständig beklagten, dass sie so wenig von ihm zu sehen bekamen, seit er nach Athen gezogen war, konnten sie es bereits am vierten Tag nach seiner Ankunft kaum erwarten, ihn loszuwerden. Seine Mutter war es auch, die ihm vorschlug, nach Nissos zu fahren, wo er bei Michalis unterkommen konnte, dem einzigen seiner Cousins, der mit achtunddreißig, zwei Jahre älter als er, immer noch unverheiratet war.
Markou schaute zu Michalis/Mike, der sich gerade einen riesigen Kopfhörer ans Ohr hielt und über seinen nächsten Mix nachdachte. Wenige Sekunden später dröhnte nach einem astreinen Übergang »Final Countdown« von Europe aus den Speakern. Der Text des Songs ließ Markou unwillkürlich auf die Uhr schauen. Fast zwei Uhr.
Er hatte seit seiner Ankunft stumm in der Ecke gesessen und war sämtlichen Annäherungsversuchen ausgewichen. Einige Partygäste wollten nämlich durchaus mit ihm ins Gespräch kommen, als sie erfuhren, dass er, wie Mike der Gastgeberin erzählt hatte, Hauptkommissar und stellvertretender Leiter der Mordkommission von Attika war. »Was war der seltsamste Mordfall, den Sie gelöst haben?« »Gibt es in Griechenland Serienmörder?« »Gibt es so etwas wie ein perfektes Verbrechen?« Das waren nur einige der Fragen.
Auf höfliche, aber bestimmte Art hatte Markou immer die gleiche Antwort gegeben: »Ich darf leider nicht über meine Arbeit sprechen.«
Nach mehreren solchen Abfuhren ließen ihn die übrigen Gäste in Ruhe.
Und seitdem hatte er neben ein paar anerkennenden Gesten zum Musikgeschmack seines Cousins und dem einen oder anderen freundlichen Blickkontakt mit der Gastgeberin die Zeit – fünfeinhalb Stunden, um genau zu sein – damit herumgebracht, auf sein Handy zu schauen und die Partygäste zu beobachten. Hin und wieder hatte er sogar versucht, einzelne Wortfetzen, die an seine Ohren drangen, zu ganzen Sätzen zusammenzufügen, eine Art Spiel, um die Langeweile zu vertreiben.
Ich hätte mir was zu lesen mitnehmen sollen, dachte er.
Natürlich wusste er, dass das unhöflich gewesen wäre. Und vor allem hätte er sich wegen der vielen Leute und der lauten Musik nicht auf seine Lektüre konzentrieren können.
Die einzige Person, die seine Meinung zu teilen schien, dass die Party langsam zu Ende gehen sollte, war die Tochter der Gastgeberin. Ihr Gähnen und ihre schweren Lider ließen keinen Zweifel an ihrer Müdigkeit.
Er lächelte dem Mädchen freundlich zu, als sich ihre Blicke trafen, und sie senkte verlegen den Kopf.
Markou richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf seinen Cousin. Eigentlich wollte er ins Bett, aber er hatte ihm versprochen, beim Abbau der Anlage zu helfen.
Was soll schon so schlimm daran sein, mal länger aufzubleiben?, redete er sich gut zu. Zum Glück hatte er bis zu seiner Rückkehr nach Athen noch eine Woche Zeit, um zu relaxen, das heimische Essen zu genießen, am Strand zu liegen, zu lesen und früh schlafen zu gehen.
Ruhe und Erholung pur, dachte er lächelnd, als er sah, wie das kleine Mädchen von seinem Sitz aufsprang und hinter der Katze die Treppe hinunterrannte.
Die Leiche in der Abstellkammer
Zuerst war es die panische Hektik des Mädchens, die seine Aufmerksamkeit erregte, als sie mehrere Stufen auf einmal nehmend die Treppe wieder heraufgerannt kam. Dann waren es ihre schreckgeweiteten Augen, die aus ihren Höhlen zu treten drohten, und die gespenstische Blässe ihres Gesichts, noch verstärkt durch ihr korallenrotes Kleid.
Und schließlich die Art, wie sie mit aller Kraft am Kleid ihrer Mutter zog. Da sie ihm dabei den Rücken zugekehrt hatte, konnte er nicht verstehen, was sie sagte. Doch der Gesichtsausdruck der Gastgeberin, zuerst skeptisch, dann bestürzt, war deutlich zu erkennen.
Markou sah, wie Mariama Milandi dem Mann, mit dem sie sich gerade unterhalten hatte, ihr Glas in die Hand drückte und ihre Tochter am Arm in Richtung Treppe zog.
Als Mutter und Tochter hinabstiegen, stand der Kommissar auf und folgte ihnen. Auf den hellen Steinstufen fielen ihm sofort die kleinen feuchten Fußabdrücke auf, die jedoch bereits trockneten und nur noch ansatzweise sichtbar waren.
Unten angekommen, ließ die Mutter den Arm der Tochter los und ging auf die Stelle zu, auf die das Mädchens zeigte: eine weit offen stehende Tür, durch die grelles Licht in den schwach beleuchteten Innenhof fiel.
Vielleicht aus einem Instinkt heraus oder auch aus Erfahrung schloss Markou als Erstes die Tür zu der Gasse, die zur Platia führte.
Ein Geräusch, als schnappte jemand erschrocken nach Luft, gefolgt von einem gellenden Schrei, drang an sein Ohr. Die Gastgeberin, die jetzt direkt vor der offenen Tür stand, riss entsetzt eine Hand an ihren Mund und hielt die andere vor die Augen ihrer Tochter. Ihr Busen wölbte sich, als sich ihre Lunge mit Luft füllte, um einen weiteren Schrei auszustoßen. Im selben Moment drehte sie den Kopf und sah ihn neben sich stehen. Sie brauchte ein paar Sekunden, um zu erkennen, dass der Mann neben ihr nicht nur ein Partygast war. Sondern Mikes Cousin, der Polizist aus Athen.
Ohne einen Schrei oder auch nur ein Wort packte Mariama Milandi den Kommissar am T-Shirt und zog ihn vor sich. Mit der anderen verdeckte sie weiter die Augen ihrer Tochter. Das Mädchen versuchte, die Finger ihrer Mutter auseinanderzuziehen, um einen Blick ins Innere der Abstellkammer zu erhaschen, wo sich Markou jetzt umblickte.
Dort lag neben alten Teppichen, allen möglichen Möbelstücken, Körben und Keramikbehältnissen eine Frauenleiche auf dem etwa zehn Zentimeter unter Wasser stehenden Boden. Die Tote trug ein hellblaues Kleid, an ihrer linken Hüfte hing ein kleiner gehäkelter Beutel, und sie lag mit dem Gesicht nach unten im Wasser, das ihr bis zu den Ohren reichte. Markous Blick wanderte zu ihren langen blonden Locken, die sich im Rhythmus des Wassers bewegten, das aus dem Schlauch neben ihr sprudelte. Dabei bemerkte er mehrere rotbraune Flecken auf ihren Haaren.
Ende des Urlaubs
Markou schob Mutter und Tochter von der Tür der Kammer fort und forderte sie auf Englisch auf, nichts anzufassen. Dann bat er die Hausherrin, wieder nach oben zu gehen, die Musik auszumachen und den Gäste zu sagen, dass sie bis auf Weiteres das Haus nicht verlassen dürften. Alle sollten bleiben, bis ihre Personalien aufgenommen waren.
Wenige Sekunden später, Markou fühlte der im Wasser liegenden Frau gerade den Puls, verstummte »Live is Life« abrupt. Nur noch die Worte der Gastgeberin drangen durch die plötzliche Stille und wurden bald von aufgeregtem Flüstern abgelöst, das sich zu fassungslosem Gestammel und bestürzten Ausrufen steigerte.
Der Kommissar beendete gerade das Telefonat mit dem Kadetten in der Wache von Chora und hoffte, er würde auftauchen, bevor die Partygäste die Treppe herunterkamen, um zu schauen, was passiert war. Menschliche Sensationsgier im Angesicht eines Todesfalls – je spektakulärer und brutaler, desto besser – war bekanntlich nichts Neues. Oft genug musste die Polizei an Tatorten Gaffer fernhalten, die es auf einen blutrünstigen Schnappschuss abgesehen hatten.
Vorsichtig machte sich Markou daran, mit dem Zipfel seines T-Shirts den Wasserhahn zuzudrehen, der neben der Tür aus der Wand ragte. Der grüne Schlauch, der zusammengerollt auf dem Boden lag, zuckte wie eine sterbende Schlange, als der Strahl versiegte.
Die Enge des Raums, das laufende Wasser und die Verletzungen am Kopf der Frau, die auch in dieser Position deutlich zu sehen waren, das alles deutete nicht auf einen gewöhnlichen Unfall hin.
»Ein Unfall – vielleicht auch Mord«, hatte der Kommissar dem jungen Kadetten am Telefon gesagt. Dessen Überraschung war nicht zu überhören gewesen.
»Mord? Hier? Auf Nissos?« Und ohne Markous Antwort abzuwarten, fügte er hinzu: »In fünf Minuten bin ich da!«
Die Ortsangabe »Mariama Milandis Haus« genügte dem jungen Polizeianwärter vollauf. Mit Ausnahme der Hauptstraße zum Hafen hatte keine der Gassen auf der Insel einen Namen. In Chora orientierte man sich an der Platia, am Kloster, an ein paar Kapellen und an den Namen der Hausbesitzer. Auch die mit schwarzer Farbe an die steinernen Türrahmen gepinselten Hausnummern waren über- flüssig.
Mit der Krankenstation von Nissos erwies sich die Verständigung als wesentlich schwieriger. Die einzige Ärztin auf der Insel bestand darauf, dass die »verletzte Partei« zu ihr gebracht wurde.
»Ich habe zwei Leute hier, die nach einem Rollerunfall genäht werden müssen. Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen, um zu Ihnen zu kommen. Ich bin ganz allein hier!«
Als ihr Markou die Situation schilderte, war die Reaktion der Ärztin entwaffnend: »Die Frau ist tot, sagen Sie? Was soll ich dann noch für sie tun? Lassen Sie mich erst die beiden hier verarzten. Dann komme ich, so schnell ich kann.« Sprach’s und legte auf.
Dieses Telefonat holte Markou wieder in die Realität zurück. Er hatte auf Nissos keinerlei Befugnisse. Er war nicht im Dienst und befand sich außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs. Hier war er nur ein stinknormaler Tourist. Deshalb beschloss er, auf den örtlichen Polizeichef zu warten und anschließend sofort ins Bett zu gehen. Schließlich war er nur hier, weil er den ausdrücklichen Befehl erhalten hatte, sich zu erholen. Auch wenn er das jetzt wohl vergessen konnte …
Er richtete den Blick wieder auf den Boden. Seit das Wasser abgedreht war, bewegte sich das Haar der Toten nicht mehr.
»Lucy. Lucy Davis. Aus London«, hatte ihm die Gastgeberin gesagt und fassungslos den Kopf geschüttelt, als Markou sie fragte, ob sie wüsste, was die Tote in ihrer Abstellkammer gewollt haben könnte.
»Sie war auf der Party«, sagte sie. »Aber ich dachte, sie wäre längst gegangen.«
Markou nahm die direkte Umgebung der Leiche genauer unter die Lupe. Er inspizierte die spitzen Ecken und Kanten verschiedener Möbelstücke, die an einer Wand gestapelten Stühle, deren Beine wie riesige Dornen in die Höhe ragten, herumliegendes Werkzeug und zerbrochene Tontöpfe. Auf der Suche nach einem Hinweis, dass es ein Unfall gewesen sein könnte, dass sie vielleicht ausgerutscht war, das Gleichgewicht verloren, sich den Kopf an einer Ecke angeschlagen und das Bewusstsein verloren hatte und dann verblutet oder ertrunken war.
Doch keiner der Gegenstände in der Kammer war blutverschmiert. Und schon wegen der Tiefe der Kopfverletzungen war nicht auszuschließen, dass sie der Frau absichtlich beigebracht worden waren.
Der Kommissar bückte sich und leuchtete mit der Taschenlampe seines Handys den Boden der Abstellkammer ab. Er lag etwa zehn bis fünfzehn Zentimeter tiefer als der Innenhof. Die blechüberzogene Türschwelle, die verhindern sollte, dass Wasser von draußen hereinfloss, verhinderte zugleich, dass das Wasser aus der Kammer abfließen konnte.
Markou richtete sich auf, trat zwei Schritte zurück und sah zu der geschlossenen Holztür, die auf die Gasse hinausführte. Er hoffte, der junge Polizist und die Ärztin kämen bald.
Bei diesem Gedanken hörte er jemanden seinen Namen rufen.
»Christophoros?«
Sein Cousin Mike stand auf der Treppe und sah ihn besorgt an.
»Was ist passiert?«
»Was passiert ist?«, antwortete Markou achselzuckend und fügte seufzend hinzu: »Mein Urlaub hat gerade eine neue Wendung genommen.«
Unorthodoxe Methoden
Mit dem Rücken zur Abstellkammer wartete Markou auf die Ärztin. Der Wind hatte bereits merklich aufgefrischt und wirbelte die rosa Blüten, die zu Boden gefallen waren, in einem wilden Tanz durch den kleinen Innenhof. Kein Wunder, dass die Bougainvillea auch als Messie unter den Bäumen bezeichnet wurde, dachte er. Egal, wie oft man fegte, hatte sie Höfe und Terrassen schnell wieder mit den Relikten ihrer Schönheit übersät. Damit die wirbelnden Blüten nicht in den Tatort wehten, schloss er die Tür der Abstellkammer.
Seit einer ganzen Weile war er nicht mehr angesprochen worden. Zuletzt hatte Mariama Milandi all ihren Mut aufgebracht und ihn gefragt, ob er etwas trinken wollte.
Und jetzt beobachtete Markou mit einem Frappé in der Hand, wie die Gäste einer nach dem anderen die Treppe herunterkamen und dem jungen Kadetten, Valantis Maroulas, ihre Beobachtungen schilderten. Ihre Blicke wanderten von der geschlossenen Tür der Abstellkammer zu Markou und dann erst zu der Kamera, die der Kadett mitgebracht hatte. Als einige der Partygäste wegen der Fotos zaghaften Protest einlegten, antwortete der junge Mann nur knapp: »Vorschrift«. Was natürlich nicht stimmte. Die Fotos waren seine Idee gewesen, und Markou hatte sie abgesegnet.
Aber nicht alle zeigten sich kooperationsbereit. Ein italienisches Ehepaar wollte unter keinen Umständen fotografiert werden und drohte, »sich bei der Botschaft zu beschweren, wenn die Polizei sie belästigte«. Trotz ihrer Proteste hielt Maroulas ihre Konterfeis auf der Speicherkarte fest, bevor er sie entließ, woraufhin sie heftig gestikulierend und in ihrer Muttersprache schimpfend von dannen zogen.
Markou fragte sich, ob die Fotos dieses Theater wert waren. Wenn es sich hier, wie er vermutete, tatsächlich um ein Verbrechen handelte und der Täter einer der Partygäste war, wäre er wohl kaum noch hier. Trotzdem hatte er dem Kadetten nicht widersprochen. Kleinvieh macht auch Mist, dachte er.
Er betrachtete den jungen Mann, dessen schmales, sonnengebräuntes Gesicht von kurzem schwarzen Haar eingerahmt war. Jedes Mal, wenn er ein Foto machte, schob sich der Ärmel seines hellblauen Uniformhemds ein Stück hoch, sodass seine deutlich blasseren Arme zum Vorschein kamen. Diese »Bauarbeiterbräune« war im Sommer auch unter den Streifenpolizisten verbreitet. Maroulas war fünfzehn Minuten nach Markous Anruf am Haus der Milandis eingetroffen. Nachdem er Markou förmlich begrüßt hatte, fügte er mit einem herzlichen Händedruck hinzu: »Es ist mir eine Ehre, Kommissar. Ich habe schon viel von Ihnen gehört!«
Markou vergeudete keine Zeit damit, auf das Kompliment einzugehen. Er informierte den Kadetten über seine bisherigen Erkenntnisse und bat ihn, Namen, Adressen und Telefonnummern aller Anwesenden aufzunehmen und sie zu fragen, ob sie das Opfer, eine Engländerin namens Lucy Davis, gekannt hatten.
Bei dem Namen leuchteten die Augen des jungen Polizeianwärters auf. Neugierig den Hals reckend fragte er Markou, ob er einen Blick in die Abstellkammer werfen dürfte. Er beugte sich über die Schwelle, schaute nach drinnen und bückte sich, um das ins Wasser getauchte Gesicht der Toten besser sehen zu können. Dann richtete er sich wieder auf, nickte und sagte: »Ihr Name ist mir gleich bekannt vorgekommen. Ich bin sicher, sie ist es! Sie ist vor einer Weile auf die Wache gekommen. Eine Journalistin, oder?«
»Keine Ahnung«, antwortete Markou.
»Doch, Journalistin und Schriftstellerin. Hat sie zumindest gesagt. Sie wollte einen Artikel über die Polizei auf den griechischen Inseln schreiben – vielleicht war es auch ein Buch – und hat sich deshalb nach unseren Arbeitsbedingungen erkundigt, nach Personalstärke, Kriminalitätsstatistiken, Unfällen und so weiter.«
Markou nickte nur und erinnerte den jungen Mann noch einmal an seine Aufgaben, worauf dieser sich daranmachte, in einem seltsam anmutenden Buch mit bunt geblümtem Einband die Personalien der Gäste zu notieren. Maroulas hatte zwar die Kamera und einen Packen Vernehmungsformulare mitgebracht, aber keinen Notizblock, und da das kleine schwarze Büchlein, das Markou in Athen immer dabeihatte, in seinem Koffer in Mikes Haus lag, hatte sich der Kadett Sophies buntes Skizzenbuch geliehen.
Jedes Mal, wenn die Kamera blitzte, musterte Markou das Mienenspiel des Fotografierten. Die Gesichter der Partygäste verrieten alles mögliche, von Fassungslosigkeit über Neugier und Besorgnis bis zu tiefer Bestürzung. Hinter einem fünfunddreißigjährigen bärtigen Mann, der sich die Augen rieb, kam ein älterer Mann mühsam die Treppe herab und hielt sich dabei am Arm einer großen, imposanten Frau fest. Der dunkelgrüne Paschmina über ihrem roten Bodysuit betonte ihre kräftigen Schultern. Ihr Blick war auf die Füße des alten Mannes geheftet, der mit langsamen, zögernden Bewegungen einen Schritt nach dem anderen tat. Obwohl er noch sehr rüstig wirkte, zitterte er am ganzen Körper. Am Fuß der Treppe angelangt, wurde die Verzweiflung in seinem Gesicht in einem Foto festgehalten. Bevor er in die enge Gasse hinaustrat, lehnte er sich, wie um Kräfte zu sammeln, kurz an den Türrahmen und drehte noch einmal den Kopf zu dem jungen Kadetten.
»Das ist Arnaud Cadena«, sagte Mariama Milandi an Markou gerichtet. »Er hat Lucy vor vier Jahren nach Nissos mitgebracht. Er ist … Sie war … wie eine Tochter für ihn.«
Markou betrachtete die hellen blauen Augen des alten Mannes, seine Hakennase und den kleinen Mund, und dann, als er sich abwandte, sein dichtes weißes Haar. Von dort sprang Markous Blick zu dem runden Gesicht der Frau, die in dem Moment in den kleinen Innenhof kam. Bevor der Kommissar die Tasche in der Hand der Frau bemerkte, verkündete die Gastgeberin: »Da kommt die Ärztin.«
Die Ärztin
Stella Kastelaki, die der einzige Arzt auf Nissos war, zog sich Plastikbeutel über die Schuhe und band sie um die Schienbeine fest. Das lenkte Markous Blick auf Sophie, die an der Hand ihrer Mutter alles beobachtete. Eine blassrote Linie über ihren Fußgelenken verriet, wie tief sie beim Betreten der Abstellkammer im Wasser gestanden hatte. Ihre weißen Wildledersandalen hatten jetzt rosa Flecken. Er dachte an die Überschwemmung auf dem Boden. Außer der DNA des Opfers würden sie sicher auch die von Sophie und – wenn sie Glück hatten – die des Täters finden.
Er fragte sich, wie er hier auf der Insel ohne die nötige Ausrüstung ermitteln sollte. Doch sofort rief er sich in Erinnerung, dass das ja gar nicht seine Aufgabe war. Mit den siebzig Einwohnern, die im Winter auf der Insel lebten – eine Zahl, die sich im Sommer verzehnfachte –, hatte Nissos nur eine einzige Polizeistation. Bald würde Antonis Katzikis, ihr Leiter, das Kommando übernehmen. Er war gerade auf Kos, würde aber in Kürze zurückkehren, wie Maroulas versichert hatte.
»Selbst wenn ich früher gekommen wäre, hätte es nichts an der Sache geändert.« Die heisere Stimme der Ärztin riss Markou aus seinen Gedanken.
»Sie war schon lange tot, als Sie mich angerufen haben«, fügte sie hinzu und sah ihn an. Mit ihrer linken, in einem Gummihandschuh steckenden Hand hob sie den Kopf der Toten ein Stück aus dem Wasser und leuchtete mit der Taschenlampe auf ihn.
»Ich bin natürlich keine Rechtsmedizinerin, aber diese Verletzungen«, der Strahl der Taschenlampe wanderte zur Stirn der Toten, »dürften tödlich gewesen sein.«
Als sie den Kopf behutsam wieder ins Wasser zurücksinken ließ, fügte sie hinzu: »Mehrere Frakturen des Stirnbeins und Verdacht auf Hirntrauma.« Sie richtete sich auf und schüttelte kleine Tropfen Blut und Wasser von ihrer Hand.
»Vielleicht täusche ich mich auch«, fuhr sie fort. »Möglicherweise hat sie infolge der Schläge nur das Bewusstsein verloren und ist dann ertrunken.« Sie zeigte mit dem Finger auf den Boden.
Und nach kurzem Umblicken gelangte sie zu dem Schluss: »Jedenfalls ist sie tot. Die genaue Ursache wird Ihnen der Rechtsmediziner verraten.«
»Ist Ihnen sonst noch etwas an ihren Kopfverletzungen aufgefallen?«, fragte Markou.
»Drei sind deutlich sichtbar, aber vielleicht sind es auch mehr. Mit Sicherheit lässt sich das auf die Schnelle nicht sagen. Beigebracht wurden sie dem Opfer wahrscheinlich mit einem stumpfen Gegenstand: einer Brechstange, einem Hammer, etwas in der Art. Ich rufe in Rhodos an, dass sie einen Hubschrauber schicken, der sie abholt. Alle weiteren Fragen werden Ihnen die Experten beantworten.«
Wieder draußen im Hof, schaute sie zu den Bougainvillea-Ranken hinauf, die sich inzwischen heftig im Wind bewegten, und sagte: »Hoffentlich schaffen sie es noch. Gut möglich, dass es schon zu spät ist.«
Markou schaute verdutzt von der Ärztin zu seinem Cousin, der auf der Treppe saß.
»Bei Windstärken über acht oder neun kommt kein Schiff oder Hubschrauber mehr auf die Insel«, bestätigte ihm Mike. »Anders ausgedrückt: Dann ist Nissos von der Welt abgeschnitten.« Er drückte seine Zigarette auf einer Steinstufe aus und fügte hinzu: »Das kommt zu dieser Jahreszeit relativ oft vor.«
»Und bei einem medizinischen Notfall?«, fragte Markou, worauf Mike und die Ärztin fast im Chor antworteten: »Die werden mit einem Boot in die Türkei gebracht. Übers Meer sind das nur ein paar Meilen.«
Markou wollte ein potentielles Mordopfer auf keinen Fall an die türkische Küste bringen. »Dann beeilen wir uns lieber«, sagte er mit einem Blick auf die Leiche.
»Der Hubschrauberlandeplatz ist gleich neben der Krankenstation«, sagte die Ärztin. »Und der Krankenwagen steht am Kreisverkehr bei den Windmühlen«, fügte sie zu Markous Überraschung hinzu.
Doch dann fiel ihm ein, dass kein Auto durch Choras enge Gassen passte, in denen nicht einmal drei Leute nebeneinander gehen konnten. Folglich musste die Leiche zum Kreisverkehr getragen werden. Er war zwar nicht weit von Mariama Milandis Haus entfernt, höchstens zweihundertfünfzig Meter den Hügel hinunter, aber ihm bereitete etwas ganz anderes Sorgen.
Diese kleinen praktischen Probleme, über die er sich sonst nie Gedanken machen musste, erschienen ihm jetzt fast unlösbar: Wie sollten sie die Leiche aus ihrem nassen Grab heben? Wie sollten sie sie wegbringen, ohne wichtige Beweise unbrauchbar zu machen oder ganz zu zerstören? Wie sollten sie die Tote zum Krankenwagen tragen?
Auf Markous Frage, ob sie einen Leichensack mitgebracht hätte, antwortete die Ärztin: »So etwas haben wir in der Krankenstation nicht.« Und ohne auf seine Antwort zu warten, fügte sie hinzu: »Wir haben nicht mal genügend Verbandmaterial oder Tetanusimpfstoff. Und der Krankenwagen wurde uns erst vor zwei Jahren gespendet, von einer von der Insel stammenden Reederfamilie.«
Aber die Ärztin ließ sich von Markous besorgter Miene nicht entmutigen. »Irgendwie kriegen wir das schon hin«, erklärte sie zuversichtlich.
Dann fragte sie die Gastgeberin auf Englisch mit starkem griechischen Akzent, ob sie ein paar Müllsäcke im Haus hätte.
»Das müsste gehen«, sagte Markou, als Mariama Milandi die Treppe zur Küche hochging. Die kleinen Plastiktüten, mit denen sie kurz darauf zurückkam, machten jedoch seine Hoffnungen wieder zunichte.
Mit den abfalleimergroßen Mülltüten in der Hand kehrte Mariama an die Seite ihrer Tochter zurück. Statt Müdigkeit und Langeweile lag jetzt Neugier in Sophies Gesicht. Mit großen Augen sog das Mädchen wie ein Schwamm alles um sich herum auf.
Ihre Mutter hatte sie zwar schon dreimal ins Bett geschickt, aber sie war immer wieder zurückgekommen, zuerst noch auf Zehenspitzen, doch das letzte Mal ganz unverhohlen.
»Ich kann nicht schlafen«, sagte sie. »Ich will bei dir bleiben.«
Nach ein paar Sekunden des Schweigens zog Sophie ihre Mutter plötzlich ein Stück beiseite. Sie flüsterte ihr etwas ins Ohr und deutete auf eine der Schlafzimmertüren.
Zuerst sah Mariama ihre Tochter skeptisch an, doch dann nickte sie zustimmend und wandte sich der Ärztin und Markou zu.
»Sophie hat eine Idee.«
Valentino
Eine halbe Stunde später lag Lucy Davis’ Leiche in einem zwei Meter langen und achtzig Zentimeter breiten cremefarbenen Plastiksack mit Reißverschluss in der Mitte. Hätte auf seiner Rückseite nicht in riesigen roten Buchstaben VALENTINO gestanden, hätte sich die für Kleider gedachte Hülle kaum von einem richtigen Leichensack unterschieden.
»Wie passend«, hatte die Gastgeberin mehr zu sich selbst gemurmelt. Auf Sophies Vorschlag hin stellte sie Markou die Hülle ihres Hochzeitskleids zur Verfügung, das seit ihrer Heirat im Rathaus von Nissos vor elf Jahren im Schrank hing.
Markou vermutete, dass ihr »Wie passend« damit zusammenhing, dass ihre Ehe genau wie Lucy Davis »tot« war. Mike hatte ihm erzählt, dass sich Milandi vor zwei Jahren von ihrem Mann hatte scheiden lassen.
Ein Problem war also gelöst, doch ihre Improvisationskünste waren weiterhin gefragt. An einem Tatort sollten keine Spuren vernichtet werden. Angesichts der besonderen Umstände in diesem Fall mussten sie jedoch Kompromisse eingehen und vielmehr versuchen, so wenige wie möglich zu vernichten. Wind hin oder her, das Team der Mordermittlung aus Athen würde es auf keinen Fall rechtzeitig nach Nissos schaffen. Deshalb brauchte Markou mehr praktische Lösungen im Valentino-Stil.
Er trug dem jungen Kadetten auf, mit einer leeren Plastikflasche so viel Flüssigkeit wie möglich aus der Abstellkammer zu schöpfen und sie durch ein Küchensieb in die Plastikeimer zu leeren, die ihm Mariama Milandi gerade brachte. Wenig später klopfte Maroulas alles, was sich im Sieb gefangen hatte, in sterilisierte Plastiktüten, die ihnen die Ärztin zur Verfügung stellte.
Durch diese unorthodoxen Methoden riskierten sie nicht nur, ihre Funde zu verfälschen, sondern auch, genetisches Material zu vermengen und den Tatort aktiv zu kontaminieren.
Aber wie heißt es so schön? Not macht erfinderisch. Und unter den gegebenen Umständen hatten sie keine andere Wahl. Das Wasser sickerte bereits langsam, aber unaufhaltsam durch Ritzen im alten Steinfußboden in den Untergrund. Bei diesem Tempo und der zu erwartenden morgendlichen Hitze würde der Boden rasch trocknen.
Es wäre zum Schießen, dachte Markou, wenn es nicht so schrecklich wäre. Die Ärztin, die neben dem Valentino-Sack stand, sagte seufzend: »Wir haben noch ein Problem.«
»Das ist ja ganz was Neues«, bemerkte Markou. Doch seine Ironie traf keinen Nerv.
»Wo sollen wir die Leiche lagern, bis sie nach Rhodos gebracht werden kann? In der Krankenstation haben wir nur eine Kühlkammer, und die ist bereits belegt«, erklärte sie Mike. »Von Antigone, der Stammlerin. Sie wird morgen früh beerdigt. Aber bis dahin haben wir keine Möglichkeit, die Leiche zu kühlen. Und selbst wenn es der Hubschrauber in den nächsten Stunden auf die Insel schafft, können wir sie bei dieser Hitze nicht einfach offen herumliegen lassen.«
Mike, der immer noch auf der Treppe hockte, sprang auf und sah seinen Cousin fragend an. »Bei Mitsenas vielleicht?«
Bevor Markou fragen konnte »Wer zum Teufel ist Mitsenas?«, nickte die Ärztin bereits. »Gute Idee.«





























