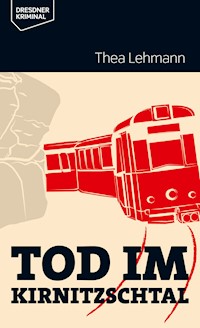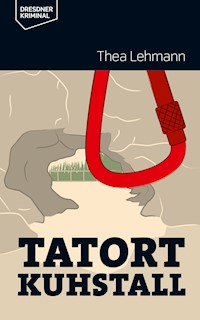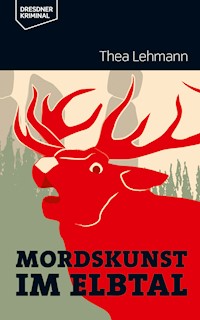
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Saxo-Phon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf den Fersen eines Kunstschmuggelrings. Die tote junge Frau vom Bad Schandauer Bahnhof lässt Kommissar Reisinger keine Ruhe. Er taucht tief in die sächsische Kunstszene ein und erlebt, welch dunkle Begierden sie entfachen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thea Lehmann
MORDSKUNST
IM ELBTAL
Die Autorin
Thea Lehmann ist geboren und aufgewachsen am Ammersee in Oberbayern. Das Schreiben hat sie schon früh fasziniert, deshalb wurde sie nach dem Germanistikstudium Journalistin. 1998 verliebte sie sich in einen Sachsen und tauchte damit in eine völlig neue Welt ein: die sächsische Seele, die besondere Landschaft, die liebenswerte Sprache und eine Familiengeschichte, die eng mit dem Kirnitzschtal verbunden ist. Heute lebt sie mit Mann und Kind in der Nähe von München, verbringt aber so viel Zeit wie möglich in der Sächsischen Schweiz.
Impressum
© DDV EDITION
Sächsische Zeitung GmbH
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
www.ddv-edition.de
© Reihengestaltung und Umschlagillustration
www.oe-grafik.de
2. Auflage, April 2020
Autorin: Thea Lehmann
Grafische Gestaltung: Thomas Walther, BBK
Satz: Ö GRAFIK agentur für marketing und design
Druck: Graspo
Alle Rechte vorbehalten | Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-943444-66-7 (Print)ISBN 978-3-948916-08-4 (Epub)ISBN 978-3-948916-09-1 (Mobi)
Thea Lehmann
MORDSKUNST
IM ELBTAL
Links: Ausschnitt aus der Wanderkarte
Großer Zschand 1:10000 von Dr.-Ing. Rolf Böhm, Bad Schandau
www.boehmwanderkarten.de
Freitag
Leo Reisinger blieb die Luft weg. Einen kurzen Moment war er unaufmerksam gewesen. Als Gundi ihren massigen Körper in Bewegung setzte, war es schon zu spät. In ihren schönen braunen, dicht umwimperten Augen hatte sich ein Abgrund aufgetan, in dem er nun zu versinken drohte. Wenn er nicht gleich wieder Luft bekam, würde er ohnmächtig werden. Leo stemmte sich mit aller Kraft gegen Gundi, aber die rückte keinen Millimeter zur Seite. Es war zu warm, und es stank erbärmlich. Was um Himmels Willen tat er hier eigentlich? Er könnte gemütlich zu Hause in Mammendorf bei Mutter und Oma am Frühstückstisch sitzen und sich umsorgen lassen – oder in Dresden mit seinen Kollegen in einem der kleinen Cafés in der Neustadt ein ausgedehntes Frühstück zu sich nehmen und die neuesten Fälle diskutieren. Stattdessen hatte ihn Veronika dazu verdonnert, ihr zu helfen, und diese Gundi war eben dabei, ihn umzubringen. Veronikas Schrei hörte er wie durch Watte, dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Seine Finger umklammerten die Computermaus, als müsse sie ihn vor dem Ertrinken retten. Raffael Gottlöber hatte zwei Buben und drei Neunen; kein schlechtes Blatt, aber ob es dreitausend Euro wert war? Er zögerte, sein Gebot abzugeben. Wenn er verlor, würde es verdammt knapp werden.
Da die elektrische Klingel an Gottlöbers kleiner Kunstgalerie schon lange nicht mehr funktionierte, waren die Besucher ziemlich genervt, als sie endlich begannen, gegen die Glastür zu klopfen. Entsprechend unfreundlich fiel das Geräusch aus. Gottlöber, nichts Gutes ahnend, wollte sich nicht stören lassen. An der Tür hing schon seit längerem ein »Geschlossen«-Schild. Er spähte von seinem Hinterzimmer, das gleichzeitig seine Wohnung und sein Arbeitszimmer war, nach vorn in den Laden.
Vor seiner Tür standen zwei Männer. Einer war groß und quadratisch, mit dichtem Haar und buschigen Augenbrauen, der andere eher zierlich und dünn, mit einer ausgeprägten Stirnglatze. Die beiden hatten es schnell satt, an die Tür zu klopfen, und verschwanden. Gottlöber setzte sich erleichtert wieder vor seinen Bildschirm und wog nochmals seine Chancen ab.
Gerade als sein Zeigefinger zum entscheidenden Klick ansetzte, machte es einen mächtigen Rumms und die Eingangstür zum Treppenhaus flog auf. Der größere der beiden Männer hatte sich dagegen geworfen. Augenblicklich standen sie in seinem Zimmer. Raffael Gottlöber sprang erschrocken von seinem Stuhl auf. Schützend hielt er die Hände vor seinen Körper.
»Warum machen nicht auf, wenn klopfen?« Der kleinere der beiden Männer sprach ihn an. »Ist billiger als Türe reparieren.« Er klang wie ein Russe aus einem schlechten Film.
»Was wollen Sie?« Gottlöber versuchte nun, einen souveränen Eindruck zu machen: »Sie können hier nicht einfach eindringen. Ich hole die Polizei!«
Die beiden Männer in grünen Militärjacken waren ein eingespieltes Team. Der Wuchtige hatte, soweit es das kaputte Schloss zuließ, die Tür hinter sich zugedrückt und warf nun prüfende Blicke in das kleine Zimmer, den Laden und die Küche. Der Schmächtige baute sich vor ihm auf.
»Paul Henschel bekommt dreitausend Euro von dir, Gottlöber.« Er hielt ihm einen unterschriebenen Schuldschein vor die Nase. Gottlöber kannte das Papier. Es war fleckig und zerknittert, aber seine Unterschrift war eindeutig zu erkennen. Er hatte den Zettel vor fünf Wochen unterschrieben. Die erwartete Glückssträhne war ausgeblieben, aber er hatte einfach nicht aufhören können. Dieser Paul Henschel war neu in der Gruppe der Spieler gewesen. Gottlöber hatte insgeheim gehofft, dass er den Schuldschein einfach vergessen würde.
»Ich habe gerade kein Geld da«, stammelte er. »Sagen Sie ihm, ich überweise es morgen.« Er schluckte, obwohl sein Mund trocken war.
Der schmächtige Russe, der bis zu diesem Moment noch recht umgänglich gewirkt hatte, hielt plötzlich ein Springmesser in der Hand. Hinter Gottlöber baute sich sein grobschlächtiger Kollege auf, umklammerte ihn mit beiden Armen und hob ihn in die Luft. Wie eine Puppe, unfähig, seine Arme zu befreien, hing er in dieser Umarmung. Mit den beiden war nicht zu spaßen, spätestens jetzt war das auch Raffael Gottlöber klar. Er keuchte ein leises »Bitte«.
»Bitte was?«, nahm der Kleine das Wort auf. Dabei führte er die Messerspitze des Springmessers langsam vor Gottlöbers Gesicht hin und her. In seinem Mund blitzten zwei Goldzähne und ließen sein Lächeln noch irritierender erscheinen.
»Bitte, tun Sie mir nichts«, stieß Gottlöber hervor. »Ich gebe Ihnen, was ich habe, aber so viel Bargeld ist nicht im Haus.«
Nach einem Wink ließ der große Russe ihn los. Gottlöber strauchelte, als er wieder Boden unter den Füßen hatte.
»Los!«, befahl der Wortführer. »Wo ist das Geld?« Sein weicher Singsang von vorhin hatte sich in einen schroffen Befehlston verwandelt.
Gottlöber schlurfte resigniert zum Schreibtisch und holte seine Geldbörse aus der Schublade. Sie enthielt genau zweihundertfünfundsiebzig Euro in Scheinen. Der Russe sah ihn interessiert an.
»Wo ist der Rest?«
Gottlöber zuckte müde mit den Schultern.
»Mehr habe ich nicht.« Um das zu unterstreichen, zog er das Futter seiner Hosentaschen heraus. Außer ein wenig Dreck kam nichts zum Vorschein. Er hoffte, die beiden würden verschwinden. Sein Computer stand auf dem Tisch. Er hatte noch nicht geboten. Wenn er nicht bald weitermachte, war er raus.
»Sagen Sie Henschel, ich überweise das Geld morgen.«
Der schmächtige Russe gab seinem Kollegen ein kurzes Zeichen, dann begann dieser in Seelenruhe Gottlöbers Computer auszuschalten und auseinanderzunehmen. Erst trennte er die Tastatur, dann den Bildschirm vom Rechner.
»Halt, das geht nicht, Sie können doch nicht meinen Computer …« Der Große war sofort bei ihm und rammte ihm die Faust in den Magen. Gottlöber ging in die Knie und keuchte. Der Schmerz tobte wie ein wild gewordenes Frettchen in seinen Eingeweiden.
»Doch, wir können«, antwortete der andere. »Wir nehmen mit, was man zu Geld machen kann. Wenn du die dreitausend Euro bezahlt hast, bekommst du es wieder.« Gottlöber hatte das Gefühl, in einem Alptraum zu stecken. So etwas gab es doch nicht in Deutschland. Russische Geldeintreiber, die vor nichts zurückschreckten? In was für eine Situation war er da geraten? Nur wegen ein paar Tausend Euro Spielschulden? Der Schmerz in seinem Bauch beruhigte sich etwas.
»Aber das dürfen Sie nicht!«, stöhnte er. »Das ist Körperverletzung und Raub, das können Sie nicht machen!«
»Nicht?« Zwei Goldzähne blitzten aus einem süffisanten Grinsen.
Auf seinen Wink hin holte der große Kerl nochmals aus und verpasste Gottlöber einen Hieb an die Schläfe. Er wurde ohnmächtig.
Als Gottlöber wieder aufwachte, sahen sein Laden, sein Zimmer und die kleine Küche dahinter aus wie nach einem Erdbeben: Alles, was er besaß, war aus dem Schrank und den Schubläden gerissen. Im Laden fehlten seine zwei barocken Sessel und der Samowar. Seine Bilder lagen am Boden neben den beiden Staffeleien. Im Materialschrank hatten sie ebenfalls gewütet, allerdings waren die Spezial-Tinte und das alte Papier unversehrt. Einige zerbrochene Flaschen verbreiteten einen intensiven Geruch nach verschiedenen Lösungsmitteln. Gottlöber bückte sich, um die unversehrten Exemplare wieder zuzustöpseln und wenigstens die letzten Reste zu bewahren. Sein Kopf schmerzte höllisch. Er tappte in die Küche, wo er feststellen musste, dass die beiden auch seine Kaffeemaschine hatten mitgehen lassen. Entnervt suchte er in dem Hängeschrank über der Spüle nach Kopfschmerztabletten und fand die Packung. Mit einer Tasse Wasser spülte er die Tablette herunter. Vorsichtig betastete er seine vor Schmerz pulsierende Schläfe, während er in sein Bad schlurfte, das eigentlich nur ein langer, schmaler Schlauch war – mit einer winzigen Dusche am Ende, einer schräg eingebauten Toilette und einem kleinen Waschbecken. Aus dem fleckigen Spiegel sah ihn ein Mann mit blutverkrusteter Schläfe und einer Platzwunde an der rechten Augenbraue an. Vorsichtig wusch er sich das Gesicht und tupfte die Haut mit dem Handtuch trocken.
»Schon besser!«, sagte Gottlöber zu sich selbst und versuchte ein aufmunterndes Lächeln. »Das Schlimmste hast du hinter dir!« Dann stieg er auf den Rand der Toilette und fasste mit der Hand in den altmodischen, weit oben angebrachten Spülkasten, um sich zu vergewissern, dass sein Notgroschen noch da war.
Aber seine Hand griff ins Leere. Gottlöber keuchte entsetzt auf. Das war sein letztes Geld gewesen! Seine eiserne Ration, die letzten zweitausend Euro, die ihn in den vergangenen zwei Jahren immer vor dem endgültigen Absturz bewahrt hatten. Er fischte verzweifelt in dem Wasserkasten, riss dabei den Stöpsel heraus, so dass die Spülung zu seinen Füßen durch die Kloschüssel rauschte. Das Wasserbecken war leer, nur das Gestänge für den Spülmechanismus war zu ertasten. Gottlöber konnte nicht fassen, dass sie sein Versteck gefunden hatten. Er war am Ende.
Kraftlos stieg er von der Toilette herunter und setzte sich.
Sollte er zur Polizei gehen? Gottlöber verwarf den Gedanken. Er hatte zu viele Probleme, um sich an die Polizei wenden zu können. Den Schaden würden die ihm ohnehin nicht ersetzen und Geld würden sie ihm auch keines geben.
Wen konnte er um Geld anpumpen? In Gedanken ging er seinen Bekanntenkreis durch. Leider hatte er von den meisten schon einen Kredit bekommen und bei den wenigsten hatte er auch nur den Versuch unternommen, einen Teil der Summe zurückzuzahlen. Seine Lage war aussichtslos. Er hatte absolut nichts mehr. Spielen war nicht möglich. Ohne Bargeld kam er nicht mehr in die einschlägigen Clubs. Internet-Poker konnte er ohne einen Computer ebenfalls nicht spielen. Er würde Geld verdienen müssen. Diese Erkenntnis kam genauso schleichend wie logisch. Er musste zu Anastasia und sich Arbeit besorgen. Vielleicht würde sie sogar einen kleinen Vorschuss herausrücken, damit er wenigstens das Nötigste würde kaufen können. Bier, eine neue Kaffeemaschine, Lebensmittel.
Apropos: Es war später Nachmittag und er hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen. Mühsam erhob sich Raffael Gottlöber und schlurfte zum Kühlschrank. »Mistkerle!«, schimpfte er, als er ihn öffnete. Das Bier war ebenfalls verschwunden. Außer einem alten Käse, einer Flasche Ketchup und einer Packung Toast war nichts mehr drin. Ärgerlich warf er die Kühlschranktür wieder zu.
Er brauchte jetzt ein Bier. Nachdem sie ihm wenigstens das Münzgeld in seiner Brieftasche gelassen hatten, ging er die drei Straßen hinüber zum Konsum, um sich zwei Flaschen Bier und ein belegtes Brötchen zu kaufen.
Jetzt war er noch im Besitz von zehn Cent. Gottlöber konnte sich nicht daran erinnern, jemals so abgebrannt gewesen zu sein. Seit er denken konnte, war er knapp bei Kasse gewesen. Nur in den drei Jahren nach der Hochschule, da hatte es mal ein wenig besser ausgesehen. Obwohl er immer wieder eine Glückssträhne gehabt hatte, war er beim Poker unterm Strich doch nie als großer Sieger vom Tisch gegangen. Meistens hatte er verloren, verloren, verloren. An den wenigen guten Tagen, an denen er tatsächlich mit mehr Geld nach Hause gekommen war, hatte er den Gewinn sofort in die nächste Chance gesteckt.
Strom, Miete, die alltäglichen Dinge des Lebens, die hatte er früher vom Erlös seiner Zeichnungen oder von seiner Arbeit als Restaurator bezahlt. Doch wann er sein letztes Bild verkauft hatte, daran konnte er sich kaum noch erinnern. Aufträge für die Restaurierung von Gemälden waren auch schon lange nicht mehr gekommen. Das war nicht verwunderlich. Wer sollte seinen Laden in einem verwahrlosten Hinterhof der Dresdner Neustadt schon finden?
Seit einiger Zeit lebte er vor allem von seiner Arbeit bei Anastasia.
Zurück in seinen vier Wänden, begann er das Chaos aufzuräumen. Er schob das Eisengitter beiseite und öffnete die gläserne Ladentür, um frische Luft einzulassen. Der April fegte mit einem frischen Wind in den muffigen Raum und nahm die Gerüche der Lösungsmittel und ein wenig Staub mit. Als Gottlöber ins Freie trat, sah er nicht den kleinen, schäbigen Laden, sondern das stolze Geschäft, das er hier vor acht Jahren voller Hoffnung eröffnet hatte. Damals waren die Scheiben sauber und die Schrift am Fenster noch makellos gewesen: »Raffael Gottlöber, Zeichner und Restaurator«. Seine Grafiken waren mehrmals in Galerien ausgestellt und einmal sogar mit einem Kunstpreis ausgezeichnet worden. Aber mit fast allen Galeristen hatte er sich überworfen, weil sie keinen Vorschuss herausrücken wollten. Immer wieder war ihm seine Geldknappheit in die Quere gekommen. Er hatte vom Restaurieren aber ganz gut gelebt, bis zu dem Zeitpunkt, von dem an sich das Poker-Spiel wie wucherndes Unkraut in seinem Leben ausbreitete. Seit drei Jahren hatte er sich nicht mehr im Griff. Gottlöber wusste das. Er hatte manchmal Angst vor sich selbst, vor seiner Gier zu spielen, davor, bis zum letzten Blutstropfen alles in die Karten zu stecken. Aber er konnte einfach nicht aufhören. Zu unwiderstehlich war das Gefühl, wenn er gewann. Dann sprudelten kleine goldene Schauer durch seine Adern, er fühlte sich wie ein Gott, unbesiegbar.
Seit zwei Jahren wohnte er in den beiden kleinen Räumen hinter dem Laden. Der Platz reichte für Bett, Computer, Küchentisch und Kühlschrank. Sehr viel mehr hatte er aus seiner Wohnung nicht hierher retten können. Außer den beiden barocken Sesseln, die damals niemand hatte kaufen wollen. Doch die waren nun auch verschwunden.
Als sein kleines Reich wieder halbwegs aufgeräumt war, sprang ihn die Leere auf dem Schreibtisch schmerzlich an. Sein Computer fehlte ihm mehr als alles andere. Wo bekam er Ersatz her? Ein neues Gerät würde ihn um die tausend Euro und eine Menge Arbeit kosten. Es war kurz vor neunzehn Uhr, draußen dämmerte es bereits. Raffael Gottlöber zog sich seine Jacke über und machte sich auf den Weg zu Anastasia. Wenn er irgendwo schnelles Geld für Arbeit bekam, dann bei ihr.
Katie drückte sich die Nase am Fenster platt, als der Zug, von Berlin kommend, über die eiserne Marienbrücke hinüber ins Zentrum fuhr. Das berühmte barocke Panorama von Dresden tat sich vor ihr auf: der Turm der Hofkirche, die gefaltete Kuppel der Kunstakademie, die glocken-förmige Frauenkirche, dazu die Augustusbrücke, die die Residenz mit der Dresdner Neustadt verband. Sie hätte zu gern das Fenster geöffnet, um die Stadt zu riechen, aber in diesem modernen Zug war nicht vorgesehen, dass neugierige Reisende ihre Nase in den Wind hielten. Das japanische Pärchen neben ihr hing ebenfalls an der großen Panoramascheibe und warf sich, beständig nickend, unverständliche Worte zu. Sie erhaschte noch einen Blick auf ein malerisches Palais an der linken Uferseite; wenig später fuhr der Zug in die lichte Bahnhofshalle ein. Sie war endlich in Dresden! Das hatte sie sehen wollen, dafür war sie nach Deutschland gekommen.
»Onkel Jakob«, rief sie theatralisch und mit deutlich amerikanischem Akzent, »das ist für dich!« Sie warf ein paar Kusshändchen Richtung Himmel und packte ihren Rucksack, ihren Gitarrenkoffer und den vollgestopften Turnbeutel zusammen. Der Zug kam schon zum Halten, und Katie reihte sich mit den anderen Reisenden in die Schlange zum Ausgang.
Sie hatte ein Zimmer in einem billigen, kleinen Hotel in der Neustadt gebucht, zunächst für drei Tage, dann würde sie weitersehen. Voller Tatendrang marschierte sie vom Bahnhof die Prager Straße hinunter Richtung Elbe. Dass die Prager Straße keine Straße, sondern eine schnurgerade, breite Fußgängerzone war, überraschte sie. Eigentlich hatte sie erwartet, ganz Deutschland sehe aus wie ein bewohntes Museum. Schließlich war hier alles viel älter als zu Hause in Minnesota. Deutschland hatte eine mehrtausendjährige Geschichte, und in ihrer Fantasie war es übersät gewesen mit alten Burgen, Schlössern und uralten, wackeligen Häusern. Die Prager Straße mit der modernen Bebauung entsprach diesem Bild so gar nicht, wie auch die meisten Ecken in Berlin nicht so ausgesehen hatten, wie sie das erwartet hatte. Aber Katie war optimistisch. Sie würde das Dresden und das Deutschland ihres Großonkels schon noch finden. Trübsal zu blasen war völlig gegen ihre Natur. In den fünfundzwanzig Jahren ihres jungen Lebens hatte sie nur selten geweint. Weinen war, das hatte sie schnell gelernt, nicht geeignet, das Leben zu erleichtern. Lachen dagegen schon. Also war sie ein fröhliches Kind gewesen, das alle geliebt und gern um sich gehabt hatten.
Als sie über den Altmarkt lief, versöhnte sie sich mit Dresden. Sie hatte die Kuppel der Frauenkirche wiederentdeckt und strebte hinüber zu dem alten, ehrwürdigen Kirchenrund, das ihr von dem Bild in Onkel Jakobs Wohnzimmer so vertraut war.
»Wonderful!« Katie stand vor der Luther-Statue und drehte sich im Kreis, um die Atmosphäre des Neumarktes, des Platzes vor der Frauenkirche, aufzunehmen. Eigentlich wollte sie gleich weiterziehen, zum Zwinger, zur Hofkirche, all die schönen alten Gebäude bewundern, aber sie war bepackt wie ein Lastesel. Die Gurte des Rucksacks zogen schwer an ihren Schultern, und sie beschloss, zur Abwechslung nicht spontan zu sein, sondern erst im Hotel einzuchecken. Auf der Augustusbrücke zupfte ein leichtsinniger Wind an ihren Haaren und an ihrem sperrigen Gitarrenkoffer. Katie stemmte sich lachend dagegen und drehte sich nochmals um. Ja, genau dieses Panorama kannte sie von Onkel Jakobs Bild. Eine kribbelige Freude rieselte durch ihren Körper. Es würde eine aufregende und wunderbare Zeit hier werden. Katie überquerte die Elbe, orientierte sich am Albertplatz in ihrem Stadtplan und fand nach zehn Minuten Fußmarsch in einer kleinen Seitenstraße ihr Hotel.
Sie mochte es auf Anhieb und beglückwünschte sich zu ihrer Wahl. Das Hotel war zwar nicht besonders schick eingerichtet, aber dafür billig, und es lag mitten in einem spannenden Viertel. Katie legte ihre Gitarre aufs Bett, warf ihren Rucksack in die Ecke und schickte gleich einige Fotos an ihre Mutter Mary.
Eine Kirchenglocke schlug zu Mittag, es blieb also reichlich Zeit, die Stadt zu erkunden.
Nachdem Veronika ihn mit zwei schallenden Ohrfeigen wieder aufgeweckt hatte, rappelte Leo sich mühsam auf. »Dieses Vieh ist lebensgefährlich«, stieß er mühsam hervor. »Das hat sie mit Absicht gemacht.«
»Ach Quatsch«, lachte Veronika. Sie stand in Gummistiefeln, Jeans und einem alten roten Sweatshirt vor ihm und sah nur ein bisschen besorgt aus. »Unsere Gundi ist eine ganz Liebe. Die gibt fünfundvierzig Liter Milch pro Tag.« Sie tätschelte Gundi, diesem Miststück, freundlich den Hals und reichte Leo die Hand, um ihm aus dem schmutzigen Stroh zu helfen. »Du wirst dich schon noch mit ihr anfreunden. Sobald wir den Hofladen haben, kennst du Korbinians Kühe alle mit Vornamen.«
Leo blinzelte und ließ sich wieder ins Stroh sinken. »Sobald wir was haben?« In seinem Kopf schalteten sich gleich mehrere Blaulichter ein. Die gequetschten Rippen spürte er kaum noch.
Veronika machte eine abwiegelnde Handbewegung. »Ach, das wollte ich dir heute Abend in aller Ruhe erzählen. Ich habe da Pläne, die dich begeistern werden. Aber jetzt steh erst mal auf!« Sie streckte ihm nochmals die Hand hin, um ihm aufzuhelfen. Gundi drehte sich um einhundertachtzig Grad, hob den Schwanz und ließ einen Haufen fallen. Der Gestank im Stall wurde noch beißender. Leo ignorierte die Hand und zog sich alleine hoch. »Was für Pläne, Veronika?«
Sie wandte sich ab und schnappte sich die Mistgabel. »Das können wir doch heute Abend besprechen. Willst du dich nach dem Schreck vielleicht ein bisschen ausruhen?«
Leo hielt sie am Arm fest und zwang sie, ihn anzusehen. »Was?«
Veronika hielt kurz inne, stellte die Mistgabel an der Wand ab und schaute ihn an. »Mein Bruder Korbinian stellt den Hof ja nun auf Bio um. Wir haben uns gedacht, dass es ein gutes Geschäft wäre, einen Hofladen zu eröffnen. Wir könnten unser Biofleisch, Kartoffeln, Getreide, Eier und so weiter direkt hier an die Kunden verkaufen. Ich würde meinen Job bei der Bank aufgeben und erst mal anfangen. Wenn es gut läuft, könntest du später auch einsteigen und zum Beispiel Käse produzieren oder wozu du sonst eben Lust hast.« Ihre Augen blitzten vor Freude.
Leo starrte sie an.
»Käse?«
Veronika redete weiter, sie war jetzt voll in ihrem Element.
»Bio ist total im Kommen. Ehrlich, ich habe mir die Zahlen angesehen. Die Aussichten sind sehr gut. Den Laden richten wir in der ehemaligen Scheune ein. Die Pläne sind schon genehmigt. Später können wir noch einen Metzger einstellen und in die Wurstproduktion investieren. Die Leute wollen wissen, was sie auf dem Teller haben. Dafür bezahlen sie gut. Ich habe mir auch überlegt, ein paar Schafe und Ziegen dazu zu nehmen, um das Sortiment zu erweitern. Mama würde Marmelade kochen und ich könnte mit Biogetreide Brot und Kuchen backen. Wäre das nicht wunderbar?«
Leo schaute sie ungläubig an. Sie trug ihre kurzen dunklen Haare unter einem grünen Kopftuch, es schauten nur ein paar kleine Strähnen an den Ohren heraus. Die Jeans und die Fleece-Jacke, die sie trug, waren alt und zerschlissen. Einige Heuhalme hingen an ihren Ärmeln und bewegten sich mit ihren Gesten sanft hin und her. Deshalb also hatte sie ihn in den letzten Tagen immer wieder auf das Potenzial von Bio hingewiesen, ihn nach Fürstenfeldbruck in den neuen Bio-Markt geschleppt und die Scheune mit ihm inspiziert. Er hatte gedacht, dass Veronika sich für ihren Bruder Korbinian mit dem Thema vertraut machte. Plötzlich hatte Leo das Gefühl, seine Freundin gar nicht richtig zu kennen.
»Ich wollte ja nie von hier weg, und wenn ich die Chance habe, hier daheim zu arbeiten, werde ich sie nutzen. Dann sind wir wieder alle zusammen! Und in zwei, drei Jahren bauen wir auf dem Grundstück hinter dem Stall unser Haus und unsere Kinder können hier in der Natur in einer richtigen Großfamilie aufwachsen. Na, was sagst du?«
Veronikas Augen glänzten vor Begeisterung. Sie sah Leo erwartungsvoll an und stützte sich auf die Mistgabel.
Warum dachten eigentlich alle Frauen, die ihm nahestanden, dass sie besser als er selbst wüssten, was gut für ihn war? Früher hätte er jetzt wahrscheinlich eingelenkt.
»Guter Plan«, sagte Leo trocken. »Aber ohne mich. Ich bin kein Biobauer und will auch keiner werden. Du solltest mit mir reden, bevor du solche Zukunftspläne machst. Ich werde ganz sicher nicht hierher ziehen und mit dir einen Hofladen aufmachen.« Er klopfte sich ärgerlich das Stroh von dem alten Pullover, den ihm Veronika für die Stallarbeit gegeben hatte.
»Aber …« Veronika sah ihn erschrocken an. »Ich dachte immer, dass es dir hier gefällt, bei mir, bei uns. Du magst doch meine Eltern und meinen Bruder und seine Familie.«
»Natürlich mag ich sie. Aber ich mag auch meinen Beruf, und mir gefällt es ausnehmend gut in Dresden. Ich finde, du solltest statt dessen mal ein paar Jahre was anderes sehen und zu mir ziehen.«
Veronika sah ihn völlig entgeistert an. Resolut rammte sie die Mistgabel ins Stroh. »Ich bin hier verwurzelt wie ein Baum. Entweder du akzeptierst das oder wir gehen getrennte Wege!« Sie drehte sich um und ging mit energischen Schritten davon.
Leo Reisinger stand da wie ein zu spät gekommener Erstklässler. Was für ein Tag! Erst versuchte diese blöde Kuh Gundi ihn umzubringen, indem sie ihn an die Stallwand quetschte. Und nun stellte Veronika ihre Beziehung infrage, nachdem er sich ihr zuliebe tagelang auf dem Biohof ihres Bruders geschunden hatte. Eine tolle Urlaubswoche war das gewesen! Morgens halb sechs aufstehen, Kühe melken, Hühner füttern, Stall ausmisten und all die anderen Arbeiten, die auf einem Hof anfielen. Abends waren sie todmüde ins Bett gefallen und er hatte sich nicht nur einmal gefragt, warum er sich das antat. Allerdings: Wenn er in Veronikas glückliches Gesicht gesehen hatte, hatte er es wieder gewusst. Eine Woche war nun aber definitiv genug. Das würde er ganz sicher nicht den Rest seines Lebens machen.
Er stand immer noch konsterniert in Gundis Stall. Sie schaute ihn aus ihren dunklen Augen interessiert an. Kühe hatten es gut. Fressen, Milch produzieren, fressen, gemolken werden, schlafen. Sehr viel mehr passierte nicht in ihrem Leben. Er sehnte sich nach seinem Büro in der Dresdner Schießgasse und nach seinen Kollegen. Er wünschte sich fast, dass ein Notfall eintreten und die Kollegen ihn anrufen und aus dem Urlaub holen würden. Dieser Bauernhof war definitiv nicht sein Revier.
»Oh Mist, wo ist mein weißes Hemd?« Olli wühlte kopflos in seinem gepackten Koffer. Sandra sah ihm vom Wohnzimmer aus zu. Eigentlich wollte sie sich da nicht einmischen. Das war seine Reise, sein Koffer, das ging sie alles nichts an.
»Sandra, hilfst du mir bitte suchen? Ich brauche unbedingt dieses weiße Hemd. Wir haben gleich morgen ein großes Abendessen mit den obersten Chefs und den Marketing- und Produktmanagern. Da muss ich mit Anzug und Krawatte erscheinen, und dafür brauche ich mein gutes Hemd!«
Sandra Kruse bewegte sich keinen Zentimeter. Ihr Freund würde sie drei Wochen in Dresden alleinlassen. International Sales Meeting, Key Account Management – Olli hatte ihr in den letzten Wochen die englischen Fachbegriffe nur so um die Ohren gefetzt, und sie hatte erkennen müssen, dass er so richtig Feuer gefangen hatte. Olli konnte es gar nicht erwarten, für drei Wochen nach Abu Dhabi zu fliegen. Nach Abu Dhabi! Welcher vernünftige Mensch wollte da schon freiwillig hin?
»Sandra, jetzt hilf mir doch bitte!«, kam es vom Schlafzimmer. »Ich muss in einer halben Stunde los zum Flughafen!«
Träge stand Sandra auf und schlenderte in den Flur.
»Vielleicht hängt es noch im Keller auf der Wäscheleine. Ich sehe mal nach«, sagte sie und griff sich den Wohnungsschlüssel.
»Auf der Wäscheleine?« In Ollis Stimme schwang Panik mit. »Ich brauche es gebügelt! Ich kann doch kein zerknittertes Hemd …«
Sandra zog die Wohnungstür hinter sich zu. Was für ein Aufstand wegen eines ollen Hemdes. Noch dazu eines Anzughemdes. Olli war immer der Naturbursche gewesen, einer, mit dem sie am Wochenende zum Klettern und Wandern in die Sächsische Schweiz fuhr. Dieses Lebenskonzept hatte sie perfektioniert und den gemeinsamen Haushalt auf vegetarische Kost und ökologisches Bewusstsein umgestellt. Das Auto blieb so gut wie ungenutzt in der Garage, beide fuhren mit dem Rad zur Arbeit. Außer mit Naturfarben gefärbte Baumwolle und Leinen kam ihr nichts mehr auf die Haut. Als sie Olli kennengelernt hatte, hatte er weder Krawatten noch Hemden besessen und ein Bügeleisen damals wahrscheinlich für ein Museumsstück gehalten. Und nun machte er diese Hundertachtzig-Grad-Wende, weil der neue Job angeblich so unglaublich interessant war.
Sie schloss den Waschkeller auf und nahm das Hemd von der Leine. Es war trocken. Sie hielt es gegen das Licht der Leuchtstoffröhren. Zum Glück war der Tomatenfleck endlich nicht mehr zu sehen. Ihre Versuche mit der Waschnuss und anderen ökologisch unbedenklichen Waschmitteln waren Fehlschläge gewesen, das musste sie sich eingestehen. Erst als sie wieder dieses phosphatverseuchte Zeug benutzt hatte, war der Fleck rausgegangen.
Sandras Blick streifte die Flasche auf ihrer Waschmaschine und sie stutzte. Als geübte Kriminalkommissarin war sie es gewohnt, auf kleinste Details zu achten. Deshalb war ihr völlig klar, dass die Flasche nicht mehr dort stand, wo sie sie am Donnerstagmorgen abgestellt hatte. Was war da los? Sie nahm die Flasche und stellte sie wieder an die Stelle, an die sie gehörte – vorn rechts ins Regal neben die Waschmittel der anderen Hausbewohner.
Die Flasche war zu leicht. »Also das …!« Sandra war empört. Jemand klaute ihr Waschmittel! Sie hatte Ollis Hemd gestern früh mit dem neu gekauften Waschmittel gewaschen, also genau eine Kappe der grünen Flüssigkeit verwendet. Jetzt war die Flasche halb leer. Ihr erster Impuls war, sie mit nach oben in die Wohnung zu nehmen. Dann wäre das Problem gelöst, sie müsste nur jedes Mal ihr Waschmittel rauf- und runtertragen. Aber dann würde sie nie erfahren, wer sie da beklaute. Sandras Augen waren zu Schlitzen zusammengezogen. Sie ließ die Flasche stehen und ritzte am Etikett mit dem Fingernagel beim aktuellen Füllstand deutlich eine Linie ein. Vielleicht hielt dieses sichtbare Zeichen den Missetäter ab.
Mit Ollis Hemd über den Arm ging sie wieder nach oben. Sie würde den Dieb entlarven, das war schließlich ihr Beruf.
Samstag
Ihr Streit war heftig gewesen. Leo warf seine Reisetasche auf die Rückbank seines VW und stieg ein, ohne sich noch mal umzudrehen. Ob sein Brustkorb wegen der gequetschten Rippe oder aus Enttäuschung schmerzte, konnte er nicht sagen. Langsam rollte er vom Hof. Veronika hatte ihm vorgeworfen, keine Rücksicht auf ihre Gefühle zu nehmen. Im letzten Oktober hatte sie drei Tage lang um sein Leben gebangt. Seither wollte sie ihn davon überzeugen, dass er sich einen neuen Beruf suchte. Das war einfach lächerlich! Immerhin hatte gestern eine Kuh versucht, ihn umzubringen. Das Leben auf einem Bauernhof war mindestens genauso gefährlich wie sein Leben als Kriminalkommissar. Er arbeitete gern bei der Kripo, er hatte sich diesen Job ausgesucht, und er würde auch Onkel Josef nicht enttäuschen, seinen Onkel, der ihn durch seine eigene Karriere als Polizist auf die Idee gebracht hatte, diesen Beruf zu ergreifen. Veronika verlangte eindeutig zu viel, oder nicht? Er hatte die Nase voll davon, dass ihm immer eine Frau sagte, was gut für ihn sei. Erst seine Mutter und seine Oma, dann Veronika. Sie hatten die halbe Nacht gestritten, es hatte keine zärtliche Versöhnung gegeben. Er hatte ein paar Stunden auf dem Sofa in Veronikas Wohnzimmer nach Schlaf gesucht und war ein paarmal eingenickt, aber am Morgen um halb sechs Uhr, als Veronika aufgestanden war, um in den Stall zu gehen, hatte ihn nichts mehr gehalten. Er war noch kurz bei seiner Mutter und Oma in Mammendorf vorbeigefahren und befand sich nun, einen Tag früher als geplant, auf dem Weg nach Dresden.
Mit jedem Kilometer, den er seiner Wahlheimat näherkam, fiel der nagende Ärger von ihm ab. Sein analytischer Verstand fand immer mehr gute Argumente für seine Entscheidung, nach Veronikas Drohung erst einmal auf Distanz zu gehen.
Samstagvormittag um halb elf Uhr. Konnte er da seine Kollegen anrufen? Leo probierte es.
»Sandra Kruse«, schallte es etwas verrauscht aus den Lautsprechern, als er auf die A72 Richtung Chemnitz abbog.
»Hallo Sandra, melde mich zurück zum Dienst. Habe die Nase voll vom Landleben«, rief er gegen die Windschutzscheibe.
»Na, was soll ich denn davon halten? Der Bayer hat Sehnsucht nach uns ollen Sachsen«, feixte sie ins Telefon. »Sei mal bloß froh, dass dein zukünftiger Schwager nur eine Woche verreist ist. Das nächste Mal darfst du wahrscheinlich Kälbchen auf die Welt helfen und Schweine schlachten.«
»Du glaubst gar nicht, wie Recht du hast«, grummelte Leo und berichtete von Veronikas Plänen, einen Hofladen zu eröffnen.
»Mensch, das klingt doch toll, so viel ökologisches Bewusstsein hätte ich ihr gar nicht zugetraut.«
»Sie will, dass ich meinen Beruf an den Nagel hänge und die Käseproduktion übernehme.«
Sandra ließ eine lange Pause, bevor sie antwortete:
»Manchmal muss man vielleicht genauer hinschauen, bevor man eine Idee verwirft. Ich mache mir bei so was immer Pro- und Contra-Listen. Am Ende hast du schwarz auf weiß, was dafür und was dagegen spricht.«
Leo schüttelte unwillig den Kopf. »Sandra, ich bin Kriminalkommissar geworden, weil ich das wollte. Keiner hat mich gezwungen. Ich mache das gern, und ich sehe viel Sinn darin, die Welt durch meine Arbeit ein wenig ins Gleichgewicht zu bringen. Ich werde nie, nie, nie in meinem Leben Käse produzieren und in einem Bioladen Dinkelkleie verkaufen!«
»Bingo. Ich sag Frau Kerschensteiner Bescheid, dass du ab morgen wieder verfügbar bist.« Sandra klang erleichtert. »Übrigens treffe ich Sascha morgen um zehn Uhr im Café Sperling zum Frühstück. Das ist gleich bei dir in der Nähe. Komm doch mit!«
Leo willigte gern ein. Das Café lag am oberen Ende der Alaunstraße, höchstens zehn Minuten von seiner Wohnung entfernt. Normalerweise war er nicht sehr erpicht darauf, seine engsten Kollegen auch noch am Wochenende zu treffen, aber nachdem er nun eine Woche Urlaub gehabt hatte, sehnte er sich förmlich nach Sandras schnippischer Art und Saschas ausgleichender Gemütlichkeit. Knapp zweihundert Kilometer trennten ihn noch von Dresden.
So viele alte Häuser auf einmal hatte Katie noch nie gesehen. Fasziniert wanderte sie durch die Fußgängerzone von Pirnas Innenstadt und bewunderte die barocken Hauseingänge mit den Sitzsteinen und die reich verzierten Torbögen. Manchmal erhaschte sie einen Blick in pittoreske Innenhöfe oder in ein uraltes Gewölbe. Die Sonne schien warm von einem blauen Frühlingshimmel, die Farben leuchteten im Licht und ein leichter Wind ließ die jungen Blätter in den Bäumen zittern. Immer wieder zückte sie ihr Smartphone, um für ihre Mutter zu Hause in Minneapolis ein Foto zu machen. Schließlich landete sie am Marktplatz, der allerdings großräumig abgesperrt war.
»Was ist hier los?«, fragte sie in ihrem holprigen Deutsch einen Passanten, der sehr merkwürdig, weil sehr altmodisch angezogen war. Trug man das in Deutschland auf dem Land? Samtjacken und Spitzenkragen? Katie wunderte sich.
»Nu, heute stellen wir den Ganaleddo nach«, sagte der Mann und eilte weiter. Katie kramte in ihrem deutschen Vokabular nach Ganaleddo, konnte aber nichts Derartiges finden. Dieses Wort hatte sie noch nie zuvor gehört. Was bedeutete es? Sie folgte dem Mann bis zur Absperrung, hinter der sich zahlreiche weitere altertümlich angezogene Menschen von einem Mann mit Megafon in die richtige Position bringen ließen. Katie ahnte, dass das Schauspieler waren, und schaute gebannt zu. Immer mehr Publikum bevölkerte den Platz und verfolgte die Inszenierung. Katie bewunderte inzwischen die alten Giebel, die verzierten Fensterrahmen und Türstöcke der Häuser am Marktplatz und das alte Rathaus, das wie ein Schiff im Meer mitten auf diesem großen Platz thronte. Ihr gegenüber reckte ein Haus ein sehr hohes, spitzes Dach mit Fensteröffnungen, die wie kleine Augen von der großen Schräge herabschauten, in den wolkenlosen Himmel. In dem Gebäude war, wie Katie erkannte, die Touristeninformation untergebracht. Ob sie sich dahin durchschlagen sollte, um zu erfahren, was hier los war?
Sie beschloss, linker Hand um das Rathaus herumzugehen, und drängelte sich durch die dichter werdende Menschenmenge hindurch zum Tourismusbüro.
Dort klärte eine Dame sie darüber auf, dass heute in Pirna der Canaletto-Blick inszeniert werde. Vor einigen Jahren habe ein Verein von Pirnaer Bürgern beschlossen, einmal im Jahr das berühmte Bild des italienischen Malers Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, nachzustellen. Sie zeigte Katie das Bild, das als Kopie im Eingangsbereich des Tourismusbüros hing. Katie war beeindruckt. Sehr viel hatte sich seit dem Jahr 1753, in dem es gemalt worden war, nicht verändert. Die Kirche, das Haus, in dem sie gerade stand, die Fassaden links gegenüber dem Rathaus – alles sah heute fast noch genauso aus wie auf dem Gemälde. In ihrem Heimatland war zu jener Zeit der Siebenjährige Krieg zwischen den beiden Kolonialmächten Frankreich und England ausgebrochen, die USA gab es noch gar nicht. Und hier stand sie vor Häusern, die schon alt waren, als Canaletto sie damals gemalt hatte! Katie drückte dankbar das Fotoalbum ihres Onkels an ihre Brust. »Onkel Jakob, wie schade, dass du das nicht mehr sehen kannst«, murmelte sie. Sie machte sich wieder auf den Weg auf die gegenüberliegende Seite des Platzes und reihte sich in die Zuschauer ein. Der Mann, der die Statisten auf ihre Plätze dirigierte, war offenbar zufrieden. Er lieh sich von Zuschauern noch einen Hund aus, den er neben den Brunnen platzierte, dann war die Inszenierung fertig und Hunderte von Fotoapparaten und Handys klickten, auch Katies.
Mit allen Sinnen nahm sie die barocke Idylle des Platzes in sich auf, die Menschen, diese Mauern, die schon so viel Geschichte erlebt hatten. Schließlich löste sich die Szene auf. Die Statisten begannen, sich wieder zu bewegen. Frauen mit langen Röcken und Hauben auf dem Kopf gingen ihres Weges, die zwei Reiter lenkten ihre Pferde in gemessenem Schritt vom Platz. Katie atmete tief durch und schlug das Fotoalbum von Onkel Jakob auf. Es zeigte zwar einige Ansichten von Pirna, aber keine vom Marktplatz. Sie konnte auf einem der kleinen Schwarz-Weiß-Fotos, die wohl um 1932 entstanden waren, ein sehr altes Haus erkennen. »Das Tetzelhaus« stand in für sie fast unleserlicher Schrift darunter.
Die nächste Station im Fotoalbum war das »Haus Bergkaiser«. Ihr Onkel hatte da wohl einen guten Freund gehabt, denn er hatte nach seinen Erzählungen dort bei dem Kaufmann Heinrich Ziegenbarth viel Zeit verbracht. Das Foto zeigte eine prächtige Jugendstil-Villa mit floralen Verzierungen und verspielten Türmen, runden Fenstern und verschachtelten Balkonen auf mehreren Stockwerken. In ihrer Kindheit hatte Katie von diesem Haus immer als dem Haus der Prinzessinnen und Feen geträumt. Sie nahm den Stadtplan aus der Tasche und orientierte sich.
Gottlöber war zufrieden mit seiner Arbeit. Das Blatt sah täuschend echt aus. Sogar der Porzellan-Papst Eduard Mocke würde die Echtheitsbescheinigung wieder schlucken, wie schon einige vorher. Ein siegessicheres Lächeln spielte um seinen Mund. Wenn er sich richtig Mühe gab, konnte er Großes vollbringen, das war ihm durchaus bewusst. Die Schrift hatte er wieder exzellent hinbekommen. Die Vorlage aus dem Archiv mit den Briefen von Dr. Gillitzer benutzte er inzwischen nur noch, um sich in die richtige Stimmung zu versetzen.
Er ließ das Dokument auf sich wirken – das steife, fleckige Papier, die großmäulige Schrift des sächsischen Kunsthistorikers Gillitzer – und fühlte sich zurückversetzt ins 19. Jahrhundert. Er stellte sich vor, wie Gillitzer mit gestärktem Kragen und langem Bart an seinem Schreibtisch saß und die Echtheit der Porzellanfiguren und Vasen aus der Sammlung Seidl bestätigte. Severin Seidl war in der Gründerzeit mit seiner Maschinenfabrik zu immens viel Geld gekommen und hatte dieses großzügig in Kunst investiert. Vor allem das Meissener Porzellan hatte es ihm angetan: »Sein Haus mit echtem Gold zu schmücken, ist dekadent. Ich bevorzuge das Weiße Gold.« Dieser Ausspruch wurde ihm zugeschrieben, und den Quellen zufolge hatte er seine Villa am Weißen Hirsch, dem Elbehochufer in Dresden, mit vielen wertvollen Porzellanen und Figuren ausstaffiert. Nach seinem Tod hatte seine Tochter Ruth die Villa geerbt, aber sie und ihr jüdischer Ehemann konnten sich nicht lange an der Pracht freuen. Kurz nach der Pogromnacht im November 1938 flohen sie Hals über Kopf nach Amerika.
All das wusste Gottlöber von Anastasia, die geradezu frohlockt hatte, dass sie diese Geschichte wie ein Trojanisches Pferd für die illegalen Importe aus Russland einsetzen konnte. Die Schätze aus der Villa Seidl waren nach der Flucht der Seidl-Erbin angeblich sicher eingelagert worden, aber bislang war nur ab und zu ein Einzelstück aufgetaucht. Man nahm an, dass sich erst die Nazis und später die Russen ungeniert an den wertvollen Figuren, Tafelaufsätzen und Geschirren bedient hatten.
Gillitzer war ein ebenso glühender Sammler wie Seidl gewesen, nur deutlich weniger betucht als der schwerreiche Industrielle. Gottlöber war sich sicher, dass Gillitzer bis zum Umfallen neidisch auf Seidl und seine Sammlung gewesen war. Seidl hatte den Kunsthistoriker noch zu Lebzeiten beauftragt, Echtheitszertifikate für all seine Stücke zu erstellen. Diese Zertifikate aus Gillitzers Feder waren jedoch genauso verschwunden wie die wertvollen Porzellane. Dafür war Raffael Gottlöber dankbar. Den typischen Schwung seiner Handschrift konnte er inzwischen perfekt nachahmen und er verdiente gut daran.
Er hatte Gillitzer regelrecht inhaliert. Er konnte fühlen, wie der Neid und der Ärger über seine Arbeit an dem Mann genagt hatten, wie verächtlich er dem Besitzer all der wunderbaren Reichtümer, die er klassifizieren und bewerten sollte, begegnet war. Der Mann war gierig gewesen, genau wie er selbst. Allerdings gierte Gillitzer nach Porzellan, und damit nach etwas, auf das Raffael Gottlöber gut und gerne verzichten konnte. Seine Passion war eine ganz andere.
Ganz wie es in der damaligen Zeit üblich war, schrieb er mit einer goldenen Feder und mit selbst gerührter Eisengallus-Tinte. Nach dem Schreiben streute er ein wenig weißen, feinen Sand über das Papier. Damit war das Zertifikat fertig. Anastasia würde ihm dreihundert Euro dafür geben, ein guter Stundenlohn. Raffael Gottlöber verspürte Lust, nach der Lohnarbeit auch noch etwas für seinen Ruhm zu tun.
Sein Handgelenk war gelockert, sein Geist war frei und lebhaft, alles in ihm bettelte förmlich darum, sich kreativ auszudrücken. Er nahm das gefälschte Zertifikat und schob es unter die noch leeren Blätter seiner Spezialpapiere aus dem 19. Jahrhundert. Dann verschloss er die kostbare alte Tinte und holte sich seinen Lieblingsstift und einen neuen, blütenweißen Papierbogen auf den Tisch. Mit großen, kühnen Strichen, so wie bei Gillitzers Handschrift, warf Gottlöber sein Motiv aufs Papier: einen großen Vogel, der einem griesgrämigen Mann auf der Schulter saß und versuchte, dessen Ohrring zu klauen.
Gottlöber klopfte sich selbst auf die Schulter und kicherte, als er in den Zügen des Mannes sich selbst erkannte. Ja, die steile Falte auf der Stirn, das zu lange, über die Schultern fallende Haar, die weit auseinander stehenden Augen – das war eindeutig er selbst. Die Zeichnung war ihm gelungen, er sah es sofort. Die Proportionen stimmten, jeder Strich saß. In der Haltung des Vogels kam die Gier nach dem Ring zum Ausdruck. Er war ein großer Künstler. Hochzufrieden mit sich selbst dekorierte er die neue Zeichnung in seinem Schaufenster. Für heute hatte er eindeutig genug gearbeitet.
In seiner Hosentasche hatte er den Vorschuss von Anastasia. Es waren zwar nur einhundert Euro, aber doch genug für ein Abendessen und die Chance, in einer Poker-Runde noch ein paar Euro zu gewinnen. Gottlöber kannte jedes Etablissement in Dresden, in dem gespielt wurde. Er knipste das Licht aus, zog sich seine Jacke an und machte sich auf den Weg.
»Kann ich gehen, Elena?« Marta trat in der Gaststube ungeduldig von einem Bein aufs andere und sah ihre Kollegin erwartungsvoll an. Mit einem Blick auf die Uhr, es war zehn vor sieben, nickte Elena und beugte sich wieder über den Getränke-Kühlschrank im Gasthaus »Zeughaus«. Marta sollte ihr Gesicht nicht sehen. Elena wollte sich nicht verraten. Lügen war noch nie ihre Sache gewesen.
»Danke, Elena!« Marta warf ihr ein Kusshändchen zu und war schon zur Tür hinaus. Erleichtert richtete sich Elena auf. Sie hörte, wie Marta draußen ihr Moped, eine Schwalbe, anließ und mit leiser werdendem Motorengeräusch auf der Zeughausstraße verschwand. Marta besuchte nicht nur seit Beginn der Saison einmal in der Woche einen Deutschkurs, sie war auch frisch verliebt und verbrachte die Abende seither mit ihrem neuen Freund Franjo. Deshalb hatte sie es immer eilig, wegzukommen. Im Gegensatz zu ihr.
Elena überprüfte die Fensterriegel und schloss die Türen ab. Als sie vor die Haustür trat, umgab sie die Stille des Waldes kurz vor der Dämmerung. Die Sonne würde erst gegen zwanzig Uhr untergehen, aber hier, im Zschand, umgeben von Wald und hohen Sandsteinwänden, wurde es deutlich früher dunkel. Das Haus des Nationalparks, ein Informationszentrum für Wanderer, stand verschlossen links von ihr, das dritte Haus gegenüber war ebenfalls verlassen. Kein Laut war zu hören, nur das Rauschen des Waldes lag wie ein Teppich über der Landschaft. Völlig ohne Besucher wirkte die Waldlichtung am Ende der Schotterstraße wie aus der Zeit gefallen.
Elena suchte in ihrer Jackentasche nach dem Schlüssel. Schwer und kalt lag er in ihrer Hand. Nachdem sie sich nochmals vergewissert hatte, dass sie völlig allein war, ging sie in schnellen Schritten los, den Großhübelweg hinauf, hinein in den dunklen Wald. Nach wenigen Hundert Metern begann der Pfad anzusteigen. Der Frühlingsregen machte den Weg glitschig. Sie musste aufpassen, wohin sie trat. Und es wurde ihr schnell warm. Elena öffnete den Reißverschluss ihrer Jacke, drosselte ihr Tempo aber nicht. Abends allein durch den Wald zu laufen war unheimlich. Obwohl sie diese Route schon oft gegangen war, schauderte es ihr jedes Mal aufs Neue. Wenn sie hier ausrutschen und sich ein Bein brechen würde – vor morgen früh würde sie niemand finden. Keuchend stieg sie den steingepflasterten, steilen Weg nach oben. Oberhalb des Hügels leuchtete der Himmel hell. Hinter ihr versank der Wald im Schatten.
Schließlich war sie fast oben. Rechts und links ragten riesige Sandsteinblöcke aus dem Boden. Elena spähte angestrengt in alle Richtungen. War sie allein? Als sich ihr Atem beruhigt hatte, verließ sie den Weg und umrundete einen der Felsblöcke, bis sie an seiner Rückseite angekommen war.
Nach wenigen Augenblicken stand sie wieder auf dem Pfad. Diesmal war es ein leichtes Paket, eingeschlagen in braunes Packpapier. Zigaretten, nahm Elena an, aber eigentlich war es dafür zu unförmig, es erinnerte an ein großes Ei.
Plötzlich riss ein Eichelhäher mit seinen Warnschreien die Stille entzwei. Elena schrak kurz zusammen, aber außer ihr war niemand zu sehen. Hastig drückte sie sich das Paket vor den Bauch und machte sich auf den Weg zurück zum »Zeughaus«.
Schon kurz nachdem sie im letzten Jahr begonnen hatte, im dortigen Gasthaus als Bedienung zu arbeiten, hatte sich ihr eine zweite Einnahmequelle aufgetan. Eine Frau hatte sie diskret angesprochen und ihr angeboten, für jeweils einhundert Euro eine Besorgung zu machen: »Sie holen ein Paket ab, steigen in Bad Schandau in die S-Bahn, legen es in Dresden am Hauptbahnhof in ein Schließfach und finden da das Geld. Es ist wirklich ganz einfach. Wir bringen ein paar kleine Sachen über die Grenze. Machen Sie sich keine Sorgen: Wenn Sie es halbwegs geschickt anstellen, wird niemand etwas mitbekommen. Das ist leicht verdientes Geld.«