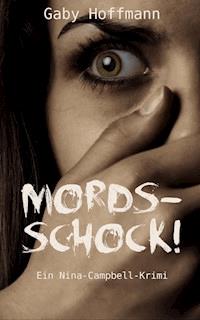
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Journalistin Nina Campbell, die von einem kuriosen Missgeschick ins nächste stolpert, möchte den Tod zweier junger Politiker aufdecken. Hierbei bringt sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre kleine Schwester Vic in Lebensgefahr. Sie verstrickt sich in ein tödliches Netz aus Liebe, Hass und Intrigen. Ein mysteriöser Mörder schlägt wieder und wieder zu. Pressestimmen: Buchregen: "Ein humoriger Thriller!" xtme: "Eine glatte Empfehlung!" Bestebookfinder: "Ein wirklicher lesenswerter Krimi!" ebookninja: "Ein spannender Krimi mit einer sympathischen Protagonistin!" Lübecker Nachrichten: "Humor, Spannung und der Schauplatz tragen zur Vielseitigkeit des Buches bei. Der Krimi bietet ganz nebenbei auch eine Kulturgeschichte des Redaktionswesens." Der Markt: "Das Besondere an 'Mordsschock!' ist, dass hier nicht nur die krimitypische Spannung herrscht, sondern gleichzeitig jede Menge humorvolle Einlagen der Heldin für Unterhaltung sorgen. Die Heldin Nina Campbell und ihre freche kleine Schwester Vic sind aus dem Holz, aus dem Serienfiguren geschnitzt sind!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaby Hoffmann
Mordsschock!
Ein Nina-Campbell-Krimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Ich habe einen Menschen umgebracht. Meine Augen sind geschlossen. Trotzdem sehe ich das grauenhafte Bild. Tief in mir drinnen. Eingebrannt unter der Haut, weil ich die eine Grenze überschritten habe, die Journalisten niemals überschreiten dürfen. Aus Egoismus – ja, und aus Liebe zu meiner kleinen Schwester Vic!
Ein Kälteschauer packt mich. Mit ihm erwacht die Angst vor Rache. Sie lässt das Blut zirkulieren. Vorsichtig strecke ich den rechten Arm aus, um nach der Bettdecke zu tasten. Aber der Griff geht ins Leere. Ich bewege meine Finger und fühle keine weichen Daunen, sondern harten Untergrund. Stechender Zitrusduft, schwülstiges Eukalyptusaroma und blumiges Parfüm steigen mir in die Nase, werden jedoch dominiert von einem merkwürdig herben Geruch.
Langsam, Millimeter für Millimeter, hebe ich meine Augenlider nach oben. Ich starre auf ockerfarbene Kacheln, die einen grellen Lichtkegel über mir reflektieren. Das beißt. Automatisch klappen die Lider zu, in der gleichen Sekunde gehen sie wieder hoch. Mein Blick wandert durch den fensterlosen Raum, in dem ich aufgewacht bin.
Das wilde Sammelsurium an Flaschen und Döschen auf dem Klowasserkasten kenne ich. Auch die bunten Zahnbürsten im Glas neben einer Packung Tampons und der Naturhaarbürste sind mir vertraut. Ein leichtes Zischen zerschneidet die Stille. Pfff ... Unter meinem linken Arm klebt etwas Weiches. Eine Tube Hautcreme verströmt ihren süßlichen Duft.
Mühsam robbe ich zwei Zentimeter vorwärts zu einem herumliegenden Stapel weißer Handtücher und lasse mich fallen. Sie färben sich rot!
Panisch untersuche ich Arme und Beine. Am Knie sickert Blut aus einer Schürfwunde. Die Quelle des herben Geruchs. Ansonsten finde ich nur Ratscher und blaue Flecke.
Im Schneckentempo drehe ich meinen dröhnenden Dickschädel in Richtung Spiegel: Eine Frau mit wirren, langen rotbraunen Haaren glotzt mich aus weit aufgerissenen grünen Augen an. Sie ist blass. Sogar die leichten Sommersprossen auf der stupsförmigen Nase haben ihre ursprüngliche Farbe verloren und existieren nur als geisterhafte Umrisse. Ihre herzförmig geschwungenen Lippen sind weiß. Einzige Farbtupfer bilden die zu schmalen Strichen gezupften dunklen Augenbrauen über den schwarzen Wimpern. Ihr schmaler Oberkörper ist halb aufgerichtet, die nackten Beine liegen seitwärts angewinkelt auf einem dunklen Fliesenboden, so, als würden sie nicht dazugehören.
Die Frau sieht verwahrlost aus. Pulli und Rock sind zerrissen und verdreckt. Etwas an ihrer Kleidung erscheint mir seltsam. Jetzt weiß ich, was: Der schwarze Rock ist an der Seite eine Schattierung dunkler gefärbt als der Grundton. Als ob über diese Fläche eine Flüssigkeit ausgelaufen wäre. Auch der Pulli hat wohl einige Spritzer abbekommen. Auf dem hellen Stoff zeichnen sich deutlich dunkle Flecken ab. Aus der verfärbten, eingerissenen Rocktasche blitzt ein metallener Gegenstand. Ein Küchenmesser! Und an dem Messer klebt die gleiche Flüssigkeit wie an Rock und Pulli.
Die Frau bin ich! Beschmiert mit fremdem Blut, liege ich auf dem Fußboden meines eigenen Badezimmers.
Ein schepperndes Geräusch lässt mich zusammenzucken. Ein Schlüssel wird im Schloss herumgedreht. Sanfter Knall. Die Tür! Dumpfes Tappen. Je näher sie kommen, umso energischer werden die Schritte.
Ich halte die Luft an. Der dunkle Schleier senkt sich wieder über mich – nein, es gibt kein Vergessen. Ich kann nicht fliehen!
Leise verfluche ich jenen Tag im Februar, an dem alles begann: Während eines einzigen Vormittags ging mir der gewichtigste Teil einer Erbschaft durch die Lappen, suchte mein Lover das Weite, und ich verlor meinen Job.
Kapitel 1
„So alt wird kein Schwein!“, sagte Großtante Carlotta wie jedes Jahr an ihrem Geburtstag. Zwei Tage später starb sie.
Da Tante Carlotta in ihren 83 Lebensjahren sparsam, aber finanziell unabhängig gewirtschaftet hatte, warteten meine Schwester Sophie und ich gespannt darauf, was uns der Notar gleich aus ihrem Testament vorlesen würde.
Ich schlug meine Jeansbeine übereinander und wippte mit den Stiefelspitzen, in denen sich mal wieder ein nicht zusammenpassendes Paar Socken verbarg.
Sophie saß kerzengerade im eleganten, eierschalenfarbenen Kostüm neben mir. Die Beine, damenhaft züchtig in hautfarbenen Nylons verpackt, endeten in hellen Wildlederpumps, die wohlsortiert vor dem Sessel ruhten. Während sie scheinbar gelassen den Worten des Notars lauschte, wanderte ihr rechter Zeigefinger nervös in das rechte Nasenloch und popelte. Treffer! Versenkt! Als der Notar zum Wesentlichen kam, zog sie ihren Finger wie einen Ausreißer erschrocken heraus und verschränkte die Hände im Schoß.
„Mein Vermögen in Form von Aktien und Investmentfonds sowie mein Haus samt Inventar hinterlasse ich der Tochter meines verstorbenen Neffen Manfred Burmeister und seiner verstorbenen Frau Helen, der lieben Sophie, die Helens dritte Tochter Vicky großzieht. Meine für mich wertvollsten Besitztümer aber vermache ich als Zeichen meiner Zuneigung Helens zweiter Tochter aus ihrer nichtehelichen Beziehung, der lieben Nina ...“
Vor Aufregung drehte ich die Tempos in der Tasche meiner Lederjacke zu tausend kleinen Kügelchen.
„Sie bekommt mein Auto und meinen Kater Oscar.“
Die Taschentuchkügelchen kullerten auf den Boden, dem Notar vor die Füße.
„Oh, Verzeihung!“ Ich bückte mich und hockte nun halb unter dem Schreibtisch. Im Rücken spürte ich die verächtlichen Blicke meiner älteren Schwester. Das Auto, mit dem Tante Carlotta so gerne hin- und hergegondelt war, hatte seine neun Jahre auf dem Buckel. Und der fette Kater ... Na ja, typisch: Sophie, die dank ihres fleißigen Mannes Thilo sowieso schon in einem repräsentativen Einfamilienhaus am Stadtrand lebte, wurde von Tag zu Tag wohlhabender. Mein Traum, meine kleine Schwester Vicky zu mir zu holen, rückte in weite Ferne.
„Schön, dass du jetzt auch ein Auto hast!“ Gönnerhaft tätschelte Sophie meine Schulter, als wir die Kanzlei verließen. Zufriedenheit spiegelte sich auf ihrem Gesicht, das mit den großen blauen Augen, den pfirsichfarbenen Wangen und den strahlend weißen, wie zu einer Perlenschnur aufgereihten Zähnen hinter den dezent bordeauxrot geschminkten Lippen einer ihrer Schlafpuppen glich, die sie als Mädchen geliebt hatte.
Normalerweise war meine Schwester eine Meisterin im Nörgeln. Keine Ahnung, wie mein wirklich herzensguter Schwager Thilo ihre Launen ertrug. Ich jedenfalls hatte von klein auf mein eigenes ‚Anti-Sophie-Programm‘. Jene von Sophie gehütete Schlafpuppe beispielsweise ließ ich als Fünfjährige vom großen Bruder eines Nachbarjungen kahl rasieren und schmierte sie dann eigenhändig mit schwarzer Schuhcreme ein. Zwar war Sophie mit 16 schon aus dem Puppenalter heraus, trotzdem regte sie sich mächtig auf, weil ihre Kinder die Puppe erben sollten. Heute, 20 Jahre später, hatte Sophie noch keinen Nachwuchs in die Welt gesetzt, besaß aber das Sorgerecht für unsere kleine Schwester Vicky. Und die spielte, genau wie ich in ihrem Alter, lieber Fußball als mit Puppen.
Sophies Absätze klapperten die schweren Steinstufen hinunter. ‚Klack-klack‘ hallte es. Ihr blonder, symmetrischer Pagenkopf wippte, ihre eierschalenfarbenen Hüften schwangen. Der Jil-Sander-Duft schwebte hinter ihr her. Das hanseatische Treppenhaus mit Stuckverzierungen und großzügigen Glastüren auf jeder Etage, an denen imposante Namensschilder diverse Anwaltskanzleien ankündigten, gab einen trefflichen Rahmen für sie ab.
Es roch intensiv nach Putzmitteln. Ein Mann im grauen Anzug wartete vor dem Fahrstuhl. Höflich grüßte er. Sicher hielt er Sophie für eine erfolgreiche Anwältin und mich für ihre missratene Mandantin, die sie aus irgendeinem Sumpf rettete.
Ich hätte den Fahrstuhl genommen, aber Sophie wollte vermutlich in den fünf Stockwerken ihre leichten Fettpölsterchen am Bauch abtrainieren, die sich vorsichtig in dem schmal geschnittenen Kostüm abzeichneten. Die Konsequenzen des guten Lebens!, dachte ich boshaft. Schon als wir Kinder waren, musste ich den Müll runterbringen, während Sophie Mutters Saucen abschmecken durfte.
Als hätte Sophie meine Gedanken gelesen, drehte sie sich plötzlich um. „Du brauchst gar nicht so ein Gesicht zu ziehen! Schließlich bist du mit Tante Carlotta nicht mal blutsverwandt! Außerdem habe ich Verantwortung.“ Ihre gute Laune verbot ihr den sonst üblichen Verweis darauf, wie teuer der Unterhalt für Vicky sei und wie eine rotzfreche Elfjährige ihre Nerven strapaziere.
Sophie stieß einen undamenhaften Seufzer aus, als wir unten ankamen. Die vielen Treppen forderten ihren Tribut, aber die Erbschaft weckte ihre großzügige Ader. „Gehst du auf einen Kaffee mit? Ich lade dich ein.“
„Muss los! Bin schon zu spät dran!“ Ich stemmte die wuchtige Marmortür im Portal auf und atmete tief durch. Es war wie der Eintritt aus einer kühlen Käseglocke in einen belebten Bienenstock. Um mich herum schwirrte und summte es. Passanten hasteten mit schweren Einkaufstüten vorbei.
Trotz der winterlichen Temperaturen kam es mir draußen wärmer vor. Die hohen Gebäude rahmten die Mönckebergstraße ein und schirmten sie vor eisigen Winden ab. Einen Straßenmusikanten hatte der Sonnenschein nach draußen gelockt. Er fiedelte mitten auf dem Gehsteig herzzerreißend auf einer alten Geige. In der Ferne ertönte ein Martinshorn. Ein Kind sprang in eine Schneematschpfütze im Rinnstein und wurde von seiner Mutter schimpfend herausgeholt. Ein Mann lief auf und ab, um den Leuten mit volltönender Stimme „die Botschaft von Jesus, dem Herrn“ zu verkünden. In einer Nische neben dem Hauseingang wärmte sich ein Bettler die Hände im zottigen Fell seines Schäferhundes auf einer zerschlissenen Wolldecke und murmelte monoton: „Bitteschön! Bitteschön!“ Von der Imbissbude neben dem Kaufhaus auf der anderen Straßenseite zog ein verlockender Bratwurstgeruch herüber.
Ich legte eine Münze in den Hut des Bettlers.
„Vergelt’s Gott, junge Frau“, bedankte er sich im gleichen monotonen Singsang.
Sophie schüttelte den Kopf. Missbilligend zog sie die Schultern hoch. Ihre Körpersprache drückte aus, was sie dachte: Du wirst es nie zu etwas bringen!
Ein langer Schatten fiel vor uns auf das Pflaster, rasch rief ich Sophie zu: „Tschüss, gib Vic einen Kuss von mir!“
Vor dem Schaufenster nebenan hatte ein großer Mann gewartet. Er trat jetzt ins Licht der Februarsonne, die sich auf seinen glänzenden, schwarzen Haaren spiegelte. Der dunkle Mantel streckte die schlanke Gestalt, sodass er wie eine Insel zwischen all den eiligen Leuten auftauchte. Freudige Erwartung lag auf seinen glatt rasierten, olivfarbenen Gesichtszügen, die so perfekt das Bild des Latin Lovers mimten. Ehe ich etwas sagen konnte, presste Anthony mir einen feurigen Kuss auf die Lippen und saugte sich, ungeachtet der Menschenmenge, eine Weile an mir fest.
Das tat gut, nach dem seriösen Muff. Ich schmeckte seine weichen Lippen, roch das herbe Aftershave. Sanft schob er seine Zunge in meinen Mund. Sie spielte mit meiner, kitzelte und liebkoste sie. Langsam und fest, dann schneller und schneller. Im Gleichtakt rasten unsere Zungen, verschmolzen zu einer Einheit. Mein Pulsschlag beschleunigte sich. Beben im ganzen Körper.
Viel zu früh löste er seine Lippen, fasste mich um die Schultern und fragte: „Und?“
„Ein Auto!“
„Benz? Jaguar? Chrysler?“
„Polo, neun Jahre alt, rostfrei.“
Anthony lockerte seinen Griff, zog hörbar Luft durch seine etwas vorstehenden Schneidezähne, die er gerne hinter festgeschlossenen Lippen verbarg, weswegen er auch als interessanter Schweiger galt. Nur, dass er nie etwas wirklich Interessantes erzählt hatte. Aber diese südländische Macho-Optik erotisierte seine Person.
„Und ...“
„Ja?“ Ungeduldig legte er mit herrischer Geste seinen rechten Arm um meine Taille.
„Ein Kater, acht Jahre alt.“
Anthony verbarg seine Schneidezähne krampfhaft hinter festverschlossenen Lippen. Stumm und finster wie eine Auster ging er im Stechschritt neben mir durch den Pulk summender Menschen zum Parkhaus. Wortlos fuhr er mich im rasanten Tempo zur Redaktion.
Geschäftshäuser, Banken, Patriziervillen, Läden, Restaurants, der Hauptbahnhof flogen an uns vorbei. Wir überquerten die Lombardsbrücke mit ihrem traumhaften Blick auf die von der Cityskyline eingerahmte Binnenalster. Verwaist ruhte sie, eine zarte Eisschicht als Bettdecke übergestülpt. Ihre Könige waren noch nicht zurück, aber bald würden die stolzen Alsterschwäne wieder majestätisch ihre Bahnen ziehen.
Anthony drückte das Gaspedal durch, als könnte er mich nicht schnell genug loswerden. Er brauste den Mittelweg an den weißen Villen entlang in Richtung Außenalster. Das Schweigen im Auto wurde erwidert. Der Fluss lag im Winterschlaf. Nur gestört von einigen Spaziergängern, hart gesottenen Joggern, Radlern und hungrigen Enten.
Wenn die Alsterfontäne ihr funkelndes Wasserspiel startete, erwachte das Leben. Ausflugsdampfer würden begeisterte Touristen befördern, zahlreiche weiße Segel würden sich im Wind blähen, schwitzende Ruderer würden mit verzerrtem Gesicht vorbeihasten, und ich würde bei einem Cappuccino in einem der Cafés am Ufer in der Sonne dösen.
Anthony setzte mich vor dem gläsernen Bürogebäude in der Alten Rabenstraße ab. Von hier aus konnte man bis zum Fähranleger hinunter sehen. Ich erkannte dort die Silhouette einer alten Frau, die Brot für die Enten ins Wasser warf.
Anthony presste schwerfällig die Lippen auseinander: „Ich rufe dich an!“
Es war das Letzte, was ich jemals von ihm hörte!
Kapitel 2
„Wir hängen tierisch!“, kreischte Conny, eine der Grafikerinnen, mir entgegen.
Bevor ich sie leibhaftig sah, entdeckte ich die Spiegelbilder meiner Kollegen an den Glaswänden, die das Großraumbüro einrahmten. Die Psychologie hinter dieser architektonischen Lösung war logisch: Kein Hindernis schottete den freien Blick kreativer Menschen ab, wenn sie ihre Gedanken in die Weite schweifen ließen. Jetzt lümmelten sich diese Künstler alle zwischen Rechnern, Telefonen und Papierbergen auf den Chromtischen und warfen mir vorwurfsvolle Blicke zu, weil ich so spät kam.
Erstaunt über die ungewöhnliche Aufmerksamkeit an meiner Person, blickte ich fragend in die kreative Runde. „Müssen wir nicht heute das Titelbild produzieren?“
„Ach, wirklich?“, äffte mich Achim, ein anderer Grafiker, träge nach. „Nö, lass dir ruhig Zeit! Die Seite muss erst morgen in der Druckerei sein!“
Mir schwante Böses. „Ist Karina etwa noch krank?“
Die Leidensmienen um mich herum bedurften keiner Antwort. Karina war meine Vorgesetzte. Da unser Art-Direktor mit gebrochenem Bein im Krankenhaus lag, zeichnete sie momentan für die Produktion der Titelseite allein verantwortlich. In mir schrillte eine Alarmglocke, meine Körpertemperatur stieg an. Jetzt kam mein Part. Ein Trend musste her, aber subito!
Manchmal geht der Ehrgeiz mit mir durch. Hätte ich in die bewährte Kiste voller Titelgirl-Fotos gegriffen, wäre mein weiteres Leben anders verlaufen. Ich wollte mich aber mit etwas sensationell Neuem beweisen. Nachdem ich vergeblich meine beschränkten Hirnwindungen nach einer bahnbrechenden Idee durchgeknetet hatte, rief ich meine beste Freundin Lila an. Das Unheil nahm seinen Lauf.
„Geschirrhandtücher!“, riet sie.
„Ich will keine Küche einrichten, sondern die Titelseite eines Lifestylemagazins produzieren.“
„Na klar“, entgegnete sie ungeduldig. „Geschirrhandtücher lässig unter den Achselhöhlen verknotet – das kommt an! Megamäßig, sage ich dir.“
Ich stellte mir vor, wie Lila in diesem Moment Daumen und Zeigefinger ihrer rechten Hand in der Luft zu einem Kreis spreizte. Ihr Zeichen für eine nicht zu toppende Sache. Zu meiner Entschuldigung muss ich gestehen, dass ich damals ein bisschen skeptisch war. Aber Lilas Enthusiasmus überzeugte. Normalerweise besitzt meine Freundin eine exzellente Spürnase für Modetrends. Diesmal litt ihr Riechorgan jedoch an Verstopfung.
Eifrig buchte ich einen Fotografen und ein Model für das Titelshooting.
Wendy, das Model, schaute mich irritiert an, als ich sie mit einem Haufen karierter Geschirrhandtücher empfing. „Soll ich mir die etwa um den Bauch binden und hier spülen?“, nuschelte sie durch ihre kesse Zahnlücke.
„Nein, unter die Achselhöhlen!“, befahl ich freundlich, eine Dosis natürliche Autorität in der Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
Wendy hob artig ihre rasierten Achselhöhlen, und eine maulende Stylistin nestelte so lange mit einem der Handtücher an ihrem Waschbrettbody herum, bis die Kreation perfekt saß.
„Come on, work harder!“, feuerte der knipsende Fotograf Wendy an, die sich professionell im geknoteten Geschirrhandtuch mit fliegenden Blondhaaren drehte, wendete, hüpfte, auf den Boden warf, die Beine überkreuzte, in die Luft sprang.
Ich entschied mich für eine Aufnahme, auf der Wendy kniete und einen tiefen Einblick ins Geschirrhandtuch-Dekolleté gewährte. Gar nicht schlecht!, dachte ich stolz.
Dieses Hochgefühl verflog, als ich meine erste Coverproduktion in den Händen hielt. Ein winziges Schild war mir durch die Lappen gegangen. ‚100 Prozent Baumwolle. Waschbar bei 60 Grad‘ prangte unschuldig an Wendys Busen. Während ihrer wilden Verrenkungen musste das Etikett, das die Stylistin mühsam nach innen geklemmt hatte, wieder an die Oberfläche gerutscht sein. Dank der Vergrößerung war es nun deutlich sichtbar.
Meine Reue kam zu spät, der Titel war bereits gedruckt! Ich dachte an einen Last-Minute-Flug, der mich weit weg bringen würde – egal, wohin. Aber das Echo meiner Heldentat war schneller als jeder Überschalljet: Wichtige Inserenten stornierten ihre Anzeigen für die nächste Ausgabe. Ein Magazin mit einem so geschmacklosen Titel war kein geeignetes Werbeumfeld. Die wirtschaftlichen Konsequenzen lagen auf der Hand.
„Warum haben Sie ihr nicht gleich eine Wäscheklammer mit Gebrauchsanleitung in den Ausschnitt geklemmt?“, erkundigte sich unser Herausgeber sarkastisch.
„Sex sells!“, erwiderte ich mit schiefem Lächeln.
Das war zu viel! Der Boss setzte seine getönte CK ab! Ein Skandal! Solange es den Verlag gab, hatte er sich nie ohne diese Gläser gezeigt. Ich zuckte erschrocken zusammen. Froschaugen! Die liefen ihm jetzt über, das verlangte ein Opfer. Ich sprang über die Klinge!
Mühsam beherrscht, steckte ich das Schreiben mit meiner fristlosen Kündigung ein. Nur keine Tränen! Die Fernseher in den WC-Räumen waren das einzig Gute an dem Job, dachte ich trotzig. Mit meiner Coolness war es jedoch nicht weit her. Auf wackeligen Beinen, den Kragen meiner schwarzen Lederjacke so hochgezogen, wie es nur irgendwie ging, schlich ich verklemmt davon. Nur niemandem begegnen!
Edith, die 68er-Rockerbraut vom rotgepolsterten Samtthron im Empfang, rief mir ahnungslos ein lässiges „Bye“ hinterher.
Dann stand ich draußen. Über mir leuchtete die neonfarbene Lichtreklame ‚Hip – Szenemagazine‘.
Ich lief zum Fähranleger, warf mich auf eine eiskalte Bank und heulte dicke Tränen in die schlafende Alster.
Lila öffnete mir die Tür wider Erwarten nicht im geknoteten Geschirrhandtuch, sondern im blau gepunkteten Overall.
Mein Tränenfluss drohte, ihre winzige Wohnung unter Wasser zu setzen.
Sie knutschte mich, ließ meine wüsten Schimpftiraden geduldig über sich ergehen, wischte mir mit einem Taschentuch quer übers verheulte Gesicht und drängte mir irgendein selbstgemixtes Zeug auf. Es schmeckte nach faden Gummibärchen, zischte wie Feuer durch meinen Schlund und betäubte den Schmerz etwas.
„Du musst mir versprechen, alle Geschirrhandtücher, die du hast, zu verbrennen“, ächzte ich mit schwerer Zunge. Mein Magen rebellierte. Instinktiv bereitete ich mich auf einen schnellen Toilettengang vor.
Lila reichte mir einen Spiegel. „Guck mal!“
Ein rot-blau-schwarz-gestreiftes Antlitz mit geschwollenen Augenlidern starrte mich an. Reif für eine komische Zirkusnummer.
„Klasse, oder? Als ob dir einer mit einem Pinsel die Farbe exakt im Gittermuster aufgetragen hat.“
„Du witterst nicht etwa einen Trend“, fragte ich entsetzt und wischte eilig die traurigen Überreste meiner Schminke weg. „Nie mehr höre ich auf dich!“ Ich tobte wie ein dickköpfiges Kind und trampelte zur Bestätigung mit den Füßen auf ihre Kuhfellimitate, die als letzter Schrei überall in der Wohnung auslagen. Sie konkurrierten mit den gleichgemusterten Sesseln, an deren Lehnen Hörner baumelten.
Lila strich sich durch die raspelkurzen, blau getönten Haare und blies den schwarzen Lack ihrer Fingernägel trocken. „Ich kann nichts dafür, wenn dein Chef so out ist. Ich dachte, du arbeitest für ein Szene-Magazin?“
Ich drehte mein Glas zwischen den Fingern und ärgerte mich, dass ich Lila im Grunde nicht mal zum Sündenbock machen konnte. Wie ich es auch wendete – schuldig blieb ich! Mein Selbstmitleid verwandelte sich langsam in Selbstkritik. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann!
„Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich brauche das Geld! Und Vic schmort weiter bei Sophie. Dabei fetzen die sich gegenseitig die Haare vom Kopf! Immer dreht sich alles nur um die Scheißkohle!“
Lila tat das einzige Vernünftige in dieser Situation: Sie schleifte mich ins Tabaluga, eine unserer Stammkneipen, wo wir mit Jenny, Julian und Hendrik mein Fiasko begossen.
Beim vierten Bier bekam Julian eine Erleuchtung, was bei ihm so gut wie nie passierte. Bedächtig legte er mir einen Arm um die Schulter und rückte minutenlang näher, räusperte sich, öffnete den Mund zum Sprechen, ließ die Zähne zur Probe ein paar Mal kreisen, rollte die Zunge dazwischen und hüstelte. „Also, weißte, hm … Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Hm ...“
„Unfassbar!“, unterbrach ihn Lila ungeduldig.
Julian wandte sich Hendrik zu. „Du hast mir doch von deinem Cousin erzählt ...“
Jetzt mischte sich unser schicker Vorzeigeyuppie Hendrik ein: „Ja, das könnte was sein! Mein Cousin ist auch Redakteur. Er hat gerade gekündigt, weil er ins Ausland gehen will. Ruf mal in dem Verlag an, ob die Position frei ist!“
Ich zog einen Flunsch und zickte. „Das war sicher nicht gestern, sondern vor drei Wochen, und die Stelle ist längst wieder besetzt. Mit Papis Töchterlein oder so ähnlich!“
Lila kniff mich in den Arm. „Nun sei nicht so eklig! Du musst jede Chance nutzen!“
Damit hatte sie ohne Zweifel recht, wenn ich die Arbeitsmarktlage realistisch analysierte und an meine langjährige Praktikantenkarriere zurückdachte. „So ’ne abgelegte Secondhandstelle will ich nicht.“ Ich zündete mir eine neue Zigarette an, blies Julian den Rauch ins Gesicht, sodass sich seine spärlichen Blondhärchen weiter lüfteten und die süße Nickelbrille beschlug.
Hendrik beugte sich forsch in meine Richtung, verlor aber seine Spontaneität, da er Opfer meiner Rauchsäule wurde. „Ruf an! Lokalzeitung in Rosenhagen!“, bellte er hustend und fächelte meinen Qualm weg.
Ich fuhr von meinem Hocker hoch und hätte dabei um ein Haar den armen Julian mitgerissen. „Was? Rosenhagen? Was? Lokalzeitung? Lieber schlafe ich unter Brücken!“
Kapitel 3
Einen Monat später stand ich in der Kleinstadt Rosenhagen vor einem winzigen Stadthaus, das so um 1900 erbaut sein mochte. Schmal und weiß mit leichten Stuckornamenten verziert, bot es dem heftigen Wind, der heute herrschte, trotzig die Stirn. Geschwungene Bögen über den grün-weiß gestrichenen Rahmen der Sprossenfenster im Giebel unterstrichen den zähen Charakter des Gebäudes.
Ebenso alt wie die Zeitung, die da drinnen modert, dachte ich grimmig und stapfte mit meinen superhohen Buffalo-Stiefeln die schmalen Stufen hoch. Ich stieß die grüne Holztür auf. Wie rostige Schneeflocken rieselten abblätternde Farbteilchen herunter und hinterließen eine grüne Spur.
Zum Vorstellungsgespräch war ich nach Feierabend da gewesen und hatte nur den hageren Chefredakteur angetroffen. Im Dämmerlicht hatte das Gebäude wie ein Spukhaus gewirkt. Trostlos, verwittert und vergessen. Kein Wunder, dass ich den Job ergattert hatte, die waren sicher froh, jemanden gefunden zu haben. Ich schickte ein Stoßgebet an Hendriks Cousin, der sich nun wer weiß wo aalte.
Jetzt, bei Tageslicht, war der Spuk weggewischt. Zweibeiniges Inventar des Hauses kroch mir lebendig entgegen. Eine rundliche, grau-brünette Frau im strassbesetzten Pullover, der über dem üppigen Busen spannte, lächelte mich an. Ihr Unterkörper blieb verdeckt, weil sie hinter einem wuchtigen Holztresen lehnte.
Frauen mit viel Oberweite animieren mich dazu, heimlich auf dem Klo zu verschwinden und eine Packung Kleenex in meinem dürftigen Ausschnitt zu versenken. Aber als Neue kann man ja wegen mangelnder Ortskenntnis keinen Schritt alleine tun. Also dümpelte mein Dekolleté weiter auf Bügelbrettniveau.
Der Vorraum verbreitete mit seiner braunen Rautentapete und den grünlichen Linoleumfliesen als beißendem Kontrast zu der Hausfassade ein gewisses 70er-Jahre-Flair. Vermutlich die Epoche der letzten Renovierungsphase.
Aus den Augenwinkeln musterte die Frau meinen Rock, der zugegebenermaßen gerade so eben den winzigen Slip bedeckte, aber ich fand ihn cool.
Ich strich mir einige vorwitzige Haarsträhnen, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatten, hinter die Ohren. „Tag, ich möchte zu ...“
Weiter kam ich nicht, denn die Dicke unterbrach meinen höflichen Satz und erklärte schnell: „Ja, ich weiß Bescheid. Sie werden erwartet. Ich bringe Sie hoch!“ Während sie sprach, entschlüpften ihr kleine Schmatzer, weil sie ein Bonbon lutschte, das sie ständig von einer Wange in die andere Wange schob. Sie winkte mir, ihr zu folgen, und kletterte trotz ihrer Fülle behände eine morsche Holztreppe hoch. Ihr imposantes Hinterteil schwankte vor mir wie ein Schleppkahn, der mich in den Hafen zog.
Ich hatte Mühe, mit meinen Plateausohlen die zierlichen Stufen zu treffen. Unter jedem meiner Schritte ächzten sie dazu so erbärmlich, dass ich alle Augenblicke befürchtete, die Treppe würde zusammenkrachen.
Oben angekommen, riss meine Begleiterin eine Bürotür auf, aus der eine blaue Qualmsäule entwich, und rief in den Dunst: „Sie ist da! Ich bringe sie in den Konferenzraum!“
Dieses ‚sie‘ fand ich nicht besonders höflich, aber das war wohl der übliche Umgangston in der Provinz.
Ich nahm auf einem durchgesessenen Regiestuhl in einem nüchternen Raum Platz. Weiß getünchte Wände, acht weitere Regiestühle und ein grauer, länglicher Tisch – das war alles. Karger als der Wartesaal eines Krankenhauses.
Ein zartgliedriger Mann huschte wie ein Elf durch die Tür, in der Hand einen Stenoblock und Kuli. „Guten Tag, schön, dass Sie gekommen sind!“, begrüßte er mich nervös blinzelnd. Hastig ergriff er meine dargebotene Hand und ließ sie sofort wieder fallen, als handle es sich um einen ekligen alten Lappen.
Meine Fingerspitzen schimmerten grünlich – ein Souvenir der Holztür! Vermutlich glaubte mein Gegenüber, ich hätte eine ansteckende Krankheit oder bereits mangels ausreichender Körperpflege Grünspan angesetzt.
Anstatt seinen Namen zu nennen, zückte er den Kuli. „Wenn es Ihnen recht ist, fangen wir gleich an.“ Seine Stimme war überraschend tief und männlich.
Ich nickte gnädig. Schließlich erwartete ich, jetzt den Vertrag zu unterzeichnen und dann an die Arbeit zu gehen. Sektfrühstück oder Champagnerempfang hatte ich mir schon vor Jahren abgeschminkt.
Fahrig rutschte das Männchen vor mir auf dem Stuhl herum und räusperte sich. „Wie sind denn so Ihre Arbeitszeiten?“
Ach, das war ja mal ganz was anderes! Durfte ich die hier etwa diktieren? Ich zupfte den kurzen Rock zurecht und wuchs in meinem Stuhl. „Bisher habe ich von neun bis achtzehn Uhr, auch mal etwas länger, gearbeitet.“
Das Männchen hob den Kopf und blickte mich an, als ob ich nicht ganz dicht sei. „So früh?“
Das war ja nett! Kompromissbereit bot ich an, gerne jederzeit später anzufangen.
Das Männchen gewann wieder etwas von seiner verlorenen Fassung zurück und setzte die nervige Fragenstellerei fort: „Wie sind Sie dazu gekommen, gerade diesen Beruf einzuschlagen?“
Diese Runde ging an ihn, ich wurde unruhig. Vermutlich hatte ich den Job längst nicht in der Tasche, und er war irgend so ein Personalchef, der mich nochmals auf Eignung testete. Wohlüberlegt formulierte ich: „Ich interessiere mich für Menschen, und da lag es nahe ...“
Das Männchen stoppte mich, während es auf seinem Block herumkritzelte. „Aber es gibt so viele andere Berufe, die mit Menschen zu tun haben und ...“, er hüstelte kurz, „ich will es mal so ausdrücken, etwas ehrbarer sind.“
Nanu, war der Typ etwa ein Nestbeschmutzer von der Sorte ‚wir schimpfen auf Schmierenjournalisten und hängen uns das FAZ-Mäntelchen um‘? Ich überlegte, ob ich ihm den Käse vom investigativen Journalismus, der durchaus ein Wohltäter der Menschheit sein könne, aufs Brot schmieren sollte.
Aber das neugierige Männchen hatte schon seine nächste Frage parat: „Gibt es Praktiken, die Sie ablehnen?“
Ich überlegte vorsichtig: „Na ja, ich habe Respekt vor dem Tod, Pietät – Sie wissen schon! Als Witwenschüttlerin eigne ich mich wohl nicht!“
Mein wissbegieriges Gegenüber fuhr in seinem Stuhl hoch, glotzte mich entsetzt an, zuckte zweimal wie ein altersschwacher Regenschirm, sackte dann in schiefer Haltung zusammen und schrieb emsig mit. Fasziniert betrachtete ich drei Schweißperlen, die ihm von der angestrengten Stirn auf die Nase tropften, als koste ihn seine Fragerei große Überwindung. Jetzt brachte die Feuchtigkeit seine Brille ins Rutschen. Er fing sie eben am linken Bügel auf. Konzentriert sandte er mir einen stechenden Blick zu, als ob das Malheur meine Schuld wäre.
„Wenn Sie mit so vielen Männern zusammen sind, wie sieht es dann mit einer festen Beziehung aus?“ Ein rosiger Hauch flackerte über sein Gesicht, als wäre er stolz, diesen Satz über die Lippen gekriegt zu haben.
Okay, ich bin bestimmt nicht verklemmt, aber das war zu viel! Mein Privatleben ging diesen fremden Typen überhaupt nichts an. „Waren Sie mal bei der Stasi?“ Ich schnappte meine Tasche, warf meine Lederjacke über und wollte mit den Worten ‚Entschuldigung, hier kann ich nicht bleiben!‘ einen eleganten Abgang machen. Der wurde mir aber versaut, weil die Tür sich dummerweise von der anderen Seite öffnete und ich sie an den Kopf bekam. Eine hübsche Beule war genau das, was mir in diesem Moment noch fehlte!
Meine Begleiterin von vorhin schob eine dauergewellte junge Frau in Jeans, Pulli und Turnschuhen durch die Tür. „Tut mir leid“, stammelte sie verlegen. „Das ist die richtige Frau Körner.“ Mit diesen Worten bugsierte sie die Sportliche ins Zimmer, reichte mir formell die Hand und sagte: „Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Riechling ist mein Name, ich bin die Sekretärin. Herzlich willkommen bei uns!“
Das Männchen schien in diesem Moment einer Herzattacke nahe zu sein. „Eine Verwechslung also?“, stammelte es keuchend und stand jetzt endgültig auf den Trümmern seiner abermals runtergerutschten Sehhilfe.
„Schon gut!“ Ich verließ mit der Sekretärin den Raum.
„Möchten Sie ’n Bonsche?“ Sie fuchtelte mit einer Tüte Himbeerbonbons vor meiner Nase herum.
Aus Höflichkeit griff ich zu. „Was hat diese Frau Körner für einen Beruf?“
Die Riechling reckte sich bis zu meinem Ohr hoch, sodass ich ihren süßlichen Himbeeratem wahrnahm, und flüsterte schmatzend: „Nutte!“ Gepflegter schob sie hinterher: „Sie wissen schon, Prostituierte!“
Tiefe Furchen auf der Stirn verliehen dem graubärtigen dürren Chefredakteur Edfried Wagner den Anschein eines großen Denkers, der ständig mit Weltproblemen befasst war. Die eingefallenen, in Höhlen liegenden graublauen Augen verstärkten das Image des ausgemergelten Asketen. Ich stellte ihn mir beim Meditieren in einem buddhistischen Kloster vor. Seine Knochen steckten in einem zerknautschten Leinenanzug. So wie ihm seine Kleidung um den Körper schlackerte und oben der farblose Kopf herausguckte, erinnerte er mich an einen Totengräber. Kein Wunder, dass ich beim Vorstellungsgespräch glaubte, in einer Spukspelunke zu sein. Ein eingefleischter Vegetarier mit Essstörungen? Heimlich spähte ich, ob ich auf seinem Schreibtisch einen ausgewaschenen Joghurtbecher voller Salatblätter entdeckte.
Während Wagner mich einwies, stürmte sein Kontrastprogramm – ein ausgemachter Fettwanst – schnaufend ins Büro. „Drei Verletzte und ein umgekippter Schweinetransporter auf der A1. Machen Sie die Eins frei, Chef!“, brüllte er, und sein schwammiges rotes Gesicht unter der blonden Vollponyfrisur wurde durch ein strahlendes Grinsen verzerrt. „Aye! Jetzt haben wir einen Super-Aufmacher!“ Die auf halb acht sitzende schmuddelige Jeans rutschte ihm in die Kniekehlen, wozu seine unzähligen Schlüssel am Hosenbund ahnungsvoll klimperten. Als Aura umgab diesen keuchenden Polizeireporter außer einem saftigen Schweißaroma die ständig piepsende und knackende Geräuschkulisse vom Polizeifunk. „Peeeddder Eins biddde kommen! Hier is ’ne Frau umgekippt. Peeeddder Eins biddde!“, schnarrte es aus dem kleinen Apparat.
Der Chef ließ sich von seiner Begeisterung anstecken. „Gut, Jelzick!“ Er ballte die knochige Faust und stampfte dabei auf den knarrenden Dielenboden. Ich lag mit meiner Einschätzung des durchgeistigten Propheten völlig falsch!
Die karge Möblierung der Büros hatte wohl auf Edfried Wagner abgefärbt oder ihm den Appetit verschlagen: Die kleinen, verwinkelten Räume waren bis auf zwei oder drei verwitterte Holzschreibtische nackt. Davor standen altersschwache graue Drehstühle, die mindestens schon drei Generationen von Journalisten durchgesessen hatten. Weder Bilder an den weißen Wänden noch Grünpflanzen auf den Fensterbänken. Nur abgerissene Zettel mit Memos, vollgekritzelte Timer, Kalenderblätter und vergilbte Zeitungsausschnitte klebten überall. Computer, Drucker und Telefone auf den Tischen wirkten wie futuristische Eindringlinge aus einer anderen Welt. Den Blick nach draußen versperrten graue, rauchgeschwängerte Mullgardinen, die sich trotz geschlossener Fenster leicht vor den offensichtlich undichten Butzenscheiben blähten.
Aha, ständige Frischluftzufuhr als kreativer Kick, dachte ich, als ich meinen neuen Arbeitsplatz in Beschlag nahm. Trotzdem roch es stark nach 1900.
Mir gegenüber erhob sich eine Hünin, vielleicht vierzig Jahre alt. Sie wiegte sich beim Gehen aufreizend in den Hüften, als wolle sie mir von vornherein demonstrieren, welche Frau in diesem Laden die Nummer 1 war. Geschmack war nicht ihre Stärke: Der grüne Hosenanzug erzeugte eine fabelhafte Disharmonie zu ihren blond gesträhnten Haaren und den grell blau geschminkten Augenlidern hinter einer goldenen Brille. Herausfordernd sog sie zunächst mit gespitzten Lippen und nach oben gerecktem Kinn an ihrer Zigarette, ehe sie mir herablassend die Hand schüttelte. Die vielen Ringe an ihren Fingern piekten. „Ich bin Gundula Zöllner. Wenn du mal nicht weiter weißt, frage mich! Nur keine falsche Scheu!“
Sie lachte für mein Empfinden etwas zu schrill. Bei dem Gedanken an ihre feuchten Qualmwolken, gepaart mit süßlichem Parfümgeruch, wird mir jetzt noch übel.
Als angenehme Überraschung entpuppte sich der zierliche Mann, der mit mir das Interview geführt hatte. Hinter den dicken Brillengläsern blitzten intelligente braune Augen, an deren Rändern sympathische Lachfältchen saßen. „Ich heiße Herbert Dabelstein. Sagen Sie ‚Herbie‘, das tun alle!“
Der Polizeireporter Jelzick popelte am nächsten Morgen während der Redaktionskonferenz gelangweilt seine Frühstücksreste aus einer Zahnlücke. „Heute ist tote Hose!“, lispelte er, und weil ein Finger noch zwischen den Zähnen klemmte, schaltete er mit den restlichen Fingern das Funkgerät ein.
„Der Peter Heimann ist verunglückt! Tragische Sache!“, meldete sich Herbie zu Wort. „Da könnten wir eine Meldung bringen.“
„Wer is ‘n das?“ Jelzick kratzte inzwischen mit einem Bleistift das Schwarze unter seinen Nägeln hervor.
„Ein Abgeordneter von den Konservativen. Jung – dreiundzwanzig Jahre alt. Aufstrebendes Talent, hoffnungsvoller Nachwuchspolitiker!“
„Umweltausschuss, oder?“, überlegte Gundula.
Herbie nickte. „Er ist zugedröhnt mit seinem Wagen in die Kieskuhle gefahren und hat irgendwie die Kontrolle verloren. Jedenfalls stürzte er mit dem Auto den Abhang runter. Der Wagen landete in der Böschung. Er wurde herausgeschleudert und hat sich das Genick gebrochen. Vermutlich nicht angeschnallt. Der Leichnam trieb am Ufer des Sees.“
„Was hatte er intus?“ Jelzicks Neugierde war geweckt.
„1,8 Promille Alkohol und Ecstasy. Ich habe in deinem Revier gewildert und mit der Polizei gesprochen.“
„Dieser Cocktail reicht, um einen ausgewachsenen Mann kirre zu machen“, bestätigte Jelzick.
„Wissen die schon, was dahinter steckt?“ Wagner trommelte ungeduldig mit einem Filzstift auf die leeren Layoutbögen.
„Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Polizei vermutet Selbstmord unter Drogeneinfluss. Anscheinend hat er alleine im stillen Kämmerchen getrunken. Jedenfalls existieren keine weiteren Zeugen.“
„An der gleichen Stelle ist vor einigen Monaten schon mal einer von diesen Nachwuchspolitikern tödlich verunglückt. Ich glaube, er wickelte sich samt Auto um einen Baum“, bemerkte Jelzick.
„Ja genau, im Herbst. Auch einer von den Konservativen“, stimmte Gundula ihm zu.
„Soll ich nun eine Meldung schreiben?“, bohrte Herbie nach.
„Na gut, machen Sie einen Nachruf! Fünfzig Zeilen inklusive Foto auf der Zwei, links oben!“, befahl der Chef.
Herbie würde es mit einem ‚tragischen Unglücksfall‘ umschreiben. Für Selbstmörder gab es keinen Platz in der Presse.
Ich betrachtete das Foto, das wenig später auf Herbies Schreibtisch lag. Peter Heimanns große Augen schauten ernst und fragend. Ich wusste nicht, warum, aber irgendetwas schienen sie mir sagen zu wollen. Ob er zum Zeitpunkt der Aufnahme schon mit dem Gedanken gespielt hatte, sein Leben zu beenden? In den dunklen Pupillen entdeckte ich jeweils einen hellen Fleck, der darin wie ein Hoffnungsschimmer aufzuflackern schien. Und doch war für ihn nun alles verloren!
Eine halbe Stunde später steuerte ich Tante Carlottas Polo in ein Kaff außerhalb von Rosenhagen, wo mich irgendein Nachbarschaftsstreit erwartete. ‚Rumpel‘ – schon der Name ließ mich an vermüllte Dachspeicher denken. Hätte ich geahnt, auf welchen gefährlichen Job ich mich einließ, wäre ich sofort nach Hamburg zurückgedüst!
Ich kurvte an Äckern und Kuhwiesen vorbei durch eine Siedlung von kleinen, spitzen Einfamilienhäusern aus den 50er-Jahren. In den herausgeputzten Vorgärten standen Stiefmütterchen, Tulpen und Narzissen in exakten Winkeln und Kurven um die Rasenflächen gruppiert. Blau, gelb, rot – immer hübsch abwechselnd. Beim Pflanzen hatten sich die Bewohner viel Mühe gegeben, als ob die Blumenrabatten signalisieren sollten: Seht ihr, bei uns ist alles in Ordnung!
Ein Mädchen in Vics Alter rannte unbekümmert knapp vor meinem Auto über die Straße.
In Gedanken sah ich plötzlich die braunen Augen meiner Schwester vor mir, aus denen sonst die Frechheit nur so sprühte, und die Erinnerung holte mich ein. Groß und traurig wie zwei dunkle Sterne hatten sie mich zum Abschied angeblickt. „Denkst du manchmal an Mutter und unsere kleine Wohnung in der Hasselbrookstraße“, fragte sie leise.
„Natürlich!“ Ich wollte ihr über den Kopf streichen, aber sie drehte ihn so energisch weg, dass ihre Baseballkappe leichte Schieflage bekam.
Vic krauste die Nase und zog sie geräuschvoll hoch. Ihr rechtes Augenlid zuckte ein wenig. Sie presste ihre Lippen fest aufeinander, als könnte sie auf diese Weise das verräterische Beben unterdrücken. Vic hasste Heulsusen – eher biss sie sich die Zunge ab, als eine Träne zu verlieren. Aus ihrem Kindergesicht war alle mutwillige Dreistigkeit, die ihr normalerweise den coolen Anstrich einer rotznäsigen Erwachsenen verlieh, weggewischt. Zurück blieb der verwundete Ausdruck eines elfjährigen Mädchens, das nicht verstand, warum die Menschen, die sie am meisten liebte, sie alleine ließen.
Bei Sophie und Thilo ist sie in besten Händen – versuchte ich, mein aufgewühltes Gewissen zu beruhigen. Ich kann ständig nach Hamburg fahren und sie besuchen. Ist ja nicht weit! Es misslang! Ich hatte in ihrem Alter ein richtiges Zuhause gehabt. Wenn auch beengt und bescheiden, so wusste ich doch, wo ich hingehörte. Vic fühlte sich bei Sophie oft nur geduldet. Sie sprach es zwar nie aus, trotzdem ahnte ich, dass in Sophies Musterhaushalt eine vorlaute Elfjährige voller verrückter Einfälle ein störendes Element war. Meine kleine Schwester baute auf mich, und ich enttäuschte sie. Ich war eine Versagerin!
„He, Partner!“ Ich knuffte sie scherzhaft, wie es die Akteure eines von ihr geliebten Actionfilms taten.
Normalerweise knuffte sie dreimal so grob zurück. Damals drehte sie sich um und ging wortlos davon.
Ein Stich fuhr mir mitten durchs Herz und zerteilte es in zwei Hälften. Niemals würde ich das vergessen. Vic, du sollst nicht mehr traurig sein!, schwor ich mir in diesem Moment. Ich werde alles tun, damit du bald zu mir ziehen kannst!
Ich kurbelte die Scheibe ein Stückchen herunter und sog gierig den zarten Blütenduft als Vorboten wärmerer Tage ein. Je weiter ich mich der Dorfmitte näherte, umso älter wurden die Häuser. Ursprünglich hatte es hier offensichtlich nur einige Bauernhöfe gegeben, von denen nur noch die wenigsten landwirtschaftlich genutzt wurden. Stattdessen schienen die Städter den Reiz der roten Backsteinhäuser für sich entdeckt zu haben, um auf dem Lande Nester für junge Familien zu schaffen. Ich holperte über Kopfsteinpflaster. Der Polo hopste, als hätte er Känguruhbenzin gefrühstückt.
Nach viertelstündiger Suche – ich war inzwischen drei Mal am romantischen Dorfweiher vorbeigekommen, hatte drei Mal den Gestank eines riesigen Misthaufens eingeatmet und war drei Mal eine beeindruckende Allee mit Silberpappeln rauf- und runtergefahren – stoppte ich neben einem Mann im dreckigen Overall, der eine Schubkarre voll Stroh über den Bürgersteig bugsierte. „Können Sie mir sagen, wo die Hausnummer 17 ist?“
„Jo!“
„Äh, wo ist sie denn?“
Mit kargen Worten, aber fuchtelnden Handbewegungen beschrieb er mir den Weg. Stirnrunzelnd beäugte er zum Abschied mein Hamburger Nummernschild, als wolle er ausdrücken, dass die Dorfbewohner von all den großkotzigen Städtern, die hier eindrangen, die Nase voll hatten.
Die Hausnummer 17 klebte verschämt am verwitterten Briefkasten einer morschen Gartenpforte. Letzte Farbspuren ließen darauf schließen, dass sie einst tannengrün gestrichen war. Dahinter verbarg sich ein verwilderter Vorgarten, in dem feuchte Laubhaufen vom Herbst lagen. Der Wind spielte mit den Blättern und verteilte sie ungeniert auf den Gehweg. Keine Stiefmütterchen, Tulpen oder Narzissen, dafür rankten Efeu und Wilder Wein an der Fassade des alten Hauses hoch. Sie bedeckten den roten Backstein und reichten bis zum bemoosten Dach. Misstrauisch zog ich den Kopf ein aus Furcht, gleich einige der lose wirkenden Dachpfannen auf mein eigenes Dach zu bekommen. Stattdessen stolperte ich über einen herumliegenden leeren Blumentopf. Scheppernd hüpfte er zur Seite. Ein Sonnenstrahl brach sich auf der blinden Glasscheibe der Fensterfront. An einer Stelle war das Glas gesprungen und notdürftig mit Zeitungspapier geflickt.
Erschrocken zuckte ich zusammen, als sich quietschend neben mir die Eingangstür öffnete.
Im Rahmen stand eine Frau, deren Kopf fast auf der Brust lag, da ein großer Buckel ihren Rücken wie einen Flitzebogen spannte. Sie spreizte ihren knochigen Zeigefinger zum Zeichen, dass ich eintreten sollte. Einen Moment lang zögerte ich, weil mir Hänsel und Gretel einfielen.
Ich folgte ihr in einen dunklen Flur, dem ein muffiger Geruch nach ungewaschenen Körpern, Staub und verwesenden Lebensmitteln entströmte. Die Duftquelle konnte ich wegen der mangelnden Beleuchtung nicht ausmachen. Eine einzelne Glühbirne baumelte an einem losen Draht von der Decke.
Im angrenzenden Raum bot meine greise Gastgeberin mir einen zerschlissenen roten Samtstuhl zwischen gammeligen Möbeln an, die über und über mit halbfertigen Kleidungsstücken und bunten Stoffen bedeckt waren. Vorsichtig entfernte ich ein Stecknadelkissen, das an der Stuhllehne klemmte. Sie war Schneiderin. Ich glaubte kaum, dass sie eine große Kundschaft besaß. Dankend lehnte ich es ab, etwas zu mir zu nehmen. Gleichzeitig nahm ich mir vor, meine Wohnung in Zukunft öfter aufzuräumen, sonst würde ich eines Tages auch als solch alte Schlampe enden.
Die Schneiderin wandte mir ihren Kopf mit dem grauen Filzgestrüpp, das sich im gewaschenen Zustand als Haar entpuppen würde, zu. Auf ihrem von Runzeln zerfurchten Gesicht, in dem erstaunlicherweise anstelle einer Hakennase eine Durchschnittsnase saß, lag ein lauernder Ausdruck, als wüsste sie nicht genau, was sie von mir erwarten könnte. Sie nestelte an ihrem Umhang, der ihre gebeugte, unförmige Figur wohl kaschieren sollte. Dabei öffnete er sich, und eine mehrfach gestopfte Bluse blitzte durch. Entweder war die Frau direkt dem Märchenbuch entstiegen oder hinter der Tür war die versteckte Kamera postiert. Als mich kein Fernsehmoderator aus dieser Umgebung erlöste, konzentrierte ich mich auf die Tiraden, die die Alte ausstieß.
Ihr Vermieter schikaniere sie nach allen Regeln der Kunst, um sie loszuwerden. Nächtliche Anrufe und Drohbriefe. „Er wollte sogar einen meiner Hunde vergiften!“ Ihre trüben Augen füllten sich mit Tränen.
Ich riskierte einen Seitenblick auf die beiden braunen Köter, die hechelnd vor ihren Füßen lagen. Bisher hatte ich versucht, mich durch möglichst unauffälliges Verhalten ihrer Aufmerksamkeit zu entziehen. Besonders vertrauenerweckend fand ich sie nicht.
Die Alte streichelte ihren Lieblingen die glatten Köpfe, schnippte einen unsichtbaren Floh aus dem Fell und jammerte weiter über ihren unmenschlichen Vermieter. Als letzte Schandtat hatte der Unhold Stacheldrahtrollen rings um ihre Terrasse aufgetürmt.
Okay, das gab ein gutes Fotomotiv! Die arme Alte, die anklagend auf den Stacheldraht deutete – so was rührte die Leser. Mit diesen Gedanken an eine herzergreifende Story stolperte ich hinter ihr her durch unzählige Rumpelkammern, in denen ich mehr als eine Rattenzucht vermutete. Ich stieg über leere Konservendosen, räumte Pappkartons zur Seite und kämpfte mit Kleidungsstücken, die plötzlich an den unmöglichsten Stellen von der Decke schlackerten.
Erleichtert atmete ich auf, als wir endlich draußen auf den grauen Waschbetonplatten standen, die die Alte hochtrabend als ‚Terrasse‘ titulierte. Dahinter erstreckte sich ein weitläufiger Garten mit einem Holzhäuschen.
„Da wohnt er.“ Sie zeigte auf ein weißes Haus hinter der Gartenlaube.
Ich begriff, dass ‚er‘ ihr Vermieter war.
Die Stacheldrahtrollen hatte bereits jemand weggeräumt. Sie lagen aufgeschichtet neben dem Holzhaus auf der Seite, die zum Garten des Vermieters gehörte. Wenn ich von einer Idee besessen bin, kann mich nichts groß aufhalten. Kurz entschlossen begann ich, die Stacheldrahtrollen, so gut es ging, wieder vor die Terrasse zu zerren. Gar nicht so einfach! Ich schützte meine Hände mit den überall herumliegenden Lappen und Tüten, ritzte mir aber trotzdem die Finger ein. Keuchend registrierte ich, dass mein Deo versagte. Blut und Schweiß.
In diesem Moment bogen zwei Männer um die Hausecke. „He, was machen Sie da?“
Als ich die Uniform des einen sah, schwante mir nichts Gutes.
Der andere Typ zeterte gleich los: „Aha, so läuft das also! Um mir was anzuhängen, hat sie sich jetzt Helfer besorgt!“ Unzweifelhaft handelte es sich um den boshaften Hauseigentümer. Wut verzerrte sein birnenförmiges Gesicht mit den kleinen Schweinsäugelein und der Knollennase. Er war so Mitte fünfzig. Blass, hager und hoch aufgeschossen funkelte er mich an und zwirbelte an seinem rötlichen Vollbart, den erste graue Fäden durchzogen.
Der rundliche Dorfpolizist zückte diensteifrig sein Notizbuch, um meine Personalien aufzunehmen.
Diese Aktivitäten besänftigten den missgünstigen Vermieter. Er ließ seinen Bart in Ruhe. Sein rechter Arm klappte nach unten. Selbstvergessen fasste er sich an den Schritt. Ein hämisches Grinsen umspielte seine dünnen Lippen und gab ihm etwas Schmieriges.
Na, fein, da war ich ja gleich in das erste Fettnäpfchen getappt!
„Die Volkshochschulen haben ihre neuen Jahresprogramme herausgebracht. Das müssen wir als Aufmacher nehmen“, schlug Gundula vor und betrachtete zufrieden ihre kirschrot lackierten Krallen. Zur Bekräftigung schickte sie Edfried Wagner, der die Themen der morgigen Ausgabe notierte, ein langes Zwinkern. Ihre quäkende Stimme erinnerte an eine Stockente, die glaubte, lauter Küken um sich herum zu haben, die sie bevormunden musste. Das Schweigen ihrer Kollegen wertete Gundula als Zustimmung. „Ich habe eben immer eine Idee.“ Sie gackerte wieder. Dabei zeigte sie ihre großen weißen Zähne, die von Lippenstiftspuren geziert wurden. Beim Lachen wackelte sie mit dem Kopf, sodass die goldene Brille auf und ab wippte. Meinte die Frau das ernst oder spielte sie die Komikerin vom Dienst?
In diesem Moment buchte Gundula mich sicherlich auf die Liste ihrer vermeintlichen Bewunderer, dumm und dreist, wie sie war. Ich hielt mich bescheiden im Hintergrund, getreu der Weisheit: ‚Neue Kollegen sieht man lieber, als dass man sie hört!‘ Später machte ich öfters Bekanntschaft mit Gundulas scharfer Zunge. Um ihre eigene Unfähigkeit zu überspielen, hatte sie sich so eine Art Mutter Theresa-Image zugelegt und meinte, an jeder menschlichen Figur ihr Helfersyndrom ausprobieren zu müssen – ob derjenige nun wollte oder nicht. Tief besorgt, verzog sie dann immer ihre Augen hinter den Brillengläsern zu Schlitzen und äußerte mitfühlend: „Das konntest du ja noch nicht wissen!“ Es klang, als erläuterte sie einem Fünfjährigen Fortpflanzungspraktiken.
Die erste Kostprobe lieferte Gundula in der gleichen Stunde. Auf Herbies Apparat rief der Stacheldrahtvermieter an, von dem sich die schlampige Schneiderin schikaniert fühlte. Natürlich, um sich über mich zu beschweren und mit seinem Anwalt zu drohen.
Gundula witterte ihre Chance. Sie gab Herbie einen Wink. „Lass nur, ich kümmere mich schon darum! Gleich ist Deadline, dein Artikel ist ja noch nicht fertig!“ Im Nu hatte sie Herbie den Hörer aus der Hand gerissen, um glucksend schleimig mit dem Anrufer zu parlieren. „Nein, selbstverständlich schreiben wir nichts.“
Pause.
„Es tut mir leid, wenn Sie Unannehmlichkeiten gehabt haben! Meine junge Kollegin weiß noch nicht Bescheid.“
Kichern.
Und so weiter und so fort. Offensichtlich kannte sie ihn. Sie redete ihn jetzt mit ‚Herr Prange‘ an.
Unruhig saß ich da, streckte ab und an die Hand zum Hörer hin. „Ich kann selbst mit ihm sprechen“, drängte ich im Flüsterton.
Aber Gundula stellte auf Durchzug und ließ mich nicht. „Ach, der!“, meinte sie abfällig, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte.
Ich dachte, damit sei die Sache erst mal gegessen. Nicht so Gundula, die die Gunst der Stunde augenscheinlich genutzt hatte, um mich beim Chef zu verpetzen.
Er rief mich in sein Büro. „Frau Zöllner sagte, es habe sich jemand über unsere Zeitung beschwert, weil Sie unbefugt gehandelt hätten. Wir sind als loyal und korrekt angesehen und können uns solche Vorkommnisse nicht leisten! Frau Zöllner meinte, Sie hätten es nicht absichtlich getan, sondern würden sich mit Berichterstattung in dieser Form nicht auskennen. Das hat sie sicherlich nett gemeint, nur uns nützt das nichts! Ich habe Sie nicht als Praktikantin, sondern als Redakteurin eingestellt. Und solche Artikel gehören zu unserem täglichen Brot. Mit Gespür und Feinsinn müssen wir die Themen angehen. Wenn Sie das nicht können, habe ich leider keine Verwendung für Sie“, drohte er mit streng gekrauster Stirn, auf der sämtliche Adern kurz vor dem Platzen waren.
Einen Moment lang gaben meine Beine nach. Puddingknie. Nicht schon wieder!, schoss es mir durch den Kopf. Aber eine echte Kämpfernatur lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Retten, was zu retten ist!, lautete jetzt die Parole. Ich riss mich zusammen und erklärte mit zittriger Stimme, dass es mir nur um ein gutes Fotomotiv gegangen sei, um die Geschichte anschaulich zu illustrieren.
Edfried Wagner ließ daraufhin einen kleinen Vortrag über political correctness und Ähnliches ab, das nicht zum Thema passte. Er holte eine Banane aus seinem Jutebeutel und fuchtelte damit umher, um die Bedeutung seiner Worte zu unterstreichen.
Währenddessen sammelte ich wieder Mut. „Ich werde dann nur ein Porträtfoto von der Schneiderin nehmen.“
Diese Ignoranz verschlug meinem Chef die Sprache. Er klatschte die Banane auf den Schreibtisch. Die Schale platzte, Fruchtfleisch quoll hervor. „Sie wollen diese Geschichte trotzdem schreiben? Die bringt uns nur Ärger ein!“
„Die Frau wird wirklich von ihrem Vermieter schikaniert. Sie sagt, er habe sogar versucht, einen ihrer Hunde zu vergiften.“
„Können Sie das beweisen? Ich will keinen Disput mit Anwälten. Das wird teuer und schadet unserem Ansehen!“ Er klaubte die Reste seiner matschigen Banane auf. „Haben Sie das endlich kapiert?“
Ich hatte und schlich mit hängenden Schultern an meinen Arbeitsplatz zurück.
Gundula schenkte mir ein barmherziges Schwesternlächeln. „Der Alte spinnt manchmal. Den muss man nicht so ernst nehmen!“
Am Abend zeigte mir Herbie die Technik im Keller, wo unsere Texte und Fotos von einem Metteur nach den Umbruchvorlagen auf die Seiten montiert wurden. So was hatte ich noch nie gesehen. Willkommen in den Fünfzigerjahren! Ein richtiges Zeitungsmuseum!
Metteur Willy im blaugestreiften T-Shirt hantierte wie ein Chirurg mit dem Messer in unseren Textausdrucken herum, um sie anschließend Absatz für Absatz sauber auf die Seiten zu kleben. Dazwischen platzierte er Fotos. Fasziniert betrachtete ich Willys Bierwampe, die sich der Tischschräge perfekt angepasst hatte. Vier andere Kollegen waren damit beschäftigt, Anzeigen zusammenzubasteln.
Barbara, die Laborantin, wirbelte hier wie eine Unterirdische umher. Von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, war sie an ihrem dunklen Arbeitsplatz gut getarnt. Für ihre Zukunft sah ich tatsächlich schwarz. In meinem früheren Verlag existierten weder Fotolaboranten noch Techniker. Alles lief auf digitalem Weg direkt ins Druckzentrum.
„Mensch, Herbie, jetzt is‘ es soweit: Bald sitzt der alte Willy auf seinem eigenen Bootssteg und angelt.“ Willy haute Herbie kräftig auf die Schulter, aber der ging nicht in die Knie. Anscheinend war er robuster, als er aussah.
„Willy träumt von einem Grundstück auf dem Gottesanger. Er will dort mit seiner ganzen Familie bauen“, erklärte Herbie mir, als wir wieder nach oben gingen.
„Was ist der Gottesanger?“
„Ein riesiges Gelände hinter dem alten Friedhof, zentral gelegen und gleichzeitig im Grünen. Die Tale fließt unmittelbar vorbei. Bis vor Kurzem gehörte es einer Sekte. Jahrelang hat der Stadtrat versucht, die Glaubensgemeinschaft zu vertreiben und zum Verkauf zu zwingen. Das Grundstück ist nun städtisches Eigentum, wird in mehrere Parzellen unterteilt und als Bauland an die Rosenhagener Bürger verkauft. Jeder Interessent soll die Chance bekommen, ein Gebot für sein gewünschtes Stück Land abzugeben. Das ist momentan unser Topthema, sozusagen der Dreh- und Angelpunkt des öffentlichen Interesses.“
„Wollen da viele Leute bauen?“
„Natürlich, gutes Bauland ist rar. Außerdem ist die Lage optimal. Nur fünf Minuten zur Fußgängerzone mit sämtlichen Geschäften entfernt und trotzdem mitten in der Natur am Ufer der Tale gelegen. Das sind Sahnegrundstücke, nach denen sich viele die Finger lecken. Kein Wunder, dass unsere Abgeordneten jahrelang gegen die Sekte prozessiert haben, um das Land in den Besitz der Stadt zu bringen.“
„Wie haben sie die Sekte weggekriegt?“
Herbie lachte. „Gar nicht! Die Sekte ist auseinandergebrochen, weil der Guru nach Neuseeland auswanderte. Man sagt, er hätte irgendwelchen Dreck am Stecken, weswegen er Rosenhagen überstürzt den Rücken kehrte. Also haben er und seine Anhänger der Stadt das Land zu einem Spottpreis hinterlassen. Und nun können die Quadratmeterpreise in die Höhe getrieben und die leeren Stadtkassen aufgefüllt werden.“ Herbie verzog sein gutmütiges Gesicht wieder zu einem Schmunzeln. „Die offizielle Version lautet anders. Da mimen unsere Politiker die Helden, die die Ungeheuer vertrieben haben. Das wirst du heute Abend live erleben.“ Mein Kollege spielte auf die Stadtratssitzung an, die ich gleich besuchen sollte. Edfried Wagner hatte gemeint, so könne ich mich am schnellsten mit den wichtigen Themen und Leuten der Stadt vertraut machen.
Kapitel 4
Ich ging mit einem Sack voller Ermahnungen und Ratschlägen von Gundula im Gepäck. Einen wichtigen Tipp hatte sie mir verschwiegen: Nämlich eine lange Unterhose und einen dicken Wollpulli anzuziehen! Die Sitzung wurde in der Aula des hiesigen Gymnasiums abgehalten. Große Bäume und Büsche vor den Fenstern sorgten dafür, dass es hier das ganze Jahr über schattig blieb. Außerdem zog es aus undichten Ritzen wie an der Nordsee. Fröstelnd kauerte ich mich auf dem viel zu kleinen Holzstühlchen zusammen. So mancher Pennäler hatte sich verewigt. ‚Guschi ist ein Arsch, weil er ...‘, stand da zum Beispiel. Ich versuchte, während einer Rede des Bürgerworthalters, der so was wie der Boss der Stadtverordneten war, zu entziffern, warum Guschi ein Arsch war. Es gelang mir nicht.
Ich merkte schnell, dass die heutige Sitzung vor allem dazu diente, die Stadtabgeordneten zu feiern. Gemeinsam durch alle Fraktionen hindurch huldigte und lobte man sich, den Gottesanger aus den Klauen der Sekte befreit und nun der Vaterstadt mit ihren braven Bürgern zur Verfügung gestellt zu haben. Das Publikum, das aus jenen braven Bürgern bestand, jubelte seinen gewählten Vertretern zu. Klar, viele hofften auf ein schönes Grundstück!
Der Bürgermeister Horst Huber rollte wie eine Billardkugel, die von einem unsichtbaren Stoß getrieben wurde, zielsicher zum Rednerpult. Ein dunkler Anzug schmiegte sich als Wurstpelle um seine gedrungenen Figur. Wie eine Wassermelone thronte sein runder Kopf auf dem kurzen Hals. Das Vollponytoupet und der Schnauzbart ließen nur die kleinen braunen Augen frei, um die sich leichte Fältchen ringelten. Ich schätzte Huber auf fünfzig. Offensichtlich ein Mann, der gutes Essen liebte. Seine Bassstimme tönte vollmundig durch die Aula: „Der Bürgermeister selbst war hoch erfreut, als er die freudige Botschaft über das freudige Ereignis zugetragen bekam ...“ Er sprach tatsächlich von sich in der dritten Person! „Schlussendlich siegt immer das Gute – so ist es auch in diesem Fall! Ein jahrelanger Kampf, in dem wir Sozialdemokraten stets im Sinne von Aufrichtigkeit und Tugend gehandelt haben, ist beendet. Sie sehen hier die Sieger zum Wohle unserer Stadt ...“ In diesem Stil palaverte er geschlagene zwanzig Minuten weiter.
Hubers Gegner von der Opposition, Ludwig von Stetten, dürfte innerlich kochen. Er ließ sich nichts anmerken und beschrieb blumig die große gemeinsame Idee aller Fraktionen. Von Herbie wusste ich, dass dieser Ludwig von Stetten seit Jahren vergeblich versuchte, Bürgermeister zu werden. Er scheiterte jedes Mal an den Mehrheitsverhältnissen, die in Rosenhagen stets zuungunsten der Konservativen ausfielen. Repräsentativer wäre von Stetten: schlank, 1,80 Meter groß, blonde Locken, braun gebrannt, dunkelblauer, perfekt sitzender Anzug und mindestens zehn Jahre jünger als Huber. Ein frisches, sympathisches Gesicht mit humorvollen Augen, das die Wähler reihenweise in seinen Bann ziehen müsste.
Jetzt stand wieder einer von Hubers Partei auf, um in den allgemeinen Salmon einzustimmen. Die hagere Gestalt mit dem rötlichen Vollbart hatte ich schon einmal gesehen ... Während er redete, wanderte seine Hand Richtung Hosenschlitz, als überprüfe er, ob sein Stall ordnungsgemäß verschlossen war. Erschrocken stoppte er auf halber Höhe ab, weil ihm offensichtlich eben einfiel, dass er sich nicht vor den Augen des Publikums an den Schritt fassen durfte.
Meine Güte! Ein heftiger Schreck fuhr mir durch die Glieder. Der Stacheldrahtvermieter! Hatte Gundula nicht ständig „Herr Prange“ am Telefon gesäuselt? Daher kannte sie ihn also! Das Glück war mal wieder voll auf meiner Seite!
In der Pause wurde mir ungeahnte Aufmerksamkeit zuteil. Charmant begrüßte mich Ludwig von Stetten. Er machte einen angenehmen Eindruck, wirkte unkompliziert. Anscheinend war es für die hiesigen Politiker wichtig, jeden Journalisten persönlich zu kennen. Nachdem von Stetten auf elegante Weise – „Ich sehe da gerade Herrn Sowieso ...“ – unseren Smalltalk beendet hatte, stand der Nächste aus seinem Gefolge vor meinem Tisch.
„Ken Winter, ich bin der stellvertretende Fraktionsvorsitzende.“ Wieder so ein sonnenbankgebräunter Charming-Boy im konservativem Einheitsanzug, Anfang vierzig, jungenhafter Typ, braune Haare. Wenn er lächelte, bildete sich ein entzückendes Grübchen im Kinn. Er wirkte ein bisschen wie der Barbiepuppen-Mann – seinen für hiesige Verhältnisse extravaganten Vornamen trug er zu Recht! Ich sah lebhafte schwarze Punkte in seinen blauen Augen funkeln, weil sie sich mit meinen genau in einer Höhe befanden. Winter war ein kleiner Mann mit großer Ausstrahlung.
Er lachte mich vom ersten Moment so vertraulich an, dass ich das Gefühl hatte, wir würden uns seit Langem kennen. „Das ist ja für die Rosenhagener Presse eine attraktive Bereicherung. Ich freue mich.“ Worüber er sich freute, blieb offen, aber seine Gestik signalisierte großes Interesse. Nachdem bisher bei mir wenig glatt gelaufen war, schmeichelte es mir. Während der belanglosen Redeschwälle, die seine Kollegen auf dem Podium abfeuerten, lächelte er später ständig in meine Richtung und zwinkerte mir unauffällig zu. Ein Flirt mit einem konservativen Politiker in einer zugigen Schulaula war allerdings das Letzte, das ich erwartet hatte!
Einer von den Grünen schlurfte auf Holzlatschen zum Rednerpult. Als wandelnde Schlaftablette und in ein ausgeleiertes Sweatshirt in verwaschenen Regenbogenfarben sowie eine schlabberige lila Stoffhose gehüllt, faselte er langatmig in breiter Aussprache davon, dass man nun im Allgemeininteresse handle, wenn die Grundstücke ausgeschrieben würden. Endlich hätten auch Randgruppen und sozial Benachteiligte faire Chancen. Wieso, leuchtete mir zwar nicht ein, denn Geld musste ja bezahlt werden, aber Huber gab dem Öko nach einer Weile einen Wink, jetzt endlich das Maul zu halten. Die Grünen hatten wohl nicht viel zu melden. Wenn sie weiter mit Huber regieren wollten, mussten sie sich seinen Genossen unterordnen. Müde sank der Öko wieder auf seinen Stuhl, wo er verstohlen ein herzhaftes Gähnen unterdrückte.
In der abschließenden Einwohnerfragestunde erkundigten sich aufgeregte Bürger nach dem Bewerbungsprozedere. „Gleiche Chancen für alle Rosenhagener“, versicherte ihnen Huber ständig und erntete jedes Mal viel Applaus.
Als er sich zum fünften Mal gnädig lächelnd verbeugte, sprang eine Frau mit kurzen roten Haaren, Anorak und Jeans auf. „Warum müssen wir alles zubetonieren?“, kreischte sie schrill.
Huber und die anderen schauten sie verdutzt an. Mit Kritik hatten sie nicht gerechnet.
„Am Ufer der Tale sind Brut- und Nistplätze des Flussregenpfeifers und der Wasseramsel. Hier gibt es viele Kleinbiotope für Amphibien und Insekten. Wollen Sie diesen Lebewesen ihren letzten Lebensraum wegnehmen?“
„Wir möchten selbstverständlich die Natur erhalten. Es wird eine Zone am Uferrand der Tale ausgewiesen, die nicht bebaut werden darf. Sie können also ganz beruhigt sein, dass die Tiere nicht vertrieben werden.“ Huber sprach sanft, als könne er auf diese Weise die lästige Bürgerin zum Schweigen bringen.
„Ha!“, schrie die Frau. „Haben Sie das gehört? Das können Sie niemandem weismachen. Die Grundstücke werden bis zum Fluss runtergehen, dann machen die Besitzer dort, was sie wollen.“
War Huber ärgerlich, so hatte er sich so gut in der Gewalt, dass man es ihm nicht ansah. „Jeder erhält die Auflage, bis unten heran weder zu bauen noch etwas zu verändern, was der Natur schaden könnte.“
„Sobald da unten erst mal die vielen Leute herumtrampeln, gibt’s für die Tiere keine ruhige Minute mehr. Ich verlange die Ausweisung des Gottesangers zum Naturschutzgebiet! Mein Name ist Hanselmann. Sie werden von mir hören!“ Die militante Frau ließ sich nicht beschwichtigen.
Huber bekam Hilfe von anderer Seite. Mit lauten Buhrufen und Grummeln kommentierten die Bürger Frau Hanselmanns Forderung. „In der Kieskuhle ist genügend Platz für die Vögel!“, rief einer.
„Genau! Und wo bleiben wir Menschen?“, krakeelte ein anderer.
„Eben! Die Großstädter haben unsere Dörfer ringsum zugebaut. Jetzt sind wir Rosenhagener mal am Zug!“, ereiferte sich wieder einer.
Eine Glocke bimmelte, um die erregten Gemüter zu beruhigen. „Ruhe bitte!“, mahnte der Sitzungsvorsitzende.
Frau Hanselmann schlug eine Welle der Feindseligkeit entgegen. Sie stand auf verlorenem Posten. Offensichtlich waren die anderen Einwohner zu heiß auf die begehrten Grundstücke, um sich Gedanken über Naturschutz zu machen. Mit geballter Faust in Richtung Huber und Restpolitiker verließ sie wütend die Aula.
Ich beschloss, ihren kurzen Auftritt in meinem Artikel zu ignorieren, da es sich um eine einzelne Meinung handelte. Der Tenor einer Zeitung sollte die Stimme der Mehrheit sein, so viel war mir klar.
Ken Winter betrat das Podium. Forsch marschierte er zum Rednerpult. Minutenlang sagte er gar nichts, sondern starrte auf das aufgeregt murmelnde Publikum herab. Aber es reichte, dass er einfach nur dastand. Der Tumult, den Frau Hanselmann hinterlassen hatte, flaute ab. Die Leute verstummten. Gespannt schauten sie nach vorne, als erwarteten sie von Ken Winter neue Informationen. Die lieferte er nicht, er wiederholte die positiven Aspekte der Grundstücksbebauung seiner Vorredner. Trotzdem war es etwas anderes! Er stach alle mühelos aus. Endlich verstand ich die Bedeutung des Begriffs ‚Charisma‘. Es war die Art, wie er den Kopf hielt. So hoch, so stolz, als wollte er sagen: Was kostet die Welt? Ich kaufe sie! Oh, leichte Fältchen um Mund und Augen erzählten davon, dass sein Weg nicht immer einfach gewesen war, aber sie verliehen seinem Gesicht genau die richtige Prise von Seriosität. Lachfältchen, weil er versuchte, auch die leichten Seiten des Lebens mitzunehmen? Egal, so wie er den Rücken durchdrückte und dabei jeden Muskel seines Körpers anspannte, glaubte man ihm, über genügend Selbstdisziplin zu verfügen, um jegliche Probleme zu meistern. Und was für eine Stimme! Tiefe, Energie, Weichheit und Erotik klangen in jedem seiner Worte mit. Sie verselbstständigten sich zu Emotionen. Es prickelte. Seine Stimme füllte den Raum, schubste – ohne dass es sich rücksichtslos anfühlte – alle anderen menschlichen Laute weg. Niemand stellte eine Frage oder wagte gar einen Zwischenruf. Auf dem Inhalt lag kein Gewicht.
Ken Winter strahlte diese heitere Gelassenheit aus, die sich die meisten Menschen wünschen. Ob sie angeboren war oder ob er hart dafür trainiert hatte? Seine Augen funkelten, signalisierten Wachheit, was die anderen Politiker abgestumpft erscheinen ließ. Die Hände setzte er beim Reden sparsam ein, nur um ein Anliegen zu nuancieren. Als bildliche Pointe des Gesagten. Ganz anders Huber, der die ganze Zeit wie wild mit den Händen fuchtelte, bis gar nichts mehr wichtig wirkte – er wedelte seine Worte selbst weg. Oder der Grüne, dessen Arme schlaff wie ein welkes Bund Suppenkraut an den Seiten herunterhingen.





























