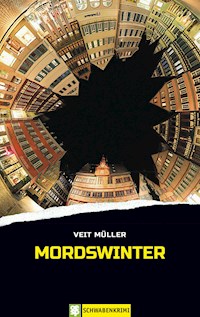
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Oertel u. Spörer
- Sprache: Deutsch
Ein heftiges Gewitter zieht über die kleine, beschauliche Stadt im Süden der Republik. Nennen wir sie jetzt einfach einmal Tübingen. Dort fristet der heruntergekommene Privatdetektiv Nick de Winter sein tristes Dasein. Seine Auftragslage ist sehr überschaubar, um nicht zu sagen, er hat keinen Auftrag. Null. Niente. Nix los in der Stadt. Was soll er da anderes machen, als nächtelang in seiner Stammkneipe herumzuhängen. Mit Blitz und Donner bricht plötzlich die Hölle über den Privatdetektiv herein. Er wird zuerst zum Lebensretter, dann zum Verdächtigen in einem Mordfall. Wer ist die geheimnisvolle schwarze Lady, die bewusstlos auf seinem Sperrmüll-Perser liegt? Was geht in der seltsamen Professorenfamilie auf Halbhöhenlage vor? Das wüsste Nick de Winter allzu gerne. Also ermittelt er. Was bleibt ihm auch anderes übrig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Veit Müller
ist in der Pfalz geboren und aufgewachsen. Er studierte in Tübingen Germanistik und Anglistik. Nach einem Zeitungsvolontariat machte er sich in Tübingen als Freier Journalist selbstständig. Im Jahr 2006 erschien sein erster Kriminalroman (»Zwischen den Zeilen lauert der Tod«). Es folgten vier weitere mit der Hauptfigur des unkonventionellen Journalisten Luka Blum. Danach war Veit Müller Herausgeber von fünf Anthologien mit Kurzkrimis. In einigen dieser Geschichten entwickelte er die neue Figur eines recht abgehalfterten Privatdetektivs. »Mordswinter« ist nun der erste Roman, in dem der Privatdetektiv Nick de Winter die Hauptrolle spielt. Veit Müller lebt in Tübingen, liebt Pfälzer Wein und irische und schottische Musik. Er ist Mitglied im Syndikat, der größten Vereinigung für deutschsprachige Kriminalliteratur. 2019 gehörte er der Jury zum Glauser-Preis des Syndikats an. Außerdem ist Veit Müller Autor von Freizeitführern.
Veit Müller
Mordswinter
Ein Schwabenkrimi
Oertel+Spörer
Dieser Kriminalroman spielt an realen Schauplätzen.Alle Personen und Handlungen sind frei erfunden.Sollten sich dennoch Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen ergeben, so sind diese rein zufällig und nicht beabsichtigt.
© Oertel+Spörer Verlags-GmbH + Co. KG 2021
Postfach 16 42 · 72706 Reutlingen
Alle Rechte vorbehalten.Titelfoto: Manfred Grohe
Gestaltung: PMP Agentur für Kommunikation, Reutlingen
Lektorat: Elga Lehari-Reichling
Korrektorat: Sabine Tochtermann
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-96555-112-1
Besuchen Sie unsere Homepage und informieren Sie sich über unser vielfältiges Verlagsprogramm:www.oertel-spoerer.de
Ich saß völlig durchnässt in meiner kahlen Wohnung und starrte vor mich hin. Ein Tisch, zwei Stühle, eine Couch, eine umgedrehte Kiste als Ablage, auf der eine Flasche Whisky samt Glas standen, ein Fernseher, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ein Laptop für mein Homeoffice – mit Abstand der wertvollste Gegenstand in meiner Bruchbude. Alles war zweckmäßig, mehr brauchte es nicht. Besuch bekam ich selten. Und wenn, dann blieb sie meist nur über Nacht und machte sich am frühen Morgen wieder aus dem Staub. Die Wände in meiner Dreizimmerwohnung am Rande der Innenstadt waren schmucklos, nur an einer hing, mit Reißzwecken angepinnt, eine vergilbte Kopie meiner Zulassung als Privatdetektiv, sonst gab es nur gähnende Leere. Und diese Leere antwortete auf meine vorsichtig aufkeimende Frage, was hast du, Nick Winter, in deinem Leben bisher zustande gebracht, eindeutig mit: nicht viel. Die Zahl meiner Aufträge in den vergangenen Monaten war überschaubar gewesen. Meist war es um Eifersucht gegangen, wie bei Irina oder Olga oder wie auch immer ihr Name war. Eine kurze Episode, die auch mich ein paar Tage auf die Sonnenseite des Lebens oder besser in eine Prachtvilla mit Pool geführt hatte. Mein Gott, nie werde ich diese engen, kurzen Hotpants vergessen. Ach, Irina. Oder hieß sie doch Olga? Egal. Unser Glück hatte nur ein paar Tage gehalten, dann war sie auf ihren Iwan umgeschwenkt und ich war Vergangenheit. Sie war weg, weg, wie mein Geld, und ich war wieder allein, allein.
Aber wenigstens hatte ich danach auch die süßen Früchte der Rache ernten dürfen. Und die schmecken immer am besten. Iwan, der kasachische Steppenhengst, hatte seine Hufe in allzu schmutzige Geschäfte gesteckt. Er hatte sich ordentlich vergaloppiert, um im Bild zu bleiben, und ich hatte ihn erwischt und ihm das Hand- oder besser das Hufwerk gelegt. Jetzt ist er von der Weide, der Hengst, wieder zurück im vergitterten Stall, auf sehr lange Zeit, und nicht ich, sondern Olga oder Irina oder wie auch immer war allein, allein. Was bei mir kein großes Bedauern ausgelöst hatte. Nein, ganz und gar nicht.
Doch ich schweife ab. Wieder zurück zum Regen, durch den ich gerade gewatet war. Er hatte ganze Arbeit geleistet. Ich triefte aus allen Poren und sorgte für eine kleine Regenpfütze auf meinem abgewetzten Perser. Dabei war der Wetterbericht gestern, den mir die Wolkenschieber im Fernsehen geliefert hatten, gar nicht so schlecht gewesen. Auch als ich meinen Trip um die Häuser gestartet hatte, war die Sonne noch fest an ihrem Platz über den alten Fachwerkhäusern gestanden, in denen die Biederkeit ihr Zuhause hat, und hatte mich zärtlich angelächelt. Vielleicht hatte die gelbe Scheibe am Himmel mich auch ausgelacht, weil ich normalerweise erst losziehe, wenn es dunkel ist, denn nur so kann ich diese Stadt ertragen, denn dann muss ich nicht in die Gesichter all dieser Menschen schauen, die immer glauben, alles besser zu wissen.
Es war kalt und ich war nass. Keine gute Kombination. Ich fror. Wieso war meine Bude so kalt, fragte ich mich. Die einfache Antwort: Wahrscheinlich hatte ich mal wieder die Heizkostenrechnung nicht bezahlt. Womit auch? Die Heizkörper jedenfalls waren so kalt wie normalerweise das Eis in meinem Whisky und änderten ihren Zustand auch nicht, nachdem ich sie aufgedreht hatte. Soll sie doch der Teufel holen, mich gleich dazu, denn in der Hölle war es wenigstens warm.
In solchen kalten Momenten ziehe ich normalerweise los und suche meine Stammkneipe auf, um mich dort zusammen mit Johnnie aufzuwärmen. Doch diese Variante hatte ich ja gerade hinter mir. Also blieb mir jetzt nur noch: frieren.
Einen kleinen Rest Wärme besaß ich noch von den Kneipen, die ich auf meiner Tour durch die Stadt aufgesucht hatte. Übrigens, Helligkeit stellt dort auch kein Problem für mich dar, denn diese Kneipen scheuen ebenfalls das Tageslicht wie der Teufel (da ist er schon wieder) das Weihwasser, deshalb suche ich sie ja auf. In ihnen treffe ich immer wieder auf die Gestalten, die fast jeden Tag am Tresen hängen. Viel gibt es in diesen Nächten nicht zu erzählen, man trinkt und schweigt. Und das ist gut so.
Am Ende jeder Tour wartet immer meine Stammkneipe auf mich. Ein Ritual. Das war auch heute – oder war es noch gestern – so gewesen. Und Sie werden es kaum für möglich halten, aber ich habe noch jede Einzelheit genau in Erinnerung.
Wenn Sie es nicht glauben, hier der Beweis: Joe stand hinterm Tresen, wie seit hundert Jahren schon, nickte mir still zu und schob mir ohne Kommentar ein Bier vor die Nase und einen Johnnie gleich hinterher. Ein guter Anfang, um den Abend abzurunden. Und Joe half mir dabei wie immer mit einem weiteren Johnnie. Ja, es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Johnnie kommt immer, wenn der Tag geht. Und es war Zeit, dass dieser Tag endlich ging, wie so viele vor ihm.
Und so hielt ich mich am Tresen fest und redete drei Sätze mit Joe. Ob er wirklich so hieß, keine Ahnung. Alle nannten ihn Joe, also nannte ich ihn auch so. Joe trug immer eine schwarze Jeans und ein weißes Hemd. Oder sagen wir besser: ein Hemd, das in grauer Vorzeit einmal weiß gewesen war. Für ihn schien schwarz und weiß wohl am besten geeignet für ein Kellner-Outfit zu sein oder vielleicht war es nur die Erinnerung an bessere Zeiten im Grand Hotel.
Was aber auffälliger an Joe war, das waren seine vielen Narben im Gesicht. Woher die kamen, wusste keiner. Vielleicht war es auch besser, wenn man es nicht wusste. Sie verschafften ihm jedenfalls Respekt. Wie auch seine tiefe Reibeisenstimme und die muskelbepackten Arme. All dies half ihm dabei, ohne viel Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, in den frühen Morgenstunden die letzten Schluckspechte vom Tresen und aus der Kneipe zu kehren.
Drei Sätze. Das reichte, um von Joe alles Neue über die Stadt zu erfahren. Ich musste ja nicht alles wissen, musste nicht jede neue Initiative oder Verordnung buchstabieren können. Sollten sie damit doch ihre kleine, heile Welt retten. Ich konnte ihnen dabei nur selten helfen, ich musste erst mal meine eigene Welt auf die Reihe bekommen.
Nach den drei Sätzen mit Joe hatte ich mich auf den Heimweg gemacht, ehe ich auch aus der Kneipe gekehrt worden wäre. Immer nach Norden und dann geradeaus. So konnte ich mein Zuhause nicht verfehlen. Aber der Regen war ein unangenehmer Begleiter gewesen und hatte mich vom Weg abbringen wollen, aber ich hatte wie immer Johnnie an meiner Seite und der zeigte mir den Weg. Und so hatte ich schließlich doch meine Wohnung erreicht und meinen Schlüssel aus der Tasche genestelt. Was nicht einfach gewesen war, genauso wenig wie das verdammt kleine Schlüsselloch zu finden. Ich schaffte es, bin schließlich ein Privatdetektiv und mit aller Art von Schlössern bestens vertraut. Ich kann sie ja fast schon im Schlaf öffnen.
Langweilig, mein kleiner Rückblick? Sorry, es gibt halt nicht mehr zu erzählen. Und so saß ich nun also auf meinem Stuhl, fror und dachte über die vergangenen Tage nach. Jeder war irgendwie gleich gewesen. Und die nächsten Tage werden wohl auch nicht viel anders werden. Ich stand auf und ging zum Kühlschrank. Es hätte mich überrascht, wenn er voll gewesen wäre. Aber ich fand immerhin noch ein Bier und die Reste der Take-away-Pizza vom Vortag. Das reichte für den ersten Hunger. Mehr brauchte ich nicht.
Ich legte meine .38er auf den Tisch, stellte mein Bierglas und den Pizzateller daneben. Ein gelungenes Stillleben. Zu meiner silbernen .38er habe ich ein inniges Verhältnis. Sie ist meine beste Freundin. Sie hat mich schon aus manch brenzliger Situation befreit, wenn mir die Argumente ausgegangen waren oder der Boden unter meinen Füßen zu heiß geworden war. Auf sie konnte ich mich verlassen. Immer. Und auf Johnnie. Verdammt noch mal, wo hatte ich die Whiskyflasche nur abgestellt?
Am nächsten Tag wachte ich verkatert gegen Mittag auf. Das Licht fiel durch meine Jalousien und stach mir in die Augen. So schnell würde die Sonne wohl nicht aufgeben. Auf, auf ins pralle Leben, sagte ich mir, drehte mich um und schlief noch eine Runde, der Beauty wegen. Dann stand ich auf, zog Shirt und Jogginghose an und machte mich hinaus in Feld, Wald und Flur. Ein Privatdetektiv braucht genügend Kondition, um die nächtlichen Recherchen an den Theken dieser Welt durchstehen zu können.
Nach meiner Tour durch die freie Natur stand noch eine halbe Stunde Workout an. Hanteln, Rope und Boxbirne – und Whiskey und Bier von gestern waren wieder rausgeschwitzt. Und mein Bauch war wieder stramm und flach, sagen wir: halb-flach.
Es war Zeit für die Dusche. Um den Rest des Tages angehen zu können, brauchte ich Wasser, viel Wasser und eiskalt. Ich schrie laut auf, tanzte zwischen den einzelnen Strahlen hin und her. Aber es half. Ich war nun richtig wach und einsatzbereit, die Kopfschmerzen hatten sich fast völlig verflüchtigt. Ich stieg in meinen Zweiter-Klasse-Anzug und machte mich auf den Weg in mein Office, man soll die Hoffnung nie aufgeben.
Ja, Office, ich könnte es auch einfach Büro nennen, doch Office klingt besser, amerikanischer, mit einem Hauch von Noir. Das Wort Office stand auch an der Tür, eigenhändig von mir hingepinselt, darunter mein Name, Nick Winter, und in schwarzen Lettern: Privat. Für das Wort Detektiv hatte die Farbe nicht mehr ausgereicht. Aber im Internet stand ja alles. Wer nach einem Privatdetektiv suchte, fand mich dort oder im Telefonbuch. Aber wer hat heute noch einen solchen Wälzer in der Schublade?
Vielleicht erkläre ich auch noch kurz meinen Namen. Genau genommen heiße ich Nick de Winter. Mein Vater ist Holländer, verkaufte, um das Klischee zu bedienen, Wohnwagen und später Tulpen. Meiner Mutter gefiel das nicht, so ging die Ehe in die Brüche. Sie zog aus, ich blieb da. Hab seit der Zeit nichts mehr von ihr gehört. Schade eigentlich, aber so ist das Leben. Als ich volljährig war, bin ich auch ausgezogen. Mein Vater hat mir ein paar Scheine und wertlose Ratschläge mit auf den Weg gegeben, das war’s. Es hat alles nicht gepasst. Familie ist seither ein Fremdwort für mich. Seit der Zeit boxe ich mich alleine durchs Leben, Typ einsamer Wolf. Normalerweise nenne ich mich Nick Winter, um meine holländische Vergangenheit hinter mir zu lassen, in manchen Situationen hole ich aber das »de« hervor und klebe es vor meinen Namen, um seriöser zu erscheinen, denn manche hier glauben, das »de« weise auf einen Adelstitel hin, was nicht stimmt. Aber ich lasse sie gerne in dem Glauben, denn es gibt immer noch verwirrte Menschen, auf die Adel Eindruck macht. Und das kann in meinem Beruf manchmal von Vorteil sein.
Und Nick Winter oder de Winter strebte jetzt seinem Office zu. Unterwegs schaute ich zum Himmel hinauf. Dort zogen bedrohliche Wolkenbänke auf, dunkelschwarz mit einem gelblichen Rand an der Stelle, an der sie sich der Erdoberfläche näherten. Ein Donnergrollen zeigte mir, dass das Gewitter nicht mehr lange auf sich warten lassen würde. In spätestens einer halben Stunde musste es hier sein. Der Platzregen, der dann sicher folgte, konnte mir dieses Mal nichts anhaben, sagte ich mir, denn zu diesem Zeitpunkt würde ich im Trockenen sitzen, in meinem Office. Von dort konnte ich das Unwetter und die durch die Straßen hetzenden Menschen, die so nass wurden wie ich gestern, in aller Ruhe beobachten und bedauern, zusammen mit Johnnie. Sollte der Regen schneller sein und mich doch erwischen, dann: zuerst Stammkneipe! Auch eine Alternative.
Aber ich war schneller. Gerade als die ersten Tropfen fielen, erreichte ich die alte Fachwerkbude, die mein Office beherbergte. Als ich über die knirschende und knarzende Holztreppe in den zweiten Stock kam, bemerkte ich mit meinem detektivischen Kennerblick, dass etwas anders war als sonst. Die Tür war nicht verschlossen, aber auch nicht offen, so etwas zwischendrin. Ich näherte mich langsamen und leisen Schritts der Eingangstür, die zu meinem Zweiraum-Office führte.
Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Es treiben sich zu viele schräge Vögel auf dieser Erde herum. Außerdem hatte ich mir in der Vergangenheit nicht immer nur Freunde gemacht. Iwan, der Schreckliche, zum Beispiel, war sicher nicht sehr gut auf mich zu sprechen. Vielleicht war er ja aus dem Knast getürmt, weil er sich dort nicht sonderlich wohl gefühlt hatte, und war jetzt gerade dabei, seine Rache-Liste abzuarbeiten, auf der ich sicherlich ganz oben stand. Um nicht zu sagen, an erster Stelle.
Mit der einen Hand umfasste ich den Türknauf, mit der anderen tastete ich nach meiner Freundin. Sie war an Ort und Stelle, im Schulterholster. Ein beruhigendes Gefühl.
Ich drückte die Eingangstür auf, die leise vor sich hin knarrte. Im selben Augenblick blitzte es und nur Sekunden später war ein kräftiges Donnergrollen zu hören. Das Gewitter war da, schneller, als ich gedacht hatte. Doch nichts sollte mich jetzt aufhalten, ich wollte der Gefahr ins Auge blicken, die da vielleicht in meinem Office auf mich wartete, und in drei Sätzen war ich durch den kleinen Vorraum hindurch, der eigentlich für meine Sekretärin samt Schreibtisch gedacht war. Aber ich brauchte ja keine, weil ich mit meinen wenigen Aufträgen selber sehr gut zurechtkam und mir auch das Geld fehlte: für die Sekretärin, den Schreibtisch, den Stuhl und … ach, egal.
Keine Zeit für monetäre Depressionen. Ich zog meine alte Liebe aus dem Holster, entsicherte sie und stieß meine Office-Tür mit aller Macht auf. Wieder blitzte es, diesmal aber folgte der Donner auf dem Fuße. Das Gewitter war direkt über meiner Bude. Ich zuckte zusammen, stand aber in der nächsten Sekunde mit gezogener Waffe mitten im Raum.
»He, Alter, das ist ja voll fett, wie du hier reinbretterst. Du stehst wohl auf grelle Auftritte. Respekt, großes Kino«, schlug es mir entgegen.
Mein Gesichtsausdruck wechselte von grimmig zu verdutzt, wobei verdutzt noch reichlich untertrieben war. Vor mir saß … Ja was war das eigentlich, was da vor mir saß? Ich versuche einmal, das Wesen zu beschreiben. Von oben nach unten: Rabenschwarz gefärbte Haare, die eine Seite des Kopfes kahl rasiert, auf der anderen Seite die Tolle so lang, dass das eine Auge verdeckt war. In der Nase, so mittendrin, steckten mehrere Ringe. Doch nicht nur da, auch in den Ohren, links wie rechts. Ach ja, die Lippen habe ich vergessen, auch die waren ordentlich beringt. Dieses Gesicht, das mich da anstarrte, hatte in jedem Fall einen hohen Altmetallwert.
Die Augen und die Lippen dieses Wesens waren dunkel geschminkt, dagegen sah der Tod noch freundlich aus. Auch der Rest abwärts war ziemlich black, teils mit Spitzen, oder wie man das Zeugs nennt, besetzt, teils funkelten mir Strasssteine entgegen. Überall hingen Ketten herum. Außerdem trug das Wesen, das deutlich weiblich war, ein Stachelhalsband. Das konnte nicht bequem sein. Aber ich musste es ja nicht tragen.
»Was … ich meine, wer bist du?«, stotterte ich vor mich hin. »Und vor allem, wie bist du hier hereingekommen?«
»Durch die Tür vielleicht?«
Ich hatte einen weiblichen Witzbold vor mir.
»War nicht verschlossen.«
Ah, gut, das war eine Erklärung. Ich musste wohl das letzte Mal vergessen haben, die Tür abzuschließen. Aber wann war das letzte Mal gewesen? Auch vergessen.
Wieder blitzte und donnerte es zeitgleich. Für einen Augenblick war es taghell in meiner schummrigen Bude. Wieder zuckte ich zusammen.
»He, wohl ziemlich schreckhaft, was, Alter?«, kam es aus dem schwarz umrandeten Schlund.
Ich muss gestehen, ich gab im Augenblick nicht gerade die beste Figur ab. Ich musste hier ganz dringend wieder die Oberhand gewinnen, das war klar. Ich steckte zuerst meine .38er zurück in ihr Zuhause, von diesem schwarzen Wesen ging wohl nicht allzu viel Gefahr aus. Ich setzte mich lässig auf meinen Schreibtisch und sah mir mein beringtes Gegenüber noch einmal genauer an. Black is beautiful. Nein, dieser Spruch galt bei ihr bestimmt nicht. Wie alt mochte diese seltsame Maid sein? Neunzehn, zwanzig? Oder doch älter? Vielleicht sah sie ja nur wegen des ganzen Plunders, den sie an- und umhängen hatte, und der Tonnen von Farbe wegen, die sie sich ins Gesicht gepinselt hatte, viel jünger aus, als sie tatsächlich war? Vielleicht war sie ja schon völlig erwachsen? Moment. Nein, unmöglich. Nicht so.
»Was willst du von mir, Kleine?«, fragte ich sie.
Sie sah mich etwas verwundert an. Gerade als sie etwas erwidern wollte, blitzte, donnerte und schepperte es heftig, was mich fast vom Schreibtisch hob. Das Gewitter über mir zeigte nun alles, was es hatte und konnte. Donner und Doria.
»Uh, das war aber jetzt verdammt nah«, sagte sie nur mit einem leichten Lispeln, das wohl den vielen Lippenringen geschuldet war.
Da musste ich ihr recht geben. Dieser Blitz war sicher ganz in der Nähe eingeschlagen. Ich rutschte vom Schreibtisch, ging zum Fenster und zog zwei Lamellen meiner Jalousie auseinander. Draußen war es völlig dunkel geworden. Zuerst erkannte ich nicht viel, doch schnell hatten sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Im nächsten Augenblick war dies alles sowieso kein Problem mehr, denn erneut blitzte es und die ganze Straße war so hell wie bei Tageslicht. Jetzt konnte ich es deutlich sehen. Der Blitz musste ins Nachbarhaus eingeschlagen sein. Im Dach klaffte ein größeres Loch. Balken und Latten waren zu sehen. Die Schindeln waren zerborsten und Teile davon nach unten auf die Straße gestürzt. Rauch stieg aus dem Loch in den Himmel. Der Blitz musste den Dachstuhl in Brand gesetzt haben.
Mein Blick fiel auf die Fenster darunter. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Zwei verängstigte Augen blickten nach draußen. Wieder blitzte es. Im grellen Licht erkannte ich den Menschen, der da am Fenster stand. Es war ein Kind.
»Verdammte Scheiße«, rief ich.
»Was ist los?«
Die Ringe-Lady stand nun direkt neben mir. Aus ihrer Stimme war Besorgnis zu hören. Wahrscheinlich hatte ihr meine spontane Aufregung zugesetzt.
Ich verlor kurz die Fassung.
»Ein Kind, dort drüben im Haus. Ich muss rüber. Ruf die Feuerwehr«, schrie ich laut und drehte mich um.
In wenigen Schritten war ich aus meinem Office. Hinter mir hörte ich eine aufgeregte Lispelstimme. Black Lady hatte wohl verstanden, was ich gesagt hatte, und sofort ihr Handy gezückt, um Hilfe zu holen. Hoffte ich jedenfalls.
Ich sprintete die Treppe hinunter auf die Straße, rempelte einen Mann beiseite und sah mich gleich weiteren Hindernissen gegenüber. Die braven Nachbarn hatten ihre Mülltonnen auf die Straße gestellt, weil am nächsten Tag die Abfuhr war. Und in diese Mülltonnen donnerte ich ungebremst hinein und landete im hohen Bogen unsanft auf der Straße. Ich fluchte laut. Meine Hose war aufgerissen, mein rechtes Knie schmerzte und aus einer kleineren Schürfwunde sickerte langsam Blut. Keine Zeit, mich um das Ergebnis meines Sturzes zu kümmern. Ich richtete mich unter Schmerzen auf und schaute nach oben. Ich glaubte, nun eine größere Rauchwolke wahrzunehmen, aber gegen den immer noch bedrohlich dunklen Himmel war sie nicht so leicht auszumachen.
Ich hetzte weiter über die Straße. Es blitzte und donnerte wieder. Der Lärm war nicht mehr so groß, das Gewitter zog weiter. Als ich die Eingangstür des Hauses auf der anderen Straßenseite erreichte hatte, drehte ich mich kurz um und schaute hoch zu den Fenstern meines Offices. Die Ringe-Lady hatte inzwischen die Jalousie hochgezogen und starrte mich wild gestikulierend an. Ihre Hände zeigten in Richtung Dachgeschoss. Offenbar wollte sie mir deutlich machen, dass ich mich beeilen sollte. Kurz darauf ging die Jalousie plötzlich wieder nach unten.
»Hab kapiert«, murmelte ich vor mich hin.
Zuerst schob ich mich durch eine Traube von Gaffern, die lautstark diskutierten, jedoch nichts unternahmen. Ich wollte ins Haus stürmen, aber die Tür war verschlossen. Eine kurze, heftige Klingelpartie, der Summer ertönte und ich drückte die Tür auf. Natürlich hatte das alte Haus keinen Fahrstuhl. Im Brandfall sollte man den ja auch nicht benutzen. Ich rannte die Treppe hinauf, drückte unterwegs noch mal auf jede Klingel und schrie:
»Es brennt im Dach, raus auf die Straße.«
Die meisten reagierten auf mein Geschrei und kamen aus ihren Wohnungen. Inzwischen konnte man auch Brandgeruch wahrnehmen. Er wurde immer stärker, je weiter ich nach oben kam. Schließlich hörte die Treppe auf, ich musste im obersten Geschoss angelangt sein. Hier gab es glücklicherweise nur noch eine Wohnungstür, auf einer anderen stand Privat und auf der dritten Dachboden.
Ich hämmerte auf die Klingel. Vorsichtig und leise knarrend öffnete sich die Tür. Auf meiner Bauchnabelhöhe blickte mich ein verängstigtes Augenpaar an.
»Ist deine Mamma nicht da?«, brüllte ich.
»Schrei nicht so. Ich hab Angst«, wimmerte das Kind.
Durch den Türspalt sah ich Rauch in der Wohnung. Ich musste mich beeilen.
»Komm mit, schnell. Es brennt bei euch im Dach.«
»Ich darf nicht mit Fremden mitgehen«, bekam ich als Antwort.
Verdammt, es ging um Sekunden. Auch im Treppenhaus kam jetzt der Rauch an. Ich konnte nicht mehr warten.
»Heute ist eine Ausnahme«, sagte ich und stieß mit Gewalt die Tür auf.
Die Tür traf das Mädchen am Kopf. Es fiel nach hinten und eine kleine Beule wurde an der Stelle sichtbar, an der ich es getroffen hatte. Die Kleine schaute mich mit großen Augen an und wusste nicht, ob sie weinen sollte oder nicht. Dann hustete sie. Und ich stimmte mit ein. Im selben Augenblick hörte ich ein lautes Krachen. Es musste aus dem hinteren Bereich der Wohnung kommen. Was es bedeutete, wollte ich nicht erforschen. Ich musste raus hier. Mit dem Kind. Ich griff nach dem Arm des Mädchens.
»Ist noch jemand in der Wohnung«, schrie ich sie an.
Das Kind schüttelte den Kopf und rieb sich dabei die kleine Beule.
»Komm jetzt.«
Ich zog sie zum Ausgang, aber sie wehrte sich.
»Was ist los? Komm bitte mit, wir müssen hier raus.«
Das Mädchen zeigte auf eine Puppe, die auf einem Stuhl saß.
»Ich kann doch Clara nicht hierlassen. Sie fürchtet sich, wenn sie alleine ist«, flüsterte das Kind und fing zu weinen an.
»Okay, Clara kommt auch mit«, sagte ich.
Es war keine Zeit für Diskussionen. In zwei Schritten war ich bei Clara, klemmte die Puppe unter den Arm und rannte zurück zu dem Mädchen.
»Jetzt alles okay«, hustete ich.
Die Kleine nickte, nahm meine Hand und folgte mir aus der Wohnung. Der Rauch war fast unerträglich geworden. Gerade als ich die Wohnungstür hinter uns zuschmiss, krachte es wieder laut. Das Dachgebälk hielt wohl dem Feuer nicht mehr stand. Wir mussten so schnell wie möglich nach unten. Hoffentlich schafften wir es durch den Rauch, der immer dicker wurde. Mir wurde schwindlig. Das Kind war einen halben Meter kleiner als ich. Dort unten war der Rauch wohl noch nicht so dicht. Sie klammerte sich fest an meinen Arm und zerrte mich nach unten aus dem Rauch, der noch nicht auf den Boden gesunken war. Ich bekam mehr Luft.
Wir hatten ein Stockwerk geschafft, als uns zwei Trupps mit jeweils zwei Feuerwehrleuten entgegenkamen. Der eine stürmte an uns vorbei nach oben, der andere zog uns zum Fenster. Davor war schon die Leiter mit dem Rettungskorb zu sehen. Ein Feuerwehrmann riss das Fenster auf und winkte seine Kollegen zu sich.
Schließlich war der Korb vor dem Fenster.
»Kommen Sie vorsichtig herüber in den Korb«, sagte der Feuerwehrmann und streckte mir seine Hand entgegen.
Ich schaute nach unten.
»Verdammt, ist das hoch«, brummte ich vor mich hin.
In meinem Kopf fing sich alles zu drehen an. Mir war speiübel.
»Schauen Sie nicht nach unten«, sagte der Mann vor mir.
Dein Rat, Freund, kommt ziemlich spät, dachte ich.
»Ich hab Angst«, wimmerte die Kleine neben mir.
Sie drückte das aus, was ich fühlte. Ich schob das Kind in den Korb. Gerade als ich ihm folgen wollte, schrie es laut auf.
»Nein!«
»Was ist?«
Das Kind zeigte von außen in Richtung Fenster.
»Clara!«
Ach, verdammt. Nicht schon wieder.
»Bin gleich zurück«, raunzte ich dem Feuerwehrmann zu und stieg aus dem Korb wieder zurück ins Treppenhaus.
Glücklicherweise hatte ich die Puppe in wenigen Sekunden gefunden. Sie lehnte recht teilnahmslos in der Nähe des Fensters mit dem Rücken an der Wand.
»Du könntest wenigstens Danke sagen«, blaffte ich die Puppe an und kletterte wieder aus dem Fenster in den Korb, der glücklicherweise noch da war.
Der Feuerwehrmann hatte auf mich gewartet. Er schaute mich reichlich verwundert an. »Sie Idiot«, schien er mir sagen zu wollen. Das Gesicht des Mädchens strahlte und war voller Glück, als ich ihr Clara in die Hand drückte. Ich sank in die Knie und übergab mich aus luftiger Höhe auf die Straße. Hoffentlich stand niemand unter der Leiter. Wenn es allerdings einen der Gaffer traf, war es okay.
Auch nach mehreren kräftigen Zügen aus der Sauerstoffmaske, die mir eine hübsche Rettungssanitäterin aufs Gesicht gedrückte hatte, fühlte ich mich immer noch reichlich benommen. Ob vom Rauch oder den rehbraunen Augen der flotten Helferin, die mich besorgt anblickten, kann ich nicht genau sagen. Und ich war mir sicher, dass auch der Rest der blonden Retterin sicher sehr ansehnlich war, wenn sie doch nur nicht in diesen unförmigen Klamotten gesteckt hätte.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie mich und legte mir ihre Hand sanft auf die Schulter.
»Schon wesentlich besser, seit Sie mich beatmen«, murmelte ich unter der Maske hervor.
Keine Ahnung, ob sie ein Wort verstanden hatte. Sie sah mich jedenfalls weiter mit ihren Rehaugen an. Ich kann nur sagen, eine intensive Mund-zu-Mund-Beatmung wäre mir im Augenblick wesentlich lieber gewesen als diese Plastikschale über der Nase. Aber manchmal hat man keine andere Wahl, da muss man das Leben nehmen, wie es ist. Außerdem fühlte ich mich noch schwach und elend, ein leidenschaftlicher Liebhaber wäre ich im Augenblick sowieso nicht gewesen.
Sie nahm ihre Hand von meiner Schulter, drehte sich um und stieg in den Krankenwagen. Ich schaute erst ihr nach, dann mich um. Es herrschte noch hektische Betriebsamkeit auf der Straße. Die Feuerwehr hatte den Dachstuhlbrand inzwischen zwar gelöscht, suchte aber noch weiter nach Glutnestern. Die vielen Blaulichter gaben der Szenerie ein gespenstiges Aussehen. Menschen standen in Gruppen auf der Straße herum, palaverten lautstark miteinander, gestikulierten wild und gafften immer wieder besorgt nach oben. Einige Dachziegel waren auf die Straße gestürzt und hatten Autos demoliert. Bei meiner Rostlaube wäre der Sachschaden nicht gerade hoch ausgefallen, aber meine rostige Gina stand bei mir vorm Haus, mit einem gefakten Anwohnerausweis hinter der Windschutzscheibe. Irgendwelche Fähigkeiten muss man als Privatdetektiv ja besitzen.
Während ich in meine Maske schnaufte und mich nach meiner Helferin umsah, denn langsam fühlte ich mich einsam, fiel mir plötzlich meine Begegnung der seltsamen Art in meinem Office ein. Die Altmetall-Königin. Ob sie noch auf mich wartete? Vielleicht sollte ich besser nachschauen, sonst fehlte noch irgendetwas in meiner Bude. Obwohl, Wertvolles hatte ich nicht zu bieten. Alles war secondhand.
Gerade als ich mich erheben wollte, landete wieder eine Hand auf meiner Schulter. Sie war wesentlich kräftiger im Griff als die zarte Hand meiner braunäugigen Sanitäterin und sie stammte von einem uniformierten männlichen Wesen. Es war wohl der Oberflorian im grell leuchtenden Schutzanzug. Er sah jedenfalls sehr wichtig aus, hatte ein leicht rußgeschwärztes Gesicht und große Pranken, die dafür sorgten, dass ich sitzenblieb.
»Na, Sie Held«, polterte er und zeigte dann ein strahlendes Lächeln.
»Nicht Held, Nick de Winter, Privatdetektiv«, antwortete ich und suchte nach einer Visitenkarte.
Die Pranke drückte zu und schüttelte mich durch.
»Oder auch Idiot«, meinte er trocken. »Was Sie da gemacht haben, war sehr riskant. Sie hätten draufgehen können – und das Mädel auch.«
»Aber wie Sie sehen, leben wir noch. Alle beide.«
»Ich weiß. Und deshalb sind Sie ja jetzt auch ein Held. Sie haben der Kleinen wahrscheinlich das Leben gerettet. Als meine Leute zu ihrer Wohnung kamen, war sie bereits total verraucht. Wenn Sie das Mädchen nicht vorher rausgeholt hätten, würde es jetzt nicht mehr leben. Davon gehe ich aus. Gratuliere.«
Wieder drückte die Pranke zu. Wenn Florian weiter so herzlich war, musste Blondie noch meine Schulter verarzten.
»Danke. Man tut, was man kann. Aber ich glaube, ich sollte jetzt langsam los. Die Arbeit ruft«, meinte ich, in der Hoffnung der Pranke entkommen zu können, ehe sie mich zermalmte.
»Das entscheidet der Arzt, denke ich. Wahrscheinlich ist es besser, Sie gehen erst mal ins Krankenhaus und lassen sich durchchecken. Rauchgase sind sehr giftig.«
»Ja, gleich morgen«, sagte ich.
»Na, ich glaube …«
Was er glaubte, erfuhr ich nicht mehr. Sein Walkie-Talkie meldete sich knisternd zu Wort. Er wurde offenbar woanders dringender gebraucht.
»Laufen Sie nicht weg. Ich brauche noch Ihre genauen Personalien«, rief er mir im Gehen zu.
Ich wedelte mit meiner Visitenkarte, aber der Oberflorian war bereits im Trubel der Straße verschwunden.
Meine Schulter erholte sich langsam wieder. Auch mein Inneres schien sich ausgehustet zu haben. Der Sauerstoff hatte zudem meine Lungen genug durchgepustet, ich fühlte mich wieder recht unternehmungslustig. Genug ausgeruht. Ich legte die Maske ab und war gerade dabei, mich zu erheben, als ich wieder festgehalten wurde. Dieses Mal allerdings von Blondies zarter Hand.
»Warten Sie. Sie können doch nicht so einfach …«, tadelte mich die Rettungssanitäterin.
»Doch, kann ich«, antwortete ich kurz.
Ich nahm ihre Hand in die meine, drückte sie und stand auf.
»Jetzt kann ich es ja zugeben. Ich habe die ganze Aktion nur gemacht, um Sie kennenzulernen«, sagte ich.
»Oh, Mann, ich bin schon mit besseren Sprüchen angemacht worden«, sagte sie trocken, verdrehte die Augen und lächelte gleichzeitig.
»Okay, ich gebe mir das nächste Mal mehr Mühe.«
Ich war gerade dabei, mich schweren Herzens von ihr abzuwenden, als mir eine Idee kam. Ich griff in die Innentasche meines Jacketts, um meine Visitenkarte wieder hervorzuziehen. Dabei öffnete sich allerdings das Kleidungsstück so weit, dass sie meine große Liebe entdecken konnte, was sie mit einem kurzen »Oh« quittierte. Ja, meine silberne .38er ruft immer wieder Erstaunen hervor. Meistens allerdings, wenn man ihr direkt in den Lauf blickt. Aber Blondie mit den braunen Augen hatte ja nichts zu befürchten, zumindest nicht von meiner .38er. Ich drückte meiner Helferin die Visitenkarte in die Hand.
»Hier, für den Florian. Und hier steht übrigens auch meine Telefonnummer drauf, die kann man sich gut merken«, sagte ich und zeigte ihr die Stelle mit der Zahlenreihe.
Sie blickte mich verdutzt an.
»Für wen?«
»Für den Oberchef hier, den Boss, den Feuerwehrkapitän.«
»Sie meinen den Kommandanten.«
»Ja, genau den. Der wollte meine Personalien. Warum auch immer?«
Es war nun an der Zeit, den Ort dieses Spektakel zu verlassen. Aber sie ließ mich immer noch nicht gehen.
»Jetzt warten Sie doch. Da will Sie noch jemand sehen.«
»Wer?«, fragte ich.
»Kommen Sie.«
Ich folgte ihr willig und war gespannt, was sie mit mir vorhatte. Sie führte mich zu einem weiteren Krankenwagen. Als sie die Seitentür geöffnet hatte, wusste ich, wen sie meinte. Vor mir lag die Kleine, die ich aus dem brennenden Haus gerettet hatte. Auch sie hatte eine Maske über der Nase und noch eine kleine Beule auf der Stirn. Als sie uns wahrnahm, drehte sie ihren Kopf in unsere Richtung. Sie streckte ihre Hand aus.
»Danke, dass Sie Clara gerettet haben«, sagte sie.
Ich nahm ihre Hand.
»Klar doch. Hab ich gerne gemacht.«
Das Lächeln auf ihrem Gesicht hätte Steine erweichen können.
Als ich zurück zu meinem Office lief, war ich gespannt, was aus meiner Altmetall-Lady geworden war. Ich sprintete die Treppe hoch, wobei ich noch etwas Rauch ausstieß wie eine Dampflokomotive. Zumindest kam ich mir so vor. Etwas außer Atem stand ich vor der Eingangstür zu meiner Privatdetektiv-Behausung. Die Tür war immer noch einen Spaltbreit offen. Ich fragte mich, ob das beringte Mädel noch auf mich wartete oder ob sie sich aus dem Staub gemacht hatte. Im Vorraum war sie jedenfalls nicht. Auch nahm ich keine Geräusche wahr, keine Stimme, nichts. Außer dem Lärm von draußen war nichts zu hören. Vermutlich war ihr die Wartezeit zu lange geworden. Musste sich wahrscheinlich dringend wieder piercen lassen.
Ich hatte mich getäuscht. Als ich die Tür zu meinem Office-Raum öffnete, wurde ich eines Besseren oder in diesem Fall Schlechteren belehrt. Die Ringe-Lady war noch da, aber sie lag ausgestreckt vor mir auf dem Boden und sie sah nicht sehr gesund aus. Ihr Gesicht war blass, noch blasser als vor einer Stunde. In zwei Schritten war ich bei ihr und kniete mich neben sie auf den Boden. Ich fühlte ihren Puls. Ich spürte kaum noch was und ich hatte das Gefühl, dass die Schlagzahl ihres Pulses immer geringer wurde. Verdammt! Sie schien mir davonrauschen zu wollen. Das konnte ich nicht zulassen. Ich erinnerte mich an einen Lebensretterkurs, den ich vergangenes Jahr aus lauter Langeweile besucht hatte. Oder war es vor zwei Jahren gewesen? Keine Ahnung. Lag jedenfalls schon einige Zeit zurück. Aber an eine Sache konnte ich mich noch gut erinnern, an die Bee Gees und Staying alive. Ist wirklich eigenartig, was so alles in den Gehirnwindungen hängen bleibt.
Ich beugte mich über das Mädel, legte meine Hände übereinander auf ihren Brustkorb und drückte im Rhythmus von Staying alive auf ihre Rippen. Auf Außenstehende hätten das Bild und mein Falsettgesang sicher etwas befremdlich gewirkt. Aber das war egal, denn es half, zumindest mir, im Rhythmus zu bleiben. In regelmäßigen Abständen pustete ich ihr Luft in den Mund. Wobei ich mir an einem der Ringe meine Unterlippe aufritzte. Ich weiß nicht, ob ich wirklich erfolgreich war, aber ich hatte das Gefühl, sie war immer noch bei mir.
Zwischen zwei Bee-Gees-Zeilen stöhnte ich auf. Ich brauche dringend professionelle Hilfe, dachte ich. Mein Stoßseufzer wurde erhört. Zuerst spürte ich einen kleinen Stromschlag, der mir durch den Körper fuhr. Aber wo sollte der herkommen? Es dauerte glücklicherweise nur eine Sekunde, bis mir klar wurde, dass es nur mein Smartphone war, das in meiner Hosentasche summte. Ich unterbrach kurz meine Wiederbelebungsversuche und nahm das Gespräch an. Es war der Feuerwehrgeneral.
»Hallo. Sind Sie das, Herr Winter?«, hörte ich die Stimme des Generals.
»Natürlich bin ich das. Wer denn sonst?«, brüllte ich zurück.
Kurze Pause.
»Ich brauche noch Ihre Personalien, mein Freund, Ihre Visitenkarte reicht mir dafür nicht.«
Hatte er nun Freund oder Freundchen gesagt? Egal, es gab keine Zeit für sprachliche Feinheiten.
»Und ich, ich brauche Hilfe, dringend. Sofort. Jetzt gleich. Auf der Stelle.«
Meine Stimme überschlug sich.
»Wie bitte?«
Die Verständigung schien leicht gestört, was nicht unbedingt an der schlechten Verbindung lag.
»Sind die Sanis noch in Ihrer Nähe?«, fragte ich gehetzt.
»Wer?«
Der General stand auf der Leitung, bildlich gesehen.
»Die Sanitäter, die Helfer in Orange, Rotes Kreuz, Tatütata …«
»Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, hörte ich die besorgte Stimme des Oberflorians.
»Bei mir ja, aber bei der Lady vor mir nicht. Notfall. Schnell. Die stirbt mir weg.«
Ich hörte ein kurzes Knacken und dann die vertraute Stimme meiner blonden Retterin.
»Was ist los? Wo sind Sie?«
Zwei Fragen auf einmal. Um nicht zu viel Zeit zu verlieren, fasste ich die Antworten in einem Satz zusammen.
»Ich brauche dringend Hilfe in meinem Office.«
»Wieso?«
»Mein Gott, bin ich hier denn in einem Ratespiel? Bitte kommen Sie sofort zu mir rauf. Ein Notfall. In meinem Office. Sie stirbt mir sonst unter den Fingern weg.«
»Wo sind Sie?«
Langsam schien der Groschen zu fallen.
»Im Haus mit der Nummer 15, zweites Obergeschoss. Schnell. Und bringen Sie diesen Debrifi-Dingsbums mit.«
»Wir sind unterwegs«, hörte ich noch, während ich wieder Staying alive zu singen begann.
Diesmal mit mehr Erfolg. Ich spürte, wie sich der Brustkorb der Ringe-Lady nun deutlich hob und senkte. Sie war bei mir geblieben. Aber mir stellte sich immer noch die Frage, was den Kollaps bei dieser jungen Frau ausgelöst hatte. Ich sah auf den ersten Blick keine äußeren Verletzungen, nichts. Allerdings hatte ich bisher auch keine Zeit gehabt, ihren Körper genauer zu untersuchen.
»Hallo. Sind Sie da drinnen?«, hörte ich im nächsten Augenblick die Stimme des blonden Engels.
»Ja, klar. Kommen Sie rein. Ich kann es kaum erwarten, Sie wiederzusehen.«
Ein Retter-Duo stürmte in mein Office und schob mich freundlich, aber professionell beiseite. Ich hatte ausgedient. Ich ließ mich auf dem Boden nieder und atmete tief durch.
Kurz darauf kam der General hereingerannt.
»Was ist denn hier los? Sie ziehen ja förmlich Katastrophen an«, meinte er trocken.
Ich wusste auch nicht, was ich darauf antworten sollte. Irgendwie hatte er ja recht und mir fiel kein cooler Spruch mehr ein. Ich fühlte mich völlig ausgepumpt. Aber ich musste auch nichts mehr sagen. Das übernahm mein blonder Engel mit den Rehaugen. Er sprach in ein Funkgerät, das kräftig knirschte und knarzte. Meine Helferin forderte Verstärkung an, die kurz darauf mit einer Trage eintraf.
Ich erhob mich, trat beiseite und stand danach hilflos in der Gegend herum. Mein Gesichtsausdruck war sicher nicht gerade von besonderer Intelligenz gekennzeichnet. Was in den letzten Stunden passiert war, hatte mich überfordert. So etwas erlebte man nicht alle Tage.
Inzwischen hatte die Sanitäter-Crew die Ringe-Lady auf die Trage gelegt. Sie hing am Tropf. Sekunden später zog das Quartett an mir vorüber. Mein blonder Engel drehte sich zu mir um.
»Sie ist stabil. Ich glaube, Sie haben ihr das Leben gerettet.«
»Ähm …«, sagte ich, während Engelchen mich kurz ihn den Arm nahm.
»Toll gemacht. Solche Leute brauchen wir.«
Sie löste sich von mir und ging mit den anderen mit.
»Warten Sie doch einen Moment«, rief ich dem Engelchen hinterher.
»Was ist?«, fragte sie kurz angebunden und wandte sich wieder mir zu.
»Sie haben mir nicht gesagt, was mit ihr passiert ist. Was kann denn diesen Zusammenbruch ausgelöst haben?«, fragte ich.
»Warum sie einen Kreislaufkollaps erlitten hat, kann ich Ihnen auf den ersten Blick nicht sagen. Das werden sie im Krankenhaus herausfinden, wohin wir sie jetzt bringen. Und das ist dringend. Also halten Sie uns nicht auf.«
Ich ging ans Fenster, hob zwei Lamellen der Jalousie in die Höhe und schaute hinunter auf die Straße. Inzwischen war auch die Notärztin da. Sie stieg mit den Sanitätern in den Krankenwagen, der sich sofort in Bewegung setzte. Ich sah ihm nach, bis er um die Ecke verschwunden war. Die Sirene wurde von Sekunde zu Sekunde leiser. Schließlich war sie nicht mehr zu hören.
Ich drehte mich um. Mitten in meinem Office stand immer noch der Feuerwehr-General. Er starrte mich mit großen Augen und offenem Mund an.
»Ja, was soll man da sagen«, sagte ich und zuckte mit den Schultern.
»Sagen Sie es nicht mir, sondern denen da«, antwortete der Vier-Sterne-General.
Er deutete mit einem Finger auf die beiden Herren in Uniform, die sich mir näherten. Es waren zwei Polizeibeamte und es sah aus, als ob sie einige Fragen an mich hätten. Ich war begehrt heute.
Es dauerte über eine halbe Stunde, bis mich die beiden Beamten von der Trachtengruppe ausgefragt hatten. Sehr glücklich sahen sie hinterher nicht gerade aus. Ich hatte keine ihrer Fragen zu ihrer Zufriedenheit beantworten können. Wer war diese Lady? Ich weiß es nicht. Was wollte sie bei Ihnen? Ich weiß es nicht. Das können Sie uns doch nicht erzählen. Doch ich kann.
Beide packten ihr Notizbuch ein und sahen mich skeptisch an.
»Ihre Geschichte klingt nicht sehr glaubwürdig«, sagte der Größere der beiden.
»Es ist aber die einzige, die ich Ihnen anbieten kann. Sie müssen sich damit zufriedengeben. Oder soll ich Ihnen zuliebe eine Geschichte erfinden? Tut mir leid. Meine Fantasie lässt mich gerade im Stich. Und übrigens, ›danke‹ könnte vielleicht auch noch irgendjemand zu mir sagen. Schließlich habe ich gerade dem beringten Etwas da das Leben gerettet. Und dem Kind von gegenüber auch. Was wollen Sie denn noch? Reicht Ihnen das nicht für heute?« Und nach einer kleinen Pause: »Mir reicht es jedenfalls.«
Die beiden sahen erst sich, dann mich an.
»Gut. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung.«
»Mach ich, Sheriff, ich hab keinen Urlaub geplant. Ich bleib in der Stadt.«
»Unsere Kollegen werden sich bei Ihnen melden. Wir müssen wieder zurück auf die Straße.«
»Ich werde Sie nicht daran hindern«, antwortete ich.
Im nächsten Augenblick waren sie wortlos verschwunden.
»Die Freundlichkeit in Person«, murmelte ich ihnen hinterher.
Ich setzte mich auf das Sofa, das ich beim Sperrmüll ergattert und unter großer Mühe mithilfe eines Nachbarn hier heraufgeschleppt hatte. Ich ließ die letzten Stunden noch einmal Revue passieren. Vor wenigen Stunden hatte ich mich noch über meine Arbeitslosigkeit beschwert. Und jetzt saß ich völlig erschöpft auf dem Sofa und sehnte mich nach Ruhe. Ich streckte mich kurz und legte mich dann auf die Couch, was im ersten Augenblick sehr unbequem war, denn irgendetwas stach mir in den Rücken. Ich richtete mich auf und sah mir den Übeltäter genauer an. Es war eine Plastikkarte, die sich in einem Polsterschlitz meines Sofas verklemmt hatte. Ich zog die Karte heraus. Es war der Ausweis der Ringe-Lady. Das konnte ich deutlich erkennen, auch wenn vor lauter Ringen kaum ein Gesicht zu sehen war. Aber sie war es. Ganz eindeutig.
»So, so, das ist also dein Name«, brummte ich vor mich hin. »Elli. Was ist dir bloß passiert? Und warum gerade bei mir?«
Ich legte mich wieder breit ausgestreckt auf das Sofa und betrachtete den Ausweis.
»Elli Pyrelli«, brabbelte ich vor mich hin.
So wollte ich sie nennen, wenn sie wieder auf die Beine kam. Auch wenn sie mit Nachnamen gar nicht so hieß. Elli Pyrelli, so wie die Sängerin bei Udo Lindenberg und seinem Panikorchester.
Ich legte den Ausweis beiseite und starrte an die Decke. Mensch, innerhalb kurzer Zeit zwei Menschenleben gerettet. Nicht schlecht, Herr Specht. Zwei gute Taten an einem Tag. Jetzt erhalte ich bestimmt die Pfadfinderehrenmedaille. Mindestens. Ich klopfte mir in Gedanken auf die Schulter.
Aber dann war Johnnie dran. Den hatte ich mir verdient.
Aufstehen, joggen. Und dann zum Gym, um Gewichte zu stemmen. Ich brauchte mehr Kondition. Brauchte bald jede Menge davon, das hatte ich im Gefühl. Außerdem frischt Sport meine Gedanken auf. Nach der Formel: Der Abend geht und Johnnie kommt, der Morgen kommt und Johnnie geht. Und er musste jetzt gehen, gestern hatte er mir zu viel Gesellschaft geleistet. Für jedes Menschenleben, das ich gerettet hatte, ein großer Schluck Whisky. Aber halt, Moment mal, wenn ich mich recht erinnere, so viele Menschenleben hatte ich doch gar nicht gerettet. Egal.
Raus an die Luft. Ich lief meine übliche Runde, sechs Kilometer, durch den Wald und über die Felder. Dann setzte ich mich in meine Blechkarre und fuhr zum Gym. Heute ein Extra-Gewicht oben drauf. Als ich später zu Hause unter der kalten Dusche stand, spürte ich jeden verdammten Muskel im Leib. Gut so.





























