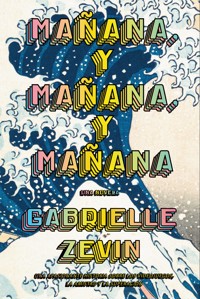13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- TIME MAGAZINE: Buch des Jahres 2022
- Amazon USA: Buch des Jahres 2022
- Apple: Buch des Jahres 2022
- US-Indie-Buchhandlungen: Buch des Jahres 2022
- Goodreads: Buch des Jahres 2022
MORGEN, MORGEN UND WIEDER MORGEN wurde 2024 von den Leser:innen der New York Times zu einem der zehn besten Romane des 21. Jahrhunderts gewählt
Mitte der 90er-Jahre in Massachusetts: An einer U-Bahn-Station trifft Sadie, hochbegabte Informatikstudentin und angehende Designerin von Computerspielen, ihren früheren Super-Mario-Partner Sam wieder. Die beiden beginnen, gemeinsam an einem Spiel zu arbeiten, und schnell zeigt sich, dass sie nicht nur auf freundschaftlicher, sondern auch auf kreativer Ebene ein gutes Team sind. Doch als ihr erstes gemeinsames Computerspiel zum Hit wird, brechen sich Rivalitäten Bahn, die ihre Verbundenheit zu bedrohen scheinen.
Ein Jahrzehnte umspannender Roman über Popkultur und Kreativität, Wagnis und Scheitern, über Verlust und über die Magie der Freundschaft.
Daniel Schreiber zu MORGEN, MORGEN UND WIEDER MORGEN: »Ein fulminanter Roman, superspannend und gleichzeitig wunderschön.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungAuszug aus einem GedichtI: KRANKE KIDS1234II: EINFLÜSSE123456III: UNFAIR GAMES123456IV: BOTH SIDES1A1B2A2B3A3B4A4B5A5BV: NEUAUSRICHTUNG123VI: EHEN12345VII: DER NPCVIII: OUR INFINITE DAYS123456IX: PIONEERSSIEDLERIN IM NEBLIGEN HOCHLAND EINGETROFFENSTADTBEWOHNERIN VERSCHENKT STEINEBUCHHANDLUNG VERKAUFT DEMNÄCHST SPIELE UND GRUSSKARTENNEUE AUGENÄRZTIN SCHLIESST INTERESSANTEN HANDELÄRZTIN SUCHT SPIELPARTNERDOKTOR UND EHEFRAU SIND GLÜCKLICH, ABER GELANGWEILTSPEZIALEVENT: SUPER-SCHNEESTURM TERRORISIERT FRIENDSHIPJUNGE ERREICHT ENDETESTAMENT VON LADENBESITZERIN ERÖFFNETX: FRACHT UND GELEIS1234ANMERKUNGEN UND DANKÜber dieses Buch
Mitte der 90er-Jahre in Massachusetts: An einer U-Bahn-Station trifft Sadie, hochbegabte Informatikstudentin und angehende Designerin von Computerspielen, ihren früheren Super-Mario-Partner Sam wieder. Die beiden beginnen, gemeinsam an einem Spiel zu arbeiten, und schnell zeigt sich, dass sie nicht nur auf freundschaftlicher, sondern auch auf kreativer Ebene ein gutes Team sind. Doch als ihr erstes gemeinsames Computerspiel zum Hit wird, brechen sich Rivalitäten Bahn, die ihre Verbundenheit zu bedrohen scheinen.
Ein Jahrzehnte umspannender Roman über Popkultur und Kreativität, Wagnis und Scheitern, über Verlust und über die Magie der Freundschaft.
Über die Autorin
GABRIELLE ZEVIN ist Autorin diverser international gefeierter Bestseller, die in viele Sprachen übersetzt wurden. Sie wurde in New York als Tochter einer koreanischen Mutter und eines jüdisch-amerikanischen Vaters geboren, die beide zeit ihres Lebens in der IT-Branche gearbeitet haben. Zevin ist Drehbuchautorin, Gelegenheitsfeuilletonistin und hat in Harvard studiert. Sie lebt in Los Angeles. Eine Hollywood-Verfilmung von MORGEN, MORGEN UND WIEDER MORGEN ist in Planung.
Aus dem amerikanischen Englisch von Sonia Bonné
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Gabrielle Zevin
This edition is published by arrangement withSterling Lord Literistic and Paul & Peter Fritz AG.
Auszug aus: Emily Dickinson. Dass Liebe alles ist. In: Sämtliche Gedichte. Übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort von Gunhild Kübler.
© 2015 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Auszug aus: Emily Dickinson. Weil ich beim Tod nicht halten konnt. In: Sämtliche Gedichte. Übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort von Gunhild Kübler.
© 2015 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Auszug aus: Emily Dickinson. Durchs Hirn schritt mir ein Leichenzug. In: Sämtliche Gedichte. Übersetzt, kommentiert und mit einem Nachwort von Gunhild Kübler.
© 2015 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München
Auszug aus: Homer. Ilias. In: Ilias und Odyssee. Übersetzt von Johann Heinrich Voß. Neu-Isenburg, 2009. Mit freundlicher Genehmigung des Wunderkammer Verlags.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Lektorat: Anna Valerius, Köln
Umschlaggestaltung: Thomas Krämerunter Verwendung eines Designs von John Gall
Umschlagmotiv: The Great Wave (detail) by Katsushika Hokusai
The Metropolitan Museum of Art, New York
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4265-8
eichborn.de
Für H. C., wieder mal – in der Arbeit wie im Spiel
Dass Liebe alles istIst was man von ihr weiß,Es ist genug, wenn nur die FrachtGemäß ist dem Geleis.
EMILY DICKINSON
I
KRANKE KIDS
1
Bevor Mazer sich als Mazer neu erfinden sollte, war er Samson Mazer, und davor hieß er Samson Masur. Zwei geänderte Buchstaben würden ausreichen, um aus einem netten, vermeintlich jüdischen Jungen einen professionellen Weltenbauer zu machen. In der Highscore-Tabelle des Donkey-Kong-Automaten seines Großvaters tauchte er als S.A.M. auf, aber meistens war er einfach nur Sam.
An einem späten Dezembernachmittag im ausklingenden zwanzigsten Jahrhundert stieg Sam aus der U-Bahn und sah, dass die Hauptverkehrsader zur Rolltreppe durch eine träge, auf eine Werbetafel starrende Menschenmasse verstopft war. Sam war spät dran. Er hatte einen Termin bei der Studienberatung, den er schon seit über einem Monat vor sich herschob, der aber nach einhelliger Meinung unbedingt noch vor den Winterferien stattfinden musste. Sam mochte keine Menschenmengen – weder hielt er sich gern darin auf noch konnte er Massenveranstaltungen etwas abgewinnen. Aber diese würde sich nicht vermeiden lassen. Wenn er in die überirdische Welt vordringen wollte, musste er sich einen Weg hindurch bahnen.
Sam trug einen riesenhaften marineblauen Wollmantel, den er von seinem Mitbewohner Marx geerbt hatte. Marx hatte den Mantel während seines ersten Studienjahrs im Armeeladen in der Stadt gekauft und ihn dann ein knappes Semester lang in einer Plastiktüte vergammeln lassen, bis Sam fragte, ob er ihn ausleihen dürfe. Der Winter war besonders unerbittlich gewesen, und im April (im April! Diese Winter in Massachusetts sind doch der Wahnsinn!) hatte der Nordostwind Sams Stolz so weit zermürbt, dass er Marx um den vergessenen Mantel bat. Sam tat so, als gefiele ihm der Stil, und da sagte Marx, er könne den Mantel gern behalten, was Sam genau so vorhergesehen hatte. Wie fast alles, was aus Armeelagerbeständen kam, roch der Mantel nach Schimmel, Staub und dem Schweiß toter junger Männer; Sam versuchte gar nicht erst darüber nachzudenken, warum das Stück in dem Laden gelandet war. Immerhin war der Mantel viel wärmer als die Windjacke, die er als Studienanfänger aus Kalifornien mitgebracht hatte. Außerdem hoffte Sam, dass der gigantische Mantel seine Gestalt kaschierte. Aber eigentlich ließen ihn die absurden Ausmaße des Kleidungsstücks nur noch kleiner und kindlicher wirken.
Mit anderen Worten hatte Sam Masur im Alter von einundzwanzig Jahren nicht gerade die passende Statur, um zu drängeln und zu schubsen, deshalb schlängelte er sich so gut es ging zwischen den Leuten hindurch und fühlte sich dabei wie die bemitleidenswerte Amphibie aus dem Videospiel Frogger. Immer wieder murmelte er ein unaufrichtiges »Verzeihung«. Das Großartige an der Kodierung des Hirns, dachte Sam, ist wohl die Tatsache, dass es »Verzeihung« sagen kann, wenn es eigentlich »Verpiss dich« meint. Sofern sie keine unzuverlässigen Erzähler oder eindeutig als verrückt oder böse markiert sind, sollten Figuren in Romanen, Filmen und Spielen unbedingt ernst genommen werden, als die Gesamtheit dessen, was sie tun oder sagen. Aber echte Menschen – gewöhnliche, anständige, eigentlich ehrliche Leute – könnten ohne dieses eine, unverzichtbare Detail in ihrer Programmierung, das es ihnen erlaubt, das eine zu sagen und etwas ganz anderes zu meinen, zu fühlen oder sogar zu tun, keinen Tag überstehen.
»Kannst du nicht außen rumgehen?«, blaffte ein Mann mit schwarz-grüner Makrameemütze ihn an.
»Verzeihung«, sagte Sam.
»So ein Mist, sie war fast eingeschlafen«, murmelte eine Frau mit Baby im Tragetuch, als Sam sich an ihr vorbeizwängte.
»Verzeihung«, sagte er.
Hier und dort machte jemand auf dem Absatz kehrt und hinterließ eine kleine Lücke in der Menge. Diese Lücken hätten Sams Fluchtweg sein können, aber irgendwie füllten sie sich jedes Mal prompt mit neuen ablenkungshungrigen Menschen.
Als er schon fast bei der Rolltreppe angekommen war, drehte er sich noch einmal um, um herauszufinden, was die Leute so faszinierte. Sam konnte sich jetzt schon vorstellen, wie er von dem Stau im Bahnhof berichtete und Marx sagte: »Und du warst gar nicht neugierig? Wenn du es schaffen würdest, deine Menschenfeindlichkeit mal für eine Sekunde abzulegen, würde dich da draußen eine Welt voller Menschen und Dinge erwarten.« Sam wollte nicht, dass Marx ihn für einen Menschenfeind hielt, selbst wenn er einer war, also drehte er sich um. Und da entdeckte er seine alte Kameradin Sadie Green.
Nicht, dass er sie in der Zwischenzeit nie gesehen hätte. Sie waren beide Stammgäste bei Wissenschaftsmessen, akademischen Spielen, Uni-Vorstellungsveranstaltungen, Wettbewerben (Rhetorik, Robotik, Kreatives Schreiben, Programmieren) und Festessen für die Jahrgangsbesten gewesen. Denn egal, ob man eine mittelmäßige öffentliche Schule im Osten der Stadt besuchte (Sam) oder eine schicke Privatschule im Westen (Sadie) – der Kreis der smartesten Kids von Los Angeles blieb derselbe. Oft hatten sie in einem Saal voller Nerds Blicke ausgetauscht, manchmal hatte sie sogar Entspannungspolitik betrieben und ihn angelächelt, nur um dann wieder in der Gruppe attraktiver smarter Kids zu verschwinden, die sie stets umgab. Jungs und Mädchen wie er, nur reicher, weißer und mit besseren Zähnen und Brillengestellen. Er wollte kein weiterer hässlicher Nerd sein, der um Sadie Green herumschlich. Manchmal erklärte er sie zum Bösewicht und redete sich ein, sie habe ihn gekränkt: dieses eine Mal, als sie ihm den Rücken zugekehrt hatte; das andere Mal, als sie seinem Blick ausgewichen war. Dabei hatte sie nichts dergleichen getan – und wenn doch, wäre es immerhin etwas gewesen.
Er hatte gewusst, dass sie am MIT studierte, und er hatte sich gefragt, ob er sie, wenn er in Harvard war, vielleicht irgendwo treffen würde. Aber dann hatte er zweieinhalb Jahre lang nichts getan, um eine Begegnung zu erzwingen, und sie auch nicht.
Aber da war sie nun: Sadie Green in Person. Bei ihrem Anblick hätte er heulen können. Es fühlte sich an, als wäre sie ein mathematischer Beweis, der ihm viele Jahre lang entgangen war, aber jetzt, mit frischen, ausgeruhten Augen, präsentierte sich ihm die offensichtliche Lösung. Da ist Sadie, dachte er. Ja.
Er war kurz davor, ihren Namen zu rufen, ließ es dann aber bleiben. So viel Zeit war vergangen, seit er zum letzten Mal mit Sadie allein gewesen war, dass das Gefühl ihn zu überwältigen schien. Wie konnte im Leben eines Menschen, der so unbestreitbar jung war wie er, so viel Zeit vergangen sein? Und wie konnte er so plötzlich vergessen, dass er sie eigentlich verachtete? Die Zeit, dachte Sam, war ein Rätsel. Aber dann besann er sich und schob das Gefühl beiseite. Die Zeit war mathematisch erklärbar; es war das Herz – also jener Teil des Gehirns, für den das Herz steht –, das Rätsel aufgab.
Sadie löste den Blick von was auch immer die Menge anstarrte und drehte sich zur herandonnernden Bahn der Red Line um.
Sam rief ihren Namen: »SADIE!« Zusätzlich zum Rumpeln des einfahrenden Zuges hallte der übliche menschliche Lärm durch die U-Bahn-Station. Ein Teenager hatte einen Hut vor sich aufgestellt und spielte auf dem Cello Musik vom Penguin Cafe Orchestra. Ein Mann in Paisley-Weste fragte alle Vorbeikommenden höflich, ob sie einen Augenblick Zeit für die muslimischen Flüchtlinge in Srebrenica hätten. Gleich neben Sadie war ein Stand, der Fruchtshakes zu sechs Dollar anbot. Just in dem Moment, als Sam ihren Namen rief, fing der Mixer zu sirren an, und in die abgestandene Bahnhofsluft mischte sich der Duft von Zitrusfrüchten und Erdbeeren. »Sadie Green!«, rief Sam abermals, aber sie hörte ihn immer noch nicht. Er beschleunigte seine Schritte, so gut er konnte. Wann immer Sam etwas schneller ging, fühlte er sich wie beim Dreibeinlauf.
»Sadie! SADIE!« Auf einmal kam er sich dumm vor. »SADIEMIRANDAGREEN! DUBISTANDYSENTERIEGESTORBEN!«
Endlich drehte sie sich um. Langsam suchte sie die Menge ab, und als sie ihn schließlich entdeckte, entfaltete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Er musste an das Zeitraffervideo von der aufblühenden Rose denken, das er einmal im Physikunterricht gesehen hatte. Ihr Lächeln war wunderschön und, wie er befürchtete, einen Hauch gekünstelt. Lächelnd ging sie auf ihn zu – sie hatte ein Grübchen auf der rechten Wange und eine winzige Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen –, und die Menge schien sich für sie zu teilen. Für ihn hatte die Welt sich noch nie auf diese Weise bewegt.
»Meine Schwester war die mit der Dysenterie, Sam Masur«, sagte Sadie. »Ich bin an Erschöpfung gestorben, nach einem Schlangenbiss.«
»Und weil du nicht auf die Büffel schießen wolltest«, sagte Sam.
»Das ist Verschwendung!«, rief Sadie. »Das viele Fleisch verrottet einfach!«
Und damit umarmte sie ihn stürmisch. »Sam Masur! Ich hatte gehofft, dich irgendwann zu treffen.«
»Ich stehe im Telefonbuch«, sagte Sam.
»Nun, ich habe mir gewünscht, dass es sich ganz organisch ergibt«, sagte Sadie. »So wie jetzt.«
»Was führt dich zum Harvard Square?«
»Das magische Auge selbstverständlich«, sagte sie scherzhaft und gestikulierte in Richtung der Werbetafel. Zum ersten Mal nahm Sam das einen mal eineinhalb Meter große Plakat wahr, das die Pendler in eine Zombiehorde verwandelt hatte.
SIEHDIEWELTAUFGANZNEUEWEISE.ZUDIESEMWEIHNACHTSFESTWÜNSCHENSICHALLEDASMAGISCHEAUGE.
Das Plakat zeigte ein psychedelisches Muster in weihnachtlichen Smaragd-, Rubin- und Goldtönen. Wenn man es lange genug anstarrte, konnte man sein Gehirn austricksen und ein verstecktes 3-D-Motiv erkennen. Das Ganze nannte sich Autostereogramm, zur Erstellung brauchte es nicht mehr als einen mittelmäßig begabten Programmierer. Das?, dachte Sam. Was die Leute alles interessant finden. Er stöhnte.
»Du magst es nicht?«, fragte Sadie.
»So was hängt in jedem Gemeinschaftsraum auf dem Campus.«
»Nicht dieses hier. Dieses gibt es nur …«
»In jedem U-Bahnhof in Boston.«
»Vielleicht sogar in den USA?«, lachte Sadie. »Aber Sam, willst du die Welt denn nicht mit magischen Augen sehen?«
»Ich sehe die Welt immer mit magischen Augen«, erklärte Sam. »Ich explodiere geradezu vor kindlichem Staunen.«
Sadie zeigte auf einen etwa sechsjährigen Jungen. »Schau mal, wie glücklich er ist! Jetzt hat er es entdeckt! Super gemacht!«
»Hast du es auch entdeckt?«, fragte Sam.
»Noch nicht«, gab Sadie zu. »Und jetzt muss ich wirklich den nächsten Zug nehmen, sonst komme ich zu spät zu meinem Seminar.«
»Du hast doch sicher noch fünf Minuten Zeit, um die Welt mit magischen Augen zu sehen«, sagte Sam.
»Nächstes Mal vielleicht.«
»Komm schon, Sadie. Das nächste Seminar kommt bestimmt. Wie oft hast du schon erlebt, dass alle um dich herum dasselbe sehen, oder zumindest dass ihre Gehirne und ihre Augen auf denselben Reiz reagieren? Wie oft bekommt man einen Beweis dafür, dass wir alle in ein und derselben Welt leben?«
Sadie lächelte zerknirscht und boxte Sam sanft gegen den Oberarm. »Das war so ziemlich das Samigste, was du jetzt sagen konntest.«
»Ich bin eben Sam.«
Sie seufzte, während die U-Bahn rumpelnd die Station verließ. »Falls ich in Computergrafik für Fortgeschrittene durchfalle, ist es deine Schuld.« Sie stellte sich wieder so hin, dass sie das Plakat sehen konnte. »Los, mach mit, Sam.«
»Jawohl, Ma’am.« Sam nahm die Schultern zurück und starrte geradeaus. Seit Jahren hatte er nicht mehr so dicht neben Sadie gestanden.
Laut den Anweisungen auf dem Plakat sollte man die Augen entspannen und sich auf einen einzigen Punkt konzentrieren, bis das versteckte Motiv auftauchte. Falls es nicht klappte, sollte man näher an das Plakat herantreten und sich dann langsam entfernen, wofür auf dem Bahnsteig aber kein Platz war. Das Motiv war Sam ohnehin egal. Er vermutete, dass es sich um einen Weihnachtsbaum handelte oder um einen Engel oder einen Stern, keinen Davidstern natürlich, sondern irgendetwas Festliches, Banales, Gefälliges, das den Umsatz der Magisches-Auge-Produkte steigern würde. Autostereogramme hatten bei Sam noch nie funktioniert, was wahrscheinlich an seiner Brille lag, die eine starke Kurzsichtigkeit korrigierte und seine Augen nie genug entspannen ließ, um die Illusion wahrnehmen zu können. Folglich gab Sam es nach einer angemessen langen Zeitspanne (fünfzehn Sekunden) auf, das versteckte Motiv zu suchen und studierte stattdessen Sadie.
Ihre Haare waren jetzt kürzer – vermutlich eine modische Frisur –, aber noch genauso kastanienbraun und wellig wie früher. Sie hatte noch immer ein paar vereinzelte Sommersprossen auf der Nase und einen olivfarbenen Teint, wirkte aber viel blasser als damals in Kalifornien. Ihre Lippen waren aufgesprungen, die Augen unverändert braun mit goldenen Sprenkeln. Sams Mutter Anna hatte ganz ähnliche Augen gehabt und ihm einmal erklärt, dass diese Färbung Heterochromie genannt wurde. Für ihn hatte das damals nach einer Krankheit geklungen, nach etwas, woran seine Mutter möglicherweise sterben könnte. Unter Sadies Augen waren kaum merkliche Augenringe, die hatte sie schon als Kind gehabt. Trotzdem machte sie einen müden Eindruck. Sam betrachtete Sadie und dachte: So fühlen sich Zeitreisen an. Wie einen Menschen gleichzeitig in der Gegenwart und in der Vergangenheit sehen zu können. Die Transportart funktionierte natürlich nur, wenn man sein Gegenüber schon eine ganze Weile kannte.
»Ich hab’s!«, sagte sie mit leuchtenden Augen und einem Gesichtsausdruck, der ihn an die Elfjährige erinnerte.
Sam richtete seinen Blick schnell wieder auf das Plakat.
»Hast du es entdeckt?«, fragte sie.
»Ja«, sagte er. »Ich habe es entdeckt.«
Sadie sah ihn an. »Was hast du entdeckt?«, fragte sie.
»Na, das«, sagte Sam. »Einfach großartig. Und so festlich.«
»Hast du es wirklich gesehen?«, fragte sie. Ihre Mundwinkel zuckten, ihre heterochromen Augen musterten ihn spöttisch.
»Ja, aber ich möchte allen, die es noch suchen, nicht den Spaß verderben.« Er deutete vage auf die Menge.
»Okay«, sagte Sadie. »Wie rücksichtsvoll von dir.«
Er wusste, dass sie wusste, dass er nichts gesehen hatte. Er lächelte sie an, und sie lächelte zurück.
»Wirklich seltsam«, sagte Sadie. »Es kommt mir vor, als hätten wir nie aufgehört, uns zu treffen. Als kämen wir jeden Tag hier runter, um dieses Plakat anzustarren.«
»Wir grokken«, sagte Sam.
»In der Tat, wir grokken. Und ich nehme zurück, was ich vorhin gesagt habe. Das ist das Samigste, was du sagen konntest.«
»Ich bin halt der Samigste von allen. Und du bist …« Während er sprach, fing der Mixer wieder zu sirren an.
»Was?«, fragte sie.
»Du bist hier falsch«, wiederholte er.
»Was meinst du mit ›falsch‹?«
»Du bist am Harvard Square, aber du musst zum Central Square oder zum Kendall Square. Irgendwer hat mir erzählt, du gehst aufs MIT«, sagte Sam.
»Mein Freund wohnt hier«, sagte Sadie so, als wolle sie nicht weiter über das Thema sprechen. »Ich frage mich, warum sie Squares heißen. Die sind doch gar nicht quadratisch, oder?« Eine weitere Bahn fuhr ein. »Das ist meine. Schon wieder.«
»So ist das mit den U-Bahnen«, sagte Sam.
»Das ist wahr. Es kommt ein Zug und ein Zug und noch ein Zug«, sagte sie.
»Deshalb solltest du einen Kaffee mit mir trinken«, sagte Sam. »Oder was auch immer du trinkst, falls Kaffee ein zu großes Klischee für dich ist. Chai-Tee. Einen Smoothie. Kombucha. Dr. Pepper. Champagner. Weißt du, direkt über uns existiert eine Welt der unbegrenzten Getränkemöglichkeiten. Wir müssten nur diese Rolltreppe nehmen, und schon wären wir mittendrin.«
»Ich wünschte, ich könnte, aber ich muss jetzt wirklich los. Ich habe noch nicht mal die halbe Leseliste geschafft. Ich behaupte mich da allein durch pünktliches Erscheinen und regelmäßige Anwesenheit.«
»Das bezweifle ich«, sagte Sam. Sadie war einer der intelligentesten Menschen, die er kannte.
Sie umarmte ihn noch einmal kurz. »Es war schön, dich zu sehen.«
Dann lief sie in Richtung Zug, und Sam überlegte, wie er sie aufhalten konnte. Wäre das hier ein Spiel, könnte er auf Pause drücken. Er könnte das Ganze neu starten und andere Sätze sagen, die richtigen diesmal. Er könnte sein Inventar nach dem einen Gegenstand durchsuchen, der Sadie zum Bleiben bewegen würde.
Verzweifelt fiel ihm ein, dass sie nicht einmal Nummern ausgetauscht hatten. In Gedanken ging er alle Möglichkeiten durch, wie sich eine Person im Jahr 1995 ausfindig machen ließ. Früher, als Sam ein Kind war, konnte man einen Menschen für immer aus den Augen verlieren, aber diese Zeiten waren vorbei. Inzwischen brauchte es nicht mehr als den bloßen Wunsch, und schon konnte man jemanden von einer digitalen Mutmaßung in einen leibhaftigen Menschen verwandeln. Deshalb tröstete er sich mit dem Gedanken, dass die Welt sich, während seine alte Freundin auf dem Bahnsteig immer kleiner wurde, in dieselbe Richtung weiterentwickelte – durch Globalisierung, Datenautobahnen und so weiter. Sadie Green zu finden wäre ganz leicht. Er könnte ihre E-Mail erraten, denn alle Mailadressen des MIT folgten demselben Muster. Er könnte das Online-Verzeichnis durchsuchen oder im Fachbereich Informatik anrufen, denn wahrscheinlich studierte sie Informatik. Er könnte sich bei ihren Eltern melden, Steven Green und Sharyn Friedman-Green in Kalifornien.
Gleichzeitig kannte er sich selbst ziemlich gut und wusste, dass er nur dort anrufen würde, wo eine Kontaktaufnahme ganz sicher willkommen war. Sein Gehirn war auf eine heimtückische Weise negativ. Er würde sich einreden, dass Sadie ihm die kalte Schulter gezeigt und an diesem Tag nicht einmal ein Seminar gehabt hatte. Dass sie einfach nur von ihm wegwollte. Sein Gehirn würde darauf bestehen, dass sie ihm, hätte sie ihn wiedersehen wollen, ihre Nummer gegeben hätte. Am Ende würde er zu dem Schluss kommen, dass er sie an einen schmerzhaften Lebensabschnitt erinnerte und dass sie ihn deshalb natürlich nicht treffen wollte. Oder vielleicht hatte er ihr nie etwas bedeutet – er war bloß das Wohltätigkeitsprojekt eines reichen Mädchens gewesen. Er würde über den Freund nachgrübeln, der angeblich in der Nähe des Harvard Square wohnte. Er würde ihre Nummer, ihre Mailadresse und ihre Anschrift herausfinden und sich dann trotzdem nie bei ihr melden. Auf einmal wurde ihm mit phänomenologischer Schwere bewusst, dass er Sadie Green heute vielleicht wirklich zum letzten Mal gesehen hatte, und deshalb versuchte er, sich in allen Details einzuprägen, wie sie ausgesehen hatte, als sie an diesem bitterkalten Dezembertag über den Bahnsteig davonging. Beige Kaschmirmütze, Fäustlinge, Schal. Hellbrauner, knielanger Wollmantel, ganz sicher nicht aus dem Armeeladen. Abgetragene, leicht ausgestellte Jeans mit ausgefranstem Saum. Schwarze Turnschuhe mit weißem Streifen. Ihre vollgestopfte Umhängetasche war aus cognacfarbenem Leder und so breit wie sie, an einer Seite hing der Ärmel eines wollweißen Pullovers heraus. Das glänzende, leicht feuchte Haar reichte ihr bis an die Schulterblätter. Aus dieser Perspektive, stellte er fest, war die echte Sadie nicht zu erkennen. Sie unterschied sich in nichts von all den anderen adretten, gepflegten Studentinnen auf dem Bahnsteig.
Doch als sie schon fast verschwunden war, drehte sie sich noch einmal um und kam zu ihm zurück. »Sam!«, rief sie. »Zockst du eigentlich noch?«
»Ja«, antwortete er ein bisschen zu eifrig. »Auf jeden Fall. Die ganze Zeit.«
»Hier.« Sie drückte ihm eine 3,25-Zoll-Diskette in die Hand. »Das ist mein Spiel. Du bist wahrscheinlich total beschäftigt, aber probier es mal aus, wenn du Zeit hast. Ich würde zu gern wissen, wie du es findest.«
Sie sprang zurück in die U-Bahn, Sam folgte ihr bis zur Tür.
»Warte! Sadie! Wie kann ich dich erreichen?«
»Meine Mailadresse ist auf der Diskette«, rief sie. »Im Readme.«
Die Türen schlossen sich, und Sadie fuhr zurück zu ihrem Square. Sam betrachtete die Diskette in seiner Hand. Das Spiel hieß Solution, der Name auf dem Etikett war handgeschrieben. Er hätte ihre Handschrift überall wiedererkannt.
Als er später an dem Abend nach Hause kam, installierte er Solution nicht sofort, sondern legte es neben das Laufwerk seines Computers. Sadies Spiel nicht zu spielen motivierte ihn jedoch sehr, und so arbeitete er am Exposé einer Hausarbeit, das seit einem Monat überfällig war und sonst bis nach den Ferien hätte warten müssen. Nach langem Händeringen hatte er sich für das Thema »Alternative Herangehensweisen an das Banach-Tarski-Paradoxon in Abwesenheit des Auswahlaxioms« entschieden. Schon beim Verfassen des Exposés langweilte er sich so sehr, dass er sich geradezu vor der Quälerei fürchtete, die die Hausarbeit selbst bedeuten würde. Er hegte den Verdacht, dass er zwar eine offensichtliche Begabung für Mathematik besaß, sich aber nicht sonderlich dafür begeistern konnte. Sein Studienberater im Fachbereich Mathematik, Anders Larsson, der später die Fields-Medaille erhalten würde, hatte bei ihrer Besprechung am Nachmittag etwas in der Richtung angedeutet. Bei der Verabschiedung hatte er gesagt: »Du bist unglaublich begabt, Sam. Aber du solltest nicht vergessen, dass gut in etwas zu sein nicht dasselbe ist, wie es zu lieben.«
Sam und Marx aßen Essen, das sie beim Italiener bestellt hatten. Marx hatte zu viel geordert, damit Sam sich von den Resten ernähren konnte, während er verreist war. Er lud Sam noch einmal über die Feiertage zum Skifahren nach Telluride ein: »Du solltest wirklich mitkommen. Falls du dir wegen des Skifahrens Gedanken machst … die meiste Zeit hängen wir sowieso in der Hütte rum.« Sam hatte oft nicht einmal genug Geld, um über die Feiertage nach Hause zu fahren, also wurden solche Einladungen in regelmäßigen Abständen ausgesprochen und abgelehnt. Nach dem Abendessen machte Sam sich an die Lektüre für seinen Kurs in Moralischer Beweisführung (es ging um die Philosophie des jungen Wittgenstein, bevor er zu der Einsicht gekommen war, dass er in allem irrte), und Marx bereitete sich auf die Reise vor. Als er mit Packen fertig war, schrieb er eine Weihnachtskarte und legte sie zusammen mit einem Fünfzig-Dollar-Gutschein für die Brauerei auf Sams Schreibtisch. Dort entdeckte er die Diskette.
»Was ist Solution?« Marx nahm die grüne Diskette und hielt sie fragend in die Höhe.
»Ein Spiel von jemandem aus meinem Freundeskreis«, sagte Sam.
»Von wem?«, fragte Marx. Sie wohnten nun schon fast seit drei Jahren zusammen, aber nie hatte Sam irgendwelche Freunde erwähnt.
»Jemand aus Kalifornien.«
»Wirst du es spielen?«, fragte Marx.
»Irgendwann. Wahrscheinlich ist es grottenschlecht. Ich sehe es mir aus reiner Höflichkeit an.« Bei diesen Worten hatte Sam das Gefühl, Sadie zu verraten, aber wahrscheinlich war das Spiel wirklichgrottenschlecht.
»Worum geht es?«, fragte Marx.
»Keine Ahnung.«
»Cooler Titel.« Marx setzte sich an Sams Computer. »Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Wollen wir es ausprobieren?«
»Warum nicht«, sagte Sam. Er hatte es allein spielen wollen, aber er und Marx zockten regelmäßig zusammen. Sie bevorzugten Nahkampfspiele: Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter. Außerdem hatten sie eine Dungeons-&-Dragons-Kampagne angefangen, die sie ab und zu weiterführten. Sam war jetzt seit über zwei Jahren Marx’ Dungeon Master. Zu zweit Dungeons & Dragons zu spielen ist eine merkwürdige und sehr intime Angelegenheit, deshalb hielten sie die Kampagne streng geheim.
Marx schob die Diskette in den Schlitz, Sam installierte das Spiel auf der Festplatte.
Ein paar Stunden später hatten sie Solution zum ersten Mal durchgespielt.
»Was zur Hölle war das?«, fragte Marx. »Ich müsste schon längst bei Ajda sein. Sie wird mich umbringen.« Ajda war Marx’ neueste Flamme – ein eins achtzig großes, Squash spielendes Gelegenheitsmodel aus der Türkei, was aber für Marx’ Verhältnisse ein eher mittelmäßiger Steckbrief war. »Ich habe echt gedacht, wir würden nur fünf Minuten spielen.«
Marx schlüpfte in seinen Mantel – kamelfarben, wie der von Sadie. »Dein Freund ist krass drauf. Und möglicherweise ein Genie. Woher kennst du ihn noch mal?«
2
An dem Sommertag, als Sadie Sam zum ersten Mal traf, war sie aus dem Krankenhauszimmer ihrer großen Schwester Alice verbannt worden. Alice war so launisch wie die meisten Dreizehnjährigen und wie fast alle Menschen, die vielleicht an Krebs sterben werden. Ihre Mutter Sharyn fand, man solle Alice viel Freiraum lassen, denn mit der doppelten Sturmfront aus Pubertät und Krankheit zurechtzukommen sei für einen einzigen Körper anstrengend genug. Viel Freiraum bedeutete, dass Sadie sich in den Wartebereich setzen musste, bis Alice nicht mehr wütend auf sie war.
Sadie war sich nicht ganz sicher, was sie diesmal getan hatte, um ihre Schwester zu provozieren. Sie hatte Alice ein Bild von einem Mädchen mit roter Baskenmütze im Teen Magazine gezeigt und so etwas gesagt wie: Die würde dir gut stehen. Sadie wusste nicht mehr, was genau sie gesagt hatte, doch auf jeden Fall hatte Alice es nicht gut aufgenommen und absurderweise geschrien: Niemand würde in Los Angeles so eine Mütze tragen! Deswegen hast du keine Freunde, Sadie Green! Dann war sie zum Weinen ins Bad gegangen, was sich wie Würgen anhörte, weil ihre Nase verstopft und ihr Hals wund war. Sharyn, die im Sessel neben dem Bett geschlafen hatte, sagte ihr, sie solle sich beruhigen, zu viel Aufregung mache sie krank. Ich bin schon krank, sagte Alice. Da fing auch Sadie an zu weinen – sie hatte tatsächlich keine Freunde, aber sie darauf hinzuweisen war gemein von Alice. Am Ende bat Sharyn sie, in den Wartebereich zu gehen.
»Das ist einfach nicht fair«, hatte Sadie zu ihrer Mutter gesagt. »Ich habe nichts getan. Sie reagiert total über.«
»Es ist wirklich nicht fair«, stimmte Sharyn ihr zu.
Die verbannte Sadie grübelte darüber nach, was passiert war – sie hatte wirklich geglaubt, dass die rote Mütze Alice gut stehen würde. Aber Alice hatte wohl gedacht, dass Sadie eigentlich etwas über ihre Haare sagen wollte, die durch die Chemotherapie ganz dünn geworden waren. In dem Fall tat es Sadie leid, die blöde Mütze überhaupt erwähnt zu haben. Sie klopfte an Alices Tür, um sich zu entschuldigen. Als Sharyn sie durch das kleine Glasfenster sah, formte ihr Mund die Worte: »Komm später wieder. Sie schläft.«
Um die Mittagszeit wurde Sadie hungrig und hatte deswegen ein bisschen weniger Mitleid mit Alice und ein bisschen mehr Mitleid mit sich selbst. Dass Alice sich so beschissen verhielt und sie dafür bestraft wurde, ärgerte sie. Alice war krank, das hatte Sadie oft genug zu hören bekommen, aber im Sterben lag sie nicht. Ihre Leukämieform hatte eine besonders hohe Remissionsrate. Sie sprach gut auf die Behandlung an und würde im Herbst wahrscheinlich sogar wieder planmäßig in die Schule gehen können. Diesmal würde Alice nur zwei Nächte im Krankenhaus bleiben müssen, und das auch nur, wie ihre Mutter sagte, »aus einem Übermaß an Vorsicht«. Sadie mochte die Formulierung »Übermaß an Vorsicht«. Sie dachte dabei an einen Schwarm Krähen, eine Herde Schafe, ein Rudel Wölfe. Sie stellte sich die Vorsicht als ein Lebewesen vor, eine Kreuzung aus Bernhardiner und Elefant vielleicht. Ein großes, intelligentes, gutmütiges Tier, das die Green-Schwestern vor real existierenden und anderen Bedrohungen schützte.
Ein Krankenpfleger, der die unbeaufsichtigte, verdächtig gesund wirkende Elfjährige im Wartezimmer bemerkt hatte, schenkte Sadie einen Becher Vanillepudding. Ganz eindeutig war sie eines der vielen vernachlässigten Kinder mit krankem Geschwisterkind, und so schlug er ihr vor, sich das Spielzimmer anzusehen. Dort gebe es eine Nintendo-Konsole, die nachmittags unter der Woche nur selten benutzt wurde. Sadie und Alice besaßen selbst eine Nintendo, aber bis Sharyn sie wieder nach Hause fuhr, hatte Sadie fünf Stunden lang nichts zu tun. Es war Sommer, und Weckerhund, Wedermann und Schlafittchen, das einzige mitgebrachte Buch, hatte sie an dem Tag schon zweimal gelesen. Wäre Alice nicht sauer geworden, würden sie jetzt ihren üblichen Beschäftigungen nachgehen: ihre Lieblingssendungen Press That Button! und The Price is Right schauen; im Seventeen Magazine blättern und sich gegenseitig den Persönlichkeitstests unterziehen; Oregon Trail oder eines der anderen Lernspiele spielen, die auf dem zehn Kilo schweren Laptop vorinstalliert waren, auf dem Alice eigentlich ihre Schularbeiten erledigen sollte. Inzwischen hatten die Mädchen unzählige Wege gefunden, sich die Zeit zu vertreiben. Sadie hatte vielleicht nicht viele Freunde, aber eigentlich brauchte sie auch keine, denn in Wahrheit war Alice ihr absoluter Lieblingsmensch. Niemand war schlauer, mutiger, schöner, sportlicher, witziger oder was auch immer als Alice. Für Sadie war Alice das Nonplusultra. Obwohl alle sagten, Alice würde wieder gesund werden, ertappte sich Sadie oft dabei, wie sie sich eine Welt ohne ihre Schwester vorstellte. Eine Welt ohne Insiderwitze und gemeinsame Lieblingsmusik, ohne geteilte Pullover und halbgare Brownies, ohne Schwesternhaut an Schwesternhaut unter der Decke, im Dunkeln, und vor allem ohne Alice, Hüterin der intimsten Geheimnisse und größten Peinlichkeiten in Sadies unschuldigem Herz. Es gab niemanden, den sie mehr liebte als Alice, auch nicht ihre Eltern oder ihre Großmutter. Die Welt ohne Alice war trostlos wie ein grobkörniges Foto von Neil Armstrong auf dem Mond, und der Gedanke daran ließ die elfjährige Sadie nachts oft nicht schlafen. Sich eine Weile in die Welt von Nintendo zu flüchten wäre eine Wohltat.
Aber das Spielzimmer war nicht leer. Ein Junge spielte Super Mario Brothers. Sadie konnte sofort sehen, dass er kein Geschwisterkind auf Besuch war wie sie, sondern krank: Mitten am Tag trug er einen Schlafanzug, neben seinem Stuhl lagen Krücken am Boden, und sein linker Fuß steckte in einer mittelalterlich aussehenden, käfigartigen Vorrichtung. Er schien ungefähr in ihrem Alter zu sein, elf oder ein bisschen älter, und hatte wirre schwarze Locken, eine Stupsnase und eine Brille. Sein Kopf war so rund wie der einer Zeichentrickfigur. In der Schule zeichneten sie gerade, und Sadie hatte gelernt, die Dinge in geometrische Formen zu zerlegen. Um diesen Jungen zu zeichnen, hätte sie hauptsächlich Kreise gebraucht.
Sie kniete sich neben ihn und sah ihm eine Weile beim Spielen zu. Er war gut – am Ende des Levels ließ er Mario oben auf der Spitze der Fahnenstange landen, was Sadie noch nie geschafft hatte. Obwohl sie am liebsten selbst spielte, machte es Spaß, einem so geschickten Spieler zuzusehen – es war, als beobachtete man jemanden beim Tanzen. Offenbar ignorierte er sie. Er schien nicht mal zu bemerken, dass sie da war. Als er den ersten Bosskampf hinter sich hatte, erschienen auf dem Bildschirm die Worte Aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss. Er hielt das Spiel an und fragte, ohne sie anzusehen: »Willst du den Rest von diesem Leben spielen?«
Sadie schüttelte den Kopf. »Nein. Du machst das echt gut. Ich kann warten, bis du stirbst.«
Der Junge nickte. Er spielte weiter, und Sadie sah weiter zu.
»Übrigens. Das hätte ich nicht sagen sollen«, sagte Sadie nach einer Weile. »Ich meine, falls du wirklich stirbst. Weil das hier ja ein Kinderkrankenhaus ist.«
Der Junge steuerte Mario in eine wolkige Gegend voller Münzen. »Weil das hier die Welt ist, müssen alle sterben«, sagte er.
»Stimmt«, sagte Sadie.
»Aber jetzt gerade sterbe ich nicht.«
»Gut zu wissen«, sagte Sadie.
»Du?«, fragte der Junge.
»Nein«, sagte Sadie. »Jetzt gerade nicht.«
»Warum bist du dann hier?«, fragte der Junge.
»Meine Schwester ist krank.«
»Was hat sie?«
»Dysenterie«, sagte Sadie.
Sie hatte keine Lust, den Krebs heraufzubeschwören, diesen Zerstörer jeder normalen Unterhaltung.
Der Junge sah Sadie an, als wollte er eine weitere Frage stellen, aber dann reichte er ihr nur den Controller.
»Hier«, sagte er. »Meine Daumen sind müde.«
Sadie schlug sich gut durch das Level, machte Mario größer und fügte ein weiteres Leben hinzu.
»So schlecht bist du gar nicht«, sagte der Junge.
»Wir haben zu Hause eine Nintendo, aber ich darf nur eine Stunde pro Woche damit spielen«, sagte Sadie. »Aber niemand achtet mehr auf mich, seit meine Schwester Al krank geworden ist …«
»Dysenterie«, sagte er.
»Ja. In diesem Sommer wollte ich ins Weltraumcamp nach Florida, aber meine Eltern haben beschlossen, dass ich zu Hause bleiben und Al Gesellschaft leisten muss.« Sadie rammte einen Goomba in den Boden, eine der pilzähnlichen Kreaturen, vor denen es in Super Mario nur so wimmelt. »Die Goombas tun mir leid.«
»Das sind nur Handlanger«, sagte der Junge.
»Aber sie wurden in etwas reingezogen, was nichts mit ihnen zu tun hat.«
»So ist das im Leben eines Handlangers. Geh durch das Rohr«, sagte er. »Da unten gibt es einen Haufen Münzen.«
»Ich weiß! Ich mache das gleich noch«, sagte Sadie. »Al ist die meiste Zeit genervt von mir, deswegen verstehe ich erst recht nicht, warum ich nicht ins Weltraumcamp durfte. Ich wäre das erste Mal in einem Ferienlager gewesen und das erste Mal allein in einem Flugzeug. Und es hätte sowieso nur zwei Wochen gedauert.« Sadie war fast am Ende des Levels angekommen. »Was ist der Trick, um oben auf der Fahnenstange zu landen?«, fragte sie.
»Halt den Laufknopf so lange wie möglich gedrückt, dann geh in die Hocke und spring ab, kurz bevor du fällst«, sagte der Junge.
Sadie/Mario landete auf der Spitze der Fahnenstange. »Hey, es hat geklappt. Ich bin übrigens Sadie.«
»Sam.«
»Du bist dran.« Sie gab ihm den Controller zurück. »Und was ist mit dir?«, fragte sie.
»Ich hatte einen Autounfall«, sagte Sam. »Mein Fuß ist siebenundzwanzig Mal gebrochen.«
»Ganz schön oft«, sagte Sadie. »Übertreibst du, oder ist das die echte Zahl?«
»Das ist die Zahl. Ich bin sehr genau, was Zahlen angeht.«
»Ich auch.«
»Manchmal erhöht sich die Zahl ein wenig, weil sie ihn an anderen Stellen brechen müssen, um ihn zu richten«, sagte Sam. »Vielleicht müssen sie ihn sogar abschneiden. Ich kann nicht mehr drauf stehen. Ich bin schon dreimal operiert worden, und eigentlich ist es kein Fuß mehr. Eher ein Fleischsack mit Knochensplittern drin.«
»Klingt appetitlich«, sagte Sadie. »Sorry, falls das jetzt eklig ist. Bei deiner Beschreibung musste ich an Chips denken. Seit meine Schwester krank ist, fallen bei uns viele Mahlzeiten aus, und ich habe ständig Hunger. Heute habe ich nur einen Pudding gegessen.«
»Du bist seltsam, Sadie«, sagte Sam interessiert.
»Ich weiß«, sagte Sadie. »Ich hoffe wirklich, dass sie dir nicht den Fuß amputieren müssen, Sam. Meine Schwester hat übrigens Krebs.«
»Ich dachte, sie hat Dysenterie.«
»Na ja, von der Krebsbehandlung kriegt sie Dysenterie. Das mit der Dysenterie ist unser Witz. Kennst du das Computerspiel Oregon Trail?«
»Nein«, sagte Sam.
»Vielleicht haben sie es ja im Computerraum deiner Schule. Wahrscheinlich mein Lieblingsspiel, auch wenn es irgendwie langweilig ist. Es geht um diese Leute aus dem neunzehnten Jahrhundert, die versuchen, in einem Wagen und mit ein paar Ochsen von der Ostküste an die Westküste zu gelangen. Das Ziel ist, dort anzukommen, ohne dass einer aus der Gruppe stirbt. Du musst sie ausreichend ernähren, darfst nicht zu schnell sein, musst die richtigen Vorräte kaufen und so weiter. Manchmal stirbt trotzdem jemand oder man selbst, durch einen Klapperschlangenbiss zum Beispiel oder an Hunger oder an …«
»Dysenterie.«
»Ja, genau! Und wenn das passiert, müssen Al und ich immer lachen.«
»Was ist Dysenterie?«, fragte Sam.
»Durchfall«, flüsterte Sadie. »Das wussten wir anfangs auch nicht.«
Sam lachte los und hörte sofort wieder auf. »Ich lache immer noch«, sagte er. »Aber es tut weh, wenn ich lache.«
»Dann verspreche ich, nie wieder etwas Lustiges zu sagen«, sagte Sadie in seltsam flachem Ton.
»Hör auf, sonst muss ich noch mehr lachen! Was bist du überhaupt?«
»Ein Roboter.«
»Ein Roboter klingt anders.« Sam ahmte Robotergeräusche nach, woraufhin sie wieder losprusteten.
»Du sollst nicht lachen!«, sagte Sadie.
»Du sollst mich nicht zum Lachen bringen. Kann man wirklich an Dysenterie sterben?«, fragte Sam.
»Früher schon, glaube ich.«
»Meinst du, sie haben es auf den Grabstein geschrieben?«
»Ich glaube nicht, dass Todesursachen auf Grabsteinen stehen, Sam.«
»In der Geisterbahn in Disneyland schon! Irgendwie wünsche ich mir jetzt, dass ich an Dysenterie sterbe. Wollen wir Duck Hunt spielen?«
Sadie nickte.
»Du musst die Waffen holen. Da oben.« Sadie holte die Waffen und schloss sie an die Konsole an. Sie ließ Sam zuerst schießen.
»Du bist wirklich sehr, sehr gut«, sagte sie. »Hast du zu Hause eine Nintendo?«
»Nein«, sagte Sam, »aber mein Opa hat einen Donkey-Kong-Automaten in seinem Restaurant. Er lässt mich umsonst spielen, so viel ich will. Und die Sache ist die: Wenn man in einem Spiel gut ist, kann man in jedem Spiel gut sein. Glaube ich jedenfalls. Eigentlich geht es immer nur um Hand-Augen-Koordination und das Erkennen von Mustern.«
»Sehe ich genauso. Und wie bitte? Dein Opa hat einen Donkey-Kong-Automaten? Das ist so cool! Ich liebe diese alten Maschinen. Was für ein Restaurant?«
»Eine Pizzeria«, sagte Sam.
»Was? Ich liebe Pizza! Das ist mein absolutes Lieblingsessen.«
»Meins auch«, sagte Sam.
»Kannst du so viel Gratispizza essen, wie du willst?«, fragte Sadie.
»Im Prinzip schon«, sagte Sam.
»Das ist mein größter Traum. Du lebst einfach meinen Traum. Du musst mich mitnehmen, Sam. Wie heißt das Restaurant? Vielleicht war ich ja schon mal da.«
»Dong and Bong’s New York Style House of Pizza. Dong und Bong sind die Namen meiner Großeltern. Auf Koreanisch ist das nicht mal witzig. Es ist so, als würden sie Jack und Jill heißen«, sagte Sam. »Das Restaurant ist auf dem Wilshire Boulevard in K-Town.«
»Was ist K-Town?«, fragte Sadie.
»Fräulein, bist du überhaupt aus Los Angeles? K-Town ist Koreatown. Wie kannst du das nicht wissen?«, fragte Sam. »Jeder kennt K-Town.«
»Ich weiß, was Koreatown ist. Ich wusste nur nicht, dass man es K-Town nennt.«
»Wo wohnst du eigentlich?«, fragte Sam.
»In den Flats.«
»Was sind die Flats?«, fragte Sam.
»Der flache Teil von Beverly Hills«, erklärte Sadie. »Liegt ganz in der Nähe von K-Town. Siehst du, du wusstest nicht, was die Flats sind! Die Leute in L. A. kennen immer nur den Stadtteil, in dem sie wohnen.«
»Da hast du wahrscheinlich recht.«
Für den Rest des Nachmittags unterhielten Sam und Sadie sich angeregt und schossen dabei virtuelle Enten ab. »Was haben uns diese Enten je getan?«, fragte Sadie irgendwann.
»Vielleicht schießen wir sie für ein digitales Abendessen. Ohne die virtuellen Enten wird unser digitales Wir verhungern.«
»Sie tun mir trotzdem leid«, sagte Sadie.
»Du hattest schon Mitleid mit den Goombas. Du hast wohl Mitleid mit allen«, sagte Sam.
»Stimmt«, sagte Sadie. »Auch mit den Büffeln in Oregon Trail.«
»Warum?«
Sadies Mutter steckte den Kopf ins Spielzimmer. Alice hatte Sadie etwas mitzuteilen, was in ihrer Sprache bedeutete, dass Sadie verziehen worden war. »Ich erzähle es dir nächstes Mal«, sagte Sadie, obwohl sie nicht wusste, ob es ein nächstes Mal geben würde.
»Bis dann«, sagte Sam.
»Wer ist dein kleiner Freund?«, fragte Sharyn, als sie den Raum verlassen hatten.
»Nur irgendein Junge«, sagte Sadie und warf einen Blick zurück auf Sam, der sich schon wieder dem Spiel zugewandt hatte. »Er war nett.«
Auf dem Weg zu Alices Zimmer bedankte sich Sadie bei dem Krankenpfleger, der ihr das Spielzimmer gezeigt hatte. Er lächelte Sadies Mutter an – heutzutage waren gute Manieren bei Kindern relativ selten. »War es leer, wie ich gesagt habe?«
»Nein, da war ein Junge. Sam …« Sie wusste seinen Nachnamen nicht.
»Du hast Sam kennengelernt?«, fragte der Pfleger und wirkte plötzlich sehr interessiert. Vielleicht hatte Sadie eine geheime Krankenhausregel gebrochen, weil sie in das Zimmer gegangen war, obwohl ein krankes Kind dort spielte. Seit Alice an Krebs erkrankt war, gab es so viele Regeln.
»Ja«, sagte Sadie zögerlich. »Wir haben geredet und Nintendo gespielt. Es schien ihm nichts auszumachen, dass ich auch da war.«
»Sam mit den Locken und der Brille. Der Sam?«
Sadie nickte.
»Ich muss mal kurz mit deiner Mutter sprechen«, sagte der Krankenpfleger.
»Geh schon mal vor zu Alice«, sagte Sharyn.
Ein bisschen nervös betrat Sadie Alices Zimmer. »Ich glaube, ich kriege Ärger«, verkündete sie.
»Was hast du jetzt schon wieder getan?«, fragte Alice. Sadie erzählte ihr von der mutmaßlichen Straftat. »Die haben gesagt, du darfst da reingehen«, sagte Alice, »also hast du nichts falsch gemacht.«
Sadie setzte sich aufs Bett, und Alice fing an, ihr die Haare zu flechten.
»Der Krankenpfleger wollte bestimmt was anderes von Mom«, fuhr Alice fort. »Vielleicht geht es um mich. Welcher Pfleger war es?«
Sadie schüttelte den Kopf. »Weiß ich nicht.«
»Mach dir keine Sorgen. Und falls du wirklich Ärger kriegst, fängst du einfach an zu weinen und sagst, deine Schwester hat Krebs.«
»Tut mir leid wegen der Sache mit der Mütze«, sagte Sadie.
»Welche Mütze? Ach, die. Es lag an mir. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist.«
»Leukämie, wahrscheinlich.«
»Dysenterie«, korrigierte Alice sie.
Aber als Sharyn das Spielzimmer auf der Heimfahrt nicht erwähnte, war Sadie relativ zuversichtlich, dass sie die Sache schon vergessen hatte. Im Autoradio lief ein NPR-Bericht über die Hundertjahrfeier der Freiheitsstatue, und Sadie überlegte sich, wie furchtbar es wäre, würde es sich bei der Freiheitsstatue um eine echte Frau handeln. Wie gruselig, ständig irgendwelche Menschen in sich zu haben. Sicher fühlten sie sich wie Eindringlinge an, wie eine Krankheit, wie Läuse oder Krebs. Die Vorstellung verstörte sie, und Sadie war erleichtert, als ihre Mutter das Radio ausschaltete. »Hör mal. Dieser Junge, mit dem du heute gesprochen hast.«
Jetzt kommt’s, dachte Sadie. »Ja«, sagte sie leise. Sie bemerkte, dass sie gerade durch K-Town fuhren, und sofort hielt sie nach Dong and Bong’s New York Style House of Pizza Ausschau. »Ich kriege doch keinen Ärger, oder?«
»Nein, warum fragst du?«
Weil Sadie in letzter Zeit fast immer Ärger kriegte. Anscheinend war es unmöglich, elf zu sein, eine krebskranke Schwester zu haben und sich so zu verhalten, wie die Leute es erwarteten. Ständig sagte sie das Falsche, oder sie war zu laut oder verlangte zu viel (Zeit, Liebe, Essen). Dabei verlangte sie nicht mehr, als sie früher bekommen hatte. »Nur so.«
»Der Krankenpfleger hat mir erzählt, dass Sam einen schweren Autounfall hatte«, fuhr Sharyn fort. »In den sechs Wochen seit seiner Einlieferung hat er mit niemandem mehr als zwei Worte gesprochen. Er hat schreckliche Schmerzen und muss wahrscheinlich noch lange im Krankenhaus bleiben. Dass er sich mit dir unterhalten hat, war wirklich eine Ausnahme.«
»Echt? Auf mich wirkte er ziemlich normal.«
»Sie haben schon alles versucht, damit er sich öffnet. Therapie, Freunde, Familie. Worüber habt ihr euch unterhalten?«
»Keine Ahnung. Nichts Besonderes«, sagte sie und versuchte, sich an das Gespräch zu erinnern. »Über Videospiele.«
»Also, das liegt jetzt ganz bei dir«, sagte Sharyn. »Aber der Pfleger hat gefragt, ob du morgen wiederkommen könntest, um noch ein bisschen mit Sam zu plaudern.« Bevor Sadie antworten konnte, fügte sie hinzu: »Ich weiß, dass du für deine Bat Mizwa im nächsten Jahr gemeinnützige Arbeit leisten musst. Wahrscheinlich würde es zählen.«
Sich wirklich auf ein Spiel mit einem anderen Menschen einzulassen ist nicht ohne Risiko. Es bedeutet, sich zu öffnen, sich zu entblößen und verletzlich zu sein. Es ist das menschliche Äquivalent zu dem Hund, der sich auf den Rücken wirft – ich weiß, du wirst mir nicht wehtun, obwohl du es kannst. Es ist der Hund, der deine Hand in die Schnauze nimmt und nicht zubeißt. Zum Spielen braucht es Vertrauen und Liebe. Viele Jahre später sagte Sam in einem Interview mit der Spiele-Website Kotaku etwas Kontroverses: »Kein Akt ist intimer als der des Spielens, nicht einmal Sex.« Die Antwort des Internets: Jemand, der guten Sex gehabt hatte, würde so etwas niemals sagen; ganz eindeutig stimmte mit Sam etwas nicht.
Am nächsten Tag ging Sadie ins Krankenhaus und am übernächsten auch und an dem danach, überhaupt an allen Tagen, an denen es Sam gut genug ging, um zu spielen, aber nicht gut genug, um das Krankenhaus zu verlassen. Sie wurden echte Spielkameraden. Sie liebten den Wettstreit, und während sie spielten, erzählten sie einander Geschichten aus ihrem relativ kurzen Leben. Irgendwann wusste Sadie alles über Sam, und Sam wusste alles über Sadie. Zumindest glaubten sie das. Sie brachte ihm die Programmiersprache bei, die sie in der Schule gelernt hatte (BASIC), er half ihr beim Zeichnen (Kreuzschraffur, Perspektive, Chiaroscuro). Für seine zwölf Jahre war er ein hervorragender Zeichner.
Nach dem Unfall hatte Sam angefangen, komplizierte Labyrinthe im Stil von M. C. Escher zu entwerfen. Seine Psychologin bestärkte ihn darin, brauchte er ihr zufolge doch eine Möglichkeit, mit den körperlichen und seelischen Schmerzen fertigzuwerden. Außerdem war sie überzeugt, dass Sam durch die Labyrinthe einen Weg aus seiner derzeitigen Lage finden wollte. Doch sie lag falsch. Sam zeichnete die Labyrinthe für Sadie. Immer wenn sie ging, steckte er ihr eins in die Tasche. »Für dich«, sagte er. »Es ist nichts Besonderes. Bring es das nächste Mal wieder mit, damit ich die Lösung sehen kann.«
Später erzählte Sam den Leuten, diese Labyrinthe seien seine ersten Versuche als Spieleentwickler gewesen. »Ein Labyrinth«, sagte er, »ist ein Videospiel in seiner reinsten Form.« Das mochte stimmen, klang aber revisionistisch und selbstgefällig. Die Labyrinthe waren für Sadie bestimmt. Wenn man ein Spiel entwirft, stellt man sich die Person vor, die es schließlich spielen wird.
Nach jedem Besuch bei Sam legte Sadie den Krankenschwestern heimlich einen Stundenzettel zum Unterschreiben vor. Die meisten Freundschaften lassen sich nicht in Zahlen ausdrücken, aber auf dem Formular konnte man genau nachlesen, wie viele Stunden Sadie schon mit Sam befreundet war.
Nach einigen Monaten warf Sadies Großmutter Freda zum ersten Mal die Frage in den Raum, ob Sadie wirklich gemeinnützige Arbeit leistete. Freda Green chauffierte Sadie oft zum Krankenhaus. Sie besaß ein rotes amerikanisches Cabrio und fuhr mit bedrucktem Seidentuch um den Kopf bei offenem Verdeck, wann immer das Wetter es erlaubte (was in Los Angeles meistens der Fall war). Sie war knapp eins fünfzig groß, nur einen Zentimeter größer als die elfjährige Sadie, und trug makellose, maßgeschneiderte Kleidung, die sie einmal pro Jahr in Paris einkaufte: strahlend weiße Blusen, weiche graue Wollhosen, Pullover aus Bouclé oder Kaschmir. Nie ging sie ohne ihre sechseckige Waffe von Lederhandtasche, ihren scharlachroten Lippenstift, ihre filigrane goldene Armbanduhr, ihr Gardenienparfum und ihre Perlenkette vor die Tür. In Sadies Augen war sie die eleganteste Frau der Welt. Freda war nicht nur Sadies Großmutter, sondern auch eine Immobilienmagnatin aus Los Angeles, und sie genoss den Ruf, furchteinflößend und bei Verhandlungen absolut unnachgiebig zu sein.
»Meine liebe Sadie«, sagte sie, als sie vom Westen der Stadt in den Osten fuhren. »Du weißt, dass ich überglücklich bin, dich ins Krankenhaus fahren zu dürfen.«
»Danke, Bubbe. Ich weiß das wirklich zu schätzen.«
»Aber nach allem, was du mir erzählt hast, ist dieser Junge doch eher so etwas wie ein Freund.«
Das wasserfleckige Formular für die gemeinnützige Arbeit ragte oben aus ihrem Mathebuch heraus. Sadie schob es schnell zurück. »Mom sagt, das wäre in Ordnung«, sagte sie wie zu ihrer Verteidigung. »Und die Leute im Krankenhaus auch. Erst letzte Woche hat sein Opa mich umarmt und mir ein Stück Pizza Funghi angeboten. Ich verstehe nicht, was daran falsch sein soll.«
»Ja, aber der Junge weiß nichts von der Vereinbarung, oder?«
»Nein«, sagte Sadie. »Es ist halt nie zur Sprache gekommen.«
»Und könnte es einen Grund dafür geben, warum du es nicht angesprochen hast?«
»Wenn ich bei Sam bin, sind wir beschäftigt«, sagte Sadie halbherzig.
»Liebling, falls es irgendwann später herauskommt, könnte es deinen Freund sehr verletzen. Vielleicht denkt er dann, er wäre für dich kein richtiger Freund, sondern ein Wohltätigkeitsfall.«
»Kann man nicht beides sein?«, fragte Sadie.
»Freundschaft ist Freundschaft, und Wohltätigkeit ist Wohltätigkeit«, sagte Freda. »Du weißt, dass ich als Kind in Deutschland war, du hast die Geschichten schon oft gehört, also werde ich sie dir nicht noch einmal erzählen. Aber glaube mir, Leute, die dir Wohltätigkeit erweisen, sind niemals deine Freunde. Es ist unmöglich, von einem Freund Wohltätigkeit zu erfahren.«
»So habe ich das noch nie gesehen«, sagte Sadie.
Freda tätschelte ihre Hand. »Liebste Sadie. Das Leben ist voll von unvermeidlichen moralischen Kompromissen. Wir sollten tun, was wir können, um ihre Zahl kleinzuhalten.«
Sadie wusste, dass Freda recht hatte. Und doch legte sie den Stundenzettel weiterhin vor. Sie mochte das Ritual, und sie mochte es, gelobt zu werden – vom Pflegepersonal, manchmal von den Ärzten und Ärztinnen, aber auch von ihren Eltern und den Leuten in der Synagoge. Sogar das Ausfüllen des Protokolls war ein Vergnügen. Für sie war das Ganze ein Spiel, das nicht viel mit Sam selbst zu tun hatte. Es war keine richtige Täuschung, denn sie verheimlichte ihr Projekt nicht aktiv vor Sam; aber je mehr Zeit verging, desto sicherer war sie, ihm niemals davon erzählen zu können. Sie wusste, dass die Existenz des Stundenzettels den Anschein erwecken würde, als hätte sie Hintergedanken, wo die Wahrheit doch offensichtlich war: Sadie Green wurde gern gelobt, und Sam Masur war der beste Freund, den sie je hatte.
Sadies gemeinnütziges Projekt dauerte achtzehn Monate. Wie befürchtet endete es an dem Tag, als Sam davon erfuhr. Unterm Strich belief ihre Freundschaft sich auf sechshundertneun Stunden, plus die vier Stunden am ersten Tag, die nicht mitgezählt wurden. Und weil für eine Bat Mizwa in der Beth-El-Synagoge nur zwanzig Stunden gemeinnützige Arbeit erforderlich gewesen wären, erhielt Sadie von den Hadassah-Frauen eine Auszeichnung für ihren außergewöhnlichen Einsatz.
3
Das Fortgeschrittenenseminar für Spieleentwicklung fand einmal pro Woche statt, donnerstagnachmittags von 14 bis 16 Uhr. Es gab nur zehn Plätze, die Studierenden wurden auf Antrag zugelassen. Leiter war der achtundzwanzigjährige Dov Mizrah, der mit Nachnamen im Kurskatalog stand, in Gamerkreisen aber nur unter seinem Vornamen bekannt war. Man sagte über Dov, er sei wie die beiden Johns (Carmack und Romero), jene amerikanischen Wunderkinder, die Commander Keen und Doom entworfen und programmiert hatten, nur eben in einer Person. Dov war berühmt für seine dunkle Lockenmähne, die engen Lederhosen, die er auf Gamertreffen trug, und, ja, für ein Spiel namens Dead Sea. Um Licht und Schatten in diesem Unterwasser-Zombie-Abenteuer fotorealistisch darzustellen, hatte er eine bahnbrechende Grafik-Engine namens Ulysses erfunden. Sadie und etwa fünfhunderttausend andere Nerds hatten Dead Sea im Sommer zuvor gespielt. Dov war der erste Professor, dessen Arbeit ihr gefiel, bevor sie den Kurs belegte, und nicht weil sie den Kurs belegt hatte. Die Fortsetzung von DeadSea wurde sehnsüchtig erwartet, und als sie seinen Namen im Kurskatalog las, hatte Sadie sich gefragt, warum jemand seine glanzvolle Karriere als Spieleentwickler unterbrach, nur um zu unterrichten.
»Jetzt mal ganz ehrlich«, sagte Dov am ersten Tag, »ich bin nicht hier, um euch das Programmieren beizubringen. Das ist hier ein MIT-Seminar für fortgeschrittene Spieleentwicklung. Ihr wisst längst, wie man programmiert, und falls nicht …« Er zeigte zur Tür.
Das Format ähnelte einem Seminar für Kreatives Schreiben. Jede Woche brachten zwei Studierende ein einfaches Spiel oder den Ausschnitt eines größeren Projekts mit, irgendetwas, das sich innerhalb des knappen Zeitrahmens programmieren ließ. Die anderen spielten es durch und besprachen es dann. Über das Semester hinweg war jeder im Kurs für die Entwicklung von zwei Spielen verantwortlich.
Hannah Levin, neben Sadie das einzige Mädchen (was am MIT allerdings ein ziemlich gängiges Männer-zu-Frauen-Verhältnis war), fragte Dov, ob er Wert auf eine bestimmte Programmiersprache lege.
»Warum sollte ich? Die sind doch alle gleich. Die können mir alle mal den Schwanz lutschen. Und das meine ich wörtlich! Die Programmiersprache sollte euch den Schwanz lutschen. Sie muss euch dienen.« Dov sah Hannah an. »Du hast keinen Schwanz – also den Kitzler oder was auch immer. Such dir die Programmiersprache aus, die dich kommen lässt.«
Hannah lachte nervös und wich Dovs Blick aus. »Also, dann wäre Java okay?«, fragte sie leise. »Manche Leute respektieren Java nicht, aber …«
»Java respektieren? Also wirklich, scheiß auf den, der das gesagt hat. Aber wie dem auch sei – benutzt eine Programmiersprache, die mich kommen lässt«, sagte Dov.
»Ja, aber falls es eine gibt, die du bevorzugst …«
»Wie heißt du?«
»Hannah Levin.«
»Hannah Levin. Alter, komm mal runter. Ich bin nicht hier, um dir zu erklären, wie du dein Spiel programmieren sollst. Benutz von mir aus drei Programmiersprachen. So mache ich das auch. Ich schreibe irgendwas, und wenn ich nicht weiterkomme, arbeite ich eine Zeitlang in einer anderen Sprache weiter. Dafür gibt es Compiler. Hat sonst noch jemand eine Frage?«
Sadie fand Dov vulgär und abstoßend und ein bisschen sexy.
»Unser Ziel ist es, uns gegenseitig vom Hocker zu hauen«, erklärte Dov. »Ich will keine Kopien meiner eigenen Arbeiten sehen und auch keine Spiele, die ich schon kenne. Ich will keine hübschen Bilder, hinter denen keine Idee steckt. Keinen makellosen Code, der am Ende bloß langweilige Welten erzeugt. Ich hasse, hasse, hasse, hasse Langeweile. Überrascht mich. Verstört mich. Kränkt mich. Wobei, mich zu kränken ist unmöglich.«
Nach dem Kurs sprach Sadie Hannah an. »Hey Hannah, ich bin Sadie. Da drin ging es ganz schön ruppig zu, was?«
»Ich fand es in Ordnung«, sagte Hannah.
»Hast du Dead Sea gespielt? Es ist fantastisch.«
»Was ist Dead Sea?«
»Sein Spiel. Der Grund, warum ich überhaupt in diesem Seminar bin. Man spielt ein kleines Mädchen, die einzige Überlebende von …«
Hannah fiel ihr ins Wort. »Wahrscheinlich sollte ich es mir mal ansehen.«
»Unbedingt. Was spielst du denn so?«, fragte Sadie.
Hannah runzelte die Stirn. »Sorry, ich muss jetzt wirklich los. War nett, dich kennenzulernen.«
Sadie wusste nicht, warum sie sich überhaupt solche Mühe machte. Man sollte meinen, dass Frauen, wenn es schon nicht so viele von ihnen gibt, irgendwie zusammenhalten, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Als wäre Frausein eine ansteckende Krankheit, die man sich nicht einfangen wollte. Indem man sich nicht mit den anderen Frauen abgab, konnte man der männlichen Mehrheit weismachen: Ich bin nicht wie die anderen. Sadie war von Natur aus eine Einzelgängerin, aber in einem weiblichen Körper ins MIT zu gehen war selbst für sie eine Lektion in Einsamkeit. Bei ihrer Zulassung hatte etwa ein Drittel des Jahrgangs aus Frauen bestanden, und irgendwie hatte es sich da schon nach weniger angefühlt. Manchmal hatte sie den Eindruck, wochenlang keiner einzigen Frau zu begegnen. Vielleicht lag es daran, dass die Männer, zumindest die meisten, Frauen für dumm hielten. Oder wenn nicht gerade für dumm, dann doch für weniger schlau. Außerdem gingen sie davon aus, dass Frauen es leichter hatten, am MIT angenommen zu werden. Statistisch gesehen war das auch der Fall – Frauen hatten eine zehn Prozent höhere Zulassungsquote als Männer. Für diese Statistik gab es aber viele mögliche Gründe. Einer davon war Selbstsabotage: MIT-Bewerberinnen stellten möglicherweise höhere Ansprüche an sich selbst. Die Schlussfolgerung hätte nicht lauten dürfen, dass eine am MIT aufgenommene Studentin weniger begabt und des Platzes weniger würdig wäre, doch anscheinend war es genau so.
In diesem Semester hatte Sadie das Glück – oder Unglück –, ihr Spiel als Siebte zu präsentieren. Zunächst war sie sich unsicher gewesen, was sie programmieren sollte. Idealerweise würde es etwas darüber aussagen, was für eine Sorte Spieledesignerin sie später einmal sein würde. Ihre Präsentation durfte nicht zu klischeehaft, nicht zu generisch und nicht zu schlicht sein, weder in grafischer noch in spielerischer Hinsicht. Aber nachdem sie mitangesehen hatte, wie die anderen von Dov niedergemacht wurden, wusste sie, dass es keine Rolle spielte. Dov hasste einfach alles. Variationen von Dungeons & Dragons hasste er ebenso wie rundenbasierte Rollenspiele. Er hasste alle Jump-’n’-Run-Spiele außer Super Mario, obwohl er Spielkonsolen eigentlich verachtete. Er hasste Sport. Er hasste niedliche Tiere. Er hasste Spiele, die auf geistigem Eigentum basierten. Er hasste das weitverbreitete Konzept von Jagen-oder-gejagt-werden. Vor allem aber hasste er Shooter, was bedeutete, dass er einen Großteil sämtlicher erfolgreicher Spiele hasste und überhaupt so ziemlich alles, was von Profis oder Studierenden entwickelt wurde. »Leute«, sagte Dov. »Ihr wisst, dass ich in der Armee war, oder? Ihr Amerikaner romantisiert Waffen so krass, weil ihr nicht wisst, wie es ist, im Krieg zu kämpfen und ständig unter Beschuss zu stehen. Es ist echt erbärmlich.«
Florian, der dünne angehende Ingenieur, dessen Spiel gerade auf der Schlachtbank lag, sagte: »Dov, ich komme nicht mal aus Amerika.« Und Florians Projekt war auch kein Shooter, sondern ein Bogenschießspiel, inspiriert durch seine Wettkämpfe als jugendlicher Bogenschütze in Polen.
»Stimmt, aber du hast die amerikanischen Werte übernommen.«
»In Dead Sea wird doch auch gekämpft.«
Aber Dov beharrte darauf, dass es in Dead Sea keine Schießereien gab.
»Wovon redest du?«, sagte Florian. »Das Mädchen verprügelt einen Typen mit einem Stück Holz.«
»Das ist doch kein Schießen«, sagte Dov. »Wenn ein kleines Mädchen einen gewalttätigen Mann mit einem Holzscheit schlägt, ist das ehrlicher Nahkampf. Eine körperlose Hand, die gesichtslose Gegner abknallt, ist unehrlich. Ich habe außerdem nichts gegen Gewalt, nur gegen einfallslose Spiele, die so tun, als wäre Ballern das Einzige, was man im Leben tun kann. Das ist einfallslos, Florian. Und das Problem bei deinem Spiel besteht nicht darin, dass es ein Shooter ist, sondern dass es keinen Spaß macht. Darf ich dich was fragen? Hast du es schon mal gespielt?«
»Ja, natürlich.«
»Hat es Spaß gemacht?«
»Für mich ist Bogenschießen kein Spaß«, sagte Florian.
»Okay, scheiß drauf, wen interessiert’s, ob es Spaß macht. Hat es sich wie Bogenschießen angefühlt?«
Florian zuckte mit den Achseln.
»Für mich nämlich nicht.«
»Ich weiß nicht, was das heißen soll.«
»Ich erkläre es dir. Deine Schießmechanik arbeitet mit Verzögerung. Ich kann nicht sehen, worauf das Visier gerichtet ist. Und wie du sicher weißt, simuliert es kein bisschen das Gefühl, einen Bogen zu spannen. Es gibt keine Spannung, und die Kopfanzeige verdeckt mehr, als dass sie hilft. Man sieht nur ein paar Bilder von einem Bogen und eine Zielscheibe. Das ist ein Spiel über irgendwas von irgendwem. Außerdem fehlt eine Geschichte. Das Problem bei deinem Spiel ist nicht, dass es ein Shooter ist, sondern dass es ein schlechter Shooter ohne Charakter ist.«
»Das ist Bullshit, Dov«, sagte Florian. Er war jetzt sehr blass, seine Haut leuchtete in einem psychedelischen Rosa.
»Alter«, sagte Dov und klopfte ihm liebevoll auf die Schulter, um ihn dann in eine aggressive Umarmung zu ziehen. »Nächstes Mal scheitern wir besser.«
Als Sadie ihr erstes Spiel programmierte, wusste sie nicht, was Dov gefallen würde, aber langsam fragte sie sich, ob das der Sinn der Übung war. Man konnte es Dov sowieso nicht recht machen. Warum also nicht etwas erfinden, das wenigstens Spaß machte? Aus reiner Verzweiflung – und weil sie kaum noch Zeit hatte – entwickelte Sadie ein Spiel mit Gedichten von Emily Dickinson. Sie nannte es EmilyBlaster. Von oben fielen Wörter herab, die man mit Hilfe eines beweglichen, tintensprühenden Federkiels am unteren Bildrand abschießen musste. In der richtigen Reihenfolge ergaben sie eines von Dickinsons Gedichten. Hatte man mehrere Zeilen korrekt abgeschossen und das Level geschafft, bekam man Punkte und durfte ein Zimmer in Emilys Haus in Amherst dekorieren.
Weil ich
SCHUSS
Beim Tod
SCHUSS
Nicht halten
SCHUSS
Konnt