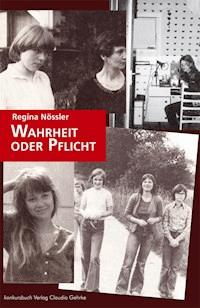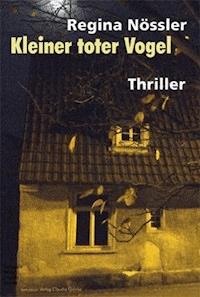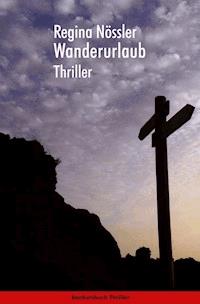Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Querverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christine Hoffmann wacht eines Morgens im Krankenhaus auf und hat ihr Leben vergessen. Ihre Eltern sind ihr ebenso fremd wie ihre beste Freundin, selbst ihre Lebensgefährtin Marion erkennt sie nicht wieder. Christines Alltag wird zu einem Puzzle, das sie aus Erzählungen und Erinnerungsblitzen neu zusammensetzen muss. Wer war sie, wer ist sie und weshalb weiß sie es nicht mehr? Was genau ist mit ihr passiert? Hat sie wirklich acht glückliche Jahre mit Marion verbracht? Wem kann sie trauen: ihrer Intuition oder denen, die scheinbar das Beste für sie wollen? Gibt es etwas, das man ihr verheimlicht? Während Christine versucht, alte Liebe mühsam neu zu erlernen, begegnet sie Eva. Mühelos verliebt sie sich und erinnert sich plötzlich an Glück. Doch kann sie es auch zulassen? Der neue Beziehungsthriller von Regina Nössler verfolgt stilsicher eine junge Frau auf der Suche nach wahren Gefühlen und sich selbst. Eindringlich und außergewöhnlich spannend erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Querverlag GmbH, Berlin 2007
Lektorat: Corinna Waffender
Erste Auflage September 2007
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag und grafische Realisierung von Sergio Vitale unter Verwendung einer Fotografie von Anja Müller.
ISBN 978-3-89656-600-3
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Querverlag GmbH, Akazienstraße 25, D-10823 Berlin
www.querverlag.de
1
Hellgrüne Streifen auf der weißen Bettwäsche. Schöne Farbe, dachte sie. Beruhigend. Der Stoff war ein wenig rau, trotzdem fühlte er sich angenehm auf der Haut an. Sonnenlicht fiel ins Zimmer. Sie hätte es gern direkt im Gesicht gespürt, auf den Armen, am Oberkörper. Sie sehnte sich danach. Sie wusste, dass es Wohlbehagen bereiten und wärmen würde, doch bis zu dem Bett, in dem sie lag, reichte es nicht.
Auch auf den kleinen Tisch am Fenster, den sie entdeckte, als sie den Kopf drehte, fiel der Sonnenschein. Am Tisch standen drei Stühle, auf ihm eine Vase mit einem Blumenstrauß. Sie wäre am liebsten sofort aufgestanden, um sich in die Sonne zu setzen, vergaß dieses Vorhaben jedoch schnell wieder, denn ihr Kopf schmerzte bei der kleinsten Bewegung. Er tat so weh wie niemals zuvor.
Niemals zuvor. Was für ein seltsamer Ausdruck.
„Ah, die Gehirnerschütterung ist wach!“
Bis zu diesem Moment hatte sie nicht bemerkt, dass sich außer ihr noch eine andere Person im Zimmer befand. Die Stimme von der gegenüberliegenden Seite erschreckte sie. Sie klang nicht unfreundlich, aber sie war viel zu laut und zerstörte mit einem Schlag das wohlige Gefühl, das Sonnenlicht und Bettwäsche gerade noch in ihr hervorgerufen hatten.
Die Gehirnerschütterung. War sie damit gemeint?
„Gerade gab es Mittagessen“, sagte die Stimme. „Aber keine Sorge, Sie haben nichts verpasst. Schweinebraten mit Kartoffelpüree und Rosenkohl. Grauenhaft, sage ich Ihnen. Alles verkocht. Man kann ja zwischen zwei Gerichten wählen. Das vegetarische Zeug kommt für mich nicht in Frage. Ein ordentliches Stück Fleisch muss schon sein, sage ich immer. Geht es Ihnen jetzt eigentlich besser?“
Vorsichtig hob sie den Kopf, um zu erkunden, woher die Stimme kam, ein schmerzhaftes Unterfangen. Die Frau, der sie gehörte, saß aufrecht in einem Bett, das genauso aussah wie ihres, auch ihre Bettwäsche war grüngestreift. Sie hielt eine Zeitschrift in den Händen und blätterte darin, ohne wirklich hineinzusehen. Stattdessen blickte sie unverhohlen neugierig in ihre Richtung.
Dieser Sorte Kopfschmerz war nicht leicht beizukommen, das spürte sie. Vorsichtig ließ sie sich zurück auf das Kissen sinken und schloss die Augen. Krankenhaus. Kein Zweifel, sie lag im Krankenhaus. Die Frage, ob es ihr besser gehe, konnte sie nicht beantworten. War es ihr denn schlecht gegangen? Noch schlechter als jetzt? Sie stellte sich das Mittagessen vor, von dem die Frau gesprochen hatte. Kam für sie das vegetarische Zeug in Frage? Sie wusste es nicht. Warum wusste sie es nicht? Ein Bild stieg empor, aus einer entlegenen Erinnerung, bemächtigte sich hartnäckig ihres schmerzenden Kopfes und ließ sich nicht mehr vertreiben: Kartoffelpüree. Gelbes Kartoffelpüree, in das eine Mulde gegraben war. Die Mulde war voller Soße. Ein kleiner brauner See.
Sie konnte das Kartoffelpüree in Gedanken schmecken, sich seine Beschaffenheit auf der Zunge vorstellen und sie dachte daran, mit der Gabel die Wände des Sees langsam einzureißen, bis sich die Soße über den Teller ergoss, man spielt nicht mit Essen, als die Tür geöffnet wurde. Ein Arzt kam herein und trat an ihr Bett. Sie hatte ihn kommen hören, da seine Schuhsohlen bei jedem Schritt quietschten. Ein Geräusch, das noch weniger zu ertragen war als die laute Stimme der Frau im Bett gegenüber.
„Guten Tag, Frau Hoffmann“, sagte der Arzt. „Ich bin Dr. Böhmer. Hier auf der Station sieht doch alles gleich ganz anders aus, nicht wahr? Können Sie sich heute wieder erinnern?“
Erinnerte sie sich? Bevor sie darüber nachdenken konnte, sprach er bereits weiter.
„Sie hatten einen Unfall, Frau Hoffmann. Sie sind auf den Hinterkopf gefallen und waren eine Weile bewusstlos. Soweit wir nach unseren Untersuchungen sehen können, liegen keine schwerwiegenden Verletzungen vor, nur eine Gehirnerschütterung und eine Wunde am Kopf. Sehr löblich übrigens, dass Sie einen Vermerk bei sich trugen, wer zu benachrichtigen ist, wenn Ihnen etwas passiert. Gestern hatten Sie ja auch schon Besuch, wie ich gehört habe.“
Sie kannte all diese Worte: Unfall. Kopf. Gefallen. Bewusstlos. Verletzung. Gehirnerschütterung. Wunde. Sie beherrschte die Grammatik und war in der Lage, einen vollständigen Satz zu bilden.
Der Satz lautete: „Ich habe Durst.“
„Ich lasse die Schwester gleich eine Flasche Wasser bringen“, sagte der Mann, der sich als Dr. Böhmer vorgestellt hatte. Er stand noch immer neben ihrem Bett und sah auf sie herunter, eindringlich jetzt.
„Frau Hoffmann, haben Sie mich verstanden?“
Hoffmann. Ein gewöhnlicher und häufiger Name. Bestimmt hatte sie ihn schon oft gehört, ganz sicher sogar. Doch was hatte er mit ihr zu tun? Warum sprach Dr. Böhmer sie damit an? Erst jetzt bemerkte sie den Schlafanzug, den sie trug. Auf der Brust des hellgrauen Oberteils prangte eine alberne schwarze Fledermaus.
Sie hob die Bettdecke ein wenig an. Die Hose, in der ihre Beine steckten, war dunkelgrau, passend zu den Bündchen der Ärmel. Dieser Schlafanzug war ihr vollkommen fremd. Plötzlich schämte sie sich vor dem Arzt und zog die Bettdecke so hoch, dass die Fledermaus nicht mehr zu sehen war.
Dr. Böhmer wiederholte seine Frage.
„Ja, ja“, sagte sie, „ich habe Sie verstanden.“ Sie wünschte sich, dass er verschwand. „Mein Kopf tut weh.“
Erstaunlicherweise schien ihn das zufriedenzustellen. „Das wird bald vorbeigehen.“ Er tätschelte ihren Arm. „Sie brauchen jetzt Ruhe. Ich sehe später noch einmal nach Ihnen.“
Nachdem er das Zimmer verlassen hatte, wandte sich die Frau von gegenüber ihr wieder zu. „Endlich scheint mal die Sonne“, sagte sie. „Das wurde aber auch Zeit, so verregnet und kalt, wie der ganze September war.“
„Ist jetzt September?“, fragte sie und hob dabei wieder den Kopf, weil es ihr unhöflich erschien, ihre Zimmergenossin nicht anzusehen, wenn sie mit ihr sprach.
Sie erntete einen verwunderten Blick. Mehr noch – lag jetzt nicht sogar Ablehnung im Gesicht der Frau? Feindseligkeit? So als hätte sie etwas ganz und gar Unanständiges gefragt?
„Wir haben doch schon längst Oktober“, sagte die Frau tadelnd. „Heute ist der zwölfte Oktober. Übrigens mein Hochzeitstag. Na ja“, sie wurde sanfter, „bei einer Gehirnerschütterung wissen Sie das Datum vielleicht nicht mehr so genau, macht ja auch nichts. Wir sind ja alle mal ein bisschen durcheinander.“
War sie ein bisschen durcheinander? War das die Lösung des Rätsels? Wusste sie deshalb nicht, wer Frau Hoffmann war?
Wie heißen Sie?
Diese Frage, immer wieder.
Medizinische Apparate. Quietschende Schuhsohlen, ein hässliches Geräusch bei jedem Schritt. Kopf abtasten. Fremde Finger. Alle fingerten an ihr herum. Alle sahen ihr immerzu in die Augen. Augen. Spiegel der Seele. Das Gehirn auf den Röntgenbildern, war das ihres? Ein schönes Gehirn.
Folgen Sie mit den Augen meinem Finger.
Wie heißen Sie? Sagen Sie mir Ihre Adresse.
Nicht den Kopf bewegen! Nur mit den Augen.
Schädel-Hirn-Trauma.
Wie heißen Sie?
Sie brauchen Ruhe.
Jemand hatte sie von eins bis fünfzig zählen lassen. Ein anderer Arzt als Dr. Böhmer. Was für eine idiotische Aufgabe. Ungefähr bei der Zahl achtzehn begann ihr langweilig zu werden, spätestens bei dreiunddreißig. Blut auf der Handfläche. Verband am Kopf, verklebte Haare. Augenpaare, die sie unentwegt anstarrten. Je länger sie es taten, desto ratloser wirkten sie. Gemurmel. So leise, dass sie nicht alles verstehen konnte, nur einzelne Begriffe: Temporäre Amnesie. Psychogene Amnesie. Abwarten.
Sie kannte all die Worte, die der Arzt vorhin gebraucht hatte, auch das Wort „erinnern“. Erinnerung. Sie wusste, was es bedeutete. Aber sie konnte sich nicht erinnern. Nicht an den kindlichen Schlafanzug mit der Fledermaus, den sie am Leib trug, nicht an den gestrigen Besuch, den sie laut Dr. Böhmer bekommen hatte, und ebenso wenig an einen verregneten Monat September, der bereits vorüber war. Auch nicht an den August, den Juli und all die Monate davor. Sie konnte sich an gar nichts erinnern.
Doch an diesem strahlend schönen zwölften Oktober, als die Sonne im Krankenhauszimmer bedauerlicherweise nur den Tisch am Fenster erreichte, erschreckte sie das Fehlen der Erinnerung nicht. Im Gegenteil. Beinahe erheiterte es sie. So etwas geschah doch nicht wirklich. Vielleicht war sie gar nicht wach, sondern in einem langen und sehr tiefen Traum gefangen? Sie mochte die grünen Streifen auf der Bettwäsche, eine beruhigende Farbe, und sie wünschte sich, dass ihr Kopf nicht mehr wehtäte. Die Frau auf der gegenüberliegenden Seite redete unermüdlich weiter auf sie ein, sprach über ihre Hüftoperation und ihren Hochzeitstag; kurz dachte sie, dass die Höflichkeit es eigentlich geböte, ihr zu antworten und sie zu fragen, wo am Hochzeitstag eigentlich der Ehemann blieb, aber sie war zu müde und dann schlief sie ein.
Die Schwester, die kurz darauf das Zimmer betrat, stellte die Flasche Wasser ganz behutsam und leise auf den Nachttisch. Ihre Sohlen quietschten nicht auf dem Fußboden.
2
Marion stellte die kleine Reisetasche auf den Fußboden, so vorsichtig, als befände sich darin etwas Zerbrechliches oder ungeheuer Kostbares. Dabei handelte es sich nur um Unterwäsche, T-Shirts, den Schlafanzug mit der Fledermaus auf dem Oberteil und einen verblichenen, rau gewaschenen Bademantel.
„Ich packe sie später aus“, sagte sie, „du legst dich jetzt erst mal ein bisschen hin. Komm. Wohin willst du lieber, ins Bett oder aufs Sofa?“
An besorgte Blicke war Christine Hoffmann inzwischen gewöhnt. Alle hatten sie in den vergangenen Tagen auf genau diese Weise angesehen. Doch in Marions Blick lag noch mehr, etwas anderes, das weit über Besorgnis hinausging: Zuneigung. Tiefe Zuneigung. Vielleicht Liebe? Neben allem anderen hatte Christine auch vergessen, was Liebe war.
„Aufs Sofa“, antwortete sie ohne Zögern. Sie hatte genug Zeit im Bett verbracht, fast eine ganze Woche. Ein weiteres Bett war ihr nicht geheuer – noch dazu ein fremdes, genauso fremd wie das im Krankenhaus. Es war geradezu beängstigend, wie eine Gruft. Matratzengruft. Sie wollte sitzen, nicht liegen. Sie wollte aufrecht in eine ihr unbekannte Welt blicken.
Marion trat näher an Christine heran. „Wie gut, dass du wieder zu Hause bist“, sagte sie leise und streifte mit den Lippen flüchtig Christines Ohr.
Dann nahm sie ihr die Jacke ab und hängte sie sorgsam an die Garderobe. „Ich bringe sie morgen in die Reinigung. Wenn du willst, auch schon heute. Aber lieber würde ich heute bei dir bleiben. Die ganze Zeit.“ Nicht nur Christine Hoffmanns Kopf, auch ihre Kleidung hatte bei dem Sturz vor einer Woche, an den sie sich nicht erinnern konnte, gelitten, doch Marion schien der Schmutz daran weit mehr zu bekümmern als Christine.
Ob sie immer so fürsorglich ist?, fragte sich Christine. Ob sie mich immer so liebevoll behandelt? Oder herrscht jetzt ein Ausnahmezustand und im Normalfall ist alles ganz anders?
In den vergangenen Tagen hatte Marion manchmal so gewirkt, als glaubte sie Christine nicht. Als würde sie den Verlust ihrer Erinnerung anzweifeln. Sie ging im Flur umher, unschlüssig und ein wenig nervös, wie es Christine schien, und ihre Schuhe klackten laut auf den Dielen. Christines Kopfschmerzen hatten inzwischen nachgelassen, aber das Geräusch der Schuhe auf dem Holzboden nahm sie überdeutlich wahr, als gingen die Absätze direkt hinter ihren Schädelknochen spazieren, auf und ab, auf und ab.
Von Anfang an war sie zur Stelle gewesen. Marion war sofort zum Krankenhaus gefahren, nachdem sie benachrichtigt worden war, sie hatte ihr Waschzeug und Kleidung gebracht; sogar an Schokolade hatte sie gedacht, von der sie sagte, es sei Christines Lieblingssorte. Obwohl sie Marion nicht zuordnen konnte, nicht fühlte, was sie miteinander verband, war Christine von der aufrichtigen Sorge in ihrem Gesicht unendlich gerührt.
„Er gehört eigentlich mir“, hatte Marion gesagt, den Schlafanzug mit der Fledermaus auf Christines Krankenhausbett gelegt und ihre Wange gestreichelt, ganz vorsichtig. „Aber du magst ihn so gern. Du ziehst ihn dauernd an. Auch meinen uralten Bademantel.“
Christine hatte nichts von all dem wiedererkannt. Nicht den Schlafanzug und auch nicht den Bademantel. Weder Marions Gesicht noch ihre Augen, ihre Hände oder ihre angenehm weiche Stimme. Nicht ihre Berührungen. In Christine Hoffmanns Gedächtnis regte sich überhaupt nichts.
Marion hatte sie jeden Tag besucht und als Christine entlassen wurde, aus dem Krankenhaus abgeholt. Christine hatte sich bei der Hand nehmen lassen wie ein vertrauensseliges Kind, dem nicht eingeschärft worden war, Fremde zu meiden und auf gar keinen Fall mit ihnen zu gehen. Aber was war ihr anderes übrig geblieben? Marion hatte ihre kleine Reisetasche getragen und ihr die Wagentür aufgehalten. Im Auto hatte sie die Hand auf Christines Oberschenkel gelegt, nur ganz kurz, aber die Wärme ihrer Hand war in dieser Sekunde durch den Stoff bis zu Christines Haut gedrungen und Christine hatte sich gewünscht, sie möge sie noch eine Weile dort liegen lassen.
„Wir fahren jetzt nach Hause“, hatte Marion gesagt und wieder ihre Wange gestreichelt, so vorsichtig, als wäre Christine zerbrechlich oder sterbenskrank, „alles wird wieder gut.“ Mit sanfter Bestimmtheit hatte sie entschieden, dass sie zu ihrer Wohnung fahren würden, und Christine hatte sich nicht dagegen gewehrt. Wozu auch? „Du wohnst doch sowieso fast bei mir“, hatte Marion erklärt. Christine Hoffmann glaubte ihr jedes Wort. Welche Schokolade sie am liebsten aß und wo sie überwiegend lebte. Da sie sich an ihre eigene Wohnung ebenso wenig erinnern konnte wie an die Marions, war es ihr gleich, wohin sie fuhren, Hauptsache, sie musste nicht länger im Krankenhaus bleiben.
„Dann leg dich aufs Sofa“, sagte Marion. „Ich hole dir eine Decke.“
„Wo ... wo ist das Sofa?“
Christine wohnte fast hier, wie Marion sagte, und wusste nicht mehr, wo das Sofa stand. Die Traurigkeit, die in Marions Augen trat, hatte Christine bereits in den zurückliegenden Tagen an ihr bemerkt, auch wenn Marion sich bemühte, sie zu verbergen. Nun breitete sie sich aus, während beide schwiegen, und erfüllte für einen Moment den Flur.
Dann fasste sich Marion, lächelte und führte Christine in einen großen, freundlichen Raum. Die Sonne des Vormittags fiel direkt auf das Sofa. Sonnenschein. Kein Wunder, dass Christine sich die meiste Zeit hier aufhielt. Wie ihre eigene Wohnung aussah, interessierte sie nicht, denn an dieses helle Zimmer, in dem sie sich augenblicklich wohlfühlte, würde sie gar nicht heranreichen können.
Marion berührte Christines Wange, ganz vorsichtig, nur mit den Fingerspitzen. „Christine, du erkennst mich wirklich nicht, oder?“
„Nein“, sagte Christine. „Ich würde so gerne, aber ich erkenne dich wirklich nicht.“
Alle nannten sie so, seit einer Woche, entweder Christine oder Frau Hoffmann.
Sagen Sie mir Ihren Namen.
Wie heißen Sie?
Im Krankenhaus hatte sie den Namen manchmal vor sich hingeflüstert, leise, damit ihre Zimmergenossin es nicht hörte. Oder sie hatte sich in der Toilette eingeschlossen und ihn dort vor dem Spiegel etwas lauter gesagt. Es war ihr vorgekommen wie eine Mischung aus Beschwörung, Gebet, Sprechenlernen und dem Versuch, Erkenntnis zu gewinnen. Doch der Name blieb leer, sooft sie ihn auch sagte. Er füllte sich nicht mit Bedeutung. Er fühlte sich x-beliebig und fremd an. Im Nachttisch hatte sie nach ihrem Geldbeutel gesucht, ihren Papieren, und dabei hatten ihre Hände gezittert und ihr Herz wild geklopft. Sie fürchtete sich davor. Dann hatte sie lange ihren Personalausweis betrachtet. Unter der Decke, damit die Frau im Bett gegenüber es nicht bemerkte. In ihrem Ausweis war es beurkundet: Sie war Christine Hoffmann. Achtunddreißig Jahre alt, in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen geboren, lebt in Berlin. Das Foto auf dem Ausweis entsprach nicht dem Gesicht, das sie im Spiegel sah.
Sie fühlte sich nicht wie Christine. Sie dachte von sich nicht als Christine, sondern nur als Ich. Sie fühlte gar nichts, wenn ihr Name gesagt wurde, und sie wusste, sie würde sich auch nicht umdrehen, wenn ihn jemand hinter ihr riefe. Sie fragte sich, ob sie möglicherweise ihre ehemaligen Klassenkameraden, die sie, wenn sie jetzt achtunddreißig war, vor ungefähr zwanzig Jahren das letzte Mal gesehen haben musste, eher erkennen würde als diejenigen Menschen, die ihr heute am nächsten standen. Doch sie erkannte nicht einmal ihre Eltern.
Ihre Eltern hatten sie vier Tage nach ihrem Unfall, von dem sie weder wusste, wo, noch wie er geschehen war, im Krankenhaus besucht. Christine schätzte die beiden älteren Leute, die plötzlich mit einem Blumenstrauß im Zimmer gestanden hatten, auf Mitte oder Ende sechzig. Den Blumenstrauß hatte Christine als lieblos empfunden, ohne erklären zu können, warum. Sie hatte die laute Stimme der hysterischen Frau, die ihre Mutter war, kaum ausgehalten, ihr übertriebenes, theatralisches Schluchzen. Der Mann, der ihr Vater war, hatte Kordhosen und Strickjacke getragen und die meiste Zeit auf den Boden oder aus dem Fenster gesehen und geschwiegen.
Die eigene Mutter nicht zu erkennen, dachte Christine, ist wahrscheinlich der größte vorstellbare Frevel. Und schlimmer noch: Sie schämte sich für diese Frau. Vor ihrer Zimmernachbarin, die mit wachsamen Augen und Ohren das Geschehen verfolgte, auch wenn sie vorgab, eine ihrer bunten Zeitschriften zu lesen. Vor der Krankenschwester, die kurz hereinkam. Ihre Mutter redete unnötig laut und wirkte chronisch schlecht gelaunt. Sie fragte die ganze Zeit: „Mein Gott! Wie ist denn das nur passiert?“, worauf Christine ihr keine Antwort geben konnte. Sie hätte es selbst gern gewusst.
Daran, dass diese Frau tatsächlich ihre Mutter war, zweifelte Christine keinen Moment. Zu groß war die Ähnlichkeit mit dem Gesicht, das ihr aus dem Spiegel entgegenblickte. Und Christine Hoffmann sah oft in den Spiegel. Würde sie in einigen Jahren auch solche nach unten zeigenden Mundwinkel aufweisen? Wie mochte das Leben ihrer Mutter verlaufen sein? Warum sah sie so verbittert aus? Hatten sie ein enges Verhältnis zueinander? Gar eine dieser Meine-Mutter-ist-meine-beste-Freundin-Beziehungen?
Ihre Eltern waren mit dem Auto aus Nordrhein-Westfalen gekommen, wollten nur eine Nacht in Berlin bleiben und am nächsten Tag wieder zurückfahren. „Brauchst du etwas?“, hatte ihr Vater gefragt und Christine war beinahe erschrocken, als der schweigsame Mann plötzlich das Wort an sie richtete. Christine hatte verneint. Was hätte sie auch brauchen sollen? Brauchte sie jetzt dasselbe wie vor dem Unfall? Wusste sie überhaupt, was sie jetzt brauchte? Ihrer weinenden Mutter hatte sie auszureden versucht, am nächsten Vormittag noch einmal das Krankenhaus aufzusuchen. „Mir geht es gut, wirklich“, hatte sie versichert, „fahrt ruhig nach Hause.“ Zu Hause. Neben allem anderen waren auch das Haus und der Ort, in dem sie aufgewachsen war, aus ihrem Gedächtnis gelöscht.
Als die beiden Menschen, die ihre Eltern waren, das Krankenhauszimmer verlassen hatten, verspürte Christine Erleichterung. Ihre verkrampften Nackenmuskeln beruhigten sich und sie atmete langsamer. Die Wunde an ihrem Hinterkopf hörte zu pochen auf. Die Frau im Bett gegenüber war ihr inzwischen vertraut, nicht aber ihre Eltern.
„Können Sie sich eigentlich wirklich an nichts erinnern?“, hatte ihre Zimmergenossin nach einer weiteren Erwähnung der unzähligen Blutkonserven, die bei ihrer Hüftoperation notwendig gewesen waren, gefragt.
„Nein“, hatte Christine geantwortet. „An nichts. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich habe mein ganzes Leben vergessen. Ich kann tun, was ich will, es fällt mir einfach nicht wieder ein.“
Die Frau hatte ihre Zeitschrift sinken lassen. „Das ganze Leben vergessen ...“, hatte sie dann träumerisch gesagt und zum Fenster geblickt. „Das ganze Leben vergessen? Oh, wie schön.“
3
„Wie schön du bist“, sagte Marion, als sie Christine zudeckte. Und noch einmal: „Wie schön.“
Liebe und Sorge, in Marions Blick erkannte Christine beides. Sie selbst hatte vergessen, wie es sich anfühlte. Ob Marion ihr oft sagte, sie sei schön? Christine hielt das Kompliment für völlig übertrieben. Sie sah durchschnittlich und gewöhnlich aus, keineswegs schön. Auf der Suche nach sich selbst hatte sie es im Krankenhaus lange genug im Spiegel überprüft. Ihre Haut war ebenmäßig, vielleicht etwas blass, sie hatte ein annähernd symmetrisches Gesicht mit Ausnahme des leicht schiefen Mundes und kleiner Fältchen unter den Augen, die sich in wenigen Jahren zu einem Problem entwickeln würden, falls sie eitel wäre. Sie sah passabel aus. Aber sie war nicht schön. Besonders ausgiebig hatte sie ihre Stirn betrachtet, die Haut und den Knochen darunter betastet und sich gefragt: Was geht dahinter vor? Wo ist das alles? Wo ist mein Leben geblieben, wenn nicht abgespeichert hinter meiner Stirn?
Anfangs war Marion fassungslos darüber gewesen, dass Christine alles vergessen hatte, ihre gesamte Existenz. Dass Christine sie vergessen hatte. Die andere Patientin im Zimmer, mit einem Gespür dafür, wann das Belauschen einer Unterhaltung lohnenswert war, hatte die Ohren gespitzt. Unentwegt hatte Marion gefragt: „Du kannst dich an nichts erinnern? Du kannst dich wirklich an gar nichts mehr erinnern?“ Und dann hatte sie Christine ihre gemeinsame Geschichte am Krankenbett erzählt.
Sie hatten sich vor acht Jahren kennengelernt, an Christines dreißigstem Geburtstag. Seitdem waren sie ein Paar. Ein glückliches, wie Marion betonte, die große Liebe, im Unterschied zu vielen anderen Frauen aus dem Bekanntenkreis, die sich gegenseitig betrogen, schlecht behandelten und es an Achtung vor der Partnerin mangeln ließen. Marion hatte auf Christines Bettrand gesessen und ihre Hand genommen. Bei der Beschreibung des Glücks, das sie verband, hatten sich Tränen in ihren Augen gesammelt. Christine hatte darauf gewartet, dass sie ihr jeden Moment über die Wange laufen würden, aber zu ihrer Verblüffung war es nicht geschehen. Marion war es gelungen, sie zurückzuhalten, und Christine hatte sich gefragt, wo die ungeweinten Tränen wohl versickerten.
Christine Hoffmann hatte nicht nur die Liebe und eine acht Jahre dauernde Partnerschaft vergessen, sie wusste auch nicht mehr, dass sie Frauen begehrte. Etwas so Wesentliches zu vergessen, erschien ihr ungeheuerlich, und sie nahm sich vor, Marion nach ihrer Vergangenheit zu fragen, nach der Zeit ihres Lebens, bevor sie sich kennengelernt hatten. Sie hoffte, Marion im Laufe der acht Jahre genug über sich berichtet zu haben, so dass es nun ausreichen würde, um sich ein Bild davon zu machen, wer sie gewesen war.
Christine hatte zwar vergessen, dass sie Frauen begehrte, aber weder überraschte noch schockierte es sie. So wie sie sprechen, lesen und schreiben konnte, wusste sie, dass es Frauen gab, die Frauen, und Männer gab, die Männer liebten. Aber sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie mit der Frau, die sie täglich im Krankenhaus besucht hatte, geschlafen hatte. Geschweige denn, wie sich Marions Körper anfühlte, ob sie sanft oder stürmisch war, ob sie in der Erregung laut wurde. Wie sie küsste. Wusste Christine eigentlich noch, wie man küsste? Dunkel glaubte sie sich an fremde Haut auf ihrer Haut zu erinnern, an das Gewicht eines Körpers auf ihrem, an die Schwere, die sie in eine Matratze drückte, aber sie wusste nicht, ob es der eines Mannes oder einer Frau war. Ob es Marions Körper war. Heftiges Atmen an ihrem Ohr, eine Zunge. Stöhnen. Leckte sie Marion über den Hals, wenn sie sich liebten? Über ihre Brüste, den Bauch? Liebten sie sich oft? Sah sie ihr dabei in die Augen? War die Liebe nach acht Jahren noch leidenschaftlich? Leidenschaft erforderte ein gewisses Maß an Fremdheit. Woher wusste Christine das? Vermutlich hatte sie es in einer Zeitschrift gelesen. Oder wusste sie es von selbst, weil es sich um eine banale Weisheit handelte, die jeder kannte? Wenn es zutraf, so dachte sie, müsste die Leidenschaft jetzt besonders groß sein, denn Marion war ihr vollkommen fremd. Sie mochte ihre Stimme, ihre Gestalt, ihr Gesicht, aber die Vorstellung, nackt neben ihr im Bett zu liegen und Lust zu empfinden, überforderte sie.
„Was denkst du?“, fragte Marion.
Was denkst du. Ließ sich diese Frage beantworten? War es nicht in jedem Moment viel zu viel, um es in einem Satz wiederzugeben, in jedem Augenblick ein eigener kleiner Kosmos? Und war eine Antwort darauf überhaupt wünschenswert?
„Nichts Besonderes“, antwortete Christine. „Ich sehe mir deine Wohnung an. Das Zimmer. Es ist schön. Du hast einen guten Geschmack.“
Schon seit Tagen war Christines Haut übersensibel. War sie es auch schon vor dem Gedächtnisverlust gewesen? Die Wolldecke, die Marion ihr gegeben hatte, kratzte und sie wäre sie gern losgeworden, doch das hätte Marion sicherlich gekränkt.
„Die Bettwäsche im Krankenhaus hat mir gefallen“, sagte Christine. „Die hellgrünen Streifen darauf. Eine beruhigende Farbe.“
Marion sah sie entgeistert an.
„Was ist?“, fragte Christine. „Habe ich etwas Falsches gesagt?“
„Du kannst Grün nicht ausstehen“, sagte Marion. „Du konntest diese Farbe noch nie leiden. Seit ich dich kenne. Eigentlich dein ganzes Leben lang. Das hast du mir oft erzählt. Zur Einschulung hat deine Mutter dir ein grünes Kleid gekauft, das hast du ihr nie verziehen.“
Christine stellte sich die Krankenhausbettwäsche vor, das helle Grün, und erst jetzt bemerkte sie, dass sich in dem großen Zimmer, in dem sie saßen, kein einziger grüner Gegenstand befand, nichts, weder ein Möbelstück noch ein Teppich. Nicht einmal eine grüne Blumenvase. Wenn sie Grün hasste, dann war es sehr rücksichtsvoll von Marion, diese Farbe aus ihrer Wohnung zu verbannen. Offenbar kannte sich Marion bestens in Christines Leben aus, wenn sie sogar wusste, was für ein Kleid Christines Mutter ihr zur Einschulung geschenkt hatte.
„Dann stimmt wohl etwas mit meinem Kopf nicht“, sagte Christine, „obwohl die Ärzte das Gegenteil behauptet haben.“
„Unsinn. Alles kommt wieder in Ordnung. Du wirst sehen.“
„Bist du dir da sicher?“
„Aber ja.“
Was ist mit mir? Was ist nur mit mir passiert?
Eine Krankenschwester war die Erste gewesen, der Christine diese Frage gestellt hatte.
„Sie sind draußen gestürzt“, hatte die Krankenschwester geantwortet. „Wahrscheinlich auf dem glitschigen Boden ausgerutscht. Kein Wunder bei dem Wetter in den letzten Wochen. Sie sind auf den Hinterkopf gefallen, aber das merken Sie ja selbst, an dem Verband und an den Kopfschmerzen. Wenn Sie etwas dagegen brauchen, sagen Sie mir einfach Bescheid.“
Ausgerutscht also.
„Und warum kann ich mich an nichts erinnern?“, hatte Christine gefragt.
„Das ist ganz normal bei einer Gehirnerschütterung. Aber das wird schon wieder.“
„Wie bin ich ins Krankenhaus gekommen?“
„Jemand hat den Notarzt gerufen.“
Christine konnte sich an keinen Sturz erinnern, keinen glatten Boden, keine Sanitäter und auch nicht an wochenlanges schlechtes Wetter. Ganz flüchtig stieg ein Bild in ihr auf, verwitterte, moosige Steinstufen, aber es verblasste sofort wieder und war nicht mehr zu greifen. Vielleicht würde ihr Gedächtnis Stück für Stück zurückkehren, ganz langsam, wenn sie in kleinen Schritten vorginge und mit dem Tag des Unfalls begänne.
„Was habe ich an diesem Tag gemacht?“, fragte sie. „Weißt du das?“
„Ich schätze, du bist spazieren gegangen“, vermutete Marion.
„Spazieren gegangen? Bei dem Wetter? Die Krankenschwester und die Frau mit der Hüftoperation haben gesagt, dass es in Strömen geregnet hat.“
„Du bist gern bei schlechtem Wetter draußen“, sagte Marion, zog die kratzende Wolldecke höher, bis unter Christines Kinn, und schlang sie um ihre Schultern, damit sie nicht herunterrutschte. „Am liebsten gehst du spazieren, wenn niemand sonst auf die Idee käme. Stundenlang. Manchmal streiten wir uns deswegen ein bisschen, denn du kannst mich nur selten dazu bewegen, dich zu begleiten. Du magst schlechtes Wetter.“
„Niemand mag schlechtes Wetter.“
„Doch, mein Engel, du.“
Mein Engel. Christine fragte sich, ob Marion sie wohl immer so nannte. Und mit welchen Koseworten sie selbst ihre Freundin bedachte. Sie wagte nicht, danach zu fragen. Obwohl sie angeblich seit acht Jahren mit der Frau, die neben ihr auf dem sandfarbenen Sofa saß, zusammen war, erschien Christine solch eine Frage als zu intim. Und was hätte sie auch fragen sollen? „Ach, übrigens, wie rede ich dich eigentlich an, wenn ich zärtlich bin? Sage ich dann deinen Namen oder etwas anderes?“ War Christine Hoffmann überhaupt zärtlich?