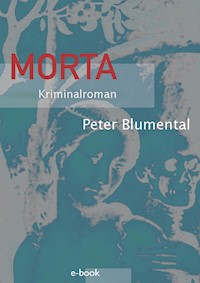
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Waldlichtung südlich von Berlin. Eine sehr schöne, sehr tote Frau. Ein durchstochenes Tattoo mit Symbolkraft. Und jede Menge offener Fragen. Inmitten einer zähen Fahndung zieht ein rätselhafter Mord Kommissar Schiffczek in seinen Bann. Aber die Zeit läuft gegen ihn. Nach stockenden Ermittlungen wird ihm der Fall entzogen. Doch der eigenwillige Kommissar gibt nicht auf. Mit Hilfe des arbeitslosen Kunsthistorikers Miguel Hernández begibt er sich auf die Jagd nach dem Mörder. Die Spuren führen ins Künstlermilieu und offenbaren nach und nach ein wirres Geflecht aus Mythos, Traum und Wirklichkeit. Es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd von Berlin über Rom nach Venedig, in deren Verlauf die Unvorhersehbarkeit des Lebens den Traum, das Schicksal beherrschen zu wollen, auf verhängnisvolle Weise durchkreuzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Morta
Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Kapitel 49Kapitel 50Kapitel 51Kapitel 52Kapitel 53Kapitel 54Kapitel 55Kapitel 56Kapitel 57ImpressumKapitel 1
Lange, dunkle Wimpern zuckten nervös in einem ansonsten leblosen, leicht kantig eingefassten Oval mit halb geöffnetem Mund, einer zielstrebigen, aber eher klein geratenen Nase und einer aufdringlichen Schmeißfliege. Die Fliege hob routiniert ab, zog lässig einen Kreis durch die Luft und ließ sich auf einer hohen, von blonden Haaren überwucherten Stirn nieder, auf der sie sich den salzigen Schweiß einer heißen Sommernacht schmecken ließ. Weiter ging es zum Halsansatz, von da auf die linke Wange. Der weitere Weg wurde durch die rüde Attacke einer plötzlich wildgewordenen Menschenhand unterbrochen und die Fliege floh hoch in die Luft, wo eine Schwalbe ihrem Fliegenleben ein jähes Ende bereitete.
Die Hand wurde wieder zahm und schob einen halbnackten Körper in die Senkrechte. Piet stand in den Strahlen der Morgensonne, die über die Bäume hinweg in die Lichtung drangen.
Der Morgen war die Freiheit einer Feder in einem Vogelkäfig.
So viel war klar.
Er kratzte sich am Kopf. Sein Organismus taumelte noch vor Müdigkeit. Aber es half nichts. Er musste los.
Schnell.
Rasch hob er sein T-Shirt vom Waldboden auf und stülpte es über den Kopf, zwang seine Füße in ein Paar zerschlissene Turnschuhe und zupfte seine Leinentasche aus einem Brombeerbusch. Dann suchte er den Rand der Lichtung nach dem schmalen Pfad ab, den sie gekommen waren. Schließlich fand er platt getretene Zweige. Er warf einen letzten Blick zurück.
Sie lag nackt auf einer Decke in der Mitte der Lichtung.
Regungslos.
Ihre Schönheit zog ihn einen Moment lang in ihren Bann.
Er spürte einen leisen, aber deutlichen Impuls, ergriff die Handtasche, die neben dem Baumstumpf lag und stopfte hastig alles hinein, was sie auf den Boden hatten fallen lassen.
Dann schlug er sich ins Dickicht.
Nach einem kurzen, mit Ästen gespickten Pfad erreichte er den Waldweg, an dem ihr alter, blauer Mercedes stand. Er wühlte in der Handtasche, fand das Lederetui, schwang sich auf den Fahrersitz und führte hastig den Schlüssel in das Zündschloss.
Eine Amsel hüpfte über die Motorhaube.
Er zögerte.
Schaute der Amsel nach.
Und zögerte noch einmal.
Dann seufzte er, stieg aus, hob den Rucksack aus dem Kofferraum und warf die Klappe ins Schloss.
Die Sonne blickte von Osten über die Baumwipfel.
Der Morgen war die Freiheit einer Feder in einem Vogelkäfig.
Er schüttelte den Kopf. Lächelte. Und verschwand, die Sonne im Rücken, im grünen Wald.
Kapitel 2
Die gebirgige Waldlandschaft zog gemächlich an seiner linken Seite vorbei, während über ihr Wolkenfäden in der Luft schwebten und die Sonne in eine diffuse rötliche Lichtpampe tauchten. Unvermittelt wechselte der Wald in ein Schwarz mit periodischen Lichtklecksen. Im spiegelnden Glas erblickte Schiffczek, dass der kleine dicke Mann links am Fenster des Abteils aus seinem Schlummer erwachte. Er schmatzte, rieb sich den Schnauzbart und warf seinen runden Kopf von einer Schulter auf die andere. Dann ploppten die Augen auf. Mit kurzen Wurstfingern kramte er aus einer kleinen schwarzen Kunstledertasche einen winzigen Kamm hervor und strich sich die auf einer Seite des Kopfes eigens zu diesem Zweck lang gehaltenen Haare über eine speckig glänzende Mittelkopfglatze. Als nächstes folgte ein langgedehnter und geräuschvoller Gebrauch eines rosageblümten Stofftaschentuchs.
Schiffczek seufzte leise.
Er versuchte, sich abzulenken, indem er vorsichtig in die Richtung eines kleinen Mädchens linste, das ihm gegenüber saß. Vielleicht fünf oder sechs. Nein, zurück, lieber wieder aus dem Fenster starren, dachte er sofort.
Zu spät.
»Warum guckst du so?«, fragte das Mädchen.
»Keine Ahnung. Irgendwo muss ich ja hin mit meinen Augen.«
»Das ist eine komische Antwort.«
Das Schwarz wich einer Betonwand, über der Hausdächer vorbeiflogen.
»Wie heißt du?«, fragte Schiffczek.
»Geht dich nichts an«, entgegnete das Mädchen.
»Ich will es aber wissen«, insistierte Schiffczek.
Es verzog sein Gesicht und schwieg. Neben ihm saßen zwei halbstarke Kerle.
»Sind das deine Brüder?«
Die Vielleicht-Brüder nickten stumm zu dünnen Beatfäden, die aus den Ohrhörern überliefen und blechern durchs Abteil zogen.
»Meine Eltern haben mir gesagt, dass ich auf Fragen von Fremden nicht antworten soll«, antwortete das Mädchen und starrte dabei zum Fenster hinaus.
»Das ist klug«, kommentierte Schiffczek vorsichtig.
Das Mädchen schaute ihm unverwandt ins Gesicht.
»Nein, das ist doof! Weißt du, wie langweilig es ist, immer mit den gleichen Leuten zu reden?«
Schiffczek dachte an das Kriminalamt.
»Ok, verstehe.«
»Aber ich denke nicht dran, mich daran zu halten. Ich hab’ auch schon mit dem Schaffner gesprochen.«
»Du bist sehr mutig.« Schiffczek blickte auf die Plüschente, die das Mädchen im Arm hielt. Kuscheltiere waren immer ein gutes Thema.
»Wie heißt denn deine Plüschente?«
»Das ist keine Ente, das ist ein König«, stellte das Mädchen trotzig klar. »Der wurde von Zeus verzaubert, weil er die schöne Leda nicht hergeben wollte.« Sie sah ihn an. »Warum fragst du eigentlich dauernd nach Namen? Bist du ein Polizist?«
Schiffczek zog den Polizeiausweis aus seiner Jackentasche und hielt ihn vor seine Brust.
»Krass!«, staunte das Mädchen. »Siehst gar nicht so aus.«
Der kleine schlaffe Mann blickte streng zu ihr herüber. Sie verstummte, verzog den Mund und blickte zum Fenster hinaus.
Als der Mann kurze Zeit später das Abteil verließ, beugte sich das Mädchen zu Schiffczek vor und flüsterte:
»Kannst du dir das vorstellen? Der Opa, der gerade rausgegangen ist, ist mein Onkel. Schrecklich, oder? Er hat meine Mutter gefressen.«
Schiffczek zog die Augenbrauen tief in die Stirn und versicherte sich, dass die Köpfe der Vielleicht-Brüder weiter nickten und der Mann außer Sichtweite war.
»Er hat –was?«
»Meine Mutter gefressen. Sagt er jedenfalls. Ich glaube ihm aber nicht. Er ist ein Angeber.«
Der kleine Mann kam zurück. Das Mädchen schaute auf und ließ sich wieder in die Rückenlehne fallen. Mit einer rauen, tiefen Stimme sagte der Mann etwas zu ihr, das sich nach Spanisch anhörte. Das Mädchen antwortete kurz und trotzig, griff sich seine abgewetzte Kuschelente, warf Schiffczek einen schweren Blick zu und begann, den König fest umklammert, regungslos aus dem Fenster zu starren.
Kurz darauf fuhr der Zug im Hauptbahnhof Berlin ein. Gedankenverloren fädelte sich Schiffczek mit seinem kleinen braunen Lederkoffer durch die Menge. Der letzte Blick des Mädchens ließ ihn nicht los.
Bisher hatte er immer geglaubt, das Minenspiel von Kindern einigermaßen gut dechiffrieren zu können. Die Mimik seiner kleinen Nichte, die immerhin komplexe Ausdrücke wie ›hör-auf-mit-dem-pädagogischen-Quatsch-folge-stattdessen-den-Bedingungen-meines-Willens-und-ich-werde-dich-mit-guter-Laune-belohnen‹, oder: ›Giraffe-möchte-so-gerne-Eis-ich-würde-es-auch-anstelle-von-ihr-essen-du-bist-doch-kein-Tierquäler‹ bereit hielt, war ihm so vertraut, dass es ihn verwirrte, den letzten Blick des Mädchens zu ihrem mütterfressenden Onkel nicht einordnen zu können.
Er blieb stehen. Ihr Blick war ein stiller Kommentar trotziger Untergebenheit. Viel mehr wollte ihm nicht in den Sinn kommen. Eine einstudierte Mischung aus Abscheu, Widerspenstigkeit und Resignation. Aber nicht ohne Anteile von Zuneigung und – was ihn am meisten verwirrte: Achtung. Aber das war nicht mehr als eine Vermutung. Vielleicht besaß der kleine dicke Mann einen Charakterzug, den das Mädchen wirklich mochte. Möglich, dass er ein begnadeter Unterhalter war. Kinder mögen das. Oder ein begnadeter Unterhalter und – wenn man die Abscheu hinzunahm – ein Schwein zugleich. Schiffczek behielt den Gedanken einen Moment lang in den Krallen seines Verstandes. Konnte es eine solche Kombination gleichwertiger Komponenten geben? Es schien ihm, als müsse es dominante Züge geben. Also entweder hauptsächlich guter Unterhalter und nebenberuflich Schwein oder hauptberuflich Schwein und nebenbei Unterhalter. Vielleicht war aber der kleine dicke Mann weder ein guter Unterhalter noch ein Schwein. Und was sollte die Geschichte von der gefressenen Mutter? Von Zeus? Warum nicht eine warzige Hexe oder der böse Wolf? Schiffczek setzte sich wieder in Bewegung. Vielleicht hatte die Kleine auch einfach nur eine gehörige Meise.
Kapitel 3
Elaine saß an ihrem Schreibtisch. Genervt.
Es hatte schon frühmorgens angefangen. Erst der dumme Kaffeefilter. Aufstehen, Maschine an. Nach ein paar Minuten: heiseres Röcheln. Kaffee fertig. Prima. Suppiger Filter raus. Mit spitzen Fingern, weil heiß. Inne Tonne. Daneben. Riesensauerei.
Und das vor der ersten Tasse. Dann Brot geschmiert. Mit Honig. Lecker. Beim Tragen zum Sessel auf den Teppich gefallen. Honigseite nach unten. Klar.
Nach dem Schrubben raus auf die Straße. Regen. Bus verpasst. Zwei Kilometer bis zum Amt gelaufen. Ohne Regenschirm. Nass bis auf die Knochen. Scheiße.
Und dann dieser Fall mit dem Kinderwagen. Elaine schüttelte den Kopf über den Vorfall, der sie in der vergangenen Nacht gut vier Fünftel ihres normalen Schlafpensums gekostet hatte. Das heißt: innerlich. Denn um ihr nasses Haar hatte sie kunstvoll ein Handtuch mit dem städtischen Polizeiemblem gewickelt, das in ihrer Vorstellung die Schmerzen des Morgens wie ein überdimensioniertes Heftpflaster heilen würde.
Kaum hatte sie alle Berichte des vergangenen Abends nochmals durchgesehen, zeichnete sich an der Glastür ihres Büros ein Schatten ab.
›Wird wieder ohne zu klopfen in meiner Tür stehen‹, dachte Elaine noch, bevor eine Sekunde später Schiffczeks Präsenz den Raum mit einem geduldigen, aber entschiedenen Informationsverlangen erfüllte.
»Es gab einen Mord, während ich weg war?«, fragte Schiffczek.
»Kann man so nennen«, entgegnete Elaine und drehte ihren wuchtigen Körper mit einem kräftigen Beinschwung zu ihm um.
»Guten Morgen, Herr Kommissar. Wie schön, Sie wiederzusehen!«, grüßte sie pädagogisch und intonierte dabei mit bedeutungsschwerem Blick die Silben.
Nachdem Schiffczek pflichtbewusst genickt hatte, setzte sie ihre Geschäftsmine auf.
»Eine Mutter mit Kind ist gestern um 16:58 Uhr in der U-Bahn-Station Potsdamer Platz mit ihrem Mann aneinandergeraten. Worüber, weiß man nicht. Ist auch egal. Jedenfalls zog sich der Streit der beiden über mehrere Minuten. Als die nächste U-Bahn einfuhr, hat die Frau ihm in die Eier getreten und ihn vor den Zug geschubst. Einfach so, weil er garstig zu ihr gewesen war. In der Hauptverkehrszeit.«
Schiffczek verzog das Gesicht, während Elaine fortfuhr und mit der freien Hand gestikulierte.
»Blieb nicht viel von ihm übrig. Die Passanten sind wie angewurzelt stehen geblieben. Nur die Mutter machte sich mit Kind und Kinderwagen davon, ohne dass irgendwer sie aufgehalten hätte.«
»Gibt es denn keine Aufzeichnungen von dem Vorfall?«, fragte Schiffczek.
»Natürlich. Man könnte aus den Videoaufzeichnungen einen abendfüllenden Film schneiden. Wir haben sie identifiziert: Nora Trappni, 29 Jahre alt, mit ihrem anderthalbjährigen Sohn Jesper. Wohnhaft in Pankow. Das Präsidium hat ihr die halbe Polizei Berlins auf den Hals gehetzt. Alle Flüge, Züge, Busse, Taxis wurden überprüft. Aber es hilft uns nichts, null. Sie ist verschwunden. Weg. Spurlos. Wie vom Erdboden verschluckt. Nicht zuhause, nicht im Bus, nicht in der Krabbelgruppe.« Elaine warf die Arme auseinander, wobei ihr für einen Augenblick das Handtuch aus der Kontrolle zu geraten drohte. »Und das mit Kinderwagen.« Sie fing das Ende des Tuchs etwas ungelenk, aber erfolgreich auf und sah Schiffczek an. »Eine Idee, was wir tun sollen?«
Kapitel 4
Eine halbe Minute später saß Anatoli Schiffczek in seinem Bürostuhl und folgte mit den Augen einem weit verzweigten Riss, der sich an der mehr grauen als weißen Wand seines Büros im ersten Stock des Landeskriminalamts entlang zog. Der Fall mit der Frau ödete ihn an, bevor er überhaupt eingestiegen war. »Idee?« Der Imperativ des Falls war so simpel wie unausweichlich: man musste sie finden. Und weil man sie finden musste und sie nicht so freundlich war, ihnen mit erhobenen Händen entgegenzulaufen, musste man sie suchen. Mit allen Mitteln. Heißt: mit Suchtrupps, Kameras, Computern, Satelliten, Hubschraubern, Drohnen, Passanten, Anwohnern, und whatnot. Wohnungen mussten durchsucht, Verwandte und Freunde befragt werden. Ein Fall der Logistik und des Delegierens. Irgendwann würde man sie finden, so gut sie sich auch versteckte – vielleicht am Ende in einem Erdloch im Irak mit angeklebtem Bart.
Schiffczek bemitleidete sich. Er hasst es, wenn Fälle ihm ein klar definiertes Vorgehen aufzwangen. Als stünde man einem miesen, stinkenden Monster aus Erwartungen und Zwängen gegenüber, das drohte, einem jederzeit seine Klauen ins Fleisch zu schlagen, wenn man nicht spurte. Er witterte schon seinen faulen Atem. Vielleicht hätte er lieber Privatdetektiv werden sollen. Naja, wahrscheinlich auch nicht viel besser. Nur dass das Ungeheuer deutlich kleiner ausfiel und man ihm im Zweifelsfall einfach eine reinhauen und wegrennen konnte. Schiffczek seufzte. Das einzig Charmante an dem Fall war die Effizienz, mit der sich die Frau samt Kinderwagen aus dem Staub gemacht hatte. Der Rest war Langeweile. Abscheuliche, anstrengende Langeweile. Ein Katz- und Maus-Spiel. Ihm war Ratlosigkeit als Ausgangspunkt lieber.
Schiffczek folgte dem zackigen Riss nach links. Auch wenn es die meisten Menschen verrückt machte, ratlos zu sein. Er lächelte. Manche machte es sogar ganz verlegen und rot im Gesicht.
Riss nach oben.
Oder sie zappelten pausenlos, liefen auf und ab wie Zootiere und warfen Kaffeetassen oder Beruhigungstees um. Sein Blick blieb an einem mausgrauen Aktenschrank hängen. Manchmal, wie in diesem Moment, fragte sich Schiffczek, ob es wirklich normal war, dass ihm das alles völlig abging. Er schloss die Augen und versuchte, die Pläne, die er für die Kinderwagensuche schmieden musste, im Abflussrohr seines Gehirns versacken zu lassen, so dass nur noch ein undefiniertes Vakuum übrig bleiben würde. Wohltuend breitete sich ein Nichts in seinem Bewusstsein aus wie ein Ozean. Weit, tief und unergründlich. In sanften Wogen schwappte es an seine Schädelwände und weichte alle eingetrockneten Denkmuster und Kategorien auf, bis sie an der Oberfläche trieben wie ein bunter Algenteppich, der sich immer wieder in kleine Flecken auflöste und neue Formationen bildete. Aber er wusste, dass das, was für ihn einer Neuformierung seiner Gedanken gleichkam, seinen Mitarbeitern eher so erschien wie ein Teppich aus Schweröl, der ihnen die Flügel verklebte. Sie konnten mit seinem Nichts nichts anfangen. Und je weniger er selbst sich davon beeindrucken ließ, desto unruhiger wurden die anderen. Besonders sein Assistent Haarmann.
Vielleicht war es die Herkunft. Geboren auf einer polnischen Ostseeinsel, war er mit der Weite des Meeres aufgewachsen, dem eintönigen Tuckern des Bootsdiesels, dem Geruch von Bratfisch und dem mürrischen Gesicht seines Vaters. Nach dem Markt saß sein Vater oft stundenlang stumm am Tisch und starrte Löcher ins Holz. Tag für Tag. Woche für Woche. Bis seine Mutter es nicht mehr aushielt, die Koffer packte und das Paar mit drei Kindern und fünf Koffern im Zugabteil den Stahlküchen des westdeutschen Wirtschaftswunders entgegenrollte.
Jedenfalls erklärte seine Herkunft das Meer im Kopf. Seit einige Kollegen davon Wind bekommen hatten, wurde er den Spitznamen »Inselpole« nicht mehr los. Schiffczek störte das nicht. Er liebte die Vorstellung, wie sich die Beine auf schwankendem Deck sanft in den Bauch drückten und ihn wieder entließen, den Blick auf die ewige Bewegung der blaugrauen Oberfläche, die Salzluft in der Nase, den Wind in den Haaren, das Rauschen der Gischt und das Kreischen der Seevögel im Ohr. Näher betrachtet war es offensichtlich: er liebte das, was andere grün im Gesicht werden ließ.
Und dann war da noch sein russischer Vorname: Anatoli. In Polen ein absolutes No-Go. Seine Mutter hatte ihn ausgesucht, weil sein Großvater mütterlicherseits ein Russe gewesen war, der auf der Flucht aus der Kriegsgefangenschaft in der Scheune eines polnischen Bauernmädchens gelandet und dort hängen geblieben war. Und jetzt saß er, Inselpole mit russischem Namen, als Teil des Staatsapparats in der Hauptstadt Deutschlands. Kommissar mit Meeres- und Migrationshintergrund. Seit zwei Monaten mit leerer Scheune.
Er stand auf und ging Befragungen anordnen.
Kapitel 5
Miguel schob einen gut gefüllten Einkaufswagen vor sich her. Ein Zigarillo hing in seinem Mundwinkel und zog eine dünne Linie blauen Rauches durch die Luft. Ohrenbetäubendes Rasseln in der ganzen Straße. Leute gafften. Aber Miguel grinste. Trotz Nieselregen. Zweimal in der Woche machte er die Route. Kreuz und quer durch Friedrichshain. Vorbei an grell leuchtenden Einkaufsmeilen, weniger grell leuchtenden alten Läden und gar nicht leuchtenden, grauen Nachkriegshäusern.
»Du hast aber Hunger«, staunte ein kleiner Junge, an dessen Armende eine Mutter vergeblich herumzerrte. »Willst du das alles selber essen?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Miguel und blieb stehen. »Das ist das Brot, das sich die nicht kaufen können, die es essen wollen.«
Rädchen drehten sich im Kopf.
»Und wo kriegst du die Butter her?«
»Bei denen gibt’s keine Butter. Zu teuer.«
»Nicht mal Wurst?«, fragte der Junge verunsichert.
»Auch keine Wurst.«
Die Mutter drückte dem Jungen ein Geldstück in die Hand.
»Das kannst du dem Mann geben.«
»Da, für die Wurst«, sagte der Junge und gab Miguel das Geldstück. Miguel nahm einen Zug aus seinem Zigarillo und schaute ihm lächelnd nach. Seine Mutter zog ihn wie einen renitenten Köter hinter sich her.
»Ist immer so bei Nieselregen«, sagte Fischer mit seiner rauen, tiefen Bärenstimme, als Miguel sich zu ihm auf die ranzige Decke setzte. Der Alte lehnte sich an die mit Graffiti beschmierte Hauswand. »Die Leute sind verwirrt.« Seine Hände wedelten richtungslos in der Luft herum. »Finden es peinlich, einen Regenschirm aufzumachen, weil die anderen sie dann für Weicheier halten könnten.« Die Hände landeten auf den Oberschenkeln »Aber nass werden wollen sie auch nicht.« Er grinste. »Werden sie aber. Das macht sie so miesepetrig. Sie sind sauer auf sich selbst, weil sie die falsche Entscheidung getroffen haben. Aber weil sie sich das nicht eingestehen wollen, sind sie sauer auf das Schicksal.« Er trank einen Schluck Chantré, biss in sein Brot und reichte Miguel die Flasche. Miguel schüttelte den Kopf und schob den Flachmann zurück.
»Was alles noch viel schlimmer macht«, fuhr Fischer fort. »Weil Gott dann ein Arschloch ist.« Er reckte den Kopf gen Himmel. »Und wenn Gott ein Arschloch ist, dann ist alles umsonst.«
Er schwieg eine Weile und kaute auf seinem Brot herum. Miguel rauchte und blickte stumm in vorbeilaufende Beine. Jeder wusste, dass man den Pfandfischer unter keinen Umständen beim Aussprechen seiner Gedanken unterbrechen durfte, selbst wenn es den Anschein hatte, er sei fertig damit. Wie beim delphischen Orakel musste man einfach zuhören und sich seinen Reim auf das machen, was aus dem Mund quoll. Denn schon bei der kleinsten Störung kam er aus dem Konzept. Und wenn er aus dem Konzept kam, redete er nur noch wirres Zeug und ließ einen nicht mehr los. Fischer warf den Tauben die übriggebliebenen Brotkrumen vor die Füße und blickte auf den löchrigen Filzhut, der vor ihm lag.
»Jedenfalls macht Miesepetrigkeit geizig. So viel steht fest.«
Kapitel 6
Die folgenden Tage verbrachte Schiffczek in einem Zustand gestresster Langeweile. Es musste pausenlos telefoniert, delegiert und ausgewertet werden. Mögliche Fluchtwege mussten geprüft und eine stets wachsende Anzahl von Suchtrupps organisiert und koordiniert werden. Nach zwei Tagen wussten sie alles über Nora Trappni: wo sie geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen war, wie ihre schulische und berufliche Laufbahn verlief, wieviel sie verdiente, mit wem sie sich vergnügte, welche Drogen sie nahm, mit wem sie im Clinch lag, wo sie einkaufte, wo ihre Schuhe genäht wurden und welchen Lippenstift sie benutzte. Sie wussten, welche Wege zur Arbeit und Kindertagesstätte sie nahm, welche Charakterzüge ihr Sohn besaß, wer und wo ihre Verwandten und Freunde waren. Eine endlose Reihe an Fakten reihte sich aneinander. Nur zwei Dinge wussten sie noch immer nicht: wo sie sich aufhielt und wie sie es geschafft hatte, einschließlich Kind und Kinderwagen so gründlich abzutauchen, dass Hundertschaften von Polizisten beständig an ihr vorbeimarschierten. Zur Suche kamen Pressekonferenzen, bei denen der Öffentlichkeit immer dasselbe verkündet werden musste: wir tun alles uns irgend Mögliche, um die Täterin zu finden, schlafen und essen nicht mehr, stecken alle uns verfügbaren Steuergelder in die Suche und würden uns selbst in den Abgrund stürzen, nur um sie auftauchen zu lassen. Am dritten Tag der Suche war Schiffczek so gelangweilt, dass er seinem Assistenten Haarmann die Koordinationsleitung übertrug und sich einen freien Tag nahm.
Just in dem Moment, als Schiffczek seine Zähne in ein nur schwer handhabbares und fetttriefendes Döner Pita schlug, vibrierte seine Hosentasche. Schiffczek war ein gewissenhafter Bulle. Er verabscheute Typen, die Löcher in anderer Leute Körper jagten. Er verabscheute aber auch Typen, die ihn beim Essen störten. Wobei er im Moment nicht sicher war, welche Sorte Typen er mehr verabscheute. In einer Spur der Verwüstung grabbelten seine fettigen Finger das Handy hervor, hielten es für eine Sekunde vor sein Gesicht und führten es an sein Ohr, das sich im Rhythmus der Kieferbewegungen leicht auf- und ab bewegte.
»Wer immer Sie auch sind, wissen Sie nicht, dass ich heute meinen freien Abend habe?«
»Doch, weiß ich«, antwortete das unglückliche Gegenüber.
Schiffczek atmete tief durch.
»Sie sind sehr mutig, Sander. Ich hoffe, Sie haben eine schusssichere Weste im Ohr.«
»Nein, ich habe einen Mord auf der Zunge.«
Schiffczeks Kiefer stockten.
»Scheiße.« Er fuhr sich mit einer Papierserviette über den Mund.
»Erzählen Sie!«
»Eine alte Frau mit Warzen im Gesicht und russischem Akzent kam heute Abend ins Polizeirevier und erzählte, dass sie in der Nähe von Lebusa, anderthalb Autostunden südlich von Berlin, eine Leiche im Wald gefunden hat. Wir haben es überprüft. Es stimmt. Eine junge Frau. Splitternackt, schön und mausetot. Stich mit einem Messer durch den Rücken ins Herz.«
»Aber wenn der Mord in Brandenburg stattgefunden hat, sind wir doch gar nicht zuständig«, sagte Schiffczek.
»Doch«, widersprach Sander. »Die Spitze der brandenburgischen Kripo liegt mit Sommergrippe danieder. Deshalb haben wir die Ehre, den Fall zu übernehmen.«
Schiffczek brummte zustimmend.
»Ok, dann müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen. Gibt es Anzeichen von sexuellem Missbrauch?«
»Keine«, antwortete Sander. »Vergewaltigung ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Wir haben die Leiche nur gesichert, nichts angerührt. Abgesehen von dem Stich gibt es zumindest oberflächlich gesehen keine Anzeichen von Gewaltanwendung.«
Schiffczek nickte und fummelte sich mit einem Zahnstocher unliebsames Material aus den Zahnspalten.
»Nicht eine Spur von Gewalt? Keine Blutergüsse oder irgendwelche anderen Anzeichen eines Kampfes?«
»Zumindest nicht offensichtlich«, gab Sander zurück. »Keine Spuren von Gewalt, keine Tatwaffe, keine Kleider. Scheint eine Art einvernehmlicher Mord gewesen zu sein.« Er schnaufte zynisch in den Hörer. »Ich schicke Ihnen die Ortsangaben aufs Telefon.«
Schiffczek blickte auf die Uhr und streckte seinen Arm mit dem Döner Pita weit von sich, um das Ziffernblatt ablesen zu können.
»Gut. Ich bin in eineinhalb Stunden bei euch. Ich will alles so sehen, wie ihr es am Tatort angetroffen habt.« Er knipste das Handy aus. Fleischstücke lösten sich aus dem Fladen und verfehlten nur knapp das Bier, das er sich an seinem freien Abend gegönnt hatte. Fleischstücke. Immer müssen sich verdammte Fleischstücke lösen, dachte Schiffczek.
Kapitel 7
Als Schiffczek am Tatort eintraf, hatten Techniker die kleine Waldlichtung mit grellen Scheinwerfern in einen fast unwirklichen Ort verwandelt. Wie eine Theaterbühne, dachte Schiffczek. Auf der der letzte Akt einer Tragödie einfach aufgehört hatte, ein Schauspiel zu sein. Kein Publikum. Der Vorhang fiel nicht zu. Die Tote ging nicht in die Umkleide. Wortlos und mit bedächtigen Schritten näherte er sich der Lichtung, grüßte knapp die zwei Polizisten, die bei der Toten Wache schoben und betrachtete die Leiche. Er war dankbar, dass Haarmann, der Fotograf und die Spurensicherung noch nicht eingetroffen waren. Die Frau lag bäuchlings in der Mitte der Lichtung, in einer Blutlache, die schon deutliche Zeichen von Austrocknung erkennen ließ. Das Opfer war auffallend zart. Eine tote Schönheit. Höchstens Mitte zwanzig, dachte Schiffczek. Dunkles, gelocktes Haar hing über ihrem schlanken Hals. Der Kopf lag seitlich im Moos. Zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule, auf Höhe des Herzens, klaffte die Wunde. Schiffczek beugte sich zu ihr herunter. Unter dem auf der Haut getrockneten Blut war ein schwarzes Tattoo zu sehen. Eine Efeuranke. Der Einstich befand sich zielgenau im mittleren Blatt. Schiffczek stand auf und schritt den Rand der Lichtung ab. Sie war klein, keine fünfzehn Meter im Durchmesser, von einem dichten Fichtenwald umstanden. Der perfekte Platz für Liebende und Mordende. Sollte es hier einen Kampf gegeben haben, wären nur Fuchs und Hase Zeugen gewesen. Drei Kerzenstummel auf einem Baumstumpf waren die einzigen Relikte, die der Mörder zurückgelassen hatte. Der Boden war mit Gras, Wildblumen und Moos bewachsen. Aufmerksam untersuchte Schiffczek den Bewuchs, als das Knurren des Polizeidiesels die Ruhe zerschnitt und Haarmann sich mit seiner Gefolgschaft durch das Dickicht kämpfte.
Haarmann grüßte und schaute an Schiffczek vorbei. »Kein schöner Anblick«, sagte er und schob sich seine Brille auf der Nase zurecht.
Schiffczek atmete durch.
»Nicht, wenn man Leichen per se unschön findet.«
»Hast du etwa eine nekrophile Neigung?«, fragte Haarmann entrüstet.
»Ein bisschen davon schadet in unseren Job nicht. Aber wir sind nicht da, um über die Ästhetik von Toten zu befinden«, beendete Schiffczek das Thema. »Trotzdem wundert mich die – sagen wir mal: Gleichgültigkeit ihres Gesichtsausdrucks. Und sieh dir mal den Einstich an.« Schiffczek führte Haarmann dicht an die Leiche heran. »Glatt, ohne Ausfransungen. Zielgenau in der Mitte der Efeuranke.«
Haarmann kratzte sich am Kopf. Ein Käuzchen rief aus dem Wald. Er schüttelte sich.
»Kein Kampf, keine Gegenwehr. Fast wie bei einem Ritual. Als hätte der Mörder sich alle Zeit der Welt gelassen. Entweder war sie ausgeschaltet oder der Mord war abgesprochen.«
Haarmann starrte ihn an.
»Was meinst du mit ›abgesprochen‹? Dass sie es selber jemandem aufgetragen hat? Selbstmord durch die Hand eines anderen?«
»Möglich ist vieles«, entgegnete Schiffczek.
Er wandte sich Haarmann zu.
»Man nennt es übrigens ›Todesliebe‹. Sowas ähnliches wie Nekrophilie. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht.«
Schiffczek folgte bedächtigen Schrittes dem schmalen Fußweg. Dann drehte er sich noch einmal um.
»Und denk’ dran, ihre Position auf den Grashalm genau festzuhalten. Wir werden jeden noch so kleinen Hinweis brauchen, umdaszu verstehen.«
Kapitel 8
Er fühlte sich umschlossen und geborgen. Sein Körper schaukelte in einem sanften, regelmäßigen Auf- und Ab. Er schlug die Augen auf. In seinem Blick war der schlanke Hals einer jungen Frau, um den eine blonde Strähne wippte. Er sah die markanten Linien ihres Gesichts, den stolzen Blick starr nach vorn gerichtet. Sie trug ihn mit gemessenen, sicheren Schritten über eine Wiese. Die Luft war kalt und rein, der Nebel legte sich wie ein frischer Gruß des Morgens auf seine Stirn. Am Himmel badete die Sonne orangerot in seidenen Schwaden. Er sah, wie die Umrisse frühlingsgrüner Bäume aus dem Grau traten. Sah den Fluss, die Prachtlibellen, die blauschimmernd über dem grünbraunen Wasser tanzten.





























