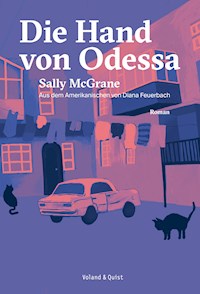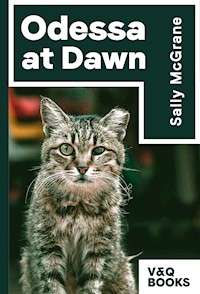Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das fulminante Spionage-Debüt aus Russlands geheimnisvollen Tiefen. Max Rushmore, abgehalfterter Russland-Experte und eben von seinem Arbeitgeber, der CIA, wegrationalisiert, soll den Nachlass von Sonja Ostranowa ordnen. Ihre halbgefrorene Leiche wurde in einer eiskalten Januarnacht auf einer Parkbank am Moskauer Patriarchenteich aufgefunden. Angebliche Todesursache: Herzversagen. Doch Max entdeckt schnell Unstimmigkeiten und logische Lücken in den Dokumenten der Expertin für Nuklearabfall. Kann es sein, dass sie gar nicht tot ist? Was hat die russische Behörde für nukleare Sicherheit zu verbergen? Und was hat es mit dem sagenhaften, blau schimmernden Diamantring auf sich, den Sonja noch beiseiteschaffen konnte? Gerade erst von der CIA herabgestuft, erhält Geheimagent Max Rushmore einen unerwarteten Auftrag in Moskau. Er soll den aufgelaufenen Papierkram im Todesfall Sonja Ostranowa abwickeln, die offenbar an Herzversagen verstorben ist. Eine unspektakuläre Aufgabe. Doch schon bald merkt Max, dass in der Sache nichts so ist, wie es scheint: Das Sterbedatum im Totenschein deckt sich nicht mit den Aussagen von Sonjas Stiefmutter. Ist die Nuklearexpertin vielleicht noch am Leben? Und warum hat Sonja ihr kurz vor ihrem vermeintlichen Tod diesen mysteriös schimmernden Diamantring anvertraut? Gegen den Willen seines Auftraggebers schlittert Max den verwischten Spuren von Sonja hinterher, die ihn auf eine rasante Schnitzeljagd durch ganz Russland führen. Dabei kommt er nicht nur einem schmutzigen Geheimnis der russisch-französischen Atomlobby gefährlich nahe, sondern gerät auch mitten hinein in die Machenschaften des internationalen Diamantenkartells. Und Max ist nicht allein: Längst hat sich eine zwielichtige Gestalt an seine Fersen geheftet, die es ihrerseits auf den geheimnisvollen Diamanten abgesehen hat. Im exklusiven Moskauer Nachtclub Midnight kommt es schließlich zu einem unerwarteten Showdown.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe 2016
© 2016 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München
Umschlaggestaltung und Motiv:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Übersetzerin: Marieke Heimburger, Tønder
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Brockhaus/Commission
ePub-ISBN: 978-3-95890-037-0
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Für Helge
DRAMATIS PERSONAE – WICHTIGSTE HANDELNDE PERSONEN
MAX RUSHMORE: Ein Mittvierziger, US-Amerikaner, hat sein gesamtes Erwachsenenleben dem Auslandsgeheimdienst CIA gewidmet, meist in Russland eingesetzt, jetzt heruntergestuft zu einem Probemitarbeiter vom CIA-Sub-Unternehmen Nightshade. Verheiratet mit Rose.
JIM DUNKIRK: Ist ca. 15 Jahre älter als Max und ebenfalls US-amerikanischer CIA-Mitarbeiter, Vorgesetzter von Max und einer der leitenden CIA-Beamten in Moskau.
SONJA OSTRANOWA: Expertin für nuklearen Abfall, ist in Russland aufgewachsen und hat den Abbau sowie die zivile Nutzung von radioaktiven Substanzen überwacht. Sie taucht unter und nimmt die Identität einer »Dascha« an. Max besucht ihre Stiefmutter Agata Ostranowa, um mehr über Sonja zu erfahren.
GERÁRD DUPRES: Vizepräsident des französischen Energiekonzerns Dynacorp. Überwacht den Bau einer Nuklearanlage im Baltikum, war verlobt mit Sonja Ostranowa.
PROF. WOLKOW: Dozent in St. Petersburg, ehemaliger Freund von Sonja Ostranowa und Kenner der sibirischen Landeskunde. Ihn besucht Max, um mehr über das Verschwinden von Sonja zu erfahren.
PASCHA: Dramatiker (Stückeschreiber) aus St. Petersburg, guter Bekannter von Max, der sich sowohl in der Szene der Künstler als auch in der russischen Unterwelt auskennt.
CONSTANTIN FUKS: Ein König der Ober- und Unterwelt, neureicher russischer Gastronom, Besitzer etlicher Moskauer Restaurants und Clubs, mit Hang zum Dramatischen.
HEINZ MÜLLER: Deutscher BND-Agent. Max und Heinz kooperieren in Sibirien.
ANTON SAMODELKIN: Professor in Sibirien, forscht an übernatürlichen Phänomenen wie der Kommunikation von Diamanten und Eigenschaften von Raum und Zeit.
GOLDZAHN: Ein Mitarbeiter von Prof. Samodelkin, Mitglied des sibirischen Stammes der »Zeitreisenden«. Spezialgebiet: Diamantenbeschaffung.
BOB DOMINION: US-Amerikaner, angeblich Hühnerverkäufer, jedoch in Wirklichkeit Diamantenhändler, der weltweit und mit allen Mitteln agiert.
1. TEIL
KAPITEL 1
Max sah sich in der hellen Ankunftshalle des Flughafens um. Sah die in sechs vorbildlichen Reihen anstehenden Menschen. Die neuen Schalter, die glänzten und irgendwie billig wirkten. Wie Zeugenstände. Er stöhnte. Er könnte überall sein: Frankfurt, Bangkok. Nur nicht zu Hause, dachte er. Nur nicht in Washington-Dulles. Der schmutzige Teppichboden dort, der schale Geruch von Fast Food und die defekten Rollsteige waren unverwechselbar.
Max spielte mit seinem marineblauen Pass. Ein alter Trick. So konnten die Umstehenden den goldenen Adler auf der Vorderseite sehen, wenn sie wollten – so konnte er ihre Neugier befriedigen. Er verlagerte das Gewicht der ledernen Aktentasche in seiner linken Hand. Ganz lässig. Sein Anzug war genauso aussagekräftig wie eine Visitenkarte. Max hatte ihn in Berlin anfertigen lassen, von einem buckligen deutschen Schneider ganz in der Nähe vom Ku’damm, in einem kleinen, dunklen, altmodisch eingerichteten Laden. Ein auf Hochglanz polierter Verkaufstresen, schummrig leuchtende Glaslampen, Samtvorhänge. Mitten in der Anprobe verkündete die kleine Messingglocke an der Tür die Ankunft eines neuen Kunden, und Max konnte von der Ankleide einen Blick auf den Mann erhaschen. Korpulent. Aufgrund seiner Körperhaltung tippte Max, dass er Amerikaner war. Die Schultern nach vorne, den Kopf gesenkt, bereit für die Katzbuckelei des Verkäufers. Bauch raus: Dieser Mann schämte sich nicht für seinen Appetit. Der Fremde holte drei in Plastik gehüllte Anzüge ab und marschierte zurück hinaus in den Sommerregen, bevor der Schneider Max wieder zu sich rief, um weiter abzustecken. Der Dicke war Max irgendwie bekannt vorgekommen, aber er wusste nicht, woher.
Max reichte der Mitarbeiterin hinter dem Schalter seinen Pass. Sie war jung und unter dem strengen, dunkelblauen Käppi wirklich schön. Eine unter der Kopfbedeckung hervorgerutschte Strähne legte sich an ihre Schläfe. Ihre dunkelblaue Uniform mit dem Gürtel wirkte militärisch. An ihrer Brust klemmte ein in Braun und Beige gehaltenes, graviertes Namensschild. Sie sah Max kaum an.
»Den Pass«, sagte sie knapp.
»Elena Viktorowna!«, sagte Max. Keine Reaktion. Er lehnte sich auf den Schaltertresen und flüsterte: »Musst du mir schon wieder das Herz brechen?«
»Grund Ihrer Reise?« Elena Viktorownas Blick war starr auf den Pass in ihrer Hand gerichtet.
»Geschäftlich«, seufzte Max.
»Wann sind Sie zuletzt in die Russische Föderation eingereist?«
»Vor dreizehn Monaten, Lenotschka. Wenn ich gekonnt hätte, wäre ich früher zurückgekommen.«
»Geplante Dauer Ihres Aufenthalts?«
»An deiner Seite würde ich für immer bleiben.« Die junge Frau hustete und runzelte die Stirn. »Aber wahrscheinlich drei Wochen«, beeilte sich Max hinzuzufügen. »Kommt drauf an, wie die Geschäfte laufen.«
Die junge Frau blätterte in seinem Pass, bis sie das in der Mitte klebende Geschäftsvisum fand. Sie nickte einmal und griff nach dem Stempel auf ihrem Tresen. Mit Nachdruck rammte sie ihn in das Stempelkissen und dann auf das Visum, zack-rumms. Erst dann sah Elena Viktorowna Krasnowajeva, Moskaus hübscheste Grenzbeamtin, zu ihm auf. Sie hatte Augen wie eine Katze, groß und umwerfend, hellbraun. Sie reichte Max seinen Pass und sagte dann mit einem bezaubernden Lächeln: »Wir haben Sie vermisst, Mr. Rushmore.«
Geschafft. Max war drin. Er bemerkte, dass er schwitzte. Reiß dich zusammen, Maxiboy, ermahnte er sich selbst. Du bist wieder im Rennen, also gib Gas. Max straffte die Schultern, durchbrach die Mauer von Männern in Bestatteranzügen mit handgeschriebenen Schildern in der Hand und erreichte die Vorhalle. Pyramiden aus Gepäck, kariert und mit Leopardenmuster, mit Klebeband und Bindfäden zusammengehalten, wippende, prekäre Königreiche. Mehrere Geldautomaten, aufgereiht wie Spielautomaten. Durch die Glastüren hindurch, an den mürrischen Männern in grauen Lederjacken und den mageren, neben ihren glänzenden koreanischen Autos lauernden Fahrern vorbei, erkannte Max jenseits der grauen, klapprigen Marschrutka-Kleinbusse mit ihren handgeschriebenen Fahrtzielzetteln in der Windschutzscheibe, dass es noch Sommer war. Der Himmel war grau, aber die Luft warm und schwer und von einem milden, leicht schwefeligen Geruch. Ein Hauch von Diesel, angenehm bio. Max winkte einen verbeulten Lada zu sich heran und bat den Fahrer, in die Stadt zu fahren.
Sie fuhren schnell. Ein unerwartetes Gefühl von Freiheit durchflutete Max. Als könne der Fahrer es auch spüren, fing er an zu reden. Ein Hüne von einem Mann. Plapperte los. Er sei aus Georgien. Vom Land. Nach Moskau gekommen, weil es zu Hause keine Arbeit gab. Hier gebe es zwar auch nicht immer Arbeit, aber dort gebe es nie welche. Mit seiner Pranke fasste er plötzlich zwischen Max' Knie. Max zuckte zusammen. »Keine Sorge, Jungchen«, sagte der Georgier und öffnete das Handschuhfach. »Was hast du denn gedacht?« Er holte das Foto einer Frau hervor, deren dunkles Haar mit einem roten Tuch zurückgebunden war. Tiefe Falten durchzogen ihr Gesicht, sie lächelte nicht. Auf ihrem Schoß saß ein kleiner Junge. Der Georgier hielt das glänzende Bild ziemlich lange zwischen seinen gewaltigen Fingern und betrachtete es, während die andere Hand auf dem Steuer ruhte. Sie rauschten an einem im Graben liegenden Lkw vorbei; die Räder drehten sich noch in der Luft. Der Georgier ging nicht vom Gas. »Meine Familie«, sagte er und reichte Max das Foto. Frau, Sohn. »Schön«, sagte Max. »Sehr schön.«
Die Felder links und rechts der Autobahn waren sattgrün. An den Rändern etwas ausgefranst, voller Unkraut, aber voller Leben. Hier und da reckte sich ein Birkenhain in den Himmel, die dünnen weißen Stämme glichen göttlichen Kreidestrichen. Max fing an, sich zu entspannen. Das konnte er in seiner Kehle spüren, wo sich nur eine halbe Stunde zuvor ein dicker Kloß gebildet hatte, der hartnäckig seine Atmung behinderte, ganz gleich, wie oft er versuchte, ihn herunterzuschlucken. Jetzt konnte er wieder durchatmen. Er schwitzte nicht mehr. Seine Nackenmuskeln lockerten sich. Er gab dem Fahrer das Foto zurück; der steckte es an die Sonnenblende. Max lehnte sich zurück und sah hinaus zu den Feldern, bis sie endeten. Auf einer Reklametafel mitten auf einem der letzten unbebauten Grundstücke stand »Hier entstehen neue Luxusresidenzen«. Max zuckte die Achseln. Nach diesem Schild erreichten sie die ersten Ausläufer der Stadt: Wohnblöcke, Betonhochhäuser, verlassen wirkende Supermärkte mittendrin. Sputnik Palast, ein ehemaliges Filmtheater. Die Stadt begann. Betonklotz neben Betonklotz. Max wurde ein bisschen leicht ums Herz. Er war drin. Er war zurück. Er war wieder obenauf.
»Europa?«, fragte der Georgier. »Amerika?«
Max nickte. »Amerika.«
»Magst du Russland?«
»Ja«, sagte Max. Unwillkürlich umfasste er den Griff seines Lederkoffers etwas fester.
»Dachte ich.« Der Georgier lächelte, dass seine Zahnlücken sichtbar wurden. Dann runzelte er die Stirn. »Für jemanden, der reich ist wie du, ist es sicher toll. Die Weiber reißen sich doch bestimmt um dich, so gut, wie du aussiehst. Aber für uns … ist es hier nicht so gut. Gefährlich.« Er lachte. »Aber wenn du zu reich wirst, wird es auch für dich gefährlich. Richtig gefährlich.«
Max nickte. »Ich bin nicht besonders reich«, sagte er.
Der Fahrer sah ihn aus dem Augenwinkel an, abschätzend. Reicher als der Georgier je werden würde, ja. So reich, dass er Ärger bekommen würde – nein. An einer roten Ampel nickte der Georgier drei an der Ecke stehenden Frauen zu.
»Die Mädchen sind im Dienst«, erklärte er und gluckste – ob aus Anerkennung oder Kameradschaft, erschloss sich Max nicht. Max brummte: »Kein Interesse.« Es wurde grün, der Georgier gab Gas. Sie überquerten den Fluss, und plötzlich wurde die rissige Windschutzscheibe des Lada zum Rahmen gespenstisch leuchtender Kirchenkuppeln. Hinter ihnen kamen die roten Sterne des Kreml zum Vorschein. Die Wolken waren aufgerissen, die goldenen Kuppeln strahlten vor dem blassblauen, frühen Abendhimmel. Max' Herz machte unwillkürlich einen Sprung.
Als wäre ihm gerade etwas eingeschossen, sagte Max: »Lassen Sie mich am Roten Platz raus.«
Der Georgier zuckte die Achseln. Ihm war das gleich.
KAPITEL 2
Als Nächstes sollte Max dem Plan folgen, der inoffiziell »Die Jagd nach dem Gestohlenen Brief« hieß. Er war Max vor zwanzig Jahren in einer schlecht besuchten Bar an der Pennsylvania Avenue in Washington D. C. von Jim Dunkirk erklärt worden. Aus unerfindlichen Gründen hatte sich Max dieser Abend sehr detailliert eingeprägt. Die Bar war das Letzte: Über dem Tresen hing ein Hirschkopf, es roch nach Flohpulver. Max war noch Anfänger und Dunkirk sollte ihn vor seiner ersten Reise in die ganz frische »ehemalige Sowjetunion« instruieren. Doch stattdessen war der hochgewachsene, ergrauende Jim Dunkirk – der in direkter Linie von den Siedlern der Mayflower abstammte und sich ein beachtliches Humpeln eingehandelt hatte, als er in den Achtzigern russische Geheimnisse an afghanische Rebellen weitergab – mit Max auf Sauftour gegangen. Sie waren beide »sternhagelvoll«, wie Dunkirk sich ausdrückte, als der ältere Mann plötzlich einen ganz neuen, freundlicheren und Max irritierenden Ton anschlug. Er klopfte dem Anfänger auf den Rücken und erklärte ihm seine Theorie.
»Verstecken ist passé«, knurrte Dunkirk. Er lehnte sich vertraulich zu Max herüber. »Sobald man anfängt, sich zu verstecken, sondert man einen bestimmten Geruch ab. Kann dir jeder Jäger bestätigen. Wie verscheucht man jede Beute? Durch seinen Geruch. Dazu braucht man schon eine sehr feine Nase, aber die haben wir. Und die auch. Also? Keinen Geruch ablassen. Nicht verstecken. Sich direkt vor ihrer Nase bewegen – da gucken sie am wenigsten hin.« Am nächsten Tag hatte Max rasende Kopfschmerzen.
Max stieg aus dem Wagen, trat auf den Roten Platz und verbannte Dunkirk aus seinem Kopf. Schließlich war er, Max, wieder da. Das war das Einzige, was zählte. Er war wieder da – wenn auch nur in Teilzeit. Wenn auch nur in privatem Auftrag. Wenn auch die CIA, seine gute alte »Agentur«, der er sein ganzes Erwachsenenleben geopfert hatte, ihn wegrationalisiert hatte – ihn! Max Rushmore, dessen Kontakte in Russland dreimal hintereinander als »höchst eklektisch« prämiert worden waren. Ihn! Maxiboy Rushmore, der binnen neun Monaten Chinesisch gelernt hatte! Mit achtunddreißig! In einem Alter, in dem das Gehirn gar keine neuen grammatischen Formen mehr annehmen kann. Wegrationalisiert! Ihn! Den schmucken Maxi-Million Rushmore, zu dessen unübertragbaren Kompetenzen es gehörte, dass er bis jetzt noch jeden Russen unter den Tisch getrunken hatte.
Max schloss die Augen und atmete tief durch. Ein, zwo-dreivier, aus, zwo-drei. Die Nachricht hatte ihm zu schaffen gemacht, das musste er zugeben. Unter anderem, weil er es überhaupt nicht hatte kommen sehen. Der Vormittag, als die Nachricht ihn erreichte, war wie jeder andere Vormittag auch gewesen – abgesehen davon, dass er die Nacht in seiner kleinen, beigefarbenen Ausweichwohnung in Bethesda verbracht hatte, um seiner Frau Rose ein bisschen Ruhe zu gönnen. Oder um endlich mal wegzukommen von ihren ewigen Renovierungsprojekten und ihrer offenbar fruchtlosen Suche nach der perfekten Kücheninsel (insgesamt drei waren bereits geliefert, installiert, nicht für gut befunden und zurückgeschickt worden und hatten mitten in der Küche eine klaffende Lücke hinterlassen). Rose hatte ihn dazu ermuntert, eine kleine Bude zu mieten, da sie beide eine Pause gebrauchen könnten. Außerdem müsste er dann unter der Woche nicht immer so weit pendeln. Dann hatte sie – seine Rose! – sich von ihm abgewandt, mit diesem geistesabwesenden Zug in ihrem runden, rosa, dänischen Gesicht (ihr Vater war Amerikaner), der sich dort breitgemacht hatte, seit sie den Versuch, Kinder zu bekommen, offiziell aufgegeben hatten. Es war weder seine Schuld noch ihre: Die Ärzte hatten herausgefunden, dass sie aufgrund einer höchst ungewöhnlichen Laune des Schicksals beide unfruchtbar waren.
Rose hatte gelächelt und »Ah« gesagt, als ihnen das mitgeteilt wurde – ein Lächeln, das Max noch nie zuvor gesehen hatte. Brüchig und herzzerreißend. Und sie hatte mit ihrer Patschehand seine Männerhand getätschelt, auf ihre leicht fremdländische Weise, die sich manchmal zeigte, weil sie viele prägende Jahre in der Heimat ihrer Mutter verbracht hatte. Dann hatte das mit dem Renovieren angefangen.
Die Hypothek an sich war schon belastend genug. Manchmal hatte Max das Gefühl, sie würde wie ein Gewicht um seinen Hals hängen, aber gleichzeitig meinte er, seiner Rose eine neue Küche zu schulden, wenn sie schon kein neues Leben hervorbringen konnte. Er dachte sich, später, wenn sie die Nachricht verdaut hätten, könnten sie über Alternativen reden. Adoption, Babysitten, was auch immer. Aber jedes Mal, wenn Max glaubte, Rose sei fertig mit Renovieren, fand sie etwas Neues, das ihr nicht mehr recht gefiel – die Schränke, die Schneidbretter – und fing wieder von vorne an. Er entwickelte eine neue Taktik: Wenn er nach Hause kam und eine Rechnung auf dem Küchentisch liegen sah, ließ er den Umschlag ungeöffnet in der oberen Schreibtischschublade verschwinden. Rose wurde immer schmaler. Monatelang aßen sie nur Mikrowellenessen. Der Staub, der Lärm, die Plastikplanen – all das nagte an ihm. Besonders der Anblick des »Spritzschutzes«. Dieses Wort hatte er damals von Rose gelernt. Der Anblick des Spritzschutzes alleine verursachte ihm geradezu körperliche Schmerzen. Die kleinen blauen Mosaikfliesen entsprachen farblich exakt Roses Augen und verteilten sich ebenso strahlend und gebrochen an der Wand.
Max hatte bereits vor Anmietung der Wohnung in Bethesda – was einen weiteren Kredit erforderte, mit dem er das Haus heimlich höher belastete – angefangen, Zuflucht in seinem kleinen Büro in der Agentur zu suchen. Er hatte in dem alten Gebäude gearbeitet, das mit seinen ständig verstaubten Fenstern, dem Fünfzigerjahre-Linoleum und seinem erschöpften Optimismus liebevoll »Fliegende Untertasse« genannt wurde. Hier hatte man alle Russland-Männer behalten, zusammen mit den Afrika-Leuten, während die wichtigen Abteilungen (Naher Osten usw.) in das hochmoderne, glasverkleidete Greenhouse zogen. Eines schönen Morgens, einen Monat vor seinem vierundvierzigsten Geburtstag, wurde Max gefeuert.
Max nahm das Ende seiner Karriere mit einer Gelassenheit hin, die selbst ihn überraschte. »Das hat überhaupt nichts mit Ihrer, äh, Performance zu tun«, sagte der Personalwichser der Agentur, ein Mann, der so himmelschreiend jeglicher sozialer Kompetenz entbehrte (daher sein Spitzname, den er sich bei einigen Pflichtseminaren zu sexueller Belästigung erworben hatte). »Wir wünschen Ihnen – ich persönlich wünsche Ihnen – für Ihre Zukunft viel Erfolg.« Max hatte genickt, ihm die Hand geschüttelt, sich bedankt. Dann war er in die beigefarbene Wohnung in Bethesda geschlendert, wo er drei Tage lang ununterbrochen Milch mit Wodka in sich hineinschüttete – eine extrem heftige Mischung, die er in einem langen, trockenen Sommer in Charkow kennengelernt hatte. Am Ende dieser Auszeit erhielt er einen Anruf von einer Truppe namens Nightshade. Max drückte sich den Hörer ans Ohr und dachte zuerst, er würde halluzinieren. Eine seltsam vertraute Stimme versicherte ihm, dass er nicht halluzinierte: Nightshade war ein Privatunternehmen, dem die Agentur während Max' Besäufnis ein Drittel ihrer Arbeitsbelastung zugeschustert hatte. Die Stimme kannte er tatsächlich: Der Personalwichser war wie er wegrationalisiert und von Nightshade aufgenommen worden. Max empfand eine seltsame Solidarität, eine verrückte emotionale Einheit, als der PW ihm mit seiner üblichen quäkenden Stimme erklärte, dass Max, wenn er den neuen Job annehme, weiter mit seinen alten Agentur-Kontakten zusammenarbeiten würde – für weniger Geld, bei null Arbeitsplatzsicherheit und minimalen Sozialleistungen. »Wir bereiten den Weg für den Wechsel zu einem mehrschichtigen Flex-Modell«, quäkte die Stimme. »Im Rahmen dieses Pionierprojekts bietet Nightshade Ihnen die Chance, Ihre Optionen auf dem freien Arbeitsmarkt auszuloten. Damit Sie Ihr Einkommen und Ihre Liquidität steigern können.«
Max nahm den Job natürlich an. Erleichtert, dass er – zumindest vorläufig – Rose nichts erzählen musste. Sie konnte ihre Renovierungen abschließen, und er würde die Rechnungen etwas langsamer abstottern als ursprünglich geplant. Gut. Als er am nächsten Morgen seinen Laptop aufklappte, verriet ihm sein Browserverlauf, dass er während seiner Milch-Wodka-Umnachtung Recherche in Sachen Aufbaustudiengänge betrieben hatte. In einigen Kästchen hatte er sogar schon Häkchen gemacht. Nüchtern und bei Tageslicht betrachtet, hatte Max gesehen, dass er sich im Zustand fortgeschrittenen Vollsuffs offenbar für einen »ziemlich starken« Kandidaten für das Studium Romantischer Poesie gehalten hatte. Dieser Umstand ließ Max ernsthaft an seiner geistigen Gesundheit zweifeln.
Er atmete noch einmal tief durch, die Augen immer noch geschlossen, und versuchte, seinen Körper zu spüren, wie er es in dem israelischen Körper-Achtsamkeitskurs gelernt hatte, zu dem Rose ihn drei-, viermal mitgeschleift hatte. Er spürte in seine breiten Fußsohlen hinein, seine Zehen, seine starken Beine, seinen sich weitenden Bauch, seine nicht mehr ganz jungen, noch nicht ganz alten Lungen.
Er öffnete die Augen. Er ging einen Schritt, dann noch einen. Der Rote Platz lag vor ihm. Lockte. Schimmerte. Die Abendsonne warf warmes Licht auf die glatten, unebenen Kopfsteine, um deren graue Oberflächen sich rötliche Schattenkränze legten, und die sich über die gesamte Weite des Platzes wellten. Die Mauern des Kremls erhoben sich, hoheitsvoll und uralt. Basilius’ spitze Türme, bunt und prächtig. Der Zar war von ihnen so entzückt gewesen, dass er dem Architekten die Augen ausstechen ließ. Max überlegte, ob ihn diese Legende etwas in Sachen Arbeitsplatzsicherheit lehren könnte.
Als er das Lenin-Mausoleum erreichte, fühlte sich Max bereits besser. Er bahnte sich seinen Weg durch die vielen Touristen aus Omsk, Tomsk, Jekaterinburg – die entlegenen Außenposten eines entlegenen Imperiums. Strahlende Farben, die schrillen Muster der Provinzen. Ein Trio kichernder Mädchen lauerte ihm auf. Kaum zückte er die Kamera, hörten sie auf zu lachen. Schoben die Hüften vor und sogen die Wangen ein. Als er ihnen erzählte, er sei ein berühmter Modefotograf, und auf den Catwalks in Mailand würde nichts Vernünftiges herumlaufen, kicherten sie wieder. Dann bog er rechts ab und ging direkt auf das berühmte Kaufhaus GUM zu.
Max setzte sich an einen der Außentische eines nagelneuen Cafés mit Blick auf den Kreml und bestellte sich einen Espresso. Ein pickeliger Junge in einer makellos weißen Kellnerkluft brachte ihn, und Max staunte, wie gut er war.
Außer ihm saß praktisch niemand draußen. Max lehnte sich zurück und beobachtete die Sonne dabei, wie sie hinter der schwarzen Wolke hervorkam und das Mausoleum anstrahlte. Wie der schwarze Marmor stumpf glänzte. Vor seinem inneren Auge sah er Lenins Gesicht: Wächsern, einbalsamiert. Mit geschlossenen Augen und nicht ganz friedlich. Noch so eine Geschichte – auch sie hatte damit zu tun, unter schwierigen Umständen den Job zu behalten. Oh ja – Lenins Leichnam sollte für die Autopsie aufgeschnitten werden. Aber wenn man eine Leiche einbalsamieren möchte, sollten die Blutbahnen tunlichst intakt bleiben. Die Einbalsamierer reparierten sie also laufend und flickten die Leiche mit Plastik und Alkohol. Die Aufgabe war so schwierig gewesen, dass der Chef-Einbalsamierer seinen Job behalten durfte, obwohl Stalin ihn hatte umbringen lassen wollen. Am Ende ist er kurz vor Stalin gestorben, bei einer der letzten »Säuberungen«.
Max sah auf, als er seinen Namen hörte. »Rush-MORE!« Toby »Bad Boy« Smithers – das am schlechtesten gekleidete und am wenigsten respektierte Immer-mal-wieder-Mitglied der US-amerikanischen Geheimdienstgemeinde in Moskau – marschierte mit seinen kurzen, seinen wulstigen, hobbitartigen Körper tragenden Beinen geradewegs auf ihn zu. Max war überhaupt nicht begeistert, als er hörte, dass Dunkirk sein Hintermann war. Dass Dunkirk einen Boten schickte – das war schon kein gutes Zeichen. Dass es Toby »Bad Boy« Smithers war, dessen Spitzname sich nicht auf seine Heldentaten bezog, sondern auf seine nicht vorhandene Kompetenz – nun ja. Nach seiner »Wiedereinstellung«, wie der agenturinterne Psychologe – der »Gefühlsfresser« – es bei seinem Abschiedsgespräch so feinfühlig genannt hatte, war Max nicht in der Position, sich zu beklagen.
Max grinste. »Rush-MORE!«, wiederholte Toby und wedelte zur Begrüßung mit seinen kurzen Armen.
»Toby«, sagte Max.
»Na, hast es wohl nicht ausgehalten, was?« Smithers setzte sich und zerhämmerte sofort eine kunstvoll zu einem Schwan gefaltete Serviette. »Hast mich vermisst?«
»Dich und einen Gehaltsscheck!«, sagte Max. Seine Stimme kippte ein wenig.
»Klar«, sagte Smithers. »Hab schon von der ›Umstrukturierung‹ gehört. Echt bitter, Alter. Aber du kommst schon wieder auf die Füße. Schließlich bist du Maxiboy Rushmore!« Dann stockte er, als wüsste er nicht, was er sagen sollte. Sorge blitzte in seinen Augen auf, und schon fühlte sich Max nackt. »Der Arbeitsmarkt ist schon echt kacke, oder?«
»Lass es mich so sagen«, entgegnete Max, der Tobys Mitleid nicht wollte. »Ich bin noch nie so froh gewesen, dass ein Vertrag über Holzlieferungen nicht ohne die Zusicherung eines knallpinken, mit rosa Brillant-Zirkonien besetzten iPhones zustande gekommen wäre.«
Toby lachte. Der Wodka Tonic, den er bestellt haben musste, kaum dass er das Café betreten hatte, wurde von dem pickeligen Jungen gebracht. Toby war so ein Typ, dachte Max, der so oder so in Russland gelandet wäre. Wenn nicht gesetzliche Abenteuer, dann geschäftliche. Wenn nicht Geschäfte, dann Übersetzungen, Presse, an Kinofilmsets aushelfen – und mit einer aus einer Akrobatenfamilie stammenden Schauspielerin leben. Wenn Max sich nicht irrte, war das tatsächlich Mrs. Smithers Hintergrund. Aus den Tiefen seines Gedächtnisses tauchte eine Geschichte wieder auf. Eine, die Toby ihm erzählt hatte, als alles noch einfacher war und sie beide jünger waren. Während Toby über Joint Ventures und den fallenden Rubel schwadronierte, fiel es Max wieder ein: Toby hatte sich mal aus seiner im fünften Stock liegenden Wohnung ausgeschlossen. Aber wenn die eigene Verlobte – wie Toby es verwegen erklärte – aus einer Akrobatenfamilie stammte, rief man nicht den Schlüsseldienst. Stattdessen rief er seinen zukünftigen Schwager an, der die Fassade hinaufkletterte und ihm öffnete. Sie zogen damit die Aufmerksamkeit einiger Nachbarn auf sich. Die Polizei wiederum freute sich, dass ihnen die Tür von einem Ausländer geöffnet wurde, der nicht belegen konnte, dass die Wohnung ihm gehörte. Letztendlich hatte er zum Bestechen der Beamten – um nicht festgenommen zu werden – das Dreifache aufgewendet, was ihn ein Schlüsseldienst gekostet hätte.
»Also … Holz?!«, sagte Toby. »Wir hatten einen Kunden in der Firma, der anfing, mit Holz zu handeln. Vor ein paar Jahren. Lief echt gut, er hat richtig Kohle gescheffelt damit. Dann wollte die Regierung ihm den Laden abkaufen, aber er wollte nicht. Tja, und dann hat seine Frau ihn auf dem Grund des Swimmingpools bei ihrer Datsche gefunden. Hände und Füße hinter dem Rücken gefesselt. Brandwunden, ziemlich fies, mit Strom, ich sag dir jetzt nicht, wo. Laut Gericht Selbstmord – sämtliches Holz fiel der Regierung zu.« Toby lachte schallend, nervig. »Ja, ja, die gute alte Zeit.«
»Ich hab diesen kanadischen Deal genau im richtigen Augenblick bekommen«, pflichtete Max ihm bei. »Joint Venture in der Taiga. Die Kanadier drücken schon seit fünfzehn Jahren beide Augen zu. Jetzt sinken ihre Erträge, und auf einmal sehen die russischen ›Standortkosten‹ aus wie Veruntreuung. Und Zack – Tataa, da bin ich wieder.«
»Schön für dich, Alter«, sagte Toby. »Das hätte niemand Netterem passieren können.«
Max zuckte zusammen. Er tat, als würde er sich die Hand vor die Augen halten, um die letzten Sonnenstrahlen abzuwehren. Toby »Bad Boy« Smithers hatte Mitleid mit ihm! Toby »Bad Boy« Smithers, der es mal für eine gute Idee gehalten hatte, sich für die Übermittlung irgendwelcher halb geheimen Dokumente eine blonde Perücke aufzusetzen, die so absurd aussah, dass sie die Aufmerksamkeit der Moskauer Flughafen-Security auf sich zog (was an sich schon eine Leistung war), worauf Toby losrannte, was wiederum dazu führte, dass er überwältigt und festgenommen wurde und sein Foto weltweit durch die Presse ging. »Wenn der Rubel total abschmiert, treten sie den Rückzug an«, sagte Max, um irgendetwas zu sagen. »Dann bin ich arbeitslos.«
»Ach, hier geht doch sowieso alles den Bach runter«, sagte Smithers fröhlich. »Du wirst schon was finden. Wo wohnst du?«
»Im Metropol.« Max nickte zum anderen Ende des Platzes. »Die Kanadier zahlen.«
»Na, das ist doch ein Silberstreif am Horizont.« Smithers bestellte einen Wodka für Max, er kam zusammen mit Smithers doppeltem. »Haben die da immer noch diese Harfenspielerin beim Frühstück?«
Max zuckte die Achseln. Diese Frage würde er ihm am nächsten Morgen beantworten. Max hörte nur halb zu, als Toby ihm diverse Anekdoten aus dem Leben gut betuchter, in Moskau lebender Ausländer erzählte: Vom Lehrer seiner Kinder, der die Jungs vor lauter Begeisterung darüber, dass das Mutterland einen Teil der Ukraine annektiert hatte, nach Hause geschickt hat. (»Die hättest du mal sehen sollen«, sagte Bad Boy. »›Die Krim gehört uns, Papa! Ist das nicht klasse?‹ Wir waren ausgerechnet an dem Abend zu einer Party in der amerikanischen Botschaft eingeladen – mit unseren Kindern. Ich hab ihnen gesagt, sie sollen die Klappe halten. Aber was soll man sagen? Die Hälfte unserer Freunde war ja genau ihrer Meinung.«) Er redete weiter. Von seiner neuen Geliebten, einer zwanzigjährigen Studentin der Medienkommunikation (»Medienkommunikation! Was soll das denn bitte sein?«), der er neulich einen Jeep geschenkt hatte und die er als »eine Freundin« bezeichnete.
Max nahm das Schnapsglas, das der Pickelknabe vor ihm abgestellt hatte. Es war angefroren. Das Brennen im Hals holte Max ins Leben zurück und setzte seine Sinne in Gang.
»Bist du länger hier?«, fragte Toby. »Komm doch mal zum Abendessen. Marina und die Kinder würden sich tierisch freuen, dich zu sehen …« Irgendwie war es Bad Boy gelungen, noch zwei weitere Wodka zu bestellen, die er und Max sofort hinunterkippten, als Toby wieder anfing, in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit in Washington zu schwelgen.
Als Max sagte, er müsse los, huschte Enttäuschung über Tobys Gesicht. Er ist einsam, ging es dem überraschten Max durch den Kopf. Toby zahlte, und auf den Kopfsteinen, mit Blick auf das schwarze Mausoleum, schüttelten sie sich die Hände und trennten sich. Nur einem sehr aufmerksamen Beobachter wäre aufgefallen, dass die lederne Aktentasche, die Max Rushmore mitgebracht hatte, nun an Toby »Bad Boy« Smithers rechter Hand baumelte, und dass Max Tobys Aktentasche quer über den Platz und in die dunkler werdenden Schatten der dicken, hohen Kremlmauern trug.
KAPITEL 3
Gérard Dupres setzte sich den Schutzhelm auf, den der estnische Vorarbeiter ihm reichte. Der Helm roch nach altem Schweiß, und Gérard machte kurz ein angewidertes Gesicht. Falls der Este – ein dünner, drahtiger Mann mit ungesunden, teigigen Gesichtszügen – das gesehen hatte, so ließ er es sich nicht anmerken.
Gérard war ein attraktiver Mann. Geschmeidig, zierlich, aber gut gebaut, mit stahlgrauem Haar und einem handgemachten Leinenanzug, in dem er selbst hier in der baltischen Einöde aussah wie jemand, der gerade eine Runde Tennis gespielt hat. Gérard verzog missmutig den Mund. Er war neulich erst zu einer Entscheidung gelangt. Nämlich, dass Paris der einzige Ort war, an dem er sich wirklich wohlfühlte. In den letzten Jahren hatte er viel Zeit in Käffern weitab der Zivilisation verbracht: Ocotillu, Sao Paolo, Washington D. C.
Das letzte Mal war Gérard im Winter hier gewesen. Die gesamte Region lag im Stockfinsteren, nur die Baustelle für die Nuklearanlage war hell erleuchtet: Der grelle Schein der Natriumdampflampen wurde vom sanft fallenden Schnee reflektiert. Die Anlage hätte längst fertig sein sollen. Aber jetzt stand er wieder hier, im Hochsommer, und die Sicherheitsbeleuchtung war überflüssig.
Der Bauplatz selbst sah dagegen auf unheimliche Weise noch genauso aus wie vorher. Rote Kräne vor grauem Beton. Das Fundament teilweise gegossen. Die kreisrunde Basis, von der aus »der Supér« – eigentlich wurde das Ding »SAEPR« genannt, ein Super-Atomenergie-Druckreaktor – wachsen würde. Irgendwann. Der Supér war Dynacorps Vorzeige-Prototyp. Der erste der nächsten Generation von Kernkraftgeneratoren. Größer und besser als alles, was bisher auf dem Markt war. Falls allerdings das PLUTO-Projekt Erfolg hatte und die Wiederaufbereitung funktionierte, überlegte Gérard, dann würde der Supér ziemlich alt aussehen. Er würde überflüssig. Falls PLUTO funktionierte, würde sich alles ändern. PLUTO – der Name passte. Denn falls PLUTO funktionierte, wäre das der absolute Traum. Selbst die bisher unvorstellbaren Mengen von Atommüll, die PLUTO produzierte, würden das Projekt nicht aufhalten – es war einfach zu groß. Zu gut. Falls. Das war der Knackpunkt.
Vorsichtig kickte Gérard mit seinen handgefertigten Schuhen gegen einen Erdklumpen. Gedankenverloren. Die Ingenieure hatten die Pläne für PLUTO bereits vor fast sieben Jahren entwickelt. Paris. Ein wunderbarer Frühlingsmorgen, an dem alles möglich schien. Nein. Nicht nur möglich. Wahrscheinlich. Die Vögel und die hellgrünen Knospen und Baron Haussmanns kühle, blasse Straßen hatten sich verschworen, um allem den Anschein größter Wahrscheinlichkeit und süßer Hoffnung zu geben. Selbst PLUTOs Achillessehne, welche die Tests so schwierig machte – der extrem giftige Abfall, den es produzierte – selbst dieses Problem schien lösbar. Wenn sie erst zeigen konnten, dass PLUTO funktionierte, würde sich natürlich keiner um die Kollateralschäden scheren. Alle lieben Sieger. Aber Politiker davon überzeugen, ein Risiko einzugehen? Das war eine ganz andere Sache. Darum war Dynacorp entschlossen, erst zu beweisen, dass PLUTO funktionierte. »Besser um Entschuldigung bitten als um Erlaubnis« – das gehörte zu den wenigen interessanten Dingen, die er an der Harvard Business School gelernt hatte – und zwar von einem betrunkenen Amerikaner auf einem der üblichen todlangweiligen Biergelage.
Die Frage, was während der Testphasen mit dem Müll passieren sollte, war aber immer noch offen. Entsorgung über die üblichen Kanäle kam nicht infrage. Normalerweise hätte Dynacorp die Abfälle des PLUTO-Experiments zur Aufbereitungsanlage in der Normandie geschickt. Aber die enorme Strahlenbelastung des Mülls würde, wenn man versuchte, ihn zu reinigen, früher oder später irgendwo Alarm auslösen. Erst würden die Umweltschützer auf die Barrikaden gehen, dann Industriespione ihre Arbeit aufnehmen. Siemens würde sich die Finger lecken!
Selbst Gérard fand den Plan, den Dynacorp ausgeheckt hatte, um den Müll während der Testphase zu verstecken, ziemlich unbedarft. Die Idee stammte von einem Rivalen, war aber gut. Um nicht zu sagen brillant. Und als sein Rivale unerwartet starb – welcher normale Mensch erleidet denn bitte mit siebenundvierzig einen Herzinfarkt? – hatte Gérard gerne die Überwachung der Müllentsorgung übernommen. In letzter Zeit waren ihm allerdings Zweifel gekommen. Er hatte sogar Albträume gehabt. Zwei Mal hatte Gérard geträumt, er sei – gemütlich mit den Armen schlagend – über die vereiste Tundra geflogen, Meile für Meile. Erst war es schön. Dann kam eine Grube. Je näher er kam, desto größer wurde das riesige schwarze Loch unter ihm. Es schien ihn anzuziehen. Gérard schlug immer schneller mit den Armen, um nicht an Höhe zu verlieren – aber vergebens: Die kolossale, trichterförmige Grube zog ihn herunter in die Dunkelheit, immer schneller. Beide Male wachte Gérard schweißgebadet auf. Die Nerven, dachte er. Das PLUTO-Projekt hatte den Kostenplan bereits um das Tausendfache überstiegen. Verdammt viel hing davon ab – zu viel, dachte er. Als Gérard sich jetzt auf der halb fertigen Supér-Baustelle umsah, fragte er sich, ob er damals zu optimistisch gewesen war. Ob es nicht besser gewesen wäre, wenn die Präsentation im Spätherbst stattgefunden hätte, wenn das Licht nachließ und allein das Geräusch des Windes draußen in den Straßen einen drinnen schaudern ließ?
Aber nun war es, wie es war. Der Alte hatte entschieden: Der Supér würde sie über Wasser halten, solange sie PLUTO testeten. »Avec tout discretion«, hatte er gesagt, als die Ingenieure gingen. Seine Stimme bebte in der Stille des holzgetäfelten Büros, seine leichenblassen Hände ruhten auf dem Schreibtisch, der einst Ludwig XIV. gehörte. Die Verhandlungen mit den Russen – die immer noch am besten wussten, was Verschwiegenheit eigentlich war, sie hatten das im Blut, auch wenn sie dafür bezahlt werden mussten – waren praktisch sofort aufgenommen worden.
Der Este rief einem der Schweißer etwas zu und riss Gérard damit aus seinen Gedanken. PLUTO konnte warten. Dynacorp brauchte den Supér. Jetzt. Nach Tschernobyl war Kernenergie umstrittener geworden. Jetzt sah es ganz so aus, als würde sich das Blatt wieder wenden, und Dynacorp hatte die Nase ganz vorn. Sie mussten ihre Gewinne konsolidieren. In Frankreich war noch ein Supér in Arbeit, unter der Bedingung, dass dieser ins Baltikum lieferte. China hatte drei weitere bestellt. Falls PLUTO funktionierte, würden natürlich selbst die deutschen Über-Ökos Dynacorp aus der Hand fressen. Aber jetzt musste er sich erst mal noch auf den Supér konzentrieren. Der Supér war eine sichere Sache. Mehr Energie, billiger, schneller, besser. Und französisch.
Gérard folgte dem Esten, dem die schwere Arbeitskleidung zu groß war. Die Baustelle glich eher einer Ruine als einem aktiven Arbeitsplatz. Metallstäbe ragten überall ins Leere. Plastikplanen über Betonplatten, haufenweise schwere Metallrohre. Der Este sprach und zeigte. »Da und da wäre der Beton in fünfzehn, zwanzig Jahren gerissen«, sagte er, als sie den Holzsteg ins Innere der Baustelle hinuntergingen. »Staunässe. Und da …« Er zeigte nach oben, wo der Reaktorbehälter hinkommen würde. »Da hatten wir ein Problem mit den Schweißungen. Hier.« Sie erreichten die Stelle: Schwarz, verkohlt. »Hier war das Feuer.«
»Sie müssen schneller arbeiten«, sagte Gérard. »Durch das Feuer sind wir weitere neun Monate im Rückstand. Die Kosten liegen schon 70 Prozent höher als veranschlagt. Es muss weitergehen.«
Der Vorarbeiter nickte. »Wir tun, was wir können. Aber die letzte Betonlieferung war minderwertig. Und die Einarbeitung der Schweißer haben wir bereits auf zwei Wochen reduziert.«
»Eine muss reichen«, sagte Gérard zum Chef-Ingenieur auf Französisch. »Und beim nächsten Mal – verwenden Sie den Beton!«
KAPITEL 4
»Oh Mann. Kann mich mal einer treten …«, sagte Max, als er die abgeschmackten Büroräume der Moskauer Niederlassung von McGovern International Consulting Inc. betrat. Wobei »Büroräume« ein bisschen hochtrabend ausgedrückt war. Es handelte sich um zwei benachbarte, schrankgroße Zimmer, von denen eines ein Fenster hatte. Was streng genommen die meiste Zeit des Jahres ohnehin ohne Belang war. Während des langen Winters sorgten einzig Leuchtstoffröhren an der Decke für das nötige Licht. Und völlig unglamourös war das Haus nun auch wieder nicht, dachte Max: Unten im zugigen Glaskasten, der als Lobby diente, kostete ein welker Salat »Mediterran« so viel, wie ein Schullehrer im Monat verdiente. Immerhin.
Erschrocken sah Marie auf. Sie saß am Schreibtisch gleich bei der Tür. Ihr glattes, braunes Haar fiel ihr um das perfekt runde, blasse, mondgleiche Gesicht und über die eckigen Schultern ihrer praktischen Jacke. Sie hatte bis eben vollkommen gebannt auf den Bildschirm ihres Laptops gestarrt. Noch bevor sie aufstehen konnte, hatte Max den Raum bereits durchschritten und sich hinter sie gestellt und er las auf ihrem Bildschirm mit:
»Eines Tages kam der Versucher: Ein kleiner schwarzer Vogel – es war eine Amsel – fing an, ihn zu belästigen und zudringlich zu werden … Hierauf folgte eine so heftige fleischliche Versuchung, wie er sie niemals verspürt hatte …«
Max rollte mit den Augen.
»Wie ich es vermutet hatte! Wer ist es denn heute? Ah, ich sehe schon. St. Benedikt.«
Marie errötete und klappte den Laptop zu. Dann breitete sich ein Lächeln auf ihrem schönen, flächigen Gesicht aus. »Max!«, sagte sie. »Hör auf, mich zu trietzen.«
»Ich?« Er küsste sie auf die Wange. »Was kann ich denn dafür, dass du so schräge Hobbys hast?«
Ehe er sich versah, sprang sie auf und schlang die Arme um ihn. Dann trat sie einen Schritt zurück und sah ihn belustigt an. »Schön, dass du wieder da bist, Max«, sagte sie leise. Sie waren beide betreten. Marie setzte sich schnell wieder, schlug die Beine übereinander und kratzte sich mit einem sehr roten, sehr langen Fingernagel verlegen die Nase.
»Schöne Nägel«, sagte er in einem Versuch, wieder den Spaßvogel zu spielen.
»Hör bloß auf.« Sie verdrehte die Augen. »Ich kann nicht mal den Aktenschrank aufmachen.«
Max lachte. »Erzähl.«
Marie wurde rot und sah zu Boden. Sie war wirklich richtig nett, dachte Max. Und clever. Die Agentur hatte Glück mit ihr. Zu Max’ Zeiten mussten alle Agenten ein intensives Sprachtraining absolvieren: Er selbst hatte zwei Jahre an dem Institut in Monterey verbracht, um seine Intonation einigermaßen hinzubekommen. Jetzt schickten sie meist Muttersprachler ins Rennen – die Kinder ausgewanderter Familien, die spätestens zu deren Einschulung wieder zurückgegangen waren (»Ich konnte beim Morgenrundkreis einfach nicht im Schneidersitz sitzen«, hatte Marie ihm mal erzählt. »Das war echt ein Problem für mich. Die Lehrer in Amerika konnten das nicht kapieren. Und ich immer nur: ›In Russland hatten wir Stühle!‹«). Max’ Generation sah dabei zu, wie alles kaputtging. Es gab immer noch ein paar Dinosaurier wie Dunkirk, die für ihre Rente und ihre Wohnung nicht selbst aufkommen mussten, und in einer Welt lebten, die es de facto nicht mehr gab, auch wenn man in ihr immer noch abends essen gehen konnte. Maries Generation dagegen war an Unsicherheit gewöhnt: Unbezahlte Praktika, die sie auf Jobs in Branchen vorbereiten sollten, die schon nicht mehr existieren würden, wenn sie endlich einen Abschluss hatten. Sie kannten es nicht anders, sie erwarteten nichts Besseres.
Aber Marie war ein toller Mensch. Gut – sie beklagte sich darüber, nur eine glorifizierte Sekretärin zu sein – ihre Generation wolle mehr. Nicht Geld, nicht Sicherheit. Sondern Action und Spannung. Sinn. Moskau, sagte sie, war aber eigentlich nur eine größere Ausgabe vom Brighton Beach bei New York. Wenn sie das gewusst hätte, wäre sie zu Hause geblieben, in der Nähe ihrer Großmutter. Ständig drohte sie damit, wieder an die Uni zu gehen und zu promovieren. Vielleicht in Theologie? Warum kein Dr. in Obdachlosigkeit, entgegnete Max dann immer. Marie zuckte die Achseln. Jetzt senkte sie die sonst klare, laute Stimme zu einem Murmeln. »Der alte Typ vom Kiosk bei mir um die Ecke meint, ich sollte mir mal einen Mann suchen. Bevor es zu spät ist.«
»Der alte Schlawiner«, sagte Max. »Woher will der wissen, dass du keinen Mann hast?«
»Genau das habe ich ihn auch gefragt!« Marie klang ein klein wenig empört.
»Und?«
Marie sah wieder zu Boden. »Er hat auf meine Fingernägel gezeigt. Ich kaue ständig drauf rum. Und er: ›Mit den Händen? Ha!‹« Jetzt musste Marie fast selbst lachen. Sie ertappte sich dabei und runzelte die Stirn. »Jetzt muss ich noch mal einen Termin machen – nur, um diese Dinger wieder loszuwerden.«
»Keine Sorge, Marie«, sagte Max. »Manche Männer stehen auf Frauen ohne Krallen.«
»Halt die Klappe. Sag, seit wann bist du denn hier?«
»Gestern Abend.« Er nickte in Richtung Schreibtisch. »Jetzt schieß aber mal los. Was läuft gerade?«
Sie seufzte, klappte den Laptop wieder auf und tippte unter einiger Anstrengung: »Schau! Regen sich alle tierisch über den Ölpreis auf – mit jedem Dollar, den der Preis pro Barrel fällt, verliert Russland hundert Milliarden Dollar oder so. Allein letzte Woche ist er um drei Dollar gefallen.«
Max setzte sich neben sie und pfiff. »Und hier: Brutale Razzia auf sogenannte Ausländische Agenten. Sie haben gerade den Direktor der Ukrainischen Bibliothek wegen antipatriotischer Umtriebe eingeknastet … Und hier, die letzten Telekommunikationsgesellschaften haben topmoderne Abhöreinrichtungen installiert … Hey, wusstest du, dass der KGB zu SU-Zeiten gerade mal dreihundert Telefonanschlüsse in Moskau abhören konnte?«
»Im Ernst?«
Sie zeigte ihr bezauberndstes Lächeln und nickte. »Echt mal. Und meine Eltern immer: ›Sprich nicht am Telefon darüber! Blabla.‹ Und ich: ›Echt mal, das hier ist Brighton Beach, und ihr redet über so was wie prähistorische Zeiten, die keine Sau interessieren!‹ Na, da habe ich wohl recht behalten. Es ist nur … das ist ja wie ein – ein Panoptikum! Weißt du? Wie bei Foucault?«
»Ja, Marie, ich habe auch mal studiert.«
Sie errötete. »Egal. Ach, und noch was Lustiges: Der FSB hat 60 – in Worten: sechzig – Ledermäntel bestellt, die exakt so aussehen sollen wie die alten vom NKWD. Ich meine – hallo?«
Max schüttelte den Kopf. »Irgendwas für mich?«
Marie guckte leicht gequält. »Dunkirk will dich sehen.«
Max stöhnte. »Jetzt?«
»Ja«, sagte sie. »Er hat gesagt, ich soll dich rüberschicken, falls – wenn du auftauchst.«
Max nickte. »Da kann man wohl nichts machen.«
Marie schüttelte den Kopf. Als Max aufstand, stand sie mit auf. »Max«, sagte sie, als er die Tür erreichte. »Tut mir wirklich leid – mit dem Job.«
Max spürte ein Brennen im Hals und um seine Augen. Was für ein Gefühl war das? Wenn er es benennen sollte (wie er es zusammen mit Rose in diesem blöden Achtsamkeitsseminar gelernt hatte), dann würde er es »Wut« nennen. »Zorn«. »Scham«. »Verletzung«? Er zuckte mit dem Kopf und war zur Tür hinaus, bevor sie etwas sagen konnte.
KAPITEL 5
Der Himmel war grau und schwer. Max ging. Setzte einen Fuß vor den anderen. Der Verkehrslärm. Das Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Seine rasselnde Atmung. Dann, wie eine Offenbarung: der Fluss. Max sah auf. Fünfspurig rollte der Verkehr unter einer dicken Abgaswolke nach Westen. Dahinter floss Moskaus tiefer, schlammiger Strom. Auf seinen Fußballen balancierend, Bad Boys lederne Aktentasche in seiner Hand, wartete er auf eine Lücke. Als sie kam, lief er los, quer über die Hauptverkehrsstraße. Auf halbem Wege sah er, dass ein schwarzer Corolla Gas gab und auf ihn zufuhr. Aus dem Nichts. Überquerte drei Fahrstreifen in drei Sekunden. Max’ Herz raste, als er sich nach vorne warf. Er spürte den Zug verschmutzter Luft. Hörte die metallene Karosserie an ihm vorbeischießen. Um Zentimeter.
Vom sicheren Gehweg aus winkte Max dem Corolla nach. Solche sportlichen Versuche, die Fußgänger in der Hauptstadt umzunieten, waren früher ganz normal, aber Max hatte es lange nicht erlebt. Da fühlte er sich direkt wieder jung.
Die Stadt wirkte verschlafener und leerer denn je auf ihn. Auf einer Brücke in der Nähe des Kreml drängte sich eine kleine Schar um einen verwitterten Schrein: Nelkensträuße in abgesägten Ein-Liter-Wasserflaschen, zu harten kleinen Pfützen erstarrtes rotes Wachs auf dem Trottoir. Ein paar Leute gingen langsam, einzeln oder paarweise, an den in Plastikhüllen steckenden Fotos vorbei, die an die Steinbrücke geklebt waren. Die Leute lasen, was auf den Zetteln daneben stand. Ihre gesenkten Mienen waren leer. Max kam hinzu und ging langsam vorbei. Trotz dieses improvisierten Denkmals war es kaum zu glauben, dass ein Mann, der als Kandidat gehandelt wurde, das Land zu regieren, hier, in Sichtweite des Kreml, erschossen worden war.
Unter ihm lähmte der Berufsverkehr jetzt die breite Straße. Jedes einzelne Auto, selbst der kleinste Golf, hatte verdunkelte Scheiben. Max sah sie Zentimeter für Zentimeter vorankriechen wie ein Umzug von Blinden.