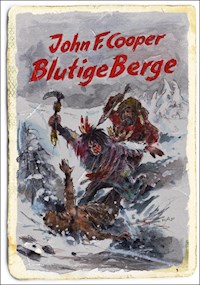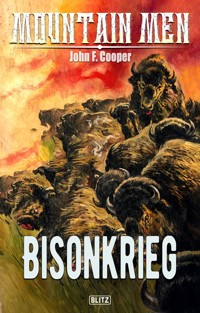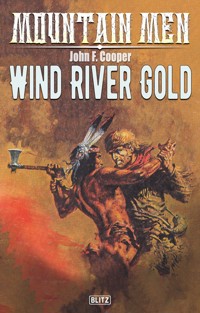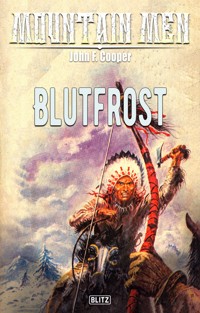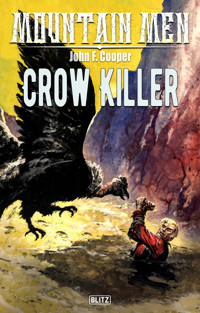Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mountain Men
- Sprache: Deutsch
Frühling 1821 in den Rocky Mountains. Nach einer gefährlichen Biber-Jagdsaison sind die Trapper Jedediah Jones und Malcolm McGruder auf dem Weg zum Missouri. Obwohl sie ihren alten Feind, den Blackfoot Hunting Coyote, besiegen konnten, fangen ihre Probleme jetzt erst richtig an. Ein tollwütiger Bär hat sich an ihre Fersen geheftet, und die Pelzdiebe von der St. Louis Missouri Fur Company sind auch nicht weit. Als Jed und Mel auf die Überreste einer alten spanischen Expedition stoßen, stecken sie bereits mitten in einem neuen Abenteuer. Es wird sie zu einem uralten Geheimnis führen. Wind River Gold (Teil 2) Die Printausgabe des Buches umfasst 282 Seiten Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
4501 John F. Cooper Wind River Gold
4502 John F. Cooper Der goldene Fluß
4503 John F. Cooper Stadt der Pelze
4504 John F. Cooper Bisonkrieg
4505 John F. Cooper Das alte Volk
4506 John F. Cooper Camp des Todes
4507 John F. Cooper Blutfrost
4508 John F. Cooper Die Belagerung
4509 John F. Cooper Crow Killer
DER GOLDENE FLUSS
MOUNTAIN MEN
BUCH 2
JOHN F. COOPER
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
© 2021 Blitz Verlag
Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH
Mühlsteig 10 • A-6633 Biberwier
Redaktion: Alfred Wallon
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten
www.blitz-verlag.de
4502 vom 25.01.2025
ISBN: 978-3-95719-766-5
INHALT
Was bisher geschah …
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nachwort des Autors
John F. Cooper
WAS BISHER GESCHAH …
Herbst 1820 in den Rocky Mountains: Der erfahrene Mountain Man Jedediah Jones und das Greenhorn -Malcolm McGruder stoßen während der Biberjagd auf kriegerische Blackfoot-Indianer. Wie sich herausstellt, handelt es sich um die Bande von Hunting Coyote, Jeds Todfeind. Er ist darauf versessen, alte Rechnungen zu begleichen, und schreckt nicht davor zurück, im Winter auf den Kriegspfad zu gehen. Als ob das nicht genug Ärger bedeuten würde, geraten die Mountain Men mit einer Gruppe Trapper von Manuel Lisas St. Louis -Missouri Fur Company aneinander.
Nachdem ihr Freund Bear Hopkins von den Blackfeet getötet wurde, fliehen Jed und Mel durch die Berge. Unterwegs retten sie das Leben des französischen Trappers Jehan Prevost. Verfolgt von den Blackfeet, flüchten sie sich in einen Handelsposten der Hudson’s Bay Company, den die Briten illegal auf dem Territorium der Vereinigten Staaten errichtet haben, um Pelzhandel mit den Indianerstämmen südlich der kanadischen Grenze zu treiben.
Der tödlich verletzte Prevost vermacht Mel seine Blockhütte in den Wind-River-Bergen mit all seinen Schätzen, die eigentlich für seinen Sohn bestimmt waren, der sich jedoch nie hat blicken lassen. Prevost spricht von Gold, doch als Jed und Mel das Caché des Franzosen entdecken, finden sie nur Biberpelze vor, das braune Gold der Wildnis.
Es kommt zum blutigen Showdown mit Hunting Coyote.
PROLOG
Nordamerika, Großes Felsengebirge,
Anno Domini 1543
Schatten folgten ihrer Fährte, seit einer Nacht und einem Morgen schon, und als der Tag in den Abend überging, hatten die Eisenmänner noch immer nichts bemerkt.
Eine kleine Reitergruppe zog auf schmalen Pfaden durchs Gebirge, auf Wegen, die vor ihnen kein weißer Mann gegangen war. Die Anmut des Landes machte die Männer blind für Gefahren. Grüne Täler dehnten sich vor dem Hintergrund schwarzer Berge, deren Gipfel selbst jetzt, im Sommer, mit gleißendem Schnee bedeckt waren, der in den Augen schmerzte, wenn man zu lange hinsah.
Es war das großartigste Land, das die Fremden je zu Gesicht bekommen hatten. Gigantisch in seiner Weite, majestätisch in seiner Schönheit, unermesslich in seiner Einsamkeit. Rauschende Bäche wanden sich durch dichte Fichtenwälder. Ihr Wasser war klar wie Kristall, so rein, dass die Schuppen der Fische in der Sonne glitzerten.
„Silberne Fische“, scherzte einer der Männer. „Vielleicht erweisen sich die Legenden ja doch noch als wahr.“
Der Sprecher hieß Fernán Ortega. Seine Haut war von zu vielen Jahren in der Glut Neuspaniens erdig braun geworden, ein dichter Bart wucherte in seinem Gesicht. Er ritt ein großes, knochiges Pferd, das nach entbehrungsreichen Wochen abgemagert, aber noch immer stark genug war, um einen Reiter in voller Rüstung zu tragen. Brustharnisch und Helm aus Eisen, dazu ein stählernes Rapier.
„Silberne Fische, warum nicht?“ Der Mann an Ortegas Seite lachte. „Ich kenne kein besseres Land als dieses hier.“
Hernando Delgado, der zweite Reiter, machte eine Geste, die den Horizont mit einschloss. Berge, Wälder, Wasser und Einsamkeit im Überfluss. Fürwahr, dies war das prächtigste aller Länder, und sie hatten bei Gott schon viele gesehen. Die Insel Fernandia und das Reich der Azteken, das nun Teil der spanischen Welt war, und Kastilien natürlich, ihre Heimat, um nur die angenehmeren der Länder zu nennen, in denen sie gelebt und gekämpft hatten. Was die letzten Jahre anging, hatten sie vor allem gekämpft, mit Hunger und Durst und verschlagenen Eingeborenen, denen man nur so lange trauen konnte, wie man ihnen nicht den Rücken zuwandte.
Das war in Cibola und Quivira gewesen, den geheimnisvollen Ländern des wilden Nordens, in denen sie nichts als Pech und Täuschung gefunden hatten. Bis sie letzte Woche auf einen Stamm freundlicher Eingeborener getroffen waren, der sie in sein Dorf einlud, eine kleine Stadt aus Zelten. Der Häuptling hatte die Fremden willkommen geheißen, und sie verbrachten mehrere Tage an seinem Feuer. Alte Krieger erzählten ihnen vom goldenen Fluss.
Vor vielen Menschenaltern war er ein reißender Strom gewesen, der oft verheerende Überschwemmungen brachte. Aber die Götter hatten ihn unter die Erde gezwungen, um das Land für ihre Kinder, die Vogelmenschen, bewohnbar zu machen. So nannten sich die Eingeborenen: Ap-sa-ro-ke, die Kinder des Vogels mit dem großen Schnabel, und sie befanden sich auf einer Wanderung nach Westen, um das neue Land für ihr Volk zu erkunden, das dem kleinen Stamm nachfolgen würde.
Der Vogel, eine riesige Krähe, war ausgestorben, ehe die Weißen in die Welt des roten Mannes kamen, aber die Erinnerung an ihn lebte in den Alten fort, genau wie die Erinnerung an den reißenden Fluss fortleben würde. Einige der Ap-sa-ro-ke behaupteten, sie hätten den Fluss in seinem unterirdischen Bett gesehen. Angeblich waren sie dort gewesen, in einer großen Höhle voll seltsamer Tiere. Der Fluss floss dort unten träge dahin, denn sein Bett war mit großen Steinen gefüllt, die vom Wasser umspült wurden, sodass sich sein Lauf verlangsamte. Gelb glänzende Steine. Metallische Brocken. Gold.
Hernando zügelte sein Pferd. Er hatte etwas wahr-genommen, eine schemenhafte Bewegung zwischen den Bäumen. Oder irrte er sich? Als er hinsah, war da nichts.
Sie ritten am Ufer eines schäumenden Wildbachs entlang, der kein Gold enthielt. Hier lebten braune Pelztiere, die Höhlen in die Uferhänge gruben und Bäume fraßen. Vielleicht war es der Schatten eines dieser Tiere gewesen.
Die anderen Reiter schlossen auf. „Was gibt es?“, fragte einer der Männer. Sein Harnisch war zerkratzt, sein Helm verbeult. Er war meist mürrisch, aber ihr bester Kämpfer. Pedro de Leiva, ein alter Soldat. Rotsilbernes Haar drängte unter seinem Helm hervor. Er sah nicht aus wie ein Spanier, führte seine Abstammung aber auf eine der edelsten andalusischen Familien zurück. Es gab niemanden, der diesem unerschrockenen Kämpfer widersprochen hätte.
„Ich weiß nicht“, räumte Hernando ein. „Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Auf der anderen Seite des Baches.“
Sie starrten zu dritt zwischen die Bäume, aber nichts regte sich. Zu hören war ebenfalls nichts; das Rauschen des Bachs war viel zu laut. De Leiva gab ein gereiztes Schnaufen von sich. Er sah aus, als wolle er sein Rapier aus der Scheide reißen, um das andere Ufer zu erstürmen und alles niederzumachen, was sich dort drüben vielleicht versteckte.
„Da ist nichts“, sagte Fernán. „Wir sollten weiter reiten, damit wir vor der Dämmerung einen Lagerplatz finden.“
Hernando nickte. Ein Lager, gut. Sie würden Holz sammeln müssen, denn in den Nächten wurde es in den Bergen empfindlich kalt. Doch es würde ihr letztes Lager sein, ehe sie den goldenen Fluss fanden. Er hatte sich die Beschreibung des Häuptlings fest eingeprägt. Einen Tagesritt noch, höchstens, dann mussten sie die Stelle erreichen.
Den Zugang zur Höhle mit dem Gold. Der einzige Grund, aus dem sie seit Jahren durch die Fremde irrten.
* * *
Fernán Ortega und Hernando Delgado hatten zur Streitmacht des Fancisco Vazques de Coronado gehört. Im Jahre des Herrn 1540 waren dreihundert schwer bewaffnete spanische Krieger, achthundert indianische Verbündete und tausend Packtiere von Compostela im Norden Neuspaniens aufgebrochen, um die sieben goldenen Städte von Cibola zu erobern. Ein paar Jahre zuvor hatte Cortez Tenochtitlán geplündert, die Hauptstadt der Azteken, Pizarro hatte Cuzco erobert, die Metropole des Inkareiches. Die Konquistadoren schickten Berge von Gold und Silber nach Spanien. Doch ihre Eroberungen waren nichts im Vergleich zu dem Reichtum, der in den sieben Goldstädten von Cibola auf Männer wartete, die entschlossen waren, sich anzueignen, was ihre Vorfahren einst hinterlassen hatten.
Die Legende berichtete von sieben christlichen Bischöfen, die vor fünfhundert Jahren aus Iberien geflohen waren, in dem damals die Mauren herrschten. Um ihren Verfolgern zu entkommen, segelten die heiligen Männer über das Meer der Dunkelheit, bis sie das Gesegnete Land erreichten. Sie fanden Flüsse, die über goldenen Sand flossen und deren Ufer von goldenen Kieseln gesäumt wurden, und sie errichteten sieben Städte aus Gold, für jeden Bischof eine.
Kein weißer Mann hatte seitdem das Gesegnete Land betreten, doch Francisco de Coronado war überzeugt, die goldenen Städte finden zu können.
Fray Marcos, ein düsterer Franziskaner, hatte Coronado zu seinem Feldzug ermutigt. Auf einer seiner Wanderungen wollte der Mönch Cibola gesehen haben. Aber sie fanden nur Dörfer aus Lehm, die in der unerbittlichen Sonne brieten. Überfüllte Siedlungen, die aussahen, als habe sie ein Riese zusammengeknüllt und in die Landschaft geworfen. Fernán und Hernando kannten Haziendas, die stattlicher waren.
Der Vizekönig Antonio de Mendoza hatte ihnen Ländereien in allen Territorien versprochen, die sie für die spanische Krone gewannen. Doch wer würde sich in diesem tristen Land niederlassen wollen? Ein Mann hatte hier nur größte Unbilden zu erwarten. In den Wüsten, die sie durchquerten, war es so heiß, dass die Hidalgos in ihren Harnischen gegart wurden. In den Bergen froren ihnen die Rüstungen am Fleisch fest. Falls sie je über die Berge kamen.
Das Land war eine bittere Enttäuschung, und dennoch war es voller Wunder. Fernán und Hernando hatten zusammen mit einer kleinen Gruppe einen Wasserlauf nach Westen erkundet. Nach zwanzig Tagen beschwerlichem Wüstenmarsch musste die Schar unvermittelt Halt machen. Vor ihnen öffnete sich eine riesige Kluft in der roten Erde, und ganz tief unten, zwischen steil abfallenden Wänden aus geschichtetem Felsen, wand sich ein schmales Flüsschen. Drei Tage suchten sie nach einem Abstieg. Als sie unten ankamen, erwies sich das Flüsschen als breiter Strom, der nur aus der Höhe unbedeutend ausgesehen hatte.
Eine Möglichkeit, den riesigen Spalt zwischen den Felsformationen zu überwinden, fanden sie nie. Ein Naturwunder, wahrhaftig, aber deswegen waren sie nicht hergekommen. Sie waren auf Reichtümer aus, doch statt Gold fanden sie nur Türkise, statt mit Silber wurden sie von umgänglichen Indios mit Pelzen beschenkt, und oft schlichen sich nachts die weniger umgänglichen Eingeborenen ins Lager und stahlen ihnen die Pelze wieder.
Coronado hatte nicht aufgegeben und war immer weiter nach Norden gezogen, aber das goldene Cibola war nichts als ein Schwindel. Fray Marcos musste nun des Nachts inmitten der Offiziere schlafen, da die einfachen Soldaten auf eine Gelegenheit warteten, dem verlogenen Mönch die Kehle durchzuschneiden.
Nur El Turco war ein noch größerer Lügner als der Franziskaner. El Turco war ein Eingeborener aus dem Norden, ein Paw-nee. Er war bei einem Überfall gefangen genommen worden und diente dem Volk der Cicúye als Sklave. Die Cicúye waren freundliche Indios. Sie überließen den Weißen ihren Sklaven als Führer, weil er sich in den Ländern auskannte, die Coronado erreichen wollte. Die Spanier nannten ihn El Turco, weil manche der Männer behaupteten, er sähe wie ein verschlagener Türke aus.
Sie behielten Recht.
Eines Tages sprach El Turco vom Land Quivira, das in seinen Erzählungen eine noch sagenhaftere Gestalt als Cibola annahm. Er berichtete von Wagenladungen voller Gold, von silbernen Tellern, von denen sogar das -einfache Volk speiste, und vom Kanu des Königs von Quivira, das über vierzig goldene Riemendollen verfügte und auf einem Fluss fuhr, in dem Fische so groß wie andalusische Hengste schwammen. Es fehlte nicht viel, und der Verräter hätte behauptet, dass den Fischen goldene Schuppen wuchsen. Wahrscheinlich hätte ihm Coronado auch das geglaubt. Irgendwo musste das sagenhafte Goldreich des Nordens doch zu finden sein.
Aber nicht in Quivira.
Der Paw-nee wollte nur nach Hause und lockte die Expedition immer tiefer in die Einsamkeit. Sie durchquerten schier endlose Ebenen, die von Stürmen aus wirbelnder Luft heimgesucht wurden, aus denen es faustgroße Hagelkörner regnete, die einen Mann töten konnten, indem sie ihm den Helm wie mit einem Streitkolben in den Schädel trieben.
Einmal hörten die Männer nahenden Donner. Hektisch beschlossen sie, Schutz unter einer Felswand zu suchen. Was das Wetter anging, irrten sie sich, doch ihre Vorsicht erwies sich als richtig, denn kurz darauf wurde die Ebene von einem gänzlich anderen Sturm erfasst: Riesige, zottige Stiere tobten vorüber, mit breiten Schädeln und Furcht einflößenden Hörnern. Tausende davon, Zehntausende, ein unaufhaltsamer Strom. Fernán schwor später, es seien Millionen gewesen.
Die Tiere hatten dichte Felle, aus denen man warme Decken machen konnte, und ihr Fleisch schmeckte saftig, doch die Spanier waren nicht zum Essen in dieses Land gekommen, das ihnen seine Schätze weiter -vorenthielt.
Weil es keine Schätze gab. Als sie die Wahrheit erkannten, töteten sie den Paw-nee. Er starb einen qualvollen Tod in der Umarmung einer Garotte, die einer der Soldaten aus dem Leder eines der zottigen Stiere gemacht hatte.
Dann befahl Coronado die Umkehr. Geschlagen trat die Expedition den Rückweg an. Es war eine Schmach, und dem Anführer liefen die Männer weg, so wie sie zwei Jahre zuvor unter seine Fahne geströmt waren. Die meisten kehrten nach Neuspanien heim oder ließen sich in den Dörfern der Cicúye nieder, wo es willige Mädchen gab. Ein Teil der Männer aber wollte nicht vergessen, welchen Traum sie geträumt hatten.
Den Traum vom Reichtum in einem fernen Land
* * *
Und hier ritten sie nun: ein Dutzend Hidalgos vor der Kulisse schneebedeckter Berge, ein verlorener, aber wohlgerüsteter Haufen. Helme funkelten im Sonnenlicht, Schwerter klirrten, und die ausgemergelten Gesichter der Männer zeigten zähe Entschlossenheit.
„Für Ruhm, für Gott und den König“, hatte Francisco de Coronado immer gerufen, doch auf diesem Ritt trieb sie etwas anderes voran. Diesmal zogen sie für sich allein durch die Fremde. Für Ruhm? Natürlich. Für Gott? Vielleicht. Vor allem aber für Gold. Der goldene Fluss wartete auf sie.
Ein Knacken riss Fernán aus seinen Tagträumen. Ein großer Vogel brach durch die Äste eines Baumes am gegenüberliegenden Ufer und gewann mit kräftigen Flügelschlägen an Höhe. Etwas hatte ihn aufgeschreckt.
Hernando Delgado und Pedro de Leiva ritten an Fernáns Seite. „Ein Bussard“, rief Hernando.
Während der jüngere Mann sich die Zeit nahm, den Vogel zu beobachten, fixierten die misstrauischen Augen des alten Soldaten nur den Baum, aus dem der Bussard in den Himmel geschossen war. De Leiva musterte den Stamm, die schmalen Mulden zwischen den Wurzeln und den moosigen Boden ringsum. Er konnte nichts Verdächtiges erkennen.
Wären sie länger im Lager der Ap-sa-ro-ke geblieben, hätten ihnen die Eingeborenen von den Kriegern ihrer Welt erzählt. Sie besaßen keine Rüstungen aus Eisen oder Klingen aus Toledo, aber sie waren wie Schatten, und keiner von ihnen hätte einen Bussard erschreckt, während er durch den Wald kroch. Es sei denn, der Krieger befand sich nicht am Boden, sondern hoch oben in den Ästen.
Pedro de Leiva sah nichts, aber er spürte etwas. „Ich werde mich mal ein bisschen umsehen“, knurrte er. Es war kein Vorschlag, sondern eine Feststellung. Seitdem sie Coronados Armee verlassen hatten, gab es niemanden mehr, der den anderen Befehle erteilen durfte. Die Männer gaben nach, wenn Pedro de Leiva sprach, weil er Erfahrung hatte und jeden Mann besiegen konnte. Außer vielleicht Fernán Ortega und Hernando Delgado, die bei einem berühmten kastilischen Fechtmeister in die Schule gegangen waren. Auf sie hörten die Männer, weil sie -Bildung besaßen und mehr über die Welt wussten als der Rest des Trupps zusammen.
Nur über diese Welt wussten sie nichts, gar nichts.
Deshalb erhoben sie keinen Einwand, als de Leiva einen einzelnen Soldaten nahm und mit ihm ein Stück dem Weg zurück folgte, wo sie eine Fuhrt gesehen hatten. Die Pferde würden dort gefahrlos durch den Wildbach waten können.
„Ich treffe euch beim Lager“, rief de Leiva. Geräuschvoll galoppierte er davon. Sein rotsilbernes Haar flatterte wie das Kriegsbanner des heiligen Santiago, fand Fernán. Was immer er auf der anderen Seite fand, er würde es bezwingen.
Die zehn verbliebenen Männer ritten noch eine Stunde weiter, bis sie einen geeigneten Lagerplatz fanden. Sie sattelten ab, tränkten ihre Pferde am Bach und sammelten Holz für ein Feuer. Einmal hörte Fernán ein Knacken im Wald, doch er schob es auf einen der Männer, der ein Bündel trockener Äste im Arm trug. Sie entfachten ein Feuer und aßen das Trockenfleisch, das ihnen die -Ap-sa-ro-ke geschenkt hatten. Es stammte von den riesigen Stieren, die die Ebenen wie schwarze Wolken bedeckten.
„Morgen“, sagte Hernando, „morgen müssen wir den Ort erreichen. Der Dorfälteste sprach von einem Tal hinter dem gewundenen Fluss. Den gewundenen Fluss haben wir vor zwei Tagen hinter uns gelassen. Dies ist das Tal, und bald werden wir an seinem Ende angelangt sein.“
Die anderen wussten, von welchem Ort er sprach. Von den Bergen, unter denen der goldene Fluss verlief. Aber keiner der Männer antwortete. Hernando erntete nicht einmal ein zustimmendes Nicken. Er blickte auf und sah den Grund.
Jenseits des Feuers standen drei Gestalten.
* * *
Wie Waldgeister waren die Fremden zwischen den Bäumen hervorgetreten. Sie trugen Kleider aus Hirschleder, stützten sich auf Hartholzbögen und sahen stumm zum Feuer der Spanier herüber. Es waren Indios mit kupferfarbener Haut und langen schwarzen Haaren, die sie sich im Nacken zusammengebunden hatten. An ihren Gürteln erkannte Hernando Beile mit steinernen Klingen. Die Ankömmlinge machten ernste Gesichter, aber sie wirkten auch neugierig.
Hernando hob die Hand. Zögernd erwiderte einer der Eingeborenen die Geste. „Du willst sie ans Feuer bitten?“, flüsterte einer der Männer aus dem Trupp. Unbehagen schwang in seiner Stimme mit.
„Warum nicht?“ Fernán Ortega antwortete anstelle seines Freundes. Eines hatte er in den Ländern des Nordens gelernt: Das Land mochte rau und seine Bewohner mochten barbarisch sein, aber an einem Feuer in der Wildnis herrschten die gleichen Gesetze der Gastfreundschaft wie auf einer spanischen Hazienda. Fremde musste man willkommen heißen, so lange sie in Frieden kamen. Er bedeutete den Indios, am Feuer Platz zu nehmen.
Die Eingeborenen wechselten einige Worte in ihrer gutturalen Sprache. Einer klang verärgert, ein anderer verträglich. Der Nachsichtige setzte sich durch, und sie kamen der Aufforderung nach. Während sie Platz nahmen, sah Fernán, dass die Sohlen ihrer Lederstrümpfe schwarz waren. Später, als einer der Indios die Hände über dem Feuer wärmte, streifte sein Beinling einen verkohlten Ast, und Fernán begriff, dass der Ruß von Kochfeuern das Schuhwerk der Eingeborenen geschwärzt hatte.
Was hatte der Disput zwischen den Indios zu bedeuten? Fernán fragte sich, ob die Anwesenheit seiner Männer ein Tabu verletzte. Vielleicht befanden sie sich auf dem Territorium der Jäger, worüber diese nicht glücklich waren.
Zumindest schien nun die Frage beantwortet zu sein, wer sie am Tage verfolgt hatte. Es mussten diese Krieger gewesen sein. Sie waren in den Wäldern zuhause und konnten sich in dem ihnen vertrauten Gelände nahezu lautlos bewegen. Ob Pedro de Leiva und der Soldat, der bei ihm war, überhaupt eine Spur der Eingeborenen entdeckt hatten?
Das brachte Fernán zu einer anderen Frage: Wo blieben de Leiva und sein Begleiter?
Hernando reichte den Fremden Fleisch und einen Krug mit frischem Wasser. Fernán nutzte die Ablenkung, um zweien der Spanier ein Zeichen zu geben: Sie sollten am Waldrand Position beziehen und Ausschau halten. -Garcia und Anza. Sie erhoben sich und schlenderten zu den Pferden.
Die Pferde erweckten das Interesse der Eingeborenen. Nach einer Weile am Feuer wollten sie sich die Tiere unbedingt ansehen. Sie strichen ihnen über das Fell, hoben die Schwänze hoch und sprangen erschrocken zurück, als einer der Hengste ungehalten schnaufte.
Fernán hatte diese Reaktionen schon bei anderen Indio-Völkern beobachtet. Auch den Ap-sa-ro-ke waren Pferde unbekannt gewesen. Als der Häuptling erkannte, wie viel Gewicht man einem dieser Tiere auf den Rücken packen konnte, begegnete er ihnen mit großer Ehrfurcht. Zum Dank für seine Gastfreundschaft hatten ihm die Spanier eines ihrer Ersatzpferde überlassen. Er nannte es Sieta Sunka.
Das war kein Name, sondern bedeutete sieben Hunde. Ein Pferd konnte so viel Gepäck tragen, wie sieben der zerzausten Hunde, die sich die Eingeborenen hielten.
Diese Jäger hier gehörten nicht zum Stamm der Ap-sa-ro-ke, aber viele ihrer Worte glichen denen des Krähen-volkes. Mithilfe von Zeichen und Sprachfetzen machte Fernán verständlich, wofür er sich interessierte: Der goldene Fluss, gab es ihn wirklich, und wo lag er?
Die roten Jäger machten undurchdringliche Gesichter, aber Fernán hatte das Gefühl, dass sie ihn nicht nur verstanden hatten, sondern dass sie auch etwas wussten. Aber eher er nachbohren konnte, entstand Unruhe bei den Pferden.
Zwei weitere Indios traten aus dem Wald. Garcia und Anza, die beiden Wachtposten, hatten sie nicht -kommen hören. Zunächst schienen die Indios von den Weißen keine Notiz zu nehmen, was Fernán befremdete. Sie begegneten unbekannten Männern mit seltsamen Tieren und hatten nichts Besseres zu tun, als stoisch ihre Brüder zu begrüßen?
Worte flogen über die Lichtung. Der Spanier verstand einige Brocken. Lager, Jagd und großer Bär. War Letzteres der Name eines der Krieger? Nein, ein Name, den sie nannten, lautete Schwarzer Wolf. Er war aus seinem Lager zur Jagd aufgebrochen und hatte einen großen Bären erlegt.
So ähnlich jedenfalls, Fernán konnte nur wenig von der fremden Sprache richtig übersetzen. Manchmal verstand er die Worte, erkannte aber nicht ihren Zusammenhang.
Sie hießen die Neuankömmlinge willkommen und boten ihnen Fleisch und Wasser an. Dann begann dieselbe Prozedur wie bei den anderen. Die Jäger bestanden darauf, die Pferde zu inspizieren, taten verwundert und ließen sich auf ein langes Palaver mit den Spaniern ein. Der goldene Fluss? Sie nickten bedächtig. Immerhin, das war ein Fortschritt.
Fernán beschloss, aufs Ganze zu gehen. Er nahm eine der Waffen, mit denen Coronado seine indianischen Verbündeten ausgerüstet hatte: ein großes Schwert aus Holz mit einer Schneide aus Obsidian. Sie waren billig in der Herstellung und dem spanischen Stahl unterlegen, im Gefecht gegen feindliche Indios aber leisteten sie wertvolle Dienste. Auch ein Holzschwert konnte tiefe Wunden schneiden.
Fernán überreichte die Waffe einem Achtung gebietenden Eingeborenen, der drei Adlerfedern im Haar trug. Ihn hatte er als Wortführer des Jägertrupps ausgemacht.
„Ein Geschenk für meinen Freund Schwarzer Wolf“, sagte Fernán mühsam in der Sprache der Ap-sa-ro-ke.
Der Indio zögerte. Täuschte er sich, oder zeigte die Miene des Roten Belustigung? Aber dann griff der Krieger zu, untersuchte das Schwert und grunzte anerkennend.
Fernán, Hernando und einige ihrer Männer mühten sich noch eine Stunde oder länger, um etwas aus den Eingeborenen herauszukriegen. Mal nickten diese, dann wieder wichen sie aus. Die Spanier gewannen allmählich den Eindruck, dass die Jäger ihren Fragen absichtlich auswichen.
„Der Fluss …“, begann Fernán ein weiteres Mal auf Ap-sa-ro-ke, um ärgerlich auf Spanisch fortzufahren: „Zum Teufel, wenn ihr etwas wisst, spuckt es aus. Ich habe es satt, jedes Wort wie einen Wurm aus euren hässlichen Hakennasen zu ziehen.“
Plötzlich erhoben sich die Indios. Hatten sie die Beleidigung verstanden und wollten gehen? Nein, ihre Geste galt einem weiteren Eingeborenen, der jetzt ins Licht des Feuers trat. Er war nur mittelgroß und untersetzt, aber er strahlte eine kalte Aura der Autorität aus. Harte schwarze Augen in einem stoischen Gesicht. Um die Schultern trug er ein dunkles Wolfsfell. Ein schwarzer Wolf.
Jetzt erkannte Fernán seinen Denkfehler. Das hier war der Mann, den er vorhin seinen Freund genannt hatte, nur dass er keinerlei Freundlichkeit an sich zu haben schien.
Mit Schwarzer Wolf kamen mehr Krieger. Zehn, fünfzehn … Fernán hatte Mühe, sie zu zählen, denn so, wie sie aus dem Wald traten, mischten sie sich zwischen die Spanier. Die Wachen wurden völlig überrumpelt. Hernando befahl den Männern, Acht zu geben, aber sie hatten der Dreistigkeit der Eingeborenen nichts entgegenzusetzen und sahen sich alsbald von roten Wilden umringt.
Fernán versuchte, die Situation zu entspannen, indem er vor Schwarzer Wolf hintrat und das Zeichen des Friedens machte. Der Indio warf ihm einen finsteren Blick zu und richtete seine Aufmerksamkeit auf das Geschenk der Spanier.
Das hölzerne Schwert mit der Obsidianschneide.
Er nahm es dem großen Krieger aus der Hand und untersuchte die Klinge. Offenbar versuchte er, herauszufinden, wie man diese Waffe benutzte.
Fernán beschlich ein ungutes Gefühl, und im selben Augenblick fiel ihm etwas ein: Obwohl die Eingeborenen lange genug in ihrem Lager waren, hatten sie noch keine Anstalten gemacht, ihren Gastgebern eine Pfeife anzubieten. Rauchen galt als Zeichen der Freundschaft in dieser Welt. Blieb es aus, konnte das nur bedeuten …
Fernán sah, dass Schwarzer Wolf eine Pfeife am Gürtel trug. Außerdem waren da ein Kriegsbeil und zwei Fellbüschel. Nein, kein Fell. Haare. Das eine Büschel war schwarz, das andere rotsilbern. Beide waren blutig.
Mein Gott, durchzuckte es Fernán, deshalb also war Pedro de Leiva nicht zurückgekehrt.
Es war sein letzter Gedanke.
Schwarzer Wolf schwang das Schwert. Er hatte recht schnell begriffen, dass man es benutzen konnte, um einem Feind den Kopf abzuhauen.
Fernáns Rumpf kippte seitwärts ins Feuer.
Schockiert sah Hernando zu, wie sein Freund starb. Er riss sein Rapier aus der Scheide. „Santiago!“ Es war der Schlachtruf, mit dem die Hidalgos Tenochtitlán erobert und das neuspanische Reich errichtet hatten. Santiago, der heilige Jakob, war der Schutzheilige der Soldaten. Doch hier, im wilden Norden, war seine Macht gering.
In dieser Nacht starben alle Männer des kleinen Trupps. Die roten Krieger nahmen ihre Rüstungen, ihre Waffen und ihre Haare. Für die großen Hunde, auf denen die Weißen in ihr Land gekommen waren, hatten die Eingeborenen keine Verwendung. Sie töteten zwei der Tiere und aßen ihr Fleisch. Die anderen nahmen sie mit. Vielleicht würden die seltsamen Wesen später noch ihre Nützlichkeit offenbaren. Die Knochen der Spanier verrotteten in den namenlosen Bergen.
Tage später fand eine Jagdgruppe der Ap-sa-ro-ke den Leichnam von Pedro de Leiva, der noch den eisernen Harnisch trug. Die Jäger erinnerten sich, dass ihnen dieser Mann als ein großer Kämpfer vorgestellt worden war, und sie bestatteten ihn mit allen Ehren, die ihr Volk kannte. Da sie nicht wussten, welche Sterberiten die Fremden abhielten, erfüllten sie dem Eisenmann seinen sehnlichsten Wunsch.
Sie halfen ihm, im Tod seinen Traum einzuholen.
KAPITELEINS
Der Bär blieb ihnen auf den Fersen.
Zu Anfang sahen sie ihn nicht; seine Gegenwart war nur eine Ahnung: Ein Rumoren im Wald, das Brechen von Zweigen, ein davoneilender Hirsch, ein Wachtelpaar, das kreischend an Höhe gewann. Der Grizzly musste schon sehr alt und schwerfällig sein, wenn er keins der Tiere erwischte.
Jed trieb zur Eile. Er wollte das Revier des Bären so schnell wie möglich verlassen, in der Hoffnung, dass dieser sich nach anderer Beute umsah. Doch entweder war sein Jagdgebiet weiter als alle Bärenreviere, die der Trapper kannte, oder der Hunger des Grizzlys war brennender als der Instinkt, sein Territorium unter Kontrolle zu halten.