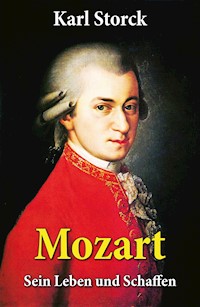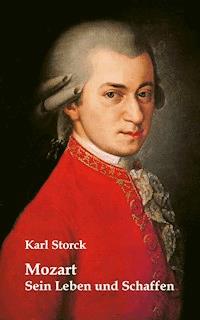
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ziel war für mein Buch: die Erkenntnis der Persönlichkeit Mozarts als der Quelle seiner Kunst. Es scheint mir unleugbar, dass die Gesamterscheinung eines Künstlers nur mit den Mitteln einer aus den geschichtlichen, kulturellen und sozialen Verhältnissen seiner Zeit in ihn eindringenden Psychologie zu erkennen ist; dass aber die Liebe zu einem Künstler vor allem in seinen lebendigen Gegenwartswerten beruht. Wir erleben bei großen Künstlern wohl immer, dass mit der Erkenntnis auch die Liebe wächst. Das ist das wunderbar Beglückende des Umgangs mit den Großen. Ich habe für meine Person dieses Glück bei Mozart erfahren und versuchte nun, andere daran teilnehmen zu lassen. So war mein stetes Bestreben, die geschichtlichen Grundlagen von Mozarts Leben und Schaffen aufzudecken, dabei aber alles Geschichtliche nur als Mittel zur Entdeckung von Gegenwartswerten zu nützen."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 867
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Karl Storck
Mozart
Sein Leben und Schaffen
Impressum
Cover: Portrait 1819 postum gemalt von Barbara Krafft
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958705692
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
Meinem Freunde
dem Bildhauer Ernst Müller
zu eigen
Es ist mir eine tiefe Freude, Ihnen, lieber Freund, dieses Buch in Ihre römische Werkstatt schicken zu können. Außer der Selbstbeglückung, die in dem Bewusstsein liegt, einem lieben und verehrten Menschen eine Freude zu bereiten, veranlassen diese Widmung auch in der Sache liegende Gründe. Der wichtigste darunter ist die Wesensverwandtschaft Ihres künstlerischen Schaffens mit dem mozartischen in dessen wunderbarster Eigenschaft: der harmonischen Schönheit. Tiefe Harmonie verdankt sich nicht einem leichten, kampflosen Erleben, sondern dem völligen Durchkämpfen des Erlebnisses bis zum Friedensschlusse in und mit sich selbst. Dann erst tritt die künstlerische Gestaltung ein, die als solche bereits das Ergebnis des Lebenskampfes ist und deshalb in ihrem Erzeugnis – dem einzelnen Kunstwerke – vom Kampfe nichts mehr verrät, sondern nur sieghafte Harmonie ausstrahlt.
In dieser Eigenschaft liegt für mich vor allem die beglückende Kraft der mozartischen Kunst; im geistigen und seelischen Erarbeiten dieser Lebens- und Kunstharmonie beruht die Herrlichkeit des Menschen Mozart. Mein Buch möchte den Leser zu dieser unversiegbaren Quelle schönen Menschentums hinführen.
Dann dachte ich bei der Widmung an die vielen Abende, an denen wir am Flügel und – gerne sei's gestanden – beim gehaltvollen Tropfen musiziert, gesprochen, gestritten, gelacht und geschwärmt haben. Es war der Tafelrunde stillschweigendes Übereinkommen, vor keiner Frage die Ohren zu verschließen und keinem Problem aus dem Wege zu gehen. Ich habe es auch bei meinem Buche so gehalten, bei dem mir oft war, als entstände es im Gespräch in unserem Kreise. Es mag auf diese Weise mancherlei in das Buch gekommen sein, was nicht unbedingt darin nötig wäre. Aber als alte Alpenwanderer wissen wir beide, dass man oft auf Umwegen am sichersten zum Ziele gelangt und auch auf ihnen wertvolle Ausblicke genießt.
Dieses Ziel war für mein Buch: die Erkenntnis der Persönlichkeit Mozarts als der Quelle seiner Kunst. Es scheint mir unleugbar, dass die Gesamterscheinung eines Künstlers nur mit den Mitteln einer aus den geschichtlichen, kulturellen und sozialen Verhältnissen seiner Zeit in ihn eindringenden Psychologie zu erkennen ist; dass aber die Liebe zu einem Künstler vor allem in seinen lebendigen Gegenwartswerten beruht. Wir erleben bei großen Künstlern wohl immer, dass mit der Erkenntnis auch die Liebe wächst. Das ist das wunderbar Beglückende des Umgangs mit den Großen. Ich habe für meine Person dieses Glück bei Mozart erfahren und versuchte nun, andere daran teilnehmen zu lassen. So war mein stetes Bestreben, die geschichtlichen Grundlagen von Mozarts Leben und Schaffen aufzudecken, dabei aber alles Geschichtliche nur als Mittel zur Entdeckung von Gegenwartswerten zu nützen.
Wenn es wahr ist, dass vieler Liebe viel vergeben wird, ist mir für die Aufnahme meines Buches trotz seiner Schwächen nicht bange. Denn ich habe es mit wahrhafter Liebe geschaffen, die umso mehr wuchs, je schwerer ich mir die Muße dafür einer reichbemessenen Berufsarbeit abgewinnen musste. So hoffe ich, dass etwas von dieser Liebe in dem Buche wirken möge auf seinen Leser und ihn dann mitreiße zur Liebe für Mozart, für edle Schönheit in Leben und Kunst.
z. Zt. Ettingen, im August 1908
Karl Storck, Berlin Präludium
Vom musikalischen Genie und dem Universalstil der Musik
Ausschnitt aus Mozarts Notierungen: Die Entführung aus dem Serail
Mozarts Name und seine Werke sind in einer Weise und Ausdehnung volkstümlich geworden, dass man den großen Feierlichkeiten wie Familienfesten beiwohnen wird.« Was Liszt zur 100. Wiederkehr von Mozarts Geburtstag voraussagte, hat sich auch bei der 150. wiederholt. Dabei fällt zweierlei als besonders merkwürdig auf. Alle Schichten der Bevölkerung und alle musikalischen Kulturvölker empfinden die Mozartfeier als Familienfest, das man aus innerem Drang, wie etwas Selbstverständliches feiert. Der Name Mozart ist geradezu zum Begriff Musik geworden, und Musikliebe wird gleich Liebe zu Mozart, selbst für jene, die sich keines engeren Verhältnisses zu des Meisters Werken rühmen können. Und wenn Richard Wagner Mozart als »Licht- und Liebesgenius« bezeichnete, so deckt sich auch das mit der Vorstellung, die der Mensch mit der Musik verbindet, die ihm die Kunst verklärender Schönheit, liebegesättigter Seligkeit ist, auch heute noch, wo unsere zeitgenössische Komposition fast immer anderen Zielen nachstrebt. So verbinden sich mit dem Namen Mozart, unabhängig von der zeitweilig stärker oder geringer hervortretenden Bedeutung seiner Werke für das öffentliche Musikleben, zwei Vorstellungen rein musikalischer Art, die auch bei keinem andern Musiker mit dieser Klarheit zu untersuchen sind: 1) Mozart ist das musikalische Genie und damit die reinste Ausdrucksform des Genies schlechthin; 2) Mozarts Musik ist in jenem höchsten Sinne universal, dass jedes Volk in ihr einen Gipfel seiner Musik sehen kann.
Wesen und Ursache dieser Erscheinung möchte ich untersuchen, bevor wir uns mit Mozarts Lebensgang beschäftigen.
Als Christoph Willibald Ritter von Gluck, nachdem er zu der Einsicht gekommen, dass er in Deutschland sein Reformwerk der Oper niemals würde durchsetzen können, die Pariser Bühne sich zu gewinnen strebte, schrieb er in seinem berühmt gewordenen Briefe vom Februar 1773 an den »Mercure de France«, es sei sein Lieblingsgedanke, »eine allen Nationen zusagende Musik zu schaffen und dadurch den lächerlichen Unterschied der nationalen Musiken verschwinden zu lassen«. Schier hundert Jahre später glaubte freilich auch Richard Wagner, dass nur von Paris aus eine für das Opernwesen bedeutsame Kundgebung auf durchschlagenden Erfolg rechnen könne. Er handelte danach; aber es geschah aus jener bitteren Erkenntnis heraus, in der Goethe bereits geurteilt hatte, dass es Deutschland zwar nie an Talenten, dagegen immer an nationalem Geiste gefehlt habe. Wagner wollte von Paris aus nicht Paris oder die Welt erobern, sondern Deutschland. Den höchsten nationalen Gehalt des Deutschtums durch die Musik und in ihr neu aufleben zu lassen und zu stärkerer Wirkung zu bringen, als es in den anderen Künsten möglich ist, war das Streben seines Lebens.
Uns Heutigen, die wir, trotz alles Geredes von Internationalität der Kunst, diese viel volklicher empfinden als irgend ein Zeitalter zuvor, weil wir das Nationale nicht mehr als eine Begrenzung betrachten, sondern als Stärkung des Charakters, erscheint Glucks Streben, eine alle Nationen umfassende Musik zu schaffen, als Beengung und Abschwächung des Stärksten in seinem Wesen. Umgekehrt fühlen wir, dass gerade auf Wagners Deutschheit seine Macht auf die Welt, seine Universalität beruht.
Glucks Streben nach Internationalität trägt die Schuld an seinem Festhalten an den konventionellen Formen der Antike, seinem Beharren in der äußerlichen Romantik, seinem Versagen gegenüber dem Plan zur »Hermannsschlacht«, der Unterlassung des Versuchs, eine deutsche Operndichtung zu vertonen. Man muss dabei bedenken, dass er begeisterter Bewunderer Klopstocks war; und es ist doch gut denkbar, ja geradezu sicher, dass Klopstock eine Operndichtung wohl hätte gestalten können, in der Gluck für sein bestes Vermögen des Ausdrucks innerer Seelenentwickelung reiche Anregung gefunden haben würde. Was Glucks unvergängliche Größe ausmacht, ist ausgesprochen deutsch: eben die Betonung der seelischen Entwicklung. Dieses ist auch das stets Lebendige, noch heute Wirksame in Glucks Kunst. Dass die Neubelebung seiner Werke so schwer fällt, dass es nicht mehr recht gelingen will, ihnen eine edle Volkstümlichkeit zu verschaffen, liegt an jenen internationalen Eigenschaften. Die Musik würde, zumal bei einer Art von Auffrischung, wie sie Wagner der »Iphigenie in Aulis« hat zuteilwerden lassen, bei ihm kaum ein Hindernis für eine Neubelebung bilden, die umso wünschenswerter wäre, als damit der romantischen Welt Wagners die ruhige, klare klassische Welt gegenübergestellt würde. Die Antike Glucks ist nämlich, wenn man die Musik allein ansieht, nicht die französische Klassizistik, als die sie durch das äußere Gewand der Handlungs- und Redeführung erscheint, sondern durchaus der Goethe'schen Welt verwandt. Gerade in der »Iphigenie« fühlt man diese Wesensverwandtschaft beider deutlich heraus.
Liegt bei Gluck das ausgesprochen Deutsche in der Musik im Gegensatz zur Dichtung, die dem Weltbesitz der antiken Mythe entnommen war, so hat umgekehrt Wagner seine Weltstellung zweifellos der Musik zu verdanken, deren Prächtigkeit und ausgesprochene Theatralik – im besten Sinne des Wortes; Wagner nannte es das Exklamative in seiner Natur – Eigenschaften sind, die der deutschen Musik wenigstens vor ihm abgehen. Es fehlt in Wagners Kunst jene Intimität, jenes Sich Versenken oder meinetwegen auch Sich Verbohren in einen Gedanken, eine Empfindung, das sonst fremden Völkern das Eindringen in das tiefste Wesen deutscher Musik so sehr erschwert hat. Das Verständnis der dichterischen Welt Wagners dagegen ist eigentlich nur aus deutsch-romantischem Gefühl heraus zu erreichen.
Es ist sicher, und die Geschichte der Oper in den verschiedenen Ländern beweist es, dass gerade die Verbindung mit dem Worte für die Musik selber, deren Tonmaterial an sich für alle Völker gleich ist, leicht einen ausgesprochenen Nationalcharakter herbeiführt. Der italienischen steht die ebenso charakteristische französische Oper gegenüber; für Deutschland kann man von einer wirklichen Nationaloper allerdings erst seit der Romantik sprechen; aber auch England in seiner kurzen Musikblüte und viel später die nordischen und slawischen Länder haben zu allererst bei der Oper sich der nationalen Eigentümlichkeiten ihrer Musik bedient.
Trotzdem ist der ja gewiss verlockende Gedanke einer allumfassenden Kunst, die alle Völker befriedigt und ergötzt, auch in der Musik einmal zur Tatsache geworden, und zwar gerade in der Verbindung mit dem Worte durch Wolfgang Amadeus Mozart. Jedes der musikalischen Kulturvölker preist Mozart als reinsten Offenbarer der Musik. Er kann uns also schlechthin als der Gipfel der Musik überhaupt erscheinen.
Es regt sich in uns Deutschen heute bei diesem Urteile vielleicht mehr Zurückhaltung – Widerspruch wäre zu scharf – als beim Franzosen oder Italiener. Drei Namen drängen sich uns dabei als Nebenbuhler um jenen Ehrentitel auf: Wagner, Beethoven, Joh. Seb. Bach. Zuerst scheiden wir Wagner aus, da er ja selber nicht als Musiker angesehen werden wollte und jedenfalls innerhalb der Bewegung der Musik allein nicht gewürdigt oder erfasst werden kann. Bach, der Urgewaltige, dessen Kunst unerschöpflich und für die Ewigkeit gestaltet erscheint, wie das Meer, dem ein Beethoven ihn bewundernd verglich, wird ja zweifellos in den nächsten Jahrzehnten immer mehr und mehr bedeuten, gerade für das deutsche Volk. Aber es ist in Bachs Kunst doch zu vieles, was uns hindert, sie als Gegenwartswert zu empfinden. Es liegt nicht nur in Einzelheiten der Form. Es liegt vielmehr gerade in dem, was Bachs allerhöchste Größe ausmacht, nämlich in der Tatsache, dass er in seiner Person die Kunst zweier verschiedener Zeitalter vereinigt. Wir aber stehen mit beiden Füßen in der zweiten dieser Welten und empfinden alles, was an die erste gemahnt, als gewesen. Dann verbindet sich uns mit Bachs Musik die Vorstellung stark erregter Religiosität. Es ist eine nicht genug beachtete Tatsache, dass sich mit der Kunst des von den Vertretern der absoluten Musik als Hort und Urbeispiel ihrer Anschauung aufgerufenen Mannes unwillkürlich eine Anschauung verknüpft, die nicht wesentlich musikalisch ist.
Dagegen wirkt Mozarts Kunst, obgleich sie viel offenkundiger sich mit einem nicht ausgesprochen musikalischen Zweck – dem Theater – verband, gerade für unsere Erinnerungsvorstellung von dem Wesen des Künstlers nur als Musik. In Mozart ist gewissermaßen die Musik an sich lebendig geworden. Er ist der einzige wirklich absolute Musiker, d. h. nur und voll Musiker, der heute noch uns ganz zu erfüllen vermag, der für uns die Bedingung des ewigen Könnens in sich zu tragen scheint.
Die heutige Welt ist nämlich für die rein musikalische Kunst nicht mehr recht empfänglich. Die im neunzehnten Jahrhundert in die eigentliche Kunsthöhe aufgerückten Nationalmusiken der slawischen und nordischen Völker sind überhaupt nicht ins Gebiet des rein Musikalischen gelangt. Entweder haben sie sich gleich an das »Dichten in Tönen« gemacht, oder sie sind so sehr im Bereich der Tanzmusik stecken geblieben, dass wir uns von der Vorstellung des Tanzens bei dieser Musik kaum freimachen können. Die Italiener, die einst um zweier Eigenschaften der reinen Musik willen – wegen des sinnlichen Wohllautes und der Freude am Spiel bewegter Form – alles andere preisgaben, haben sich auch in ihrer Oper, in der allein sie sich ja ausleben zu können scheinen, ebenfalls der Macht des Dichterischen oder doch der Situation gebeugt. Ebenso sind die Franzosen, die in rein musikalischer Hinsicht vielleicht das am wenigsten begabte unter den Kulturvölkern sind, immer offenkundiger jener Musik zugefallen, die ihren innersten Anstoß von anderer Kunst erhält.
Diese Musik hat zwei Gipfel. Der eine ist Richard Wagner, der in seiner Kunst die offene Verbindung der Musik mit anderen Künsten anstrebt und für sie eigentlich kein Sonderleben möglich hält, der als Theoretiker in der Dichtung das männlich schöpferische, in der Musik das weiblich empfangende und ausgestaltende Element sah. Der andere Gipfel ist Beethoven. In seinem Schaffen und nicht in dem Richard Wagners liegt der Grund dafür, dass wir eine nur aus musikalischen Elementen hervorwachsende, rein musikalische Kunst kaum mehr besitzen. Um die Bedeutung dieser Tatsache in ihrem vollen Umfang erkennen zu können, müssen wir etwas weiter ausholen.
Goethe hat uns, als der dazu Berufenste, da ja kein anderer schöpferische Kraft und psychologisch nachempfindendes Verständnis fremder Eigenart in so hervorragender Weise verband wie er, den tiefsten Einblick in das Wesen des Genies eröffnet. Es geschieht in einem der Gespräche mit Eckermann (11. März 1828), deren Fruchtbarkeit für die tiefere Erkenntnis der Kunst unerschöpflich ist. Goethe sieht danach das Genie in der Kraft der Produktivität, in der Fähigkeit, produktiv zu sein, d.h. in der Fähigkeit, Taten hervorzubringen, »die vor Gott und der Natur sich zeigen können, und die eben deswegen Folge haben und von Dauer sind«. Diese schöpferische Kraft ist das Entscheidende, ist der Urgrund alles genialen Schaffens. Wie sich die Kraft offenbart und betätigt, ist ein Zweites. »Es kommt gar nicht auf das Geschäft, die Kunst und das Motiv an, das einer treibt, es ist alles dasselbe. Ob einer sich in der Wissenschaft genial erweist oder im Kriege und der Staatsverwaltung, oder ob einer ein Lied macht, es ist alles gleich.« Das alles sind nur Erscheinungsformen, Offenbarungsformen, Gestaltungsformen jener urschöpferischen Kraft.
Aus dieser einen Erkenntnis ergeben sich für das Sondergebiet der Künste alle Folgerungen über die Grenzen unter ihnen wie über ihre Vereinigung. Das Allkunstwerk Richard Wagners erklärt sich ebenso einfach und natürlich wie die Wirkungskraft, die Möglichkeit der vollen Lösung eines großen Problems in einer Spezialisten-Technik.
Übersetzen wir Goethes Wort in die Philosophiesprache Schopenhauers, des tiefsten Denkers über die Psychologie der Kunst, so erhalten wir die einfache Formel, dass jene schöpferische Kraft, sofern sie nach künstlerischer Betätigung drängt, parallel steht der Idee der Kunst, während die Gestaltungen, die jene schöpferischen Gedanken durch die einzelnen Künste finden, Abbilder dieser Idee werden. Es wäre dabei festzuhalten, dass ein und derselbe schöpferische Gedanke die denkbar verschiedensten Abbilder in den verschiedensten Künsten hervorrufen kann.
Nun hat derselbe Schopenhauer der Musik im Verhältnis zu den anderen Künsten eine Sonderstellung eingeräumt, indem sie nicht wie die anderen ein Abbild der Idee, sondern eine solche selbst sei. Sie sei Abbild des Willens, die Ansicht der Welt selber. »Deshalb eben ist die Wirkung der Musik umso mächtiger und eindringlicher als die der anderen Künste, denn diese reden nur vom Schatten, jene aber vom Wesen.« Die Musik besitzt danach die Fähigkeit, das Schöpferische an sich zu verlebendigen, die Wonne des Schöpferisch-Seins auszudrücken. Die Musik braucht nicht zu sein eine Form, in der sich die Schöpferkraft ausdrückt, sondern sie ist der Ausdruck der Schöpferkraft selber.
Es ist merkwürdig, wie sich die Größten in ihren Empfindungen begegnen. Die Musikphilologie hat neuerdings Goethes Verhältnis zur Musik als nicht besonders tief hingestellt. Man kann ja so leicht eine Reihe von Fällen aufzählen, in denen sich das musikalische Verständnis Goethes nicht so fest bewährte, wie wir es heute von jedem großstädtischen Abonnenten philharmonischer Konzerte gewöhnt sind. Man denke sich nur, dass er, zu dem Beethoven sich so mächtig hingezogen fühlte, nicht nur von dem ungefügen und ungeschlachten Komponisten selber, sondern auch von seiner Musik nichts wissen wollte. Wenn wir, die wir so gern nachreden, dass das Genie für das bloße Begriffsvermögen ewig ein Geheimnis bleiben müsse, den wirklichen großen Genies gegenüber doch jene Bescheidenheit bewahren möchten, die einem erhabenen Geheimnis gebührt, so wären wir wohl in der Erkenntnis großer Künstler längst weiter. Wir würden in unserem Falle nicht stolz verkünden, dass Goethe kein großes musikalisches Verständnis besessen hat, sondern würden uns bescheiden fragen: Wie kommt es, dass Goethe, der durch einfache Volkslieder aufs tiefste ergriffen wurde, der für die Musik Mozarts eine grenzenlose Bewunderung hegte, von dem wir über Musik und Musiker einzelne Aussprüche von einer wunderbaren Tiefgründigkeit haben, Beethoven ablehnte?
Einer jener tiefgründigen Aussprüche gilt Joh. Seb. Bach. Als der junge Mendelssohn ihn mit den Klavierwerken des Titanen bekanntmachte, meinte Goethe: »Mir ist es bei Bach, als ob die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte, wie sich's etwa in Gottes Busen kurz vor der Schöpfung mag zugetragen haben.« Es gibt Leute, die solche Worte, wenn sie nicht gerade von einem Goethe stammen, mehr als ästhetische Phrase abtun. In Wirklichkeit haben wir hier wieder einen Fall, in dem der Genius Goethes, weit über alles Erkennungsvermögen hinaus, die Wahrheit fühlte und für ein wunderbares Geheimnis das erhellende Wort fand. Denn die Empfindung Goethes Bach gegenüber bedeutet dasselbe wie Schopenhauers Gefühl von der Sonderstellung der Musik, und in dem »kurz vor der Schöpfung« liegt das Merkwürdige und Tiefsinnige dieser Empfindung. Warum nicht während der Schöpfung? Warum nicht nach ihr? Nein, vor ihr! Da war Gottes Busen geschwellt von unendlicher Schöpferkraft. Was er nachher gestaltete, war ja alles nur Ausdruck, nur Form, nur Abbild dieser Kraft. In der Musik Bachs spürte also Goethe, der doch oft genug selber die Zustände des Schöpfer-Seins wie die der Gestaltung eines schöpferisch Erschauten empfunden hatte, jene sonst in keiner Kunst ausdrückbare Empfindung, fühlte er die Idee selber gegenüber den Abbildern einer Idee, welch letztere sonst die Kunst nur zu geben vermag.
Was so den alten Goethe leicht einen Weg finden ließ zum Tiefsten Bachs, das in seiner Zeit sonst kaum erfasst wurde, führte ihn dazu, Beethovens Musik nicht anzunehmen.
Beethoven ist der Begründer jener Musik, die eigentlich auch dann nicht mehr für sich allein steht, wenn sie ohne die Verbindung mit anderen Künsten vor uns tritt. Er selber hat mit den Worten »Dichten in Tönen« seine schöpferische Tätigkeit bezeichnet und schon in diesem Ausdruck eine bestimmte Art, man könnte sagen eine bestimmte Tendenz der Benutzung des Tonmaterials angedeutet. Denken wir an Goethes Erklärung der genialen Produktivität, so erkennen wir, dass bei Beethoven dieses innerliche Schöpfen vor dem Gestalten nicht rein musikalisch, sondern mit Entwickelungsvorstellungen oder Gedankenanschauungen verknüpft erscheint, die aus dem Gebiet der Dichtung, der Philosophie oder auch aus einem in der Natur liegenden Bilde geschöpft sind. In Beethoven liegen die Keime der Programmmusik und der sinfonischen Dichtung. Was seine Überlegenheit über alle Nachfolger ausmacht, ist die ungeheure musikalische Kraft seiner Natur, mit der es ihm gelang, die vielfach aus dem Vorstellungskreise der Dichtung oder der Anschauung heraus erschaffene Idee ganz in Musik aufzulösen. Es ist deshalb ganz kurzsichtig, wenn man Beethoven, wie es vielfach geschieht, zu den absoluten Musikern rechnet; er ist nie und nirgendwo ein solcher. Dennoch steht er als Gipfel völlig getrennt von Richard Wagner, weil das, was bei Beethoven Dichten ist, noch vor jeder Gestaltung der schöpferischen Idee liegt. Dieses Dichten beeinflusst nur die Art der schöpferischen Vorstellung. Es erzeugt für nachher die Vorführung des Nacheinanders eines bestimmten seelischen Erlebens, während die absolute Musik seelische Zustände im Allgemeinen ausgesprochen hat. Richard Wagner hat als erster diese Stellung der Beethoven'schen Sinfonie gegenüber der älteren betont und hervorgehoben, dass bei Beethoven an die Stelle des Gegensatzes verschiedener seelischer Zustände die Entwickelung von einem zum anderen getreten ist. Diesen musikalischen Entwickelungsgängen aller Sonaten und Sinfonien Beethovens liegt die Vorstellung eines bestimmten seelischen Erlebens zugrunde, und diese Vorstellungsart ist in ihrem Wesen dichterisch. Darauf kommt es an. Dadurch, dass Beethoven für diese dichterischen Gedanken eine musikalische Ausspracheform wählt, dadurch, dass diese musikalische Ausspracheform von so hinreißender Kraft, von so urmusikalischer Naturgewalt ist, erreicht er den Sieg des Musikalischen über das Dichterische, während bei sämtlichen Vertretern der sinfonischen Dichtung das Musikalische im günstigsten Falle zur Vollbringung des dichterischen Wollens ausreicht. So kann man wohl dahin kommen, dass man in Beethovens Musik bloß die höhere Bestimmtheit des Ausdrucks und damit die stärkere Gewalt dieses Ausdrucks sieht und dabei vergisst, dass diese gewaltige Ausdruckskraft immerhin einer Einengung des rein und nur Musikalischen zu danken ist.
Da diese Weltanschauung der Beethoven'schen Musik der seelischen Veranlagung der neuesten Zeit entspricht, bewirkt, dass Beethovens Musik uns heute näher steht, uns tiefer packt als jede andere. Dass aber die urmusikalische Kraft eines Bach an sich stärker ist, dass vor allem die rein musikalischen Wirkungen Mozarts auf unendlich größere und weitere Schichten der Welt sich erstrecken können, scheint mir unzweifelhaft festzustehen.
Für mein Empfinden ist Mozart noch viel reiner musikalisch als Bach. Man sollte bei Bach nicht immer gleich an die Fugen denken. Wenn wir das Riesenwerk der Bach'schen Kantaten ansehen, erkennen wir am deutlichsten, wie diese Kunst aus dem Erleben aller Qualen, aller schweren Probleme der Zeit, ja der Menschheit überhaupt hervorgewachsen ist. Gewiss ist von allen Musikern in Beethoven am meisten und deutlichsten das Promethidenhafte, das Titanische, das Heldenhafte ausgeprägt; das Faustische, das an sich ja viel weniger Heldentum ist, das mehr die Versenkung in die Tiefe als die Erstürmung der Höhe bedeutet, lebt wohl noch gewaltiger in Bach, und es ist nur die Tatsache, dass in seinem Jahrhundert alles Denken sich innerhalb der äußeren Grenzen der dogmatischen Glaubensvorstellungen und eines kirchlich religiösen Empfindens bewegte, was uns diese faustische Art Bachs so leicht verkennen lässt. In Mozart fehlt alles dieses Titanische, Faustische und Promethidenhafte. Seine Schöpferkraft ist von göttlicher Art, ist Wonne des Schaffens. Die Qualen des menschlichen Ringens, der Krampf des Hervorbringens fehlt. Und das ist ja der Unterschied zwischen göttlichem und prometheischem Schaffen, dass dieses aus dem Gegensatz zu jenem die Befruchtung erhält und darum Kampf ist, dass dagegen jenes voll der göttlichen Heiterkeit ist, die da sagt: Ich will, dass es werde, und nachher sieht, dass das Gewordene gut ist, wie es das Gewollte war.
Gerade Goethe fühlte bei Mozart diese blühende, sonnige Schöpferkraft. Bei jeder Gelegenheit, wo er auf das Genie zu sprechen kommt, sei es nun, dass er dessen gewaltige Wirkungen preist oder das wunderbare Unbegreifliche im Schöpfungsprozesse betont, nennt er Mozarts Namen als leuchtendes Beispiel. Ihm erschien Mozart gewissermaßen als ein Gefäß, in dem die göttlichen Schöpferkräfte der Musik schalteten; als eine Kraft, deren sie sich mit überirdischer Gewalt zur Aussprache bedienten. Gerade im Hinblick auf Mozart verwarf er das Wort komponieren. »Wie kann man sagen, Mozart habe seinen ›Don Juan‹ komponiert. Komponieren – als ob es ein Stück Kuchen oder Biskuit wäre, das man aus Eiern, Mehl und Zucker zusammenrührt. Eine geistige Schöpfung ist es, das einzelne wie das Ganze, aus einem Geist und Guss und von dem Hauch eines Lebens durchdrungen, wobei der Produzierende keineswegs versuchte und stückelte und nach Willkür verfuhr, sondern wobei der dämonische Geist seines Genies ihn in der Gewalt hatte, so dass er ausführen musste, was jener gebot.«
Es gibt wohl keinen zweiten Künstler, bei dem sich das Genie als schöpferische Kraft in solchem Maße offenbarte wie bei Mozart. Musizieren, und das ist ihm Komponieren, oder um dieses von Goethe so scharf verpönte Wort zu vermeiden, in Tönen gestalten, erscheint bei ihm als Lebenselement, als Lebensnotwendigkeit wie irgendein körperliches Bedürfnis. »Sie wissen,« schreibt er seinem Vater, »dass ich sozusagen in der Musik stecke, dass ich den ganzen Tag damit umgehe, dass ich gern spekuliere, studiere, überlege.« Die Wunderkindschaft Mozarts ist das eigenartigste und überzeugendste Beispiel für jene Anschauung, die das Unbewusste im künstlerischen Schaffen betont, die im Künstler schließlich nur das Werkzeug einer unbegreiflichen höheren Gewalt erkennen möchte. Wir werden im Verlaufe unserer Biographie aus allen Lebenszeiten Mozarts über ganz wunderbare Erscheinungen seiner Art zu schaffen zu berichten haben.
Von der Schärfe der kindlichen Beobachtungsgabe, der außerordentlichen Fähigkeit der kindlichen Sinne, das Charakteristische in den Erscheinungen der Umwelt aufzunehmen und in erstaunlich charakteristischer Weise, wenn auch noch so unbeholfen, festzulegen, sind wir heute durch die reicheren Beobachtungen des Verhältnisses der Kindheit zur Kunst alle unterrichtet. Bei Mozart hat man das Gefühl, als sei diese ganze sinnliche Aufnahme der Erscheinungswelt musikalisch, als setze sich alles gleich in Töne um. Wie er als Drei- und Vierjähriger gewisse Geräusche, falsche Töne oder z. B. auch die schrillen Trompetentöne als etwas Schmerzhaftes empfindet, wird ihm auch jegliches Erlebnis zum Tonbild, das das Kind in merkwürdigen Noten aufzeichnet, wie andere Kinder in Strichen ihre Gesichtsbilder festlegen. Ebenso merkwürdig ist bei einer Kunst, in der das handwerkliche Wissen und Können eine so wichtige Stellung einnimmt wie in der Musik, die Leichtigkeit, man könnte fast sagen die unbewusste Art, wie er sich das Technische zu eigen macht als eine selbstverständliche Ergänzung des inneren Lebens, als dessen einziges Mitteilungsmittel. So war er mit fünf Jahren ein fertiger Klavierspieler; wie er aber die Geige lernte, weiß man überhaupt nicht. Eines schönen Tages spielte er eben in einem Trio die zweite Geige fehlerlos mit, ohne jemals irgendwelchen Unterricht auf diesem Instrument erhalten zu haben. Man mag einfach sagen, dass er den Vater, der ein trefflicher Geiger war, kopierte, wie andere Kinder ja auch irgendwelche Fähigkeiten der Eltern in ihrer Weise oft verblüffend nachmachen. Die Art, wie das Kind Mozart komponiert, wirkt so, dass man darin seine natürliche Sprechweise erkennt. Das außerordentlich starke Empfinden des Knaben, für den die Versicherung der Liebe und Freude an ihm seitens aller in seiner Umgebung Lebensbedürfnis war, einigt sich sehr schön mit der Fähigkeit und dem Bedürfnis, sein eigenes Empfinden in Tönen wiederzugeben. Auf diese Weise erklärt es sich auch, dass sein Herumreisen als Wunderkind ohne schädlichen Einfluss auf seinen Charakter blieb, erklärt es sich, dass das Künstlertum ihm durch die Verhätschelung, die er als Knabe erfuhr, ebenso wenig beeinflusst wurde wie später durch die Verkennung. Und bei dem kaum den Kinderschuhen Entwachsenen setzt sich die Erkenntnis, Komponist, schöpferischer Künstler zu sein, in einer so ausgeprägten Weise fest, dass ihm die Huldigungen, die die Welt seinem Spiel darbringt, ebenso als Störungen und Beeinträchtigungen seiner innersten Art erscheinen, wie etwa die Notwendigkeit, Stunden zu geben. In seinen Briefen kehren immer die Stellen wieder, in denen sich diese Lebensnotwendigkeit des in Tönen Gestaltens offenbart. Man kann sie alle in jene Worte zusammenfassen, die er einem Knaben, der ihn fragte, wie er komponieren lernen könne, antwortete: »Wenn man den Geist dazu hat, so drückt's und quält's einen: man muss es machen, und man macht's auch und fragt nicht darum.«
Mozarts Briefe und die zahlreichen beglaubigten kleinen Züge seines Lebens bieten eine Fülle von Stoff zur Beurteilung und Kenntnis seines Wesens und damit jener Art des schöpferischen Genies, die der naivsten Auffassung des Wesens des Genies entgegenkommt, bei dem man allem Werden und Tun des Betreffenden gegenüber das Gefühl hat: das muss so sein, das musste so kommen, das ist also auf diese Weise richtig. Eine Erklärung solcher Erscheinungen verlangt man dann gar nicht; weil sie da sind, sind sie notwendig gewesen. Es ist wie mit dem Wunder, das man glauben muss, das man nie erklären kann. Und es ist das Merkwürdige, dass man bei Mozart, ähnlich wie auch bei Raffael, gar nicht nach einer Erklärung verlangt. Wir fühlen diesen Künstlernaturen gegenüber fast nie etwas vom Werden, sondern nur vom Sein. Natürlich haben auch sie sich entwickelt, aber das ist ein so natürliches Wachsen wie das körperliche Zunehmen des Menschen. Es fehlt eben jene sichtbare Entwickelung, zu der schwere oder große Lebenserfahrungen, zu der die Auseinandersetzung mit bedeutenden Kunsterscheinungen oder Kunstpersönlichkeiten veranlasst. Diese Künstler wachsen, wie der Baum an geschützter Stelle frei in der Natur wächst, sich ausbreitet, Früchte trägt und – zugrunde geht. Es muss so sein. Man hat eigentlich bei Mozart nicht das Gefühl der Trauer, dass sein Leben so früh zu Ende ging. Das beweist, dass unser Erkennen des Wesens der künstlerischen Persönlichkeit Mozarts in ihr nichts finden kann, was der Künstler nicht bereits gegeben hat. Es offenbart sich darin die absolute Vollkommenheit dessen, was er gegeben hat. Wir können auch gar nicht sagen, wie nun der weitere Weg Mozarts wohl ausgesehen haben würde, wie sein Schaffen geworden wäre; kaum, dass man sich einmal vorstellen mag, wie wohl die spätere Entwicklung Beethovens auf den ja doch nur vierzehn Jahre älteren Mozart gewirkt haben würde. Wir müssen uns auch da wieder mit Goethe zufriedengeben: »Der Mensch muss wieder ruiniert werden. Jeder außerordentliche Mensch hat eine gewisse Sendung, die er zu vollbringen berufen ist. Hat er sie vollbracht, so ist er auf Erden in dieser Gestalt nicht weiter vonnöten, und die Vorsehung verwendet ihn wieder zu etwas anderem. Da aber hienieden alles auf natürlichem Wege geschieht, so stellen ihm die Dämonen ein Bein nach dem anderen, bis er zuletzt unterliegt. So ging es Napoleon und vielen anderen; Mozart starb in seinem sechsunddreißigsten Jahre, Raffael im gleichen Alter, Byron nur um weniges älter. Alle aber hatten ihre Mission auf das vollkommenste erfüllt, und es war wohl Zeit, dass sie gingen, damit auch anderen Leuten in dieser auf eine lange Dauer berechneten Welt etwas zu tun übrig bliebe.«
Für die Beurteilung des künstlerischen Genies ist es sehr fruchtbar, zu sehen, wie bei Mozart dem ausgesprochen dämonisch genialen Schaffen ein hervorragender Kunstverstand sich eint. Man kann das nicht scharf genug betonen, da sogar Richard Wagner urteilen konnte, Mozart habe »in ganz unreflektiertem Verfahren, in ungetrübtester Naivität« geschaffen. Dabei zollte Wagner der genialen Musikernatur Mozarts höchste Bewunderung. Nur, wie so oft bei Wagner, empfindet man auch hier, dass der gewaltige Theoretiker und Kritiker, der er war, für seine meist tiefdringenden Urteile über Musiker nicht genug die geschichtlichen Vorbedingungen der einzelnen Erscheinungen in Anschlag brachte, vor allem dann nicht, wenn es sich um das Verhältnis des Musikers zur Dichtung handelte. Wie gering gerade für uns Deutsche, bei denen das Wiedererwachen des gesamten seelischen Lebens viel früher in der Musik vorging als in der Dichtung, die schöpferischen Anregungen der letzteren für den auf anderem Gebiete tätigen Künstler in der Zeit vor Goethe sein müssten, wird allzu oft von unserer Kunstgeschichtsforschung übersehen, da wir selber so sehr gewohnt find, die Entwickelung des geistigen Lebens des Volkes hauptsächlich nach der Literatur zu beurteilen. Es kommt gerade bei Wagner hinzu, dass bei ihm die urschöpferische Tätigkeit durchaus auf jener Linie des Dichtens sich bewegte, die wir oben für Beethoven näher gekennzeichnet haben. So urteilt Wagner von Mozart in »Oper und Drama«: »Von Mozart ist mit Bezug auf seine Laufbahn als Opernkomponist nichts charakteristischer als die unbesorgte Wahllosigkeit, mit der er sich an seine Arbeiten machte: ihm fiel es so wenig ein, über den der Oper zugrunde liegenden ästhetischen Skrupel nachzudenken, dass er vielmehr mit größter Unbefangenheit an die Komposition jedes ihm aufgegebenen Operntextes sich machte, sogar unbekümmert darum, ob dieser Text für ihn, als reinen Musiker, dankbar sei oder nicht. Nehmen wir alle seine hier und da aufbewahrten ästhetischen Bemerkungen und Aussprüche zusammen, so versteigt alle seine Reflexion gewiss sich nicht höher als seine berühmte Definition von seiner Nase.« Wir werden dagegen gerade bei der Betrachtung von Mozarts dramatischem Schaffen sehen, wie »reflektiert sein Verfahren« gegenüber allen jenen Dingen war, bei denen die Reflexion etwas zu tun hat.
Das letzte Wort Wagners zielt auf jenen als Ganzes sicher unechten Brief vom Jahre 1789, in dem ausführlich über Mozarts Art zu komponieren gesprochen ist. Da der Brief innerlich wahr ist und gewissermaßen das von der äußeren Beobachtung her Erkennbare in Mozarts Schaffensweise zusammenfasst, sei die wichtigste Stelle auch hier wiedergegeben:
»Wenn ich recht für mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen im Wagen oder nach guter Mahlzeit beim Spazieren und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, da kommen mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich im Kopf und summe sie wohl auch für mich hin, wie mir andere wenigstens gesagt haben. Halt' ich das nun fest, so kommt mir bald eins nach dem andern bei, wozu so ein Brocken zu gebrauchen wäre, um eine Pastete daraus zu machen, nach Kontrapunkt, nach Klang der verschiedenen Instrumente usw. usw. Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; da wird es immer größer, und ich breite es immer weiter und heller aus, und das Ding wird im Kopf wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, so dass ich's hernach mit einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Menschen, im Geist übersehe und es auch gar nicht nacheinander, wie es hernach kommen muss, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das ist nun ein Schmaus! Alles das Finden und Machen geht in mir nun nur wie in einem schönen, starken Traum vor. Aber das Überhören, so alles zusammen, ist doch das Beste. Was nun so geworden ist, das vergesse ich nicht gleich wieder, und das ist vielleicht die beste Gabe, die mir unser Herrgott geschenkt hat. Wenn ich hernach einmal zum Schreiben komme, so nehme ich aus dem Sack meines Gehirns, was vorher, wie gesagt, hineingesammelt ist. Darum kommt es hernach auch ziemlich schnell aufs Papier; denn es ist, wie gesagt, eigentlich schon fertig und wird auch selten viel anders, als es vorher im Kopf gewesen ist. Darum kann ich mich auch beim Schreiben stören lassen, und mag um mich herum mancherlei vorgehen, ich schreibe doch, kann auch dabei plaudern, nämlich von Hühnern und Gänsen und von Gretel und Bärbel und dergleichen. Wie nun aber über dem Arbeiten meine Sachen überhaupt eben die Gestalt oder Manier annehmen, dass sie Mozartisch sind und nicht in der Manier eines anderen, das wird halt ebenso zugehen, wie dass meine Nase ebenso groß und heraufgebogen, dass sie Mozartisch und nicht wie bei anderen Leuten geworden ist. Denn ich lege es nicht auf die Besonderheit an, wüsste die meine auch nicht einmal näher zu beschreiben; es ist ja aber wohl bloß natürlich, dass die Leute, die wirklich ein Aussehen haben, auch verschieden voneinander aussehen, wie von außen, so von innen. Wenigstens weiß ich, dass ich mir das eine so wenig als das andere gegeben habe.«
Dagegen steht jenes Geständnis, das Mozart bei der Einstudierung des »Don Juan« in Prag dem Kapellmeister Kucharcz gegenüber äußerte: »Überhaupt irrt man, wenn man denkt, dass mir meine Kunst so leicht geworden ist. Ich versichere Sie, lieber Freund, niemand hat so viel Mühe auf das Studium der Komposition verwendet als ich; es gibt nicht leicht einen berühmten Meister in der Musik, den ich nicht fleißig und oft mehrmals durchstudiert hätte.«
Den scheinbaren Widerspruch hilft uns wieder Goethe lösen, der von der Produktivität höchster Art, die der Mensch als unverhofftes Geschenk von oben zu betrachten habe, das da übermächtig mit ihm tut, wie es ihm beliebt, und dem er sich bewusstlos hingibt, eine Produktion anderer Art unterscheidet, die irdischen Einflüssen unterworfen ist, und die der Mensch mehr in seiner Gewalt hat. »In diese Region zähle ich alles zur Ausführung eines Planes Gehörige, alle Mittelglieder einer Gedankenkette, deren Endpunkte bereits leuchtend dastehen; ich zähle dahin alles dasjenige, was den sichtbaren Leib und Körper eines Kunstwerkes ausmacht.« Bei der Ausgestaltung der genial erfassten Idee tritt der Kunstverstand als wichtigste Kraft auf. Die Bedeutung dieser zweiten, von Goethe mit vollem Recht noch in den Bereich des Genialen hineingezogenen Tätigkeit ist so groß, dass vielfach der Kunstbeurteiler in dieser Kraft der Ausführung das Ausschlaggebende sieht. Fast die ganze französische Art des Kunsturteils bewegt sich in diesem Kreise, wobei wir freilich hinzufügen müssen, dass in der Geschichte der romanischen Künste die Erscheinungen, dass diese zweite Art der Produktivität nicht auf der Höhe der ersten steht, sehr selten sind. Wohl aber ist es eine charakteristische Erscheinung der germanischen Kunstgeschichte, dass die Gestaltung eines künstlerisch genialen Gedankens weit hinter dessen ursprünglicher Erfassung zurückbleibt. Wir berühren hier vielleicht das tiefste Problem germanischer Kunstauffassung und damit den entscheidenden Punkt im germanischen Kunstschaffen, für das die Schwierigkeit immer darin liegt, dass die Konzeption so ungeheuer stark ist, dass die Formgebung für jeden einzelnen Fall als neues Problem dasteht. Wir haben nun gerade bei Mozart so stark das Gefühl, dass die Form sich mit dem Inhalt deckt – alles natürlich rein musikalisch verstanden –, dass wir schon daraus auf eine hohe Bildung seines Kunstverstandes schließen können. Während er sonst, wie seine Schwester sagte, zeitlebens in allem ein Kind blieb, war er in allen musikalischen Dingen von einer erstaunlichen Frühreife, auch hinsichtlich des verstandesmäßigen Urteils. Die schroffe Entschiedenheit dieses künstlerischen Urteils wirkt gerade bei seinem so liebevollen Charakter, welcher in allen anderen Dingen das Lobenswerte heraussuchte, doppelt charakteristisch.
Es ist für Mozart charakteristisch, dass wir fast nichts von dieser Arbeit der Produktion merken, in der das innerlich erschaute Werk seine Gestaltung für die Mitteilung an die äußere Welt erfährt. Diese ganze Arbeit wird in einer sonst unerhörten Weise innen vollzogen. Wir haben von Mozart fast keine Skizzen, und die vorhandenen wirken mehr als Notierung wertvoller Einfälle denn als Vorbereitungsarbeiten oder Vorstadien eines bestimmten Kunstwerkes.
Die Gestaltung ist in der Musik, technisch betrachtet, das Aufzeichnen in Noten, also etwas der Schreibarbeit ähnliches. Immerhin wäre es falsch, diese Notenschreibarbeit etwa der Niederschrift eines innerlich fertiggemachten Gedichtes zu vergleichen. Die formale Arbeitsleistung ist in der Musik eine unendlich verwickeltere. Eine Orchesterpartitur mit ihrer Verteilung der Melodieführung und der Tonfarben an die verschiedenen Instrumente kann man viel eher einer Radierung mit ihrer Verteilung von Hell und Dunkel vergleichen als einer Wortniederschrift. Der Dichter arbeitet in den Worten mit festgeprägten Begriffen, für den Musiker dagegen ist ein einzelnes, noch so inhaltreiches Motiv für die letzte Umarbeitung noch schier ein Nichts, nicht mehr als der Gedanke, der erst der Formulierung bedarf. Also wenn bei Dichter und Musiker die Mitteilungsform an die Außenwelt in der Arbeit scheinbar dieselbe ist, so ist die Gestaltung beim Musiker doch ein viel verwickelterer Prozess. Man mag es sich so vorstellen, wie wenn ein Maler ohne vorangegangene Zeichnung, ohne Untermalung oder dergleichen ein großes Ölgemälde so schüfe, dass er in der einen Ecke anfinge, überall gleich den endgültigen Farbenton hinsetzte und so das ganze Bild glatt hinmalte, wie es vor seinem inneren Auge steht. Ein solcher Gedanke wirkt geradezu unsinnig; aber Mozart hat derartiges geleistet. Die Entstehungsgeschichte der Ouvertüre zum »Don Juan« – sie wurde in körperlicher Erschöpfung in der Nacht vor der Aufführung geschrieben – ist ein solches Wunder. Ein anderes Mal hat er ein Orchesterwerk, den ergötzlichen musikalischen Spaß einer »Bauernsinfonie« gleich in Stimmen hingeschrieben, was im Grunde noch erstaunlicher ist als der oben angeführte Fall, weil das nicht nur ein völlig genaues Klangbild voraussetzt, sondern auch ein schier unbegreifliches Gedächtnis, das genau weiß, wo und wie lange die einzelnen Instrumente zu pausieren haben, wo sie, rein zeitlich genommen, wieder mit den anderen zusammentreffen und dergleichen. Wieder eine andere Variante zeigt der Fall mit der Geigerin Strinasacchi, der er eine Violinsonate für ein gemeinsames Konzert versprochen hatte. Am Abend vorher war noch nichts fertig. Sie bittet, beschwört ihn so lange, bis er ihr schließlich die Violinen-Stimme schreibt. Sie übt noch schnell ihren Part ein, und beim Konzert ernten beide großen Beifall. Der Kaiser Joseph aber, der zugegen war, erkannte durch die Lorgnette, dass Mozart keine Noten vor sich hatte. Er bittet ihn deshalb zu sich und verlangt die Sonate. Da stellt sich heraus, dass außer der Violinen-Stimme nichts aufgeschrieben ist, Mozart also im Augenblick den Klavierpart zu der Violinen-Stimme erfunden hatte. Mozart besaß also die Fähigkeit, innerlich etwas ganz fertig zu machen, so dass er nachher gewissermaßen die dem Gehirn als fertiges Bild vorschwebende Partitur einfach mit den Händen abschrieb. Das war dann so mechanische Arbeit, dass er keiner musikalischen Beihilfe – etwa des Klaviers – dazu brauchte, dass ihn leichtes Geplauder eher anregte als störte, dass er, wie seine Frau sich äußert, »Noten schrieb wie Briefe«. Vom wunderbarsten Beispiel aber gibt zweifellos folgender Brief (30. April 1782) an die Schwester Kunde: »Hier schicke ich Dir ein Präludio und eine dreistimmige Fuge. Das ist eben die Ursache, warum ich Dir nicht gleich geantwortet, weil ich – wegen des mühsamen kleinen Notenschreibens nicht habe eher fertig werden können. – Es ist ungeschickt geschrieben, – das Präludio gehört vorher, dann folgt die Fuge darauf. – Die Ursache aber war, weil ich die Fuge schon gemacht hatte und sie unterdessen, dass ich das Präludium ausdachte, abgeschrieben.« Also während er eine so schwierige, höchste Aufmerksamkeit erheischende Abschrift fertigstellte, war Mozart zur »innerlichen« Produktion eines neuen Werkes imstande.
Erst so verstehen wir nun recht, was Mozart darunter verstand, dass er »ganz in der Musik steckte«. Das war höchste Arbeitsleistung, die durch eine ungeheuer gesteigerte Fähigkeit innerlicher Konzentration ermöglicht war. Diese wird uns denn auch von allen Seiten bezeugt. Das heißt indirekt durch die Berichte von Zeitgenossen. Der Friseur hatte große Not mit ihm, denn alle Augenblicke sprang er auf und lief zum Klavier, und der Figaro musste ihm mit dem Zopfband überallhin folgen. Beim Kegeln und Billardspielen summte er vor sich hin, taktierte mit dem Kopf und warf Noten auf irgendein hervorgezogenes Stück Papier. Teile des »Don Juan« und der »Zauberflöte« sind so entstanden. Beim Reiten wurde ihm das Komponieren fast gefährlich, denn das Pferd ging mit dem versonnenen Meister durch. Schuf er ein großes Werk, so war er zu Possen und Späßen besonders geneigt, in denen er ein Gegengewicht gegen die geistig tief erregenden Momente des Gestaltens fand. »Er war immer guter Laune, aber selbst in der besten sehr nachdenkend, einem dabei scharf ins Auge blickend, auf alles, es mochte heiter oder traurig sein, überlegt antwortend, und doch schien er dabei an etwas ganz anderem tief denkend zu arbeiten. Selbst wenn er sich in der Früh die Hände wusch, ging er dabei im Zimmer auf und ab, blieb nie ruhig stehen, schlug dabei eine Ferse an die andere und war immer nachdenkend. Bei Tisch nahm er oft eine Ecke der Serviette, drehte sie fest zusammen, fuhr sich damit unter der Nase herum und schien in seinem Nachdenken öfters nichts davon zu wissen, und öfters machte er dabei noch eine Grimasse mit dem Munde. – Auch sonst war er immer in Bewegung mit Händen und Füßen, spielte immer mit etwas, z. B. mit seinem Chapeau, Taschen, Uhrband, Tischen, Stühlen gleichsam Klavier.«
Ebenso bezeichnend ist die Mitteilung, die Mozarts Schwager, Jos. Lange, in seiner Selbstbiographie (S. 181) macht: »Nie war Mozart weniger in seinen Gesprächen und Handlungen für einen großen Mann zu erkennen, als wenn er gerade mit einem wichtigen Werk beschäftigt war. Dann sprach er nicht nur verwirrt durcheinander, sondern machte mitunter Späße einer Art, die man an ihm nicht gewohnt war; ja, er vernachlässigte sich sogar absichtlich in seinem Betragen. Dabei schien er doch über nichts zu brüten und zu denken. Entweder verbarg er vorsätzlich aus nicht zu enthüllenden Ursachen seine innere Anstrengung unter äußerer Frivolität; oder er gefiel sich darin, die göttlichen Ideen seiner Musik mit den Einfällen platter Alltäglichkeit in scharfen Kontrast zu bringen und durch eine Art von Selbstironie zu ergötzen.« An Selbstironie ist dabei natürlich nicht zu denken; eher an eine Art Notwehr, in der sich der dem Alltäglichen dienstpflichtige materielle Mensch gegen die Übermacht des Geistes verteidigt. Oder auch an das Schamgefühl des fein und zart empfindenden Künstlers, der vor der Umwelt die Wunder zu verheimlichen strebt, die in ihm sich vollziehen.
Natürlich, wer nun bloß dieses Äußere sah, musste denken, das sei überhaupt keine Arbeit. Selbst der Vater erkannte in dieser Hinsicht die Art seines Sohnes nicht. Auch er schätzte nur das als Arbeit, was er sah, und bedachte nicht, dass wenn sein Sohn sich zur Niederschrift hinsetzte, eigentlich bereits alles gearbeitet war, trotzdem ihm dieser das oft genug sagte; so z. B. einmal von München aus, als er dort am »Idomeneo« arbeitete, wo er ihm schrieb: »Komponiert ist schon alles, aber geschrieben noch nicht.« Dabei ist es so leicht erklärlich, dass Mozart vor der Niederschrift zurückschreckte; sie war ja für ihn eigentlich gleich einer rein handwerksmäßigen Arbeit, im Grunde mechanische Abschrift eines innerlich Fertigen. Nun mag es ja sein, dass bei diesem »Auf-die-lange-Bank hinausschieben«, wie es der Vater nannte, gelegentlich etwas nicht fertig geworden ist. Aber angesichts der riesigen Zahl der Mozart'schen Werke müssen wir schon rein äußerlich von einem ganz gewaltigen Fleiß sprechen. Nicht bei allen ähnlich veranlagten Genies können wir das gleiche sagen. Lionardo da Vinci z. B., zweifellos eine der produktivsten Naturen, die es je gegeben hat, ist nur selten zur vollendeten Gestaltung seiner genial erschauten und innerlich fertig gestalteten Werke gelangt. Während der Arbeit an der Gestaltung des Äußeren nahm ihn die innere Produktion eines Neuen bereits derartig in Anspruch, dass er nicht nur die Lust, sondern auch die Spannkraft zur äußeren Vollendung der älteren Werke verlor. In herrlicher Weise hat der Russe Mereschkowski in seinem Roman »Lionardo da Vinci« den Wegen dieser eigenartigen Genialität nachgespürt.
Dass Mozart dieser Gefahr so völlig entronnen ist, hat seinen tiefsten Grund wohl darin, dass für ihn das Formale keine Probleme ergab. Das elementar Musikalische, von jeglicher außermusikalischen Beimischung Freie seiner Empfindungsweise bewirkt, dass bei Mozart ein Widerstreit zwischen Form und Inhalt nicht möglich ist. Hier liegt auch die Erklärung dafür, dass seine Werke von so vollkommener Stileinheit sind. Dieser Mozart'sche Stil ist der entzückendste Ausdruck seiner Persönlichkeit. Nichts ist ihm zu vergleichen. Wir wollen sein Wesen zu ergründen versuchen.
Der 22jährige Mozart hat auf der Reise nach Paris an den Vater geschrieben, er würde sich sehr freuen, wenn er in Paris den Auftrag zur Komposition einer Oper erhalten würde, und so viel lieber ihm eine italienische Oper wäre, so würde er sich doch auch kecklich eine französische Oper übernehmen, »denn ich kann so ziemlich, wie sie wissen, aller Arten Stil von Kompositionen annehmen und nachahmen«. In der Tat, man wird von diesen Kompositionen aus den Wunderkinderjahren nicht ein ausgesprochen persönliches Gepräge erwarten. Das ist sogar das Gute dabei; denn so frühreif das Kind Mozart war, so große psychologische Rätsel seine Entwicklung aufgibt, psychopathisch, krankhaft wirken die Erscheinungen nirgends. Und so ist denn auch Mozarts frühe Kompositionstätigkeit im letzten Sinne die durchaus kindliche Eigenschaft der Nachahmungsfähigkeit, freilich in einer sonst kaum wieder anzutreffenden Höhe.
Die Fähigkeit, alle Arten Stil anzunehmen, ward bei ihm zum Stilgefühl insofern dadurch, dass doch alle diese Stilarten durch ihn hindurchgehen müssten, sich bei ihm ganz natürlich die Empfindung einstellte, dass der und der Stil besser für diese Gelegenheit passe, als für eine andere. So offenbart sich schon in den Kompositionen, die der Zwölfjährige für Wien schuf, ein bewusstes, scharfes Auseinanderhalten im Stil der Kompositionen für die Kirche und für die Oper.
Im Hinblick auf Mozart hat Richard Wagner den Satz geschrieben: »Der deutsche Genius scheint fast bestimmt zu sein, das, was seinem Mutterlande nicht eingeboren ist, bei seinen Nachbarn aufzusuchen, dies aber aus seinen engen Grenzen zu erheben und somit etwas Allgemeines für die ganze Welt zu schaffen.« Diese Universalität – nicht Internationalität – des Geistes haben vor allem deutsche Musiker angestrebt. Aber Mozart hat nicht nur »diese Universalität des deutschen Geistes in der höchsten Potenz vollbracht und die ausländische Kunst sich zu eigen gemacht, um sie zur allgemeinen zu erheben« (Wagner), – er hat das viel Höhere erreicht, dass die Weltsprache der Musik seine Persönlichkeitssprache wurde. Das haben wir nach meinem Gefühl seinem Herumreisen als Wunderkind zu danken, der Tatsache, dass er in so jungen Jahren die Stile der verschiedenen Völker sich zu Eigen machte. Denn auf Italien folgte Paris, wo er die ganze Art der französischen Musik wirklich erleben konnte, überdies in aller Lebendigkeit die Werke Glucks auf sich einwirken ließ. Gerade weil er selber noch ein Kind oder Knabe oder doch noch ein unfertiger Jüngling war, übernahm er diese verschiedenen Musikstile als Formen. Da ein eigenes Seelenleben, die Persönlichkeit in ihm noch nicht entwickelt war, da er jugendlich empfand, nahm er alle diese fremde Kunst als Außenerscheinung in sich auf, nicht aber den tieferen Gehalt derselben, vor allen Dingen nicht die Art des Fühlens, die eine solche Ausdrucksweise bedingt. Hochbegabte Musiker, wie Hasse und Naumann, waren völlig zu Italienern geworden; aus ihren Opernwerken kann niemand auf ein deutsches Empfinden schließen. Sie hatten mit der italienischen Opernform auch die italienische Seele in sich aufgenommen oder hatten doch wenigstens die Fähigkeit eingebüßt, ein deutsches persönliches Empfinden auszudrücken. Auch der Riese Händel ist in seinen Opern durchaus Italiener. Dagegen wird man selbst die italienischste Oper des späteren Mozart, »Cosi fan tutte«, niemals als italienische Musik empfinden. Man spürt ganz deutlich eine Persönlichkeit heraus, und diese Persönlichkeit ist kein Italiener.
Für Mozart – ich meine jetzt den späteren, fertigen Meister – wurde die Beherrschung der verschiedenen Stile niemals zu einer Nachahmung derselben, weil er sie niemals um ihrer Form willen anwandte, sondern weil sie ihm in dem betreffenden Augenblick als geeignet erschienen, sein Empfinden und seine Absichten in Musik auszudrücken.
Letzterdings entsteht doch das Gefühl, dass eine Ausdrucksform Stil sei, dadurch, dass sich diese Ausdrucksform mit einem Inhalt, einer Stimmung so deckt, dass sie nicht nur für den einzelnen Schöpfer, sondern für eine große Zahl von Menschen (in der Idealvorstellung für die Gesamtheit) als die gegebene, die einzig wirkliche Ausdrucksform des betreffenden Inhalts erscheint. Auch Richard Wagner mit seinem Sprachgesang hat z. B. die durchaus nicht den Sprachgesetzen angepasste, ja diesen eigentlich fortwährend widersprechende kontrapunktische Polyphonie des Palestrina-Stils als den durchaus entsprechenden katholischen Kirchenmusikstil empfunden und hat nicht die Bedenken dagegen erhoben, die er aus seinem persönlichen Stilgefühl der Verpflichtung der Musik der Sprache gegenüber hätte fühlen müssen. Er selbst hat aber trotzdem auch in den Abendmahlschören des »Parsifal« diesen Stil nicht zur Anwendung gebracht. Mozart würde es in einem gleichen Falle sicher getan haben. Ebenso ist in den »Meistersingern« die Annäherung an die ältere deutsche Kontrapunktik nur Kolorit, nicht eigentlicher Stil, was die akademischen Gegner Wagners oft dahin verkannten, als hätte Wagner nicht so recht im kontrapunktischen Stil schreiben können. In Wirklichkeit beruht aber der kontrapunktische Stil auf einem dem innersten Kunstprinzip Wagners durchaus entgegengesetzten Lebenselement, ist absolut musikalisch und immer mit einem schweren Zwang für die Sprache verbunden. So erkennen wir, dass bei Wagner auch den verschiedensten Vorlagen gegenüber im Grunde immer dasselbe Stilprinzip tätig ist, dass die musikalische Verschiedenheit nur in einer leichten Beimischung eines anderen Kolorits beruht, etwa so, wie ein Dichter, wenn er bei einem älteren Stoff die Sprache etwas altertümlich färbt, durchaus nicht seine persönliche Sprechweise aufzugeben braucht.
Bei Mozart ist dagegen der merkwürdige Fall eingetreten, dass er gewissermaßen mehrere Muttersprachen hat, mehrere Sprachen, in denen ihm Denken und Reden natürlich geworden ist. Aber auch diese liegen nun nicht nebeneinander getrennt, sondern bilden eine große Einheit, tatsächlich das Ideal einer Weltsprache. Es ist leicht erklärlich, dass nur die Musik, die völlig befreit ist von den trennenden Grenzen, die sonst die Sprachverschiedenheit aufrichtet – bei den bildenden Künsten entstehen Grenzen durch die wenn auch oft nur geistige Zweckbestimmung –, dass die Musik, die ihrem innersten Wesen nach Empfindungen und Gedanken als solche ausdrückt, also bevor sie eine Gestalt gewonnen haben, eine solche Welt- oder sagen wir besser allgemein menschliche Sprache abgeben kann. Soweit das Nationale in den Musikformen liegt, soweit es nicht auf der Tatsache beruht, dass die verschiedenen Völker ebenso gut wie die einzelnen Menschen verschiedene Persönlichkeiten sind, deren Art zu fühlen und zu empfinden unterschiedlich ist, soweit also die Musik formen irgend einen Nationalcharakter tragen, ist dieser bereits nicht mehr urmusikalisch, sondern äußere Gestaltung. Es ist doch sehr bezeichnend, dass dabei der Rhythmus, dessen Beziehungen zur Körperbewegung unverkennbar sind, also dass Tänze und Volkslieder diese Charakterisierungsmittel abgeben.
Es ist darum nur natürlich, dass, solange ein stärkeres, vergeistigtes Nationalgefühl fehlte, solange vor allen Dingen die Kunstmusik eigentlich nur für die Kirche herangezogen wurde, von irgendwelchen nationalen Stilen nicht die Rede war; die kontrapunktische Polyphonie ist überall dieselbe. Von der Zeit aber, wo die Musik mehr Seelensprache des einzelnen wird, bilden sich die Nationalmusiken heraus. Es hat immer Künstler gegeben, und es waren bezeichnenderweise fast immer Deutsche, die diese Stilabsonderung als einengend empfanden. Dieses Empfinden geht dann nach zwei Seiten; auf der einen ist es Verwischung der persönlichen Eigenart zugunsten einer allgemeinen Internationalität, ist Schwäche; auf der anderen ist es höchste Steigerung des Besten in der eigenen Kraft, genährt und vermehrt durch die Aufnahme des Verwandten oder doch innerlich Anpassungsfähigen in dem Besitzstande der Fremde, ist es Universalismus, höchste Stärke. Für die Musik vertritt Mozart diesen Universalismus in der vollendetsten Weise. Seine Musik ist überhaupt in der gesamten Kunst das wunderbarste Beispiel eines Menschheitsbesitzes.
Nochmals müssen wir, um das klar zu erfassen, einige Schritte zurückgehen und wieder an Goethes Wort anknüpfen, dass das wesentliche Künstlerische der Genialität darin beruht, dass man zur Produktion von Kunst fähig ist, dass also die schöpferische Idee, die die Seele zu erfassen vermochte, nach künstlerischer Aussprache drängt. Erst in zweiter Linie steht die Umsetzung der Idee in die Tatsache, also die Gestaltung jenes Schöpfergedankens. Freilich tritt vor uns Menschen ja nur diese sichtbare oder hörbare, diese körperlich, sinnlich wahrnehmbar gewordene Gestalt des Kunstwerks, und somit ist man vielfach dahin gekommen, das Künstlertum nach seiner Gestaltungskraft einzuschätzen. Immerhin wissen wir alle, dass sogar bei den verschiedenen Völkern da eine verschiedene Veranlagung hervortritt, dass z.B. die Romanen, die Franzosen voran, vorzügliche Gestalter, dass sie ausgezeichnete Formengeber des ihnen schöpferisch Aufgegangenen sind, dass dagegen die deutsche Kunst fast immer schwer um diese Formgebung zu ringen hat, dass nur in ganz vereinzelten Fällen in der deutschen Kunst die Formgebung auf derselben Höhe steht wie die innerliche schöpferische Kraft. Nur wer es wagen würde, die germanische Kunst darum geringer einzuschätzen als die romanische, dürfte sich zu jenem verbreiteten Grundsatze, dass die Gestaltung das Wesentlichste der Kunst ist, ohne weiteres bekennen. Immerhin, die eine Tatsache bleibt bestehen, dass die künstlerische Kraft nur dann in Kunstwerke ausgemünzt werden kann, wenn eine solche Gestaltungskraft vorhanden ist und diese in Tätigkeit umgesetzt wird.
Wenn nun auch jeder schöpferische Gedanke in jeglicher Kunst einen Ausdruck finden kann, je nach der Formgebung, die dem betreffenden produktiven Menschen zur Mitteilung zur Verfügung steht, so liegt es doch in den einfachen Gesetzen der Logik, dass für jeden schöpferischen Gedanken eine Art der Aussprache die vollkommenste, die idealste sein muss. Es liegt hier der innerste Grund dafür, dass die verschiedenen Künste nach ihrer Trennung immer wieder Vereinigungen angestrebt haben, aus dem Gefühl heraus, dass es im Grunde nur eine Kunst gibt und die verschiedenen Künste nur unterschiedliche Mitteilungsarten der einen gleichen Kraft sind. Wenn es trotzdem im Laufe der Entwicklung dahin gekommen ist, dass die einzelnen Künste sich so sehr als selbständige Wesenheiten fühlten, dass man viel lieber die Grenzen zwischen den verschiedenen Gebieten untersuchte als das Einigende, dass die Wiedervereinigung dieser Künste als etwas Neues wirkte und sich regelmäßig zum künstlerischen Problem auswuchs, so zeugt das nur dafür, dass jede einzelne dieser Künste ein so unendlich weites Gebiet darstellt, dass der Einzelmensch für alle seine Empfindungen darin sehr leicht Platz findet, dass er in der Regel sogar noch lange nicht zur völligen Ausfüllung derselben kommt. Aber das Vorhandensein von Männern wie Michelangelo, Lionardo da Vinci, Goethe, Richard Wagner zeugt ebenso für das stete Vorhandensein dieses großen Urkunstgefühls wie die Tatsache, dass einzelne Künste sich sehr leicht innig verbinden können, z. B. Malerei und Plastik, Musik und Lyrik in der ganz volkstümlichen Form des Liedes, Poesie und Mimik bei aller Darstellung, Musik und Mimik im Tanz.
Die Trennung hat sich aber nicht auf die verschiedenen Künste beschränkt, sondern innerhalb der einzelnen Künste weiter gewaltet. Hierbei könnte man ein Nebeneinander von einem Nacheinander unterscheiden. Das Nebeneinander wird dargestellt durch die verschiedenen Gattungen der betreffenden Kunst. Auch in der Wahl der Gattung offenbart sich das Formgefühl. Der Künstler erkennt, welche Art der Aussprache für seinen schöpferischen Gedanken die natürlichste ist, bei welcher am meisten die Form mit dem Inhalt sich deckt. Wir erleben gerade in der Musik heute immer und immer wieder, dass unseren Künstlern dieses Gefühl abgeht, indem sie z. B. für die einfachen, kleinen Formen des lyrischen Gedichts dieselben Ausdrucksmittel aufwenden wie für eine große Sinfonie. Zeitalter mit ausgeprägtem Formensinn haben sich in dieser Hinsicht niemals derartig vergriffen.
Außer diesem Nebeneinander gibt es ein Nacheinander. Das schildert uns die Geschichte der Stile, die in der Baukunst uns am augenfälligsten entgegentritt.
Stil ist, historisch genommen, eine Art der Formgebung, die zu einer gewissen Zeit derartig natürlich erschien, dass sie alles beherrschte und alles ergriff. Man hat im Zeitalter der Gotik keineswegs bloß Kirchen und das den Kirchen Zugehörige gotisch gestaltet, sondern alles, was gebaut wurde, in diesem Geiste gehalten. Ebenso nachher in der Renaissance. Es ist klar, dass eine solche Auffassung des Stils und damit die Herrschaft eines Stils sich nur in Zeitaltern entwickeln kann, in denen das gemeinsame Fühlen außerordentlich groß, in denen fast eine Einheitlichkeit des Kunstempfindens vorhanden ist. Denn zum Stil wird nur eine Form, die allen als die natürliche Aussprache eines künstlerischen Inhalts erscheint. Es ist darum ganz natürlich, dass, sobald in der Menschheit das Gefühl dieser großen Einheitlichkeit nachließ, sobald die Willkür des persönlichen Fühlens im Einzelgeschmack die Herrschaft an sich riss, Stile nicht mehr so leicht entstehen konnten; und wenn das doch geschah, das Gefühl sich einstellte, dass ein Stil nicht alles ausdrücken könne, dass er vielmehr für ganz bestimmte Sachen besonders geeignet sei. Wir stehen heute auf dem Standpunkt, dass der Stil nicht mehr der Ausdruck einer bestimmten Zeit, sondern die beste Ausdrucksweise für eine bestimmte Sache ist.
Dass von den Künstlern, zumal wieder auf dem hier sinnfälligsten Gebiete der Architektur, gegen diese Erkenntnis fortwährend gefehlt wird, ist allbekannt und oft bedauert. Es stehen sich hier zwei von der geschichtlichen Entwicklung her begreifliche Gefühlswelten gegenüber, von denen die eine, die ihren Antrieb mehr aus der geschichtlichen Betrachtung der Vergangenheit gewonnen hat, jene Einheitlichkeit alles Dargestellten zu erreichen sucht, die in vergangenen Zeitaltern von selbst zustande kam, die also alles in einem bestimmten Stil darstellte. Man denke z. B. an die romanische Anlage des Platzes um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, wo auch die Privathäuser, die Geschäftsräume, Wirtschaftsstuben, die Hallen des Zoologischen Gartens, die Laternenpfähle, ja, wenn es dazu käme, eine Bedürfnisanstalt im romanischen Stil errichtet sind. Das ist aber ein künstliches Zurückschrauben des Empfindens ins Historische, die gerade bei der Kunst unmöglich und unlebendig ist. Es liegt zweifellos daran, dass heute die Architektur die unproduktivste aller Kunst ist, wenn solche Fälle überhaupt noch möglich sind.
Die entgegengesetzte Richtung beruht auf dem Gefühl der Sachlichkeit, der inneren Wahrheit der Kunst, und sie verlangt, dass die Form aus dem Inhalt heraus gestaltet werde, dass also der Inhalt gesetzgeberisch wirkt. Der aus der Geschichte geschöpfte Einwand der ersten Richtung, dass in Zeitaltern, deren künstlerische Überlegenheit über unsere heutige alle willig anerkennen, die Einheitlichkeit der Form, die Alleinherrschaft eines Stils vorhanden gewesen sei, ist nicht stichhaltig. Gerade die Fähigkeit, historisch zu empfinden, vergangene Zeiten in ihren seelischen und damit Kunstäußerungen zu verstehen, bewirkt es, dass wir gewisse Stilformen als den Ausdruck eines ganz besonderen seelischen Empfindens fühlen, dass diese Formen damit für uns Ausdrucksmittel eines Seelischen geworden sind und nicht mehr gegebene Formen. Gerade auf dieser Herrschaft des Seelischen beruht es, dass wir keinen Stil mehr erhalten. Dieses Seelische ist individuell, persönlich, der Stil dagegen ist etwas allgemein als gültig Anerkanntes. Je stärker die Individualität sich ausgeprägt hat, je zahlreicher und stärker die Persönlichkeiten werden, umso weniger wird die große Masse den Ausdruck einer einzelnen Persönlichkeit so sehr als den eigenen empfinden, dass sie diesen Ausdruck als einen Stil anerkennt, das ist als die Form, in der sich ein Bestimmtes allein oder doch am besten ausdrücken lässt. Wir haben ja gerade in den letzten Jahren der ewigen Stilsucherei massenhaft Stile einzelner Künstler erhalten, d. h. ein einzelner Künstler fand für sich eine Form, in der er bestimmten Zwecken entsprechende Dinge naturgemäß ausdrücken zu können glaubte. Auch bei den gelungensten derartigen Versuchen ist es nur dahin gekommen, dass man das betreffende Werk als ein vorzügliches persönliches Kunstwerk anerkannte, nicht aber als den Stil, d. h. als die einzige oder doch die vollkommenste Ausdrucksform der betreffenden künstlerischen Aufgabe. Als einzige Ausnahme stände allenfalls Richard Wagners Musikdrama da, wobei wir aber doch fühlen, dass auch hier der Stilkreis weit enger umschrieben ist, als man lange Zeit annahm, indem wir immer mehr empfinden, dass es vor allen Dingen die Persönlichkeitswelt Wagners war, die diesen Ausdruck gebot.