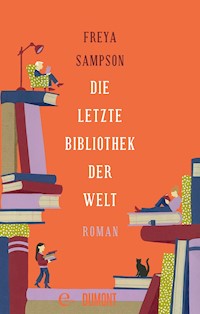12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dorothy Darling, 77 Jahre alt und misstrauische Eigenbrötlerin, lebt schon fast ihr halbes Leben in Shelley House im beschaulichen Chalcot. Wachsam beobachtet sie das Treiben ihrer Nachbarn, unternimmt regelmäßige Kontrollgänge, führt Buch über Fehltritte und schreibt Beschwerdebriefe. Als die 25-jährige Kat, die nicht nur pinke Haare hat, sondern auch noch ein schrottreifes Auto fährt, (illegalerweise!) bei Dorothys Nachbarn Joseph zur Untermiete einzieht, wittert die alte Dame Ärger. Doch der kommt plötzlich von ganz anderer Seite: Shelley House soll abgerissen und durch ein Gebäude mit Luxusapartments ersetzt werden. Joseph demonstriert vor dem Büro des Vermieters – und wird kurz darauf bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden. Was geht hier vor sich? Und wer kümmert sich jetzt um Josephs Hund? Kat und Dorothy müssen sich verbünden, um den Frieden wiederherzustellen und Shelley House zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dorothy Darling, 77Jahre alt und misstrauische Eigenbrötlerin, lebt schon fast ihr halbes Leben in Shelley House im beschaulichen Chalcot. Wachsam beobachtet sie das Treiben ihrer Nachbarn, unternimmt regelmäßige Kontrollgänge, führt Buch über Fehltritte und schreibt Beschwerdebriefe. Als die 25-jährige Kat, die nicht nur pinke Haare hat, sondern auch noch ein schrottreifes Auto fährt, (illegalerweise!) bei Dorothys Nachbarn Joseph zur Untermiete einzieht, wittert die alte Dame Ärger.
Doch der kommt plötzlich von ganz anderer Seite: Shelley House soll abgerissen und durch ein Gebäude mit Luxusapartments ersetzt werden. Joseph demonstriert vor dem Büro des Vermieters – und wird kurz darauf bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden. Was geht hier vor sich? Und wer kümmert sich jetzt um Josephs Hund? Kat und Dorothy müssen sich verbünden, um den Frieden wiederherzustellen und Shelley House zu retten. Eine scheinbar unmögliche Allianz, denn ebenso wie Dorothy hält auch Kat ihre Mitmenschen gern auf Abstand. Aber vielleicht lohnt es sich ja doch, die eigenen Vorbehalte über Bord zu werfen?
Freya Sampson hat in Cambridge Geschichte studiert, ist Fernsehproduzentin und war u.a. an zwei Dokumentationen über die britischen Royals beteiligt. Bei DuMont erschien 2021 ihr Debütroman ›Die letzte Bibliothek der Welt‹, der auf der Shortlist für den Exeter Novel Prize stand, und 2023 ›Menschen, die wir noch nicht kennen‹. Freya Sampson lebt mit ihrer Familie in London.
Claudia Voit studierte Germanistik, Anglistik/Amerikanistik und Literaturübersetzen. Für ihre Arbeit erhielt sie mehrere Stipendien und Auszeichnungen. Sie übersetzt aus dem Englischen, u.a. Chris Power, Clare Sestanovich und Maria Tumarkin.
FREYA SAMPSON
Ms Darling und ihre Nachbarn
ROMAN
Aus dem Englischenvon Claudia Voit
Von Freya Sampson sind bei DuMont außerdem erschienen:
Die letzte Bibliothek der Welt
Menschen, die wir noch nicht kennen
Die englische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel ›Nosy Neighbours‹ bei Bonnier Zaffre, London.
Copyright © 2024 Sampson Writes Ltd
E-Book 2025
© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Übersetzung: Claudia Voit
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagillustration: © Carlo Stanga/2Agenten
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1082-7
www.dumont-buchverlag.de
KAPITEL 1
Dorothy
Wenn die Bewohner von Shelley House Jahre später auf die außergewöhnlichen Ereignisse dieses langen, turbulenten Sommers zurückblickten, waren sie sich uneins, wie alles seinen Anfang genommen hatte. Tomasz aus Wohnung fünf zufolge hatte es an dem Tag begonnen, als die Briefe eintrafen: sechs harmlos aussehende braune Umschläge, die eines Mittwochmorgens im Mai durch den Schlitz des Gemeinschaftsbriefkastens geflattert waren. Omar aus Wohnung drei behauptete, die Probleme hätten ein paar Wochen später angefangen, als ein Rettungswagen mit heulender Sirene vor dem Haus gehalten hatte und jemand auf einer Bahre darin verladen worden war. Und Gloria aus Wohnung sechs erklärte, bereits im Januar habe ihre Astrologin ihr vorausgesagt, sie habe in naher Zukunft Drama und Zerstörung zu erwarten (und, was noch wichtiger war, sie werde noch vor Weihnachten verlobt sein).
Doch für Dorothy Darling, Wohnung zwei, stand immer außer Frage, ab wann das Unheil seinen Lauf genommen hatte. Sie konnte den exakten Moment benennen, in dem sich alles verändert hatte: den einzelnen Flügelschlag eines Schmetterlings, der den Tornado ausgelöst hatte, der sie alle verschlingen sollte.
Es war der Tag, an dem das Mädchen mit den pinken Haaren in Shelley House eintraf.
Der Morgen hatte begonnen wie jeder andere. Um sechs Uhr dreißig wurde Dorothy von einem Poltern aus der Wohnung über ihr geweckt. Mehrere Minuten lang blieb sie mit fest zugekniffenen Augen im Bett liegen und jagte den letzten Schatten ihres Traums hinterher. Als sie es nicht länger hinauszögern konnte, stand sie auf und begab sich für ihre Morgentoilette mit hartnäckig knackenden Knien ins Bad. In der Küche zündete Dorothy mit einem Streichholz den Herd an und machte ihre allmorgendlichen Dehnübungen, während sie darauf wartete, dass ihr Ei kochte und der English Breakfast Tea in seiner Kanne zog. Sobald beides fertig war, trug sie ihr Frühstück auf einem Tablett in den Salon und nahm es an einem Kartentisch am Erkerfenster sitzend zu sich. So weit, so gewöhnlich.
Beim Essen beobachtete Dorothy, wie ihre Nachbarn das Gebäude verließen. Darunter war der große, grimmige Mann aus Wohnung fünf, der von seinem ebenso grimmigen, stets den Bürgersteig verunreinigenden Hund begleitet wurde. Als Nächstes kam die Jugendliche aus Wohnung drei, ein sehr hübsches Mädchen, wenn sie nur nicht immer so finster dreinblicken würde. Sie starrte auf ihr Handy und ignorierte ihren Vater, der ihr mit einer ramponierten Aktentasche unter dem einen und einem überquellenden Eimer Recyclingabfall unter dem anderen Arm folgte. Als er den Inhalt in die Gemeinschaftsmülltonne leerte, verfehlte eine Blechdose ihr Ziel und rollte über den Gehweg. Dem keinerlei Beachtung schenkend, eilte der Mann seiner Tochter nach. Dorothy zückte Tagebuch und Bleistift, die sie immer zur Hand hatte.
7.48Uhr O.S. (3) Inkorrekte Abfallentsorgung
Sobald die morgendliche Stoßzeit vorbei war, zog Dorothy sich an, bürstete sich die langen silbernen Haare und legte ihre Perlenkette an. Um acht Uhr fünfzig war sie wieder am Fenster, gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie die Rothaarige aus Wohnung sechs das Haus Hand in Hand mit ihrem derzeitigen Angebeteten verließ, einem großen, grobschlächtigen Mann in einer billigen Lederjacke. Danach kehrte Ruhe ein, Dorothy bezog das Bett frisch und staubte die Bilderrahmen und den Nippes auf dem Kaminsims ab, begleitet von Wagners Götterdämmerung, um den Krach aus der Wohnung über ihr zu übertönen.
Und dann, kurz nach zehn, als Dorothy sich gerade ihre zweite Kanne Tee kochte, hörte sie von draußen einen gewaltigen Knall. Sie ließ den Kessel stehen und eilte zum Fenster. Ein altes, klappriges blaues Auto fuhr vor dem Haus vor und setzte mit dem Hinterrad auf dem Bordstein auf. Eine große schwarze Rauchwolke quoll aus dem Auspuff, während der Motor stotternd zum Erliegen kam. Kurz darauf öffnete sich die Fahrertür und jemand stieg aus. Es war ein junger Mensch, dem Augenschein nach zwischen zwanzig und dreißig, aber auf den ersten Blick konnte Dorothy nicht mit Gewissheit sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Die kurzen, ungekämmten Haare waren in einem grellen Pinkton gefärbt, und die Person hatte eine Latzhose an, wie man sie von Arbeitern auf einer Baustelle kennt. Sie trug weder Mantel noch Strickjacke, obwohl es für Anfang Mai ungewöhnlich kühl war. Tätowierungen schlängelten sich an ihren Armen hinauf wie Graffiti. Die Person griff auf den Rücksitz des Wagens und hievte einen großen, abgewetzten Rucksack heraus, dann stieß sie mit dem Fuß die Tür zu, was das Fahrzeug bedenklich wackeln ließ. Erst als sie sich Shelley House zuwandte, erkannte Dorothy, dass sie eine junge Frau vor sich hatte.
Die Pinkhaarige betrachtete das Haus mit undurchdringlicher Miene, aber Dorothy vermutete, dass sie es mit einer Mischung aus Beklommenheit und Ehrfurcht auf sich wirken ließ. Ein Gebäude wie Shelley House sah man schließlich nicht alle Tage. Das während der Regierungszeit von Königin Victoria erbaute und nach dem englischen Dichter der Romantik benannte Gebäude hatte eine breite Fassade aus präzise gemauerten roten Ziegelsteinen mit weißem Außenstuck und wurde von einer kunstvollen Balustrade gekrönt. Ausladende Steinstufen führten zu der imposanten Eingangstür, über der in gotischer Schrift die Worte SHELLEY HOUSE, 1891 eingraviert waren. Beeindruckende Erkerfenster in den ersten beiden Stockwerken rahmten die Tür ein, während die oberste Etage, die das Dienstbotenquartier beherbergt hatte, bevor das Gebäude in Wohnungen unterteilt worden war, kleinere, rechteckige Dachgauben aufwies. Dorothy konnte sich noch gut an das erste Mal erinnern, als sie das Haus gesehen hatte; wie sie mitten auf dem Bürgersteig stehen geblieben war, es mit offenem Mund angestarrt und in all seiner Pracht und mit all seiner Geschichte bewundert hatte. Noch nie zuvor hatte sie ein derart schönes Haus gesehen, und genau da, in diesem Augenblick, hatte Dorothy sich geschworen, dass es ihr Zuhause werden würde. Vierunddreißig Jahre später war es das immer noch.
Das pinkhaarige Mädchen begutachtete weiterhin das Gebäude, und als ihr Blick über das Erdgeschoss schweifte, schien er einen Moment lang an Dorothys Fenster zu verharren. Instinktiv wich Dorothy zurück, obwohl sie wusste, dass sie durch die Gardine nicht zu sehen war. Ihr Herz schlug ein wenig schneller, als die junge Frau die Treppe hinaufstieg und an der Haustür aus ihrem Blickfeld verschwand. Wen mochte sie bloß mitten an einem Werktag besuchen? Vielleicht den ungehobelten neuen Mieter in Wohnung vier? Dorothy wartete auf ein entferntes Läuten und war völlig perplex, als sie den ungewohnten Klang ihrer eigenen Türklingel vernahm. Ach du liebes Lieschen, sie wollte zu ihr! Sollte sie aufmachen? Es war lange her, dass Dorothy zuletzt Besuch empfangen hatte, und das Mädchen sah alles andere als vertrauenswürdig aus. Vielleicht war sie eine Halunkin, die es auf wehrlose Seniorinnen abgesehen hatte, in ihre Häuser eindrang, sie ausraubte und mit dem Tod ringend zurückließ? Natürlich war Dorothy weder wehrlos noch war sie dumm genug, um auf solch eine Masche hereinzufallen, aber das konnte diese junge Schurkin nicht wissen. Sollte sie sich zur Sicherheit ein Messer aus der Küchenschublade holen?
Es klingelte erneut, und Dorothy schreckte aus ihren Gedanken auf. Sie griff nach ihrem Bleistift – die Spitze war scharf genug, um nötigenfalls als Waffe zu dienen – und ging zur Wohnungstür. Ein paar Jahre zuvor hatte ein früherer Vermieter ein äußerst ausgeklügeltes Videoüberwachungssystem installiert. Auf einem kleinen Bildschirm neben der Wohnungstür konnte Dorothy sehen, wer vor der Haustür stand, und über eine Gegensprechanlage konnte sie mit dem Besucher sprechen, bevor sie den Summer betätigte. Dorothy war entsetzt gewesen, selbst als der Techniker ihr versicherte, das Video funktioniere nur in eine Richtung und die Person draußen könne sie nicht sehen. Nun trat sie so nah heran, dass ihre Nase beinahe den Bildschirm berührte. Er zeigte das körnige Schwarz-Weiß-Bild der jungen Frau, die an einem Fingernagel kauend darauf wartete, dass man sie einließ. Was wollte sie bloß von ihr?
Zum dritten Mal läutete es, diesmal lange und anhaltend. Dorothy räusperte sich, bevor sie auf die Taste mit der Aufschrift INTERCOM drückte.
»Wer sind Sie und was wollen Sie von mir?« Sie musste schreien, um über den dritten Akt der Götterdämmerung, die immer noch in voller Lautstärke lief, gehört zu werden.
»Ich bin wegen dem Zimmer hier.«
Dorothy runzelte die Stirn. »Da müssen Sie sich irren. Hier gibt es kein freies Zimmer, das kann ich Ihnen versichern.«
Durch den Lautsprecher war ein entnervtes Seufzen zu vernehmen. »Ist es schon vergeben? Das hätten Sie mir sagen können, ich bin extra hergefahren.«
Dorothy war empört über diesen unverschämten Ton. »Dann fahren Sie dorthin zurück, woher Sie gekommen sind. Und vergessen Sie bloß nicht, Ihr Auto mitzunehmen – das ist ja eine Bedrohung für die Allgemeinheit!«
Selbst auf dem winzigen Monitor sah Dorothy den Anflug von Wut im Gesicht des Mädchens.
»Es ist widerrechtlich geparkt«, stellte Dorothy klar.
Die Besucherin drehte sich nicht einmal zu dem Fahrzeug um. »Ist es nicht.«
»Doch, ist es. Ihr Hinterrad steht auf dem Bordstein, was gegen Vorschrift 244 der Straßenverkehrsordnung verstößt. Wenn Sie das Auto nicht wegfahren, sehe ich mich gezwungen, die Stadtverwaltung anzurufen.«
Das Mädchen stieß einen Laut aus, der wie eine Mischung aus Lachen und Schnauben klang. »Wow, Sie scheinen ja eine echte Stimmungskanone zu sein. Da habe ich ja noch mal Schwein gehabt, was?«
Dorothy hatte nicht den blassesten Schimmer, was das Mädchen ihr damit sagen wollte, aber bevor sie etwas angemessen Bissiges erwidern konnte, machte die junge Frau auf dem Absatz kehrt und stieg, ohne sich zu bedanken oder auch nur zu verabschieden, die Treppe hinunter.
Triumphierend trat Dorothy von der Tür zurück. Sie hatte keinerlei Zweifel, dass das Mädchen bei Wohnung eins hatte klingeln wollen. Der grässliche Mieter dort hatte die Angewohnheit, sein zweites Zimmer unterzuvermieten – ohne Erlaubnis vom Eigentümer. In drei verschiedenen Fällen hatte Dorothy ihn gemeldet, aber Konsequenzen hatte es offenbar keine gegeben. Dennoch empfand sie eine gewisse Genugtuung darüber, zumindest diesen Versuch vereitelt zu haben. Das Niveau in Shelley House mochte seit Jahren sinken, aber dass diese respektlose Ganovin auf der anderen Seite des Flurs einzog, hatte ihr gerade noch gefehlt.
Dorothys Blick wanderte zu ihrem Tagebuch auf dem Tisch. Sie sollte diese Interaktion schriftlich festhalten, solange sie sie noch frisch im Gedächtnis hatte.
10.17Uhr Unverschämte pinkhaarige Besucherin erkundigt sich irrtümlich nach Zimmer. Habe sie über Straßenverkehrsordnung belehrt und weggeschickt.
Aber das musste warten. Dringender musste sie sich um ihre zweite Kanne Tee kümmern, die sie mitten in der Zubereitung stehen gelassen hatte. Begleitet von dem anschwellenden Gesang von Wagners Brünnhilde, die in den Flammen ihrem Tod entgegenritt, kehrte Dorothy in die Küche zurück.
KAPITEL 2
Kat
Kat machte den Kofferraum auf, warf ihren Rucksack hinein und knallte die Heckklappe zu. Was für eine Zeitverschwendung. Gestern Abend hatte sie extra noch eine SMS geschickt, um sich zu vergewissern, dass das Zimmer nach wie vor frei war, und ihr war versichert worden, dass das der Fall sei. Jetzt hatte sie durch die Fahrt hierher einen ganzen Vormittag verloren, den sie hätte nutzen können, um anderswo nach einem Zimmer und einem Job zu suchen. Kat hatte sowieso gezögert, nach Chalcot zurückzukehren. Vielleicht war das ein Zeichen, dass sie nach so vielen Jahren lieber doch nicht hier sein sollte? Sie riss die Fahrertür auf und verzog das Gesicht, als diese protestierend quietschte.
»Sorry, Marge«, murmelte sie und tätschelte den Türrahmen. Heute auch noch von ihrem Auto im Stich gelassen zu werden, war das Letzte, was sie jetzt gebrauchen konnte.
So behutsam wie möglich setzte sich Kat auf den Fahrersitz, aber gerade als sie die Tür zuziehen wollte, rief jemand ihren Namen. Sie schaute zurück zum Haus. In der offenen Tür stand ein weißhaariger Mann und winkte ihr zu.
»Hallo? Sind Sie Kat?«
Sie nickte, rührte sich aber nicht vom Fleck.
»Sagen Sie bloß, Sie haben es sich schon anders überlegt?« Der Mann lächelte schief.
Sollte das ein Scherz sein? Kat machte erneut Anstalten, die Tür zu schließen.
»Ich weiß, so toll sieht es von hier draußen nicht aus, aber das Zimmer ist wirklich hübsch«, rief er. »Sie sollten es sich zumindest mal ansehen, bevor Sie es ganz abschreiben.«
Noch immer lächelte er sie hoffnungsvoll an. Kat stieß die Tür wieder auf und sprach laut und langsam, für den Fall, dass er Schwierigkeiten hatte, sie zu verstehen.
»Ihre Frau hat mir gesagt, dass das Zimmer schon vergeben ist.«
Er runzelte die Stirn. »Meine Frau?«
»Ja. Sie hat gesagt, hier ist kein Zimmer frei.«
Er zögerte kurz, und Kat empfand ein bisschen Mitleid mit ihm. Der arme Mann musste wirklich schwer verwirrt sein, wenn er sich nicht mal an seine eigene Frau erinnern konnte. Doch dann grinste er, und um seine Augen bildeten sich Fältchen.
»Oje, ich glaube, Sie haben die falsche Tür erwischt! Keine Sorge, da sind Sie nicht die Erste.«
Nun war Kat diejenige, die die Stirn runzelte. »Also ist das Zimmer doch noch zu haben?«
»Aber sicher. Kommen Sie rein, ich zeige Ihnen alles.«
Er trat von der Eingangstür zurück und hielt sie für Kat geöffnet, aber sie blieb im Auto sitzen. Wollte sie wirklich hierbleiben? An das Gebäude konnte sie sich noch lebhaft aus ihrer Kindheit erinnern. Immer wenn Kat zu ihrem Großvater geschickt worden war, um vorübergehend auf seiner Farm am Dorfrand zu wohnen, hatte sie der Weg zur Grundschule von Chalcot an Shelley House vorbeigeführt. Damals hatten sich die anderen Kinder Geschichten erzählt, dass in dem unheimlichen, verfallenen alten Haus eine böse Hexe lebte, die Kinder auf dem Dachboden einsperrte, und darum hatte Kat immer einen Zahn zugelegt, wenn sie an dem Haus vorbeiging, nur für den Fall, dass die Hexe auch sie entführen wollte.
Sie ließ den Blick über das Haus schweifen. Vor kinderfressenden Hexen hatte sie keine Angst mehr, aber etwas Beklemmendes hatte Shelley House nach wie vor an sich. Die Farbe war verblasst und das Mauerwerk bröckelte, die Fensterrahmen waren verzogen und der Lack blätterte ab wie in einem Horrorfilm. In der steinernen Balustrade auf dem Dach fehlten Teile, und das ganze Bauwerk schien sich bedrohlich zur Seite zu neigen. Wenn es schon von außen so aussah, weiß Gott, in welchem Zustand es dann innen war. Kein Wunder, dass die Zimmermiete so günstig war. Kat konnte sich kaum vorstellen, dass jemand freiwillig hier wohnte.
Noch immer stand der Mann in der Tür und beobachtete sie. Über seinem Kopf prangte der in Stein gravierte Namen des Gebäudes. Seit ihrem letzten Besuch war der Schriftzug dem Vandalismus zum Opfer gefallen, und nun war da nicht mehr SHELLEY HOUSE zu lesen, sondern HELL HOUSE. Kat konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen, und der Mann strahlte zurück.
»Na los, kommen Sie! Ich habe gerade Wasser aufgesetzt.«
Ach, was sollte es. Sie hatte den ganzen Weg auf sich genommen, da konnte sie sich auch das Haus ansehen, vor dem sie als Kind so viel Angst gehabt hatte. Sie stieg aus Marge und schloss vorsichtig die Tür.
Oben auf der Treppe streckte ihr der Mann die Hand entgegen.
»Joseph Chambers. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
»Kat Bennett«, sagte sie, ließ aber die Hände in den Hosentaschen.
Sie folgte ihm hinein, und hinter ihnen fiel die Tür schwer ins Schloss. Kein natürliches Licht drang herein, und es dauerte einen Moment, bis sich Kats Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Sobald das geschehen war, stellte sie fest, dass sie sich in einem unscheinbaren Hausflur befand. Schwarz-weiß karierte Bodenfliesen ließen eine prächtige Vergangenheit des Gebäudes erahnen, aber inzwischen war der Flur zu einer Deponie für ungewollte Besitztümer verkommen. Auf einem Regalbrett stapelte sich ungeöffnete Post, und von irgendwo weiter oben hörte Kat Drum-and-Bass-Musik, aber sonst gab es keine Anzeichen von Leben. Links und rechts im Flur befand sich je eine Tür ohne Schild, und Kats Blick huschte zwischen ihnen hin und her.
»Ich wohne in Nummer eins, gleich hier«, sagte Joseph und deutete auf die linke. »Wohnung zwei gehört Dorothy Darling. Ich glaube, Sie hatten bereits das Vergnügen, mit ihr zu plaudern.«
Kat hatte nichts Nettes über die alte Frau zu sagen, die sie über die Gegensprechanlage angeschnauzt hatte, darum hielt sie lieber den Mund. Joseph schmunzelte.
»Das habe ich mir schon gedacht. Keine Sorge, Dorothy ist exzentrisch, aber bellende Hunde beißen nicht. Und wo wir gerade dabei sind …« Er ging zur linken Tür, und als er sie erreichte, ging auf der anderen Seite Gekläffe los. »Sie sind aber nicht auf Hunde allergisch, oder?«
»Nein.«
»Gut.« Er stieß die Tür auf, und prompt stürmte ein kleiner braun-weißer Jack Russell Terrier aus der Wohnung, umkreiste Joseph und kam schlitternd vor Kats Füßen zum Stehen. Sein Bellen erreichte einen neuen Geräuschpegel, während er an ihrem Bein hochsprang.
»Das ist Reggie«, rief Joseph über das Getöse hinweg. »Er fängt sich gleich wieder. Er ist immer sehr aufgeregt, wenn er jemand Neuen kennenlernt.«
Kat beugte sich hinunter und hielt Reggie auffordernd die Hand hin. Eifrig schnupperte er daran, seine Nase fühlte sich feucht an. Kat strich ihm über den Kopf und musste dabei an einen anderen Hund denken, dessen Fell ebenso kurz und drahtig gewesen war wie Reggies – und an den beruhigenden Geruch von Zigarrenrauch, der ihn stets begleitet hatte. Sobald Kat begann, Reggie zwischen den Ohren zu kraulen, hörte er auf zu bellen.
»Er mag Sie!« Joseph klatschte vor Freude in die Hände. »Das ist ein ausgezeichnetes Omen. Meinen letzten Untermieter konnte er nicht ausstehen. Hat ständig hinter seinen Kleiderschrank gepinkelt, aber ich glaube, das Problem werden wir mit Ihnen nicht haben. Komm, Reggie, dann wollen wir Kat mal alles zeigen.«
Beim Klang seines Namens trottete der Hund gehorsam zurück in die Wohnung. Kat machte sich auf alles gefasst, als sie auf die Tür zuging, aber beim Eintreten stockte ihr der Atem. Das Zimmer, in dem sie sich wiederfand, war riesig, hoch über ihren Köpfen spannte sich eine Gewölbedecke auf, und ihre Füße standen auf polierten Holzdielen. Die Wände hatten einen neuen Anstrich nötig, und es roch ein bisschen muffig, aber durch das großzügige Erkerfenster strömte Licht ins Zimmer, und der überwiegende Teil der hinteren Wand wurde von dem größten Kamin eingenommen, den Kat je gesehen hatte. Mit so einem beeindruckenden Anblick hatte Kat im Leben nicht gerechnet. Ihr war, als befände sie sich am Set eines Historiendramas, nur dass die Möbel von IKEA stammten und in der Ecke ein Flachbildfernseher stand.
»Nicht schlecht, oder?«, sagte Joseph.
»Es ist unglaublich.«
»In viktorianischer Zeit hat hier ein reicher Industrieller gewohnt. Tatsächlich standen in der ganzen Straße Villen wie diese hier, und alle waren nach berühmten englischen Dichtern benannt: Byron, Wordsworth, Keats und so weiter, daher auch der Name Poet’s Road. Die Hälfte der Villen wurde im Zweiten Weltkrieg zerbombt, der Rest wurde später abgerissen und durch kleinere, praktischere Häuser ersetzt. Irgendwie hat Shelley House überlebt, wurde aber in den Sechzigern umgebaut und in kleinere Wohneinheiten unterteilt.«
Schweigend ließ Kat das alles auf sich wirken. Ihr Großvater hatte sein ganzes Leben lang in diesem Dorf gelebt, was bedeutete, dass er die Poet’s Road schon gekannt haben musste, als die anderen Villen noch gestanden hatten. Wer weiß, vielleicht war er sogar mal in Shelley House gewesen? Bei dem Gedanken spürte Kat ein Stechen in der Brust.
»Wenn Sie das Haus jetzt schon beeindruckend finden, hätten Sie es vor dreiunddreißig Jahren sehen sollen, als ich hier eingezogen bin«, fuhr Joseph fort. »Damals war es eins der prächtigsten Gebäude in der Nachbarschaft und wurde tadellos instand gehalten. Aber im Laufe der Jahre haben es die wechselnden Vermieter leider ziemlich vernachlässigt, daher der jetzige Zustand.« Er deutete auf einen feuchten Fleck an der Wand neben ihnen, an dem die Farbe abblätterte. »Aber genug von der Geschichtsstunde. Ich führe Sie herum.«
Joseph steuerte die beiden Türen am anderen Ende des Raums an, und Reggie flitzte ihm schlitternd über den glatten Boden hinterher.
»Hier ist die Küche«, sagte Joseph und stieß die hintere Tür auf.
Kat fragte sich, ob es darin auch aussehen würde wie am Set von Downton Abbey, aber als sie hineinschaute, stellte sie fest, dass die Küche klein und enttäuschend gewöhnlich war.
»Ich glaube, ursprünglich war das mal die Spülküche«, sagte Joseph. »Nicht gerade prunkvoll, aber sie erfüllt ihren Zweck. Fühlen Sie sich hier ruhig wie zu Hause – ich bin ganz gut ausgestattet mit Töpfen und Pfannen. Und das Abendessen ist in der Miete inbegriffen.«
»Oh, für mich muss nicht mitgekocht werden«, warf Kat hastig ein. Davon hatte nichts in der Anzeige gestanden, und sie verspürte nicht die geringste Lust, jeden Tag ein angespanntes Essen mit ihrem Vermieter abzusitzen. Schon in jungen Jahren hatte sie gelernt, dass man seinen Mitbewohnern am besten nicht zu nahekam. Nie würde Kat die vermeintlich nette alte Dame vergessen, bei der sie ein Zimmer gemietet hatten, als sie sechs oder sieben Jahre alt gewesen war. Nach der Schule hatte sie Kat immer Kekse angeboten und mit ihr über ihren Tag geplaudert. Dann, eines Nachmittags, kam Kat nach Hause und wurde bereits vom Jugendamt erwartet, das ihr einen Haufen schwieriger Fragen stellte. Noch in der gleichen Nacht floh ihre Mum mit ihr, und sie schimpfte, weil Kat der Vermieterin gegenüber »nicht die Klappe gehalten« hatte. Diesen Fehler machte sie kein zweites Mal.
»Ich stelle Ihnen das Essen in den Kühlschrank, dann können Sie es sich aufwärmen, wann immer es Ihnen passt«, sagte Joseph, als hätte er ihre Gedanken gelesen. »Um ehrlich zu sein, würden Sie mir damit einen Gefallen tun. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, nur für eine Person zu kochen, wissen Sie. Inzwischen ist es drei Jahre her, und trotzdem …«
Er unterbrach sich, und einen schrecklichen Moment lang dachte Kat, er würde gleich in Tränen ausbrechen, aber dann blinzelte er, sah zu ihr auf und lächelte wieder. »Das ist einer der Gründe, warum ich Untermieter habe. Na ja, das und um einen Teil der Miete abzudecken, jetzt, wo ich in Rente bin. Sollen wir mit der Besichtigung weitermachen?«
Er wies zur zweiten Tür, die in einen kleinen Flur führte. Das Badezimmer war bescheiden und in Avocadogrün gehalten, an einigen Stellen blätterte die Tapete ab, aber im Großen und Ganzen sah es sauber aus. Die Tür daneben war geschlossen – Josephs Schlafzimmer, vermutete Kat –, die letzte Tür hingegen stand offen.
»Besonders groß ist es nicht, aber ich find’s gemütlich«, sagte Joseph und blieb auf der Schwelle stehen. »Es war das Kinderzimmer unserer Tochter.«
Der Raum war tatsächlich klein, aber Kat gefiel er sofort. Darin standen ein Einzelbett, ein Kleiderschrank und ein altmodischer Schaukelstuhl neben einem kleinen Bücherregal, vollgestopft mit abgegriffenen Taschenbüchern. Kat warf einen Blick auf die Titel: Stolz und Vorurteil … Bleak House … Moby Dick … alles alte Bücher, die sie nie gelesen hatte und auch nie lesen würde. Sie drehte sich wieder zur Tür und registrierte erleichtert, dass sie sich von innen verriegeln ließ. Joseph wirkte zwar harmlos, aber man konnte nie vorsichtig genug sein. Oberhalb des Betts befand sich ein Fenster, und Kat trat heran, um sich die Aussicht anzusehen. Sie rechnete mit einem Garten oder zumindest ein bisschen Grün, aber sie blickte auf den Betonparkplatz eines modernen Wohnblocks.
»Früher hatten wir einen Gemeinschaftsgarten, aber der wurde vor Jahren von dem damaligen Eigentümer verkauft«, sagte Joseph.
Kat drehte sich wieder um und begutachtete das Zimmer. Es war wirklich klein, aber das machte nichts. Ihre Habseligkeiten passten locker in den alten Rucksack im Kofferraum – sie brauchte also echt keinen begehbaren Kleiderschrank. Und Joseph machte einen ganz netten Eindruck: ein bisschen zu gesprächig vielleicht, aber ihm würde sicher bald auffallen, dass sie kein redseliger Mensch war, und dann würde er sie in Ruhe lassen. Die größere Frage war, ob sie überhaupt nach Chalcot zurückkehren wollte. Immerhin gab es einen sehr guten Grund, warum Kat sich fünfzehn Jahre lang von hier ferngehalten hatte, und daran hatte sich nichts geändert. Na und, was machte es schon, dass sie in den letzten Monaten immer öfter an das Dorf und ihren Großvater gedacht hatte und die Erinnerungen sie juckten wie ein Mückenstich, der einfach nicht heilen wollte? Das hieß noch lange nicht, dass sie das Risiko eingehen musste, hierher zurückzukommen. Am vernünftigsten wäre es sicher, weit wegzufahren und sich nie wieder blicken zu lassen.
»Also, was meinen Sie?« Joseph sah sie an. »Nehmen Sie das Zimmer?«
Kat atmete tief durch. Jetzt, da sie sowieso schon hier war, konnte sie auch ein paar Wochen bleiben. Und dank Marge vor der Tür hatte sie, falls nötig, jederzeit die Möglichkeit, schnell zu verschwinden.
»Okay, danke.« Sie zögerte, als ihr ein Gedanke kam. »Wollen Sie nichts über mich wissen, keine Referenz einholen oder so was?«
»Wozu sollte ich denn eine Referenz wollen?«
»Was weiß ich. Ich könnte eine psychopathische Axtmörderin sein.«
Joseph brach in schallendes Gelächter aus. »Ach, wie eine Axtmörderin kommen Sie mir nicht vor. Nein, wenn überhaupt, würde ich eher darauf tippen, dass Sie der Typ Mensch sind, der seine Opfer vergiftet.«
Kat konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Der Kerl hatte sie nicht mehr alle. Aber wenn er keine Referenz wollte, war ihr das bloß recht. Je weniger er – oder sonst jemand hier – über sie wusste, desto besser.
»Na, kommen Sie«, sagte Joseph und ging zur Tür. »Sie holen Ihre Sachen rein, und ich koch uns erst mal einen Kaffee.«
KAPITEL 3
Dorothy
Jeden Tag, kurz nach dem Vormittagstee, zog Dorothy ihren Hausmantel an, holte die Handtasche vom Tischchen neben der Wohnungstür und nahm ihre Inspektion von Shelley House vor.
Im Laufe der Jahre hatte sie festgestellt, dass elf Uhr die optimale Zeit für diese Aufgabe war, denn da befanden sich die meisten Nachbarn außer Haus. Nicht, dass Dorothy ihre Aktivitäten verheimlichen wollte; schließlich gab es nichts, wofür sie sich schämen musste. Sie wünschte einfach nicht gestört zu werden und hielt den Kontakt zu den anderen Anwohnern gern so gering wie möglich.
Wie immer begann Dorothy im Eingangsbereich. Bei ihrem Einzug in Shelley House war dieser eins der Glanzstücke des Hauses gewesen. Damals waren die Wände in einem satten Burgunderrot erstrahlt, ein gläserner Kronleuchter war dort angebracht gewesen, und so wie der Fliesenboden geglänzt hatte, hätte man darauf frühstücken können. Heute sah das völlig anders aus. Mit missbilligend geschürzten Lippen durchquerte Dorothy den dunklen, übel riechenden Raum. Ihr fiel auf, dass der übliche Unrat – eine Tüte mit Damenschuhen und ein ausgedienter Staubsauger – inzwischen um ein Fahrrad ergänzt worden war, das nun unter dem Schild mit der Aufschrift KEINE PRIVATEN GEGENSTÄNDE IN GEMEINSCHAFTSRÄUMEN ABSTELLEN stand. Dorothy hatte das Schild vor einigen Jahren persönlich angebracht, aber das hatte keinerlei Effekt gehabt. Sie stupste den Drahtesel mit dem Fuß an. So nah an der Treppe war er wahrhaftig ein Sicherheitsrisiko. Was, wenn jemand in Eile auf dem Weg nach unten darüber stolperte? Sie holte ihr Tagebuch aus der Tasche und kritzelte eine Notiz hinein.
11.17Uhr Alexander Properties wegen unzulässigen Abstellens von Gegenständen im Hausflur schreiben. Auf acht neun vorangegangene Briefe in selbiger Sache hinweisen.
Dorothy beschleunigte ihre Schritte, als sie an der Tür von Wohnung eins vorbeikam, in der Joseph Chambers, seine Ratte von einem Hund und – trotz Dorothys Bemühungen – das pinkhaarige Mädchen wohnten. In den letzten zwölf Tagen hatte Dorothy das Kommen und Gehen der jungen Frau besonders gut im Auge behalten, aber bislang nur feststellen können, dass sie sich stets wie eine Landstreicherin kleidete und offenbar weder Freunde noch Familie hatte. Das überraschte sie nicht – Joseph sammelte Heimatlose wie andere Leute Porzellanfiguren von Royal Doulton.
Nach dem Rundgang im Eingangsbereich stieg Dorothy die Treppe hinauf in den ersten Stock, wobei ihre Knie sie jedes einzelne ihrer siebenundsiebzig Jahre spüren ließen. Bis vor Kurzem war dieser Aufstieg ein regelrechtes olfaktorisches Abenteuer gewesen. Die Familie Siddiq – bestehend aus Omar, seiner Frau Fatima und ihrer Tochter Ayesha – mietete seit sieben Jahren Wohnung drei. Eines der Familienmitglieder (Dorothy schlussfolgerte nun, dass es sich um MrsSiddiq gehandelt haben musste) hatte offenbar begnadet gekocht, und Dorothy war bei ihrem täglichen Kontrollgang von den himmlischsten Düften in Empfang genommen worden. Dann, eines Nachmittags vor etwa sechs Monaten, hatte MrsSiddiq Shelley House auf den Arm ihres Mannes gestützt verlassen, und die Gerüche waren schlagartig verschwunden. Ein paar Wochen später hatte Dorothy beobachtet, wie ein Leichenwagen vor dem Gebäude vorfuhr, gefolgt von einer dunklen Limousine. Omar und Ayesha waren schweigend in den Fond des Wagens gestiegen. Zu Dorothys Beunruhigung waren ihr die Tränen gekommen, als die Fahrzeuge abfuhren, und es hatte einer zusätzlichen Kanne Tee und dreier Garibaldi-Kekse bedurft, bis sie sich wieder gefasst hatte. Seither roch es im ersten Stock von Shelley House nur noch nach Schimmel und in jüngster Zeit nach dem schweren, unverwechselbaren Aroma von Marihuana, das unter dem Türschlitz von Nummer vier hervorkroch.
Vor dieser Wohnung blieb Dorothy jetzt stehen, zückte eine Dose Lufterfrischer und besprühte großzügig den Flur vor Nummer vier. Von drinnen hörte sie das schwere Hämmern der entsetzlichen Musik, die der Mann rund um die Uhr laufen ließ, aber Dorothy wusste, dass es keinen Zweck hatte, zu klopfen und ihn zu bitten, sie leiser zu stellen. Denn der neueste Mieter von Shelley House war unnachgiebig, streitlustig, ausgesprochen unhöflich und ignorierte sämtliche Ermahnungen Dorothys, mehr Rücksicht auf seine Nachbarn zu nehmen. Erst seit ein paar Wochen wohnte er hier, und die beiden waren bereits mehrfach aneinandergeraten. Ein Lichtblick war jedoch, dass so furchtbare Nachbarn wie er selten lange blieben; gewiss würde ihn der Vermieter bald vor die Tür setzen.
Nachdem sie den Flur gründlich mit Glade Vanilla Blossom eingenebelt hatte, ging Dorothy hinauf ins oberste Stockwerk. Auf jeder Stufe hielt sie an, um sich zu vergewissern, dass sich der abgetretene Teppich nicht über Nacht gelöst hatte und eine Stolperfalle darstellte. Einer Familienlegende zufolge war ihre Urgroßtante Phyllida mit dem Fuß an der Ecke eines persischen Bidjar-Teppichs hängen geblieben und in den Tod gestürzt. Dorothy wusste also nur zu gut, wie wichtig die gewissenhafte Instandhaltung von Teppichen war. Sie benötigte mehrere Minuten, um den Teppich auf jeder der zwanzig Stufen sowie auf dem Treppenabsatz zu inspizieren, was ihr genug Zeit verschaffte, die recht hitzige Diskussion in Wohnung sechs zu belauschen.
Nun war Dorothy stolz darauf, kein neugieriger Mensch zu sein. Dennoch hielt sie es als die am längsten ansässige Mieterin für ihre Pflicht, ein Auge auf die anderen Bewohner zu haben und deren Sicherheit zu gewährleisten, solange sie in Shelley House lebten. Das galt insbesondere für Gloria Brown, die Mieterin von Wohnung sechs. Vor rund zehn Jahren war Gloria mit ihrem damaligen Freund eingezogen, einem untersetzten Jamaikaner mit strahlenden Augen. Leider hatte er nicht einmal ein Jahr durchgehalten, und auf ihn war eine Reihe von Rüpeln und Männern ohne jede Moral gefolgt. Denn wenn Gloria Brown sich durch etwas auszeichnete – abgesehen davon, in Stretch-Leggings umwerfend auszusehen –, dann durch ihren furchtbaren Männergeschmack. Der aktuellste Kandidat, ein Leder tragender Einfaltspinsel, dem ständig der Mund offen stand, war vor sieben Monaten auf der Bildfläche erschienen, und bislang hatte es so ausgesehen, als befände sich das Paar in der Flitterwochenphase seiner Beziehung. Doch so sicher wie das Amen in der Kirche, das hatte Dorothy gleich gewusst, würden das Gekicher und die überflüssigen öffentlichen Zuneigungsbekundungen bald in Groll und Feindseligkeit umschlagen. Und den Geräuschen nach zu urteilen, die jetzt aus Wohnung sechs tönten, schien dieser Moment gekommen zu sein.
»Scheiße, ey, du hast sie doch nicht mehr alle!«
Die Stimme des Mannes dröhnte aus der Wohnung, und seine vulgäre Wortwahl ließ Dorothy zusammenzucken. Wie unnötig.
»Ich dachte, du wärst anders, aber du bist genau wie alle anderen … paranoid und eifersüchtig.«
»Paranoid?«
Das war Glorias Gekreische. Man konnte es ja wohl kaum als Lauschen bezeichnen, wenn die beiden in dieser Lautstärke stritten, während Dorothy im Treppenhaus stand, oder? Sie ging zur Feuertreppe und drückte die Türklinke hinunter, um sich zu vergewissern, dass der Ausgang fest verschlossen war. Seit MrF. Alexander das Gebäude vor einem Jahr übernommen hatte, schrieb Dorothy ihm jede Woche und forderte, dass dieser Zugang zum Dach ein für alle Mal verschlossen wurde. Selbiges hatte sie auch bei sämtlichen früheren Vermietern getan, und trotzdem war nie etwas unternommen worden. Sie machte sich eine Notiz.
»Was hat das mit Paranoia zu tun, Barry?« Glorias Tonlage hatte die Höhe eines Mezzosoprans erreicht. »Erklär mal, was ist paranoid daran, den Slip einer anderen Frau in deiner Tasche zu finden?«
»Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich keine Ahnung hab, wie der da hingekommen ist. Da muss sich einer der Jungs einen Spaß erlaubt haben.«
Dorothy schnaubte. Diese alte Leier? Der Mann hatte anscheinend keinerlei Fantasie.
»Es ist nicht nur der Slip. Wo warst du gestern Abend? Du warst erst nach vier daheim.«
Er war also für die zuknallende Haustür verantwortlich, die Dorothy morgens um vier Uhr vierzehn geweckt hatte. Sie machte sich eine weitere Notiz.
»Mir reicht’s, Gloria. Den Scheiß muss ich mir echt nicht mehr geben!«
Aus der Wohnung war lautes Scheppern zu hören, und Dorothy erstarrte. Sollte sie eingreifen? Das hatte sie schon einmal getan, vor mehreren Jahren, als sie spätnachts von Glorias Schrei geweckt worden war. Im Nachthemd und mit einem Küchenmesser bewaffnet war Dorothy die Treppe hinaufmarschiert und hatte mit der Polizei gedroht, falls Gloria die Tür nicht öffnete. Schließlich war sie aufgetaucht und hatte Dorothy in schroffem Ton versichert, dass sie nicht in Gefahr sei. Doch was, wenn die Situation diesmal ernst war? Was, wenn er Gloria verletzte? In der Wohnung herrschte bedrohliche Stille, und Dorothy drückte das Ohr an die Tür, um nach Geräuschen eines Kampfs zu horchen. Vielleicht sollte sie gleich die Polizei rufen und melden, dass –
Zu Dorothys Überraschung schwang die Tür auf. Sie kippte nach vorn und streckte die Hand aus, um sich abzufangen. Eine dicke, bullige Brust empfing sie.
»Was zum Teufel machen Sie da?«
Dorothy richtete sich auf und errötete. »Ich wollte nur …«
»Haben Sie uns wieder hinterherspioniert?« Spucke spritzte ihm aus dem Mund und traf Dorothy im Gesicht.
»Natürlich nicht! Wie können Sie es wagen, mir so etwas zu unterstellen?«
»Warum haben Sie dann an der Tür gelehnt?«
Seine Stimme war tief und bedrohlich, und Dorothy kam der Gedanke, dass sie womöglich selbst in Gefahr sein könnte. »Ich … ich wollte sichergehen, dass alle ihre Türen gut verschlossen halten. Hier in der Gegend gab es in letzter Zeit eine Reihe von Einbrüchen.«
»Was ist los, Barry?«
Hinter ihm war Gloria aufgetaucht. Sie sah unverletzt aus, wie Dorothy feststellte, aber sie hatte Tränensäcke unter den Augen und ihre Haare hatten dringend eine Bürste nötig. Glorias Gesicht verfinsterte sich, als sie Dorothy sah.
»Die neugierige alte Schachtel von unten hat mal wieder rumgeschnüffelt«, sagte der Mann.
»Ich habe nicht herumgeschnüffelt! Gloria, ich wollte mich nur vergewissern, dass Sie …«
Aber die Frau wandte sich ab, bevor Dorothy den Satz beenden konnte, und zog sich wortlos in die Wohnung zurück.
»Verpissen Sie sich und lassen Sie uns in Ruhe«, knurrte der Mann und knallte Dorothy die Tür vor der Nase zu.
Sie eilte die Treppe hinunter, und erst als sie den Eingangsbereich erreichte, hielt sie inne, um Luft zu holen, wobei sie versuchte, den schmerzhaften Stich der Demütigung zu ignorieren. Genau aus diesem Grund vermied Dorothy den Kontakt zu ihren Nachbarn – weil sie ein Haufen undankbarer, gemeiner Dummköpfe waren. Sie versuchte doch lediglich, sich um ihrer aller Sicherheit und Wohlergehen zu kümmern – und was war der Dank? Nichts als Beleidigungen und verleumderische Anschuldigungen. Sie griff in ihre Handtasche und zückte Tagebuch und Bleistift.
11.32Uhr Häuslicher Streit in Wohnung sechs. Wollte G.B. Unterstützung anbieten, wurde von männlichem Bewohner in Lederjacke verbal angegriffen und bedroht.
Einen Augenblick lang überlegte Dorothy, ob sie direkt in ihre Wohnung zurückkehren sollte, um sich auf den Schreck eine Kanne Tee zu gönnen, aber nein. Sie straffte die Schultern und stopfte das Tagebuch wieder in die Tasche. Eine letzte Aufgabe war noch zu erledigen. Eine Aufgabe, die Dorothy in den letzten dreißig Jahren jeden Tag ausgeführt hatte. Eine Aufgabe, von der sie sich nicht von Gloria Brown und ihrem ungehobelten Ignoranten von einem Freund abhalten lassen würde.
Das Postregal.
Jeden Morgen wurde sämtliche Korrespondenz, die durch den Briefschlitz von Shelley House fiel, kurzerhand auf einem Regal neben Dorothys Wohnungstür abgelegt und anschließend weitgehend ignoriert. Das bedeutete, dass der Stapel von Briefen, Flugblättern und Gratiszeitungen stets rasant wuchs wie eine Familie promiskuitiver Kaninchen, der niemand Einhalt gebot. Dorothy hatte es auf sich genommen, Ordnung im Postregal zu halten, und das nahm sie äußerst ernst. Nun machte sie sich daran, den Haufen zu sichten, wobei sie richtige Post auf einen (kleinen) Stapel und alles andere auf einen zweiten (deutlich größeren) Müllstapel legte. Da waren zwei, nein drei Rechnungen für Omar aus Wohnung drei, von denen Dorothy wusste, dass er sie später holen und in seiner Aktentasche verstecken würde, bevor seine Tochter von der Schule nach Hause kam. Außerdem lag da ein Paket für Tomasz Wojcik aus Wohnung fünf von einer Firma namens Haare für Ihn und eins für Gloria Brown von Ann Summers (Dorothy hatte einmal den Fehler begangen, die Firma mit dem entzückenden Namen am Computer in der Bücherei zu recherchieren, und war vor Schreck beinahe vom Stuhl gefallen). Wie üblich hatte Dorothy keine Post bekommen, genauso wenig wie der Rüpel aus Wohnung vier, der bislang noch nie Post erhalten hatte.
Gerade wollte Dorothy zurück in ihre Wohnung gehen, da klapperte der Briefschlitz. Als sie sich umdrehte, flatterte eine Handvoll brauner Briefumschläge auf die Fußmatte. Der Postbote musste vorhin vergessen haben, sie zuzustellen. Tadelnd schnalzte sie mit der Zunge und durchquerte die Eingangshalle, um sie aufzuheben, wobei sie dem Ächzen, das ihr beim Hinunterbeugen unwillkürlich entfuhr, keine Beachtung schenkte. Insgesamt waren es sechs Umschläge, von denen jeder an den Mieter einer anderen Wohnung adressiert war, aber sie hatten weder Briefmarke noch Poststempel, was darauf hindeutete, dass sie persönlich zugestellt worden waren. Wie seltsam.
Dorothy legte fünf der Umschläge in das Postregal und kehrte mit dem sechsten in der Hand in ihre Wohnung zurück. Sie nahm ihren Brieföffner aus der Tischschublade, schlitzte das Kuvert auf, ohne sich hinzusetzen, und zog die beiden gefalteten Blätter heraus. Bei dem zweiten schien es sich um eine Art Formular zu handeln, also richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf die erste Seite, einen maschinell getippten Brief.
Dorothy las die Worte einmal, dann ein zweites Mal, was, so sehr wie ihre Hände zitterten, leichter gesagt war als getan. Danach fiel ihr Blick auf den Kamin, und sie eilte in die Küche, wo sie eine Schachtel Streichhölzer fand. Sie entzündete eines – wofür sie wegen des bereits erwähnten Zitterns mehrere Anläufe benötigte –, streckte dann den Brief von ihrem Körper weg und hielt das Streichholz darunter. Als die Flammen an dem Papier leckten, ließ sie die Seiten in das Spülbecken fallen. Keine zehn Sekunden dauerte es, bis der Brief verbrannt war: Die Wörter glühten und kräuselten sich, bis sie der Vergangenheit angehörten. Dann feuerte Dorothy den Herd an, griff nach ihrer Teekanne und schwor sich, keinen Gedanken mehr an diesen Brief zu verschwenden.
KAPITEL 4
Kat
Es gab nicht vieles im Leben, was Kat Bennett Angst machte, aber als sie sich der Hauptstraße von Chalcot näherte, zog sich ihr Magen zu einem festen Knoten zusammen. Was, wenn sie ihrem Großvater über den Weg laufen und die Hölle losbrechen würde? Oder was, wenn jemand sie erkannte und ihn informierte, dass sie im Dorf war? Kat mochte inzwischen fünfundzwanzig sein und einen anderen Namen tragen, aber es bestand dennoch das Risiko, dass jemand die Ähnlichkeit zu der dürren, rauflustigen Zehnjährigen bemerkte, die damals für so viel Ärger gesorgt hatte. Und so hielt sie die Luft an, als sie am Golden-Dragon-Imbiss vorbeiging und nach rechts in die Hauptstraße einbog. Adrenalin rauschte ihr durch die Adern, und ihre Füße waren bereit, jeden Moment umzudrehen und loszusprinten.
In den letzten fünfzehn Jahren hatte Kat oft an dieses Dorf gedacht und damit an den schmerzhaften Erinnerungen gekratzt wie an einer verschorften Wunde, aber jetzt, da sie hier war, fühlte sich auf einmal alles ganz anders an als früher. An den Ladenfronten hingen immer noch bunte Wimpel und Blumenampeln, und sie erkannte die alte Bibliothek und den Plough, den Pub, in dem ihr Großvater gerne gesessen hatte. Aber die meisten Geschäfte waren neuen gewichen, und irgendwie kam ihr alles kleiner und gewöhnlicher vor, als sie es im Gedächtnis gehabt hatte. Die Gesichter auf der Hauptstraße waren ihr fremd, und niemand würdigte sie eines genaueren Blickes, als sie die Straße entlangging. All die Jahre hatte Kat sich davor gefürchtet, zurückzukommen, als ob ein wütender Mob sie aufs Polizeirevier zerren würde, sobald sie das Dorf betrat, doch anscheinend war sie hier genauso anonym wie an jedem anderen der zahllosen Orte, an denen sie gelebt hatte.
Jetzt, da sie ihre Angst, erkannt zu werden, überwunden hatte, war es Kats nächste Priorität, einen Job zu finden. Sie mochte zwar nicht lange bleiben, aber Geld verdienen musste sie trotzdem. Und so verbrachte sie die nächsten Tage damit, mit Marge durch die Gegend zu fahren und nach Arbeit zu suchen. Anfangs sah es so aus, als hätte sie kein Glück; fast nirgends war etwas frei, und die wenigen, die eine Stelle ausgeschrieben hatten, warfen nur einen kurzen Blick auf ihre Tattoos und pinken Haare und schickten sie weg. Doch gerade als sie aufgeben und das Dorf wieder verlassen wollte, kam Kat zufällig am Remi’s vorbei, einem billigen Café, das etwas versteckt hinter der Hauptstraße von Winton lag, und entdeckte im Fenster einen Aushang, laut dem eine Spülhilfe gesucht wurde. Der Besitzer, ein großer, bärtiger Mann, brummte ein paar Fragen und bot Kat den Job auf der Stelle an. Die Arbeit war dreckig und ermüdend, den ganzen Tag auf den Beinen und mit den Armen bis zum Ellbogen in schmutzigem Spülwasser, aber sie wurde bar auf die Hand bezahlt, und lange würde sie das sowieso nicht machen.
Und so hatte sich in Kats zweiter Woche in Chalcot bereits ein ruhiger, wenn auch eintöniger Alltag eingependelt. Sie arbeitete zehn Stunden am Tag und kehrte bei Sonnenuntergang nach Shelley House zurück. Da war Joseph meist außer Haus. Im Grunde genommen hatte Kat ihren Mitbewohner seit dem Einzug kaum zu Gesicht bekommen. Manchmal liefen sie sich morgens über den Weg, bevor Joseph zu seiner täglichen Joggingrunde mit Reggie aufbrach – als Kat zum ersten Mal Zeugin geworden war, wie sich der Fünfundsiebzigjährige in winzigen Laufshorts und mit Schweißband ausgestattet aufwärmte, hatte sie sich das Lachen verkneifen müssen –, aber er schien zu spüren, dass Kat es bevorzugte, in Ruhe gelassen zu werden. Ihr Kontakt beschränkte sich hauptsächlich auf die Teller mit Essen, die er für sie in den Kühlschrank stellte, immer mit einem handgeschriebenen Zettel, auf dem stand, wie sie das Essen am besten aufwärmen sollte. Noch nie hatte Kat jemanden gehabt, der sie frisch bekochte – die Vorstellung ihrer Mutter von Kochen war ein Laib Brot und ein Glas Erdnussbutter gewesen, und manchmal nicht einmal das. In den ersten paar Tagen hatte Kat das Essen nicht angerührt, aber schließlich stimmte sie ein Teller mit köstlich aussehendem Chicken Pie um, und seitdem ließ sie sich jeden Tag ein selbst gekochtes Abendessen schmecken.
Als Kat am Freitag die Poet’s Road hinaufstapfte, war sie so erschöpft, dass ihr alles wehtat. Sie hatte sieben Schichten ohne einen freien Tag hinter sich und wollte nur noch ins Bett. Als sie die steilen Stufen zur Eingangstür von Shelley House hinaufstieg, bewegte sich etwas im Fenster zu ihrer Rechten. Sie drehte sich um, sah nichts als die schweren Gardinen, wusste aber trotzdem, dass dahinter Dorothy Darling stand und ihr hinterherspionierte. Kat hatte sie zwar immer noch nicht persönlich kennengelernt, und ihr einziger Kontakt war die angespannte Unterhaltung über die Gegensprechanlage an ihrem Einzugstag gewesen, aber Kat fühlte sich oft von ihr beobachtet, wenn sie in Shelley House ein- und ausging. Vielleicht war Dorothy ja wirklich die böse Hexe, über die damals in der Schule alle gesprochen hatten, und sie plante gerade jetzt in diesem Moment, sich auf Kat zu stürzen und sie auf dem Dachboden einzusperren. Kat lächelte in sich hinein, als sie die Haustür aufschloss und zu Wohnung eins ging. Nur noch ein paar Schritte, dann konnte sie sich ihr Abendessen aufwärmen und ins Bett fallen. Doch als sie die Tür öffnete, stand sie nicht nur Joseph gegenüber, sondern auch vier Fremden, die sie unverhohlen misstrauisch anstarrten.
»Ah, Kat, perfektes Timing«, sagte Joseph und stand auf. »Wir wollten gerade anfangen.«
Oh nein, wo war sie da nur hineingeraten? Kat musterte die seltsame, bunt zusammengewürfelte Truppe. War sie in ein Treffen der Anonymen Alkoholiker hineingeplatzt oder war das hier eine schräge Sex-Sekte? Reggie wedelte begeistert mit seinem kurzen Schwanz und tippelte zu ihr, um sie zu begrüßen. Sie beugte sich hinunter und streichelte ihn, um den Blickkontakt mit den Leuten im Zimmer zu vermeiden.
»Tut mir leid, dass ich keine Gelegenheit hatte, dich vorzuwarnen. Es war recht kurzfristig«, sagte Joseph. »Wir haben diese Woche eine schlechte Nachricht bekommen, deshalb habe ich eine Notfall-Versammlung der Mieter einberufen.«
Aha, dann mussten das also die Nachbarn sein. Bislang war Kat noch keinem von ihnen begegnet, aber manchmal hörte sie ihre gedämpften Alltagsgeräusche: eine Toilettenspülung von oben, Musik oder ein Streit aus der Ferne.
»Ich würde dir gern alle vorstellen«, sagte Joseph, als Kat sich aufrichtete. Sie klappte den Mund auf, um zu sagen, dass sie dringend etwas essen musste, aber Joseph fuhr bereits fort. »Also zunächst mal, das hier ist Gloria Brown aus Wohnung sechs.«
Er nickte einer zierlichen Frau zu, die aussah wie Ende dreißig, Anfang vierzig. Sie hatte kupferrotes Haar, trug hautenge goldene Leggings und war perfekt geschminkt. Mit langen Acrylnägeln tippte sie auf ihrem Handy herum und murmelte ein halbherziges »Hi« in Kats Richtung.
»Und das sind Omar und Ayesha aus der Wohnung über uns«, sagte Joseph und zeigte auf die beiden auf dem Sofa ihm gegenüber. Kat vermutete, dass es sich um Vater und Tochter handelte, aber sie saßen so weit auseinander, wie es die Couch zuließ. Omar stand die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben, während Ayesha aussah, wie Teenager eben aussehen, wenn sie lieber sonst wo wären. Das konnte Kat ihr nicht verübeln.
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Omar und nickte ihr knapp zu.
»Und zu guter Letzt: Das ist Tomasz aus Nummer fünf.«
Der Mann, den Joseph meinte, war so riesig, dass der Sessel Mühe zu haben schien, sein Gewicht zu tragen. Er war locker zwei Meter groß, hatte muskulöse Arme so massig wie zwei Schinken, und sein Kopf war kahl geschoren.
»Wann fangen wir an?«, fragte er mit einem breiten osteuropäischen Akzent und machte sich nicht die Mühe, Kat irgendeine Form von Beachtung zu schenken. »Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Princess muss raus.«
Reggie knurrte leise und sein Nackenfell stellte sich auf.
»Ich wollte warten für den Fall, dass sich noch jemand anschließen möchte«, sagte Joseph, und Kat fiel ein strenger Ton auf, den sie bisher noch nicht von ihm kannte. Offenbar war er ein ähnlich großer Fan von Tomasz wie Reggie. »Kat, warum holst du dir nicht einen Stuhl? Das betrifft dich schließlich auch.«
»Ehrlich gesagt, ich hab echt Hunger. Ich muss was essen.«
»Okay, schade.«
Kat hörte ihm die Enttäuschung an, eilte aber trotzdem in die Küche. Eine Mieterversammlung war ihr persönlicher Albtraum. Außerdem war Kat sowieso keine offizielle Bewohnerin, sondern nur für ein paar Wochen zur Untermiete hier. Was auch immer da vor sich ging, es hatte nichts mit ihr zu tun. Auf dem Herd fand sie einen Topf mit einem Post-it, auf dem Wärme mich langsam für 10Minuten auf stand, verziert mit einem Smiley. Als Kat den Deckel anhob, schlug ihr der köstliche Duft von Zitronengras und Knoblauch entgegen.
»Okay, dann fangen wir eben ohne die beiden anderen an«, hörte Kat Joseph im Wohnzimmer sagen, gefolgt von etwas, das wie ein Schnauben klang.
»Als ob uns die feine Dame Darling mit ihrer Anwesenheit beglücken würde.« Das musste Gloria sein, ihre Worte trieften nur so vor Sarkasmus. »Eher würde sie das Haus niederbrennen, als sich mit uns in einen Raum zu setzen.«
»Das ist nicht fair«, sagte Joseph sanft. »Dorothy wohnt schon länger hier als wir alle. Ich kann mir nicht ausmalen, wie schwer das für sie sein muss.«
»Nun mach aber mal einen Punkt, Joe. Du weißt so gut wie ich, dass sie sich ins Fäustchen lachen würde, wenn man dich und mich zwangsräumt.«
Zwangsräumt. Kat rutschte das Herz in die Hose. Wie oft hatte sie dieses Wort schon gehört? Sie hatte es bereits gekannt und gefürchtet, bevor sie das Alphabet aufsagen konnte. Zwei Wochen durften ein neuer Rekord sein, selbst für sie. Kat atmete tief ein. Du wirst nicht zwangsgeräumt. Das ist Josephs Problem, nicht deins. Du findest eine neue Bleibe, das tust du immer.
»Was ist mit dem Neuen in Wohnung vier, kommt der nicht?«, hörte sie Gloria fragen.
»Ich habe bei ihm geklopft und eine Nachricht hinterlassen, aber nichts von ihm gehört«, sagte Joseph.
»Wundert mich nicht. Der Typ ist der reinste Albtraum.« Das war Omar. »Laute Musik rund um die Uhr, wilde Partys, Drogen. Das einzig Gute an dem ganzen Schlamassel ist, dass ich dann nicht mehr gegenüber von ihm wohnen muss.«
»Selbst ohne ihn und Dorothy sind wir immer noch zu fünft«, sagte Joseph. »Ich bin mir sicher, gemeinsam finden wir einen Weg, diesen Räumungsunsinn zu verhindern.«
»Und wie stellst du dir das bitte vor?« Das war die unverwechselbare tiefe Stimme von Tomasz. »Wir sind bloß Mieter. Der Vermieter kann machen, was er will. Dieser Paragraf-21-Bescheid bedeutet, wir müssen gehen.«
Noch so ein Begriff, den Kat schon häufiger gehört hatte, als ihr lieb war. Tomasz hatte recht; ein Räumungsbefehl »ohne eigenes Verschulden« nach Paragraf 21 bedeutete, dass sie allesamt rausgeschmissen werden konnten, obwohl sie nichts falsch gemacht hatten. Diese Leute waren am Arsch.
»Also, seit die Briefe am Mittwoch angekommen sind, habe ich ein bisschen nachgeforscht, und vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wie wir denken«, sagte Joseph. »Ich habe mich da mal eingelesen, und rechtlich gesehen können wir in unseren Wohnungen bleiben, auch nachdem unser Mietverhältnis am fünfzehnten Juli endet. Wenn wir das tun, muss Alexander Properties vor Gericht gehen und einen Räumungsbefehl von einem Richter erwirken, erst dann können wir zwangsgeräumt werden. Und bei der Anhörung vor Gericht können wir dann persönlich vorsprechen und begründen, warum die Zwangsräumung abgelehnt werden sollte.«
»Der Richter könnte also entscheiden, dass wir bleiben dürfen?«, fragte Gloria, und Kat nahm einen Funken Hoffnung in ihrer Stimme wahr.
»Ganz genau. Wenn wir nicht nachgeben und unsere Argumente überzeugend vortragen, entscheidet das Gericht vielleicht zu unseren Gunsten.«
»Das sind ja tolle Neuigkeiten«, sagte Omar.
Kat schüttelte den Kopf. Wenn die dachten, das würde funktionieren, dann machten sie sich ordentlich was vor. Sollte sie rübergehen und ihnen sagen, dass sie die Räumung sowieso nicht stoppen konnten? Aber dann müsste sie ihre oberste Regel brechen: sich nie in die Angelegenheiten der Nachbarn einmischen. Nein, sie sollte sich raushalten; das war schließlich nicht ihr Problem. Aus dem Wohnzimmer war aufgeregtes Geplapper zu hören und mittendrin Josephs Stimme. Sie sah auf die Haftnotiz mit dem Smiley und seufzte.
»Sie können versuchen, sich vor Gericht dagegen zu wehren, aber Sie werden nicht damit durchkommen.«
Fünf Augenpaare richteten sich auf Kat, als sie das Wohnzimmer betrat.
»Und woher bitte schön wollen Sie das wissen?«, fragte Gloria.
»Weil ein Richter Paragraf 21 nur dann aufhebt, wenn der Vermieter im Bescheid einen Fehler gemacht hat, was hier wohl nicht der Fall sein wird. Der Richter wird so oder so einen Räumungsbefehl erlassen, selbst wenn Sie vor Gericht ziehen, und dann müssten Sie auch noch die Kosten für das Verfahren und die eigene Räumung tragen. Das wird Sie alle ein Vermögen kosten.«
»Bist du dir da sicher, Kat?«, fragte Joseph. »Woher weißt du das?«
Kat schwieg. Sie würde ganz sicher nicht erklären, wie oft der Gerichtsvollzieher bei ihr und ihrer Mutter auf der Matte gestanden hatte, um sie zu räumen. Auch würde sie nicht erzählen, wie es sich anfühlte, zuzusehen, wie die eigenen wenigen Habseligkeiten auf die Straße geworfen wurden, oder unter der ständigen Bedrohung der Obdachlosigkeit aufzuwachsen.
»Ja, bin ich.« Mehr sagte sie dazu nicht. Sie drehte sich um und ging zurück in die Küche.
Ein paar Augenblicke lang herrschte Stille im Wohnzimmer.
»Wir sind geliefert«, sagte Omar, und all der Optimismus von eben war aus seiner Stimme verschwunden.
»Nicht unbedingt, Dad.« Das musste Ayesha sein. »Ich denke trotzdem, dass es sich lohnt, sich zu wehren.«
»Aber du hast doch gehört, was Kat gesagt hat, Schatz. Außerdem ist Fergus Alexander eine Institution hier vor Ort: Die Hälfte der Immobilien gehört ihm. Meine Güte, er sitzt sogar im Vorstand der Schule. Nie im Leben stellen sich die Behörden gegen ihn.«
»Ayesha hat recht, wir sollten es zumindest versuchen«, sagte Joseph. »Selbst wenn wir nicht vor Gericht gehen können, gibt es noch andere Möglichkeiten, zu protestieren. Was, wenn wir versuchen, Aufmerksamkeit auf die Sache zu lenken, vielleicht schaffen wir es sogar in die Lokalzeitung? Wenn Fergus sein Ruf wichtig ist, können wir ihn vielleicht durch den Druck der Öffentlichkeit zum Einlenken bewegen?«
»Das klappt niemals«, blaffte Tomasz. »Vermieter wie er scheren sich einen Dreck um die öffentliche Meinung, denen geht’s nur ums Geld.«
»Aber eine andere Wohnung in Chalcot kann ich mir nicht leisten«, sagte Omar, und Kat konnte die Angst in seiner Stimme hören. »Solange wir auch Fatimas Gehalt hatten, sind wir klargekommen, aber jetzt bin ich auf mich gestellt. Die Wohnung hier ist schon teuer genug, aber habt ihr euch mal die anderen Mietpreise in der Gegend angesehen?«
»Dad, ich habe dir doch gesagt, dass ich mir einen Job suchen kann.«
»Nein, Ayesha.« Omar hatte einen scharfen Ton angeschlagen. »Darüber haben wir gesprochen, und ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du dich von der Schule ablenken lässt.«
»Aber ich bin fast sechzehn, also …«
»Ich habe Nein gesagt!«
Die Jugendliche antwortete nicht, und es wurde wieder still im Wohnzimmer. Kats Essen hatte zu köcheln begonnen, und sie nahm sich einen Teller aus dem Schrank, ganz vorsichtig, damit er keinen Lärm machte und alle an ihre Anwesenheit erinnerte.
»Ich war gestern bei der Stadtverwaltung«, sagte Gloria schließlich. »Anscheinend gibt es eine zweijährige Warteliste für deren Wohnungen. Zwei Jahre!«
»Du ziehst aber nicht mit deinem Freund zusammen, oder?« Das Wort »Freund« spuckte Tomasz geradezu aus.
»Geht dich doch nichts an, mit wem ich zusammenwohne«, schnauzte Gloria zurück. »Wenn wir ausziehen, muss ich mich wenigstens nicht mehr mit deinem stinkenden Hund rumschlagen.«
»Princess stinkt nicht.«
»Ach, kommt schon, Leute, bleiben wir ruhig«, sagte Joseph. »Wir stehen doch alle auf derselben Seite.«
»Princess stinkt aber wirklich«, sagte Ayesha. »Ich kann sie immer schon von der Treppe aus riechen. Echt ekelhaft.«
»Sie ist nicht ekelhaft!« Tomasz hatte die Stimme erhoben. »Sie hat hin und wieder ein bakterielles Problem, aber dafür kann sie nichts. Wenn du ein Problem mit Hunden hast, dann ist doch wohl Josephs Kläffer schlimmer.«
»Halte Reggie da raus«, sagte Joseph. »Er ist ein Schatz, außer wenn Princess ihn terrorisiert.«
Kat schüttelte den Kopf. Was für ein schräger Haufen. Das war noch so ein Grund, warum sie sich stets von Nachbarn fernhielt: Früher oder später geriet man sich wegen irgendwelchen bescheuerten Kleinigkeiten in die Haare. Man musste sich nur diese fünf hier ansehen; offenbar konnten die sich absolut nicht ausstehen.
»Ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen vom Thema ab«, sagte Omar. »Ich dachte, bei diesem Treffen geht es um den Räumungsbefehl und nicht um Hunde?«
»Du hast recht, Omar«, sagte Joseph. »Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich will mein Zuhause retten, ich will unser aller Zuhause retten. Wer unterstützt mich dabei?«
Lange herrschte Stille, dann hörte Kat Stuhlbeine über den Boden schaben.
»Ich werde meine Zeit jedenfalls nicht damit verschwenden«, sagte Tomasz. »Es ist, wie es ist. Das müssen wir akzeptieren und nach vorne sehen. Jetzt entschuldigt mich, ich muss zurück zu meinem stinkenden Hund.«
Seine schweren Schritte polterten über den Boden, dann schlug die Tür zu.
»Was ist mit dir, Omar? Ayesha?«
»Ich würde mich ja gern dagegen wehren, Joseph, aber was können wir schon machen?«, sagte Omar. »Fergus Alexander hat alle Fäden in der Hand, und wir haben nichts.«
»Mama hätte gewollt, dass wir kämpfen«, sagte Ayesha leise.
»Deine Mutter hätte gewollt, dass ich tue, was für die Familie am besten ist«, erwiderte Omar, und seine Stimme zitterte kurz. »Im Moment ist das, dafür zu sorgen, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und du dich auf deine Prüfungen konzentrierst. Jetzt komm, ich muss kochen und du musst lernen.«
Kat hörte sie ebenfalls gehen und Ayesha eine Verabschiedung murmeln.
»Tja, sieht so aus, als bleibt es an uns hängen, Gloria«, sagte Joseph.
Sie hüstelte. »Hör zu, ich würde dir ja gern helfen, aber ich habe echt viel um die Ohren. Auf der Arbeit werden gerade Leute entlassen, und meiner Mutter geht’s nicht gut, und dann ist da noch Barry … Ich muss mich darauf konzentrieren, was ich als Nächstes tun will. Tut mir leid, Joe.«
»Schon okay, ich verstehe das. Aber versprich mir, dass du vernünftig darüber nachdenkst, bevor du wichtige Entscheidungen triffst. Du kennst meine Meinung: Du verdienst jemanden, der dich gut behandelt.«
»Das mach ich, versprochen.«
Glorias Absätze klackerten über den Holzboden, und die Wohnungstür fiel ins Schloss. Einen Moment später ertönte ein langer Seufzer, und Joseph erschien mit gesenktem Kopf an der Küchentür.
»Ah, Kat. Abendessen ist in Ordnung?«
»Köstlich, danke.«
»Ich vermute, du hast alles mitbekommen?«, fragte er und nickte in Richtung Wohnzimmer. »Ich hatte gehofft, dass mir zumindest einer von ihnen helfen würde, aber anscheinend haben alle schon aufgegeben.«
Kat fuchtelte mit der Gabel herum und versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie unwohl ihr bei dem Gespräch war. Besser, sie verließ die Küche, bevor sie etwas Falsches sagte und alles noch schlimmer machte, aber Joseph blockierte den Ausgang. Sie wartete darauf, dass er wieder das Wort ergriff, aber er war in Gedanken versunken.
»Hat sich so angehört, als hätten gerade alle ihre eigenen Probleme«, sagte Kat schließlich.
»Natürlich. Es wäre nur schön gewesen, in diesem Kampf einen Verbündeten zu haben. Allein kann ich so was nämlich nicht gut – ich funktioniere besser, wenn ich mit anderen zusammenarbeiten kann. Du weißt ja, wie das ist.«
»Eigentlich nicht, fürchte ich.«
Joseph sah sie fragend an, und sie zuckte die Achseln.
»Ich war schon immer der Meinung, dass man allein besser dran ist. Andere lassen einen am Ende sowieso nur im Stich.«
»Tut mir leid, dass du das so siehst«, sagte Joseph sanft.