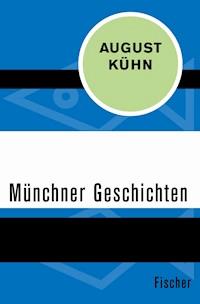
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band versammelt in Anthologien und Zeitungen erschienene Texte August Kühns aus über 10 Jahren. Er erzählt aus der Münchner Geschichte, von politischen Ereignissen und privatem Erleben; und immer wieder steht die Schwanthalerhöh im Mittelpunkt, das Arbeiterviertel, dessen Entwicklung und Veränderungen er engagiert und kritisch unter die Lupe nimmt. Im zweiten Teil werden Valentinaden, Satiren und Glossen zusammengefaßt, die der Autor unter dem Namen Rainer Zwing fürs Kabarett und für Münchner Anzeigenblätter geschrieben hat. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
August Kühn
Münchner Geschichten
FISCHER Digital
Inhalt
Gemeinhin München
DIE STADT VON OSTEN Mit den haubenlosen Frauentürmen und den zwei Spitzen der Peterskirche. Holzschnitte aus Schedels Chronik von 1493 (Ausschnitt).
Wegen einem Herzog sei München entstanden und wegen einer seichten Stelle an der Isar, so mußte ich im »Heimatkundeunterricht« erfahren, als ich mir erst bis zur Brust ging (heutiges Maß einmetersechsundachtzig gerechnet). Und elfhundertachtundfünfzig sollte es passiert sein, daß der gewalttätige Herzog Heinrich mit dem kriegerischen Tier-Beinamen »der Löwe« dem Freisinger Bischof dessen Brücke samt Zollstation abbrannte, um den geldbringenden Verkehr über seine neue bei Munichen, bei den Mönchen am Petersberg, vorbei zu lenken.
Inzwischen habe ich mir oft überlegt, was ich, hätte ich damals gelebt und zufällig bei dem Dorf, aus dem dann in den nachfolgenden achthundert und einigen Jahren die »Weltstadt mit Herz« (Fremdenverkehrswerbung) gewachsen ist, was ich vielleicht damals gewesen wäre, wo mein Platz gewesen wäre in der damaligen Gesellschaft. Mönch? Laienbruder? Kaum, dazu hätte ich Schwärmer sein müssen, ich bin es bis heute noch nicht, obwohl das Schwärmen für irgend etwas wieder sehr in Mode gekommen ist, zwar nicht mehr für Religion und Jenseits, um so mehr für Vergangenes und Altes, Vorgestriges mindestens (Nostalgie). Dazu gehört, daß man Stadtansichten, fein in Kupfer gestochen oder in Holz geschnitten vor Jahrhunderten, an Wände, Schaufenster oder Einkaufstüten von Kaufhäusern anbringt. Ohne dem Wesen der Stadt von damals näher zu kommen? Oder doch?
Damit man damals in der Stadt sicher war, umgaben die Bürger sie damals mit einer Mauer, die Tore bewehrten sie mit Türmen, einige davon sind uns noch erhalten geblieben, verschönern ohne weiteren erheblichen Gebrauchswert das Stadtbild. Zum Dienst auf der Mauer waren alle Bürger verpflichtet. Wurde deshalb die Stadt immer kampflos übergeben, wenn Landfeinde vor den Mauern erschienen? Dann würde es erklärlicher, daß die Nachfahren im Jahr 1977, in dieser Tradition handelnd, nicht auf die Barrikaden zu bringen sind, wenn irgend welche Interessen von oben ihre Stadtinteressen berühren, wenn zum Beispiel ganze Stadtviertel ver-saniert werden sollen.
Aber war das immer so hinter den wehrhaften Mauern der Stadt München, der Haupt- und Residenzstadt, zuerst der bayrischen Herzöge, dann Kurfürsten, schließlich Könige? Schade, der Geschichtsunterricht war da nicht sehr ergiebig, aber mir ist in Erinnerung, daß die Herzöge schon sehr früh die Stadtburg, den »Alten Hof«, von der übrigen Stadt abtrennten, aus Sorge vor rebellischen Bürgern. Heute gibt es keinen Landesfürsten mehr in der Residenz. Das Volk ist der Souverän – 1918 ist dies auch in München erkämpft worden. (Es wird im Fremdenverkehrsprospekt nicht erwähnt.)
Zurück zum alten München! Was also haben die Bürger hinter den Mauern geschützt, die soviel Geld und Arbeitsaufwand erforderten? Ihr Hab und Gut und ihre städtische Freiheit war ihnen diese Arbeit wert. – Ja, aber im Mittelalter genossen doch nur die besitzenden Bürger, die Patrizier, alle städtischen Rechte und Freiheiten, wird da einer einwenden, der es mit der Geschichte genauer nimmt. Und derselbe wird bei der nächsten Gelegenheit einen städtischen Oberinspektor devot um die Ausübung der ihm übertragenen Amtspflicht in irgend einer Sache ersuchen.
Gemeinhin kann man von München sagen, daß sie eine achthundertjährige Stadt ist mit einem in Spuren noch erhaltenen mittelalterlichen Kern. Soweit es um Baulichkeiten aus dieser Zeit geht, bin auch ich für deren Erhaltung, sonst nicht.
Münchner Arbeiterfamilien
Das Kramen in näherer oder fernerer Vergangenheit ist in jüngster Zeit als »Nostalgie« zur weitverbreiteten Mode geworden. Aber nicht dieser Mode folgte ich, als ich damit begann, zurückzuschauen auf über 100 Jahre Münchner Arbeiterbewegung. Vielmehr war mir daran gelegen, eine Antwort zu finden auf die immer wieder gehörte Anspielung: »In Bayern gehen die Uhren anders« – ob überhaupt, und wenn, warum. Da nicht irgendein einzelner, König Ludwig II., Freiherr von Feilitzsch, Prinzregent Luitpold, Georg von Vollmar, Kurt Eisner, Epp oder Hitler, Thomas Wimmer oder Alois Hundhammer, maßgeblich sind oder waren für die Abläufe gesellschaftlicher und ökonomischer Vorgänge – für die »Uhren«. Ich fand, daß die Oberlechner, Mayer und Huber auf der einen, und die Sedlmayr, Finck, Pschorr und Siemens andererseits dafür ausschlaggebend sind.
Also werde ich Münchner Arbeiterfamilien und ihr Leben in den vergangenen 100 Jahren untersuchen müssen, um eine Antwort auf die mir selbst gestellte Frage zu finden. Eigentlich müßte es doch über sie längst umfangreiches, wohlgeordnetes Material geben, sind sie es doch, die die Räder am laufen halten und hielten. Daß es nicht so ist, mußte ich gleich zu Beginn meiner Materialsammlung erfahren. Gerade noch über gewählte, ermordete, verfolgte Führer der Arbeiterbewegung in Bayern findet sich einiges Geschriebene und Gedruckte, sonst nur Zeitungen, bürgerliche zumeist, weil man die frühe sozialdemokratische Presse nicht der Aufbewahrung und Archivierung für wert befand, ja sogar noch Vorhandenes vernichtete.
Aber da gab es in meiner Umgebung noch alte Genossen, die Erinnerungen hatten, wenigstens auf die letzten 60, 70 Jahre. Und die eigene Familie, ein Großvater, der »auch so einer« war, der sich 1918 dem Demonstrationszug Kurt Eisners angeschlossen hatte, aus einem Schulhaus heraus, das als Behelfskaserne diente. Was weiß einer schon über die eigene Familie? Im Stadtarchiv fanden sich dann Einwohner-Meldekarteikarten, Einbürgerungsurkunden und Verehelichungszeugnisse der einmal zahlreichen Familie von Güterhallenarbeitern, Metallschleifem, Druckern, Dienstmädchen und Zigarrenarbeiterinnen. Die Einbürgerungsakte lieferte Hinweise auf damalige Lohnverhältnisse: 41,50 Mark die ermäßigte Gebühr für das Bürgerrecht – 17,80 Mark ein als gut auskömmlich bezeichneter Wochenlohn eines Arbeiters bei der Staatsbahn 1890. Die Meldebogen des Einwohneramtes trugen öfter den Vermerk »Referat 6 vorstellen«. Was für ein Referat war das wohl? Das Einwohneramt war Referat 2 – aber Michael Gehret, Polizeikommissär, wurde 1878 für das neugeschaffene Referat angestellt. Heute kenne ich ein solches Referat mit der römischen Ziffer drei aus eigener Erfahrung, hatte es doch einmal, ganz unzuständig, Schwierigkeiten bei der Ausstellung eines Reisepasses gemacht.
Auf einer »Legitimation« des Louis Viereck, Kammergerichtsreferendar a.D., Dissident, finden sich solche Vermerke dieses politischen Referats 6 mehrfach, seit er aus Berlin ausgewiesen, unter Bismarcks Sozialistengesetzen, nach München kam. Kammergerichtsrefendar: das heißt, daß er noch vor dem 2. Staatsexamen seinen angestrebten Juristenberuf aufgeben mußte, da er noch nicht einmal eine Zulassung als Rechtsanwalt bekommen konnte. Berufsverbot damals! So wurde Louis Viereck in München Buchhändler und bald auch Verleger sozialdemokratischer Zeitungen. Dreißig Jahre alt, als er 1881 nach München kam, verheiratet mit seiner aus San Francisco stammenden Frau Laura, dazu den viereinhalbjährigen Sohn Franz. Das Münchner Fremdenblatt freut sich am 16. Juli 1886, als er innerhalb von fünf Tagen zugestellt bekommt: »Sein Ausweisungsdekret aus Leipzig für die Zeit bis zum 29. Juni 87 (er war ja Reichstagsabgeordneter für den Wahlkreis Leipzig-Land, und die Reichtagswahl stand wieder an), den Entscheid der Reichskommission mit Bestätigung des Verbots der Münchner Abendzeitung (insgesamt wurden während der zwölf Jahre Sozialistengesetz in München 24mal Verbote gegen Vierecks Zeitungen ausgesprochen), eine Vorladung nach Freiburg in Sachen Chemnitzer Sozialistenprozeß, eine Vorladung mit Anklage wegen Geheimbund vom Landgericht München (im Anschluß an den am 11. Juni 86 stattgefundenen Prozeß, von dem Viereck wegen Tagen des Reichstags ausgeschlossen geblieben war), und eine Vorladung in Sachen Beleidigung des Kommerzienrats Vogel in Lanzenau, begangen durch das Buch ›Der Kommerzienrate‹.«
Wie sich doch die Zeiten ändern! Oder nicht? Sozialdemokraten, damals verfolgt, stellen heute Münchens Bürgermeister, die Mehrheit des Stadtrats, einflußreiche Verwaltungsstellen werden von ihnen besetzt, nach ihrem damaligen und noch linken Parteiführer Georg von Vollmar ist heute ein ganzes Haus am Oberanger benannt, steinerne Erinnerung an eine alte Tradition. – Ist da nicht einem Sozialarbeiter Frieser der Stuhl vor die Tür gesetzt worden von der Münchner Stadtverwaltung, eine Claudia Eisinger nach dem Studium gar nicht erst eingestellt worden in den staatlichen Lehrdienst? Was haben die beiden heute mit dem Louis Viereck von damals gemein? Mindestens das Kommunistische Manifest von Marx und Engels, das Frieser und Eisinger so gut wie Viereck zur Grundlage ihres politischen Handelns machten.
Ist es also in irgendeiner Weise nützlich, sich mit »so alten Sachen« zu beschäftigen? Kann man heute überhaupt Vergleiche anstellen mit dem, was gestern und vorgestern war? Gibt es denn noch die Klassen, die zueinander im Gegensatz stehen? Was ist inzwischen mit der Familie Sedlmayr geworden, deren damaliges Familienoberhaupt, Brauereibesitzer und Millionär, mit Unterstützung Georg von Vollmars 1884 in den Reichstag einzog, und der dann mit seiner National-liberalen Partei für die Verlängerung der Sozialistengesetze stimmte. Und was wurde aus der Familie des Schneiders Dotter, der 1885 wegen Zugehörigkeit zu einem verbotenen Gewerbeverein, Vorläufer heutiger Gewerkschaften, vor Gericht gestellt und wegen Geheimbündelei angeklagt wurde? Der als gebürtiger Österreicher, nachdem ihm bei der Verhandlung nichts nachzuweisen war, trotzdem er seit zwölf Jahren in München wohnte und hier verheiratet war, nach dem Prozeß des Landes verwiesen wurde.
Die Familie Sedlmayr ist heute noch im Besitz von zahlreichen Häusern, Grundstücken und Brauereiaktien der Spaten-Hacker-AG. Aber was wurde aus dem erst vor knapp drei Jahren ausgewiesenen persischen Doktoranden und seiner deutschen Frau?
Bei dem Begräbnis des im gleichen Prozeß von 1885 angeklagten einundzwanzigjährigen Sozialdemokraten Johann Kleinhönig, Schuhmacher aus Pöttmes bei Aichach, waren als Trauergäste auch Louis Viereck und Georg von Vollmar. Sie dürften für den an Lungenschwindsucht Verstorbenen keinen Nachruf sprechen, der königliche Polizeikommissär Klein entzog schon dem ersten Redner am Grabe das Wort.
Heute werden Arbeiter in München in so großer Zahl gebraucht, daß man sie nicht mehr aus den umliegenden Dörfern und Kleinstädten holen kann. Aus Griechenland, Jugoslawien, der Türkei, Italien und Spanien holt das Kapital seine Ausbeutungsobjekte. Ein Münchner Polizeipräsident ließ politisch engagierte Griechen, die vor dem Bürgerbräukeller gegen die Provokation ihrer faschistischen Militärdiktatur demonstrierten, mit massiertem Einsatz seiner Beamten auseinandertreiben und zusammenschlagen. Welcher Tradition folgt München heute? Oder kennt man nur die der König Ludwig I. – III., der Pschorr und Sedlmayr? Da treibt die Nostalgie literarisch und filmisch wild wuchernde Sumpfblüten, bis hin zu einem Führer samt seinen Verdauungs-, Trink- und Schlafgewohnheiten. Wo aber wird etwas von den wichtigen Entwicklungen Münchens zur modernen Industriestadt geschrieben aus dem Blickwinkel derer, die sie dazu machten?
Die ABC-Burg neben dem Gstingadn
»Gell, Papa, des is scho a oids Haus«, fordert mein fünfjähriger Namenserbe Auskunft, nachdem wir, auf dem Weg zum Kindergarten, den gekachelten Maulwurfgang unter dem Mittleren Ring hindurch, wieder ans Tageslicht klimmen. – Ja, es ist schon so an die siebzig Jahre her. Seither wird dort, in der Guldeinschule, der Schwanthalerhöhe-Nachwuchs mit Wissen um Bruchrechnung und die erste und zweite Vergangenheitsform in Deutsch präpariert.
Ich sag recht ungenau: »Ja, es ist ein altes Haus.« Weil ich halt einem Fünfjährigen noch nicht genau erklären kann, was sich so alles abgespielt hat in diesem nun schon recht verbrauchten Einmaleinszwinger. Sonst müßte ich erklären, daß nicht nur fürs Leben gelernt worden ist, hinter diesen grauen Mauern. Ich müßte ihm berichten, daß sein Urgroßvater an jenem 7. November 1918, zusammen mit vielen Kameraden in feldgrauer Landsturmuniform, in so einem Schulsaal campiert hat – bis am Nachmittag ein Demonstrationszug vorbeigekommen ist, mit dem Kurt Eisner an der Spitze.
Der hatte die Soldaten aufgefordert mitzugehen.
– Und der Urgroßvater war auch mitgezogen, mit allen anderen Mannschaftsdienstgraden, damit es eine Demokratie wird in Bayern, hatten sie gesagt, und damit der Krieg ein Ende nimmt, der Erste Weltkrieg war es damals gewesen. Und die Landstürmer waren die ersten Soldaten, die ihr Gewehr für sich selbst und für das Volk trugen – in München.
Der Kurt Eisner war am 8. November Ministerpräsident eines weiß-blauen Freistaates ohne König geworden, aber schon nach einem Dutzend Wochen von einem jungen Grafen, mit Namen Arco, auf dem Weg zum Landtag erschossen worden. Der Urgroßvater aber hatte sich wieder an eine Werkbank gestellt, aber das Gewehr, als republikanischer Schutzgardist, noch behalten. Die Arbeiter in Bayern hatten sich gefreut über ihre unblutige Revolution. Aber nur noch kurze Zeit dauerte es, da waren dann wieder Soldaten in der Guldeinschule einquartiert, Landsknechte vom Freikorps Epp, geführt von ehemals kaiserlichen Offizieren und geschickt von einem Minister namens Noske, der sich selbst, nicht ohne Stolz, den Beinamen »Bluthund« zulegte.
Dem Urgroßvater haben die eine Kugel in die Brust geschossen, damit der Fabrikant nebenan, der von der Gummikocherei Metzeler, keine Sorgen mehr um seinen Profit zu haben brauchte.
Und den hatte er ja auch machen können, im Zweiten Weltkrieg, mehr als genug, als der Freikorpsführer Epp, in brauner Uniform, als Reichsstatthalter residierte. Der lieferte die schlechte Bereifung für Räder, die für irgendeinen Sieg rollen sollten. Damals hatte auch noch an der Ecke dort die »Kinderanstalt« gestanden. »Deine Großmutter ist hier von den strengen protestantischen Gemeindeschwestern betreut worden, wenn die Urgroßmutter in der Fabrik Zigarren gewickelt hat.«
Weil ein paar amerikanische Brandbomben nur noch die Außenmauern der Gummifabrik stehengelassen haben, hat sie mitgeholfen, den Betrieb wieder aufzubauen, bald nach 1948. Nicht, wie sie vielleicht glaubte, für die Kinder, für sich und die anderen, sondern für den Eigentümer, der dadurch noch ein großes Stück reicher geworden ist. Naja, zu irgendeinem Sieg mußten die Räder ja rollen. – Übrigens, 1948, da hat man sich, auch dort in der Schule, die vierzig nagelneuen D-Mark abholen dürfen, Kopfgeld, auf daß alle gleich gewesen sind. »Gell, Papa, des do drübm is aber no koa so oids Haus?« – Nein, das ist noch nicht so alt wie die Schule. Das ist die Verwaltung der Fabrik, die ist schon öfters um- und auch mal wieder neu gebaut worden, je nach Konjunkturlage.
Aber alt, alt ist der Wunsch der Bewohner der Münchner Vorstadt Schwanthalerhöhe, von gut 25000 Arbeitern und Angestellten, daß dieser Stink- und Rußkoloß aus ihrem Viertel verschwinden möge. Doch statt des Gstingadn sind Hunderte von Menschen ins triste Stadtrandexil getrieben worden, erst vor ein paar Jahren, als man die vorbeilaufende Trappentreustraße zum Mittleren Ring erweitert hat.
RÄDER MÜSSEN ROLLEN FÜR DEN PROFIT! So heißt es heute in Abwandlung einer nicht mehr recht gängigen Parole, die für uns schon in der Originalfassung, als noch von Sieg die Rede, nicht die richtige gewesen ist. Doch was zählen offenbar schon die Wünsche der Mehrheit gegen die einer kleinen radikalen Minderheit, die bei uns in der Schwanthalerhöhe typischerweise den Namen Metzeler hat und uns mit Ruß aus ihren Schloten, eigentlich unseren, anschwärzt, uns eins husten läßt. –
Ach so, zur Gleichheit’48 wollte ich noch etwas sagen: Dreißig Jahre zuvor hat es schon recht gut angefangen, bloß zu einem Ende sind wir bis heute noch nicht gekommen. Denn daß man einem Räder-Rollen-Sieg-Fabrikanten zu einem in zwei Weltkriegen – bestimmt Von uns mühsam – erwirtschafteten Besitz auch noch saubere 40,– DM für seine neue, möglichst weiße Weste dazuspendierte, hätte mein Großvater bestimmt nicht verstanden.
Ob es meinem Sohn in der Guldeinschule von einem strebsamen Hauptlehrer verständlich gemacht wird?
Ich glaube doch, daß ich es ihm selber sagen muß.
Zwei Herzinfarkte
»Wenn ich nicht bald wieder auf dem Damm bin, werde ich auf eine andere Stelle gesetzt, vielleicht zurückgestuft. Mein Arzt meint, ich brauche viel frische Luft, auch das Sitzen belaste meinen Kreislauf sehr.« Jochen ist nun 54, ein kultivierter Mann mit vielseitigen Interessen, Sachbearbeiter bei einer großen Versicherung, Schadensabteilung. Soldat war er im Krieg, danach lange in Gefangenschaft, Frankreich, freiwilliger Reparationsarbeiter. »Ich hatte eingesehen, daß dieser Krieg der Nazis ein Verbrechen war, wollte wieder gut machen.« – Deshalb kam er recht spät erst dazu, eine Familie zu gründen, Ende der Fünfziger-Jahre. Seine Kinder sind noch im Schulalter, eine Tochter und ein Sohn.
»Begabt sind sie beide, aber ob ich es mir leisten kann, sie noch auf eine höhere Schule zu schicken – bei meinem Alter?«
Ein Jahr ist es her, an einem Sonntag war es, nach einem Stadtspaziergang mit der Familie zu einer Amateurmaler-Ausstellung. Jochen malt auch in seiner Freizeit. Daheim ist er dann zusammengebrochen. »Herzinfarkt!« sagte der Notarzt zu seiner verängstigten Frau und ließ ihn mit dem Rettungswagen sofort in die Klinik bringen. Gerade noch rechtzeitig, so daß man Jochen rettete. Vom März bis zum Juli mußte er im Krankenhaus bleiben, dann noch bis November zu Hause sich schonen – Krankenbetten sind rar in München wie anderswo.
»Halbtags kann ich schon wieder, aber der Ärger reicht für den ganzen Tag.«
Ärger?
»Zum Beispiel mit dem Urlaub. Mir stehen als Kriegsbeschädigtem vier Wochen zu. Kollegen haben mich darauf hingewiesen, daß ich meinen Jahresurlaub noch im Dezember nehmen müßte, weil er sonst verfällt. Was nach dem 10. Januar des nächsten Jahres nicht genommen ist, verfällt. Wie ich mich beim Personalchef wegen Urlaub gemeldet habe, meinte der, ich hätte schon zwölf Tage verbummelt – aber ich hätte ja das ganze Jahr Krankenurlaub gehabt, da sei es nicht so schlimm.«
Sein noch von der schweren Krankheit gezeichnetes Gesicht überschattet sich mit Verbitterung, wie er das erzählt.
Na, und euer Betriebsrat, was hat der zu dieser Urlaubskürzung gemeint?
»Wie der im Personalbüro angerufen hat, gesagt hat, was ist, wenn er zur Gewerkschaft geht mit dem Fall, da habe ich dann meinen ganzen Urlaub noch bekommen.«
Er meint, öfter dürfe er sich nicht so rühren, sonst …
Vierzehn Jahre versieht er nun seinen Dienst in der Schadensabteilung, so leicht macht ihm da keiner was vor. Aber jetzt, da so viele auf eine Stelle warten, in Schlangen am Vermittlungsschalter des Arbeitsamtes stehen, auch Jüngere, da muß man aufpassen, zu leicht wird man ausrangiert, durch einen ersetzt, der noch unverbraucht ist. Und dann hat er auch die Wohnung von der Versicherung. Als er angefangen hat, vor 14 Jahren, waren die Wohnungen für Familien mit Kindern noch so knapp, daß er sie nehmen mußte, obwohl er bereits damals dachte, daß sie einmal zur Fessel, zum Erpressungsinstrument werden könne.
»Mehr Lohn wollen Sie, Gehaltserhöhung? Sie können sich doch nicht beschweren, Sie haben doch eine günstige Miete!« Dabei macht die Versicherung jede mögliche Mieterhöhung mit, die das Gesetz erlaubt. Ängste sind es, die ihn an seinem Schreibtisch halten, gegen den Rat seines Arztes. »Wer nimmt schon einen Angestellten über fünfzig?« Ängste auch vor der Macht des Personalchefs, des Aufsichtsrates, der nur zweimal im Jahr Zusammentritt und dafür jeder sein Jahresgehalt als Aufwandsentschädigung bekommt; Ängste vor dem Hauptvorstand und der Direktion, für die nur Rendite und Profitüberlegungen maßgebend sind, nicht aber der Mensch – seine Arbeit ließ ihn darüber längst jeden Zweifel verlieren: »Sehen Sie zu, daß Personenschäden kostensparend abgewickelt werden!«
Und er macht mit, sogar in Überstunden. Knappst Unfallopfern von ihrer Entschädigung oder Rente ab, damit die Kasse der Aufsichtsräte, des Hauptvorstands, der Aktionäre stimmt. Elf Jahre noch wird er seinen Zorn darüber in sich hineinfressen, auf seine Würde verzichten, weil er Angst hat. Oder kürzer, weil sein Herz nicht mehr mitmacht.
Rudi Tourini hatte seinen Schreibtisch in der Warenannahme der großen Münchner Reifenfabrik stehen. Mit Jochen hatte er gemeinsam, daß er über ein Jahrzehnt, getrieben von Terminen, seine Arbeitskraft verschliß für die Rechnung eines Herrn Kaus, mit dem er weder verwandt noch verschwägert war. Bis der »den Laden« an einen Chemiekonzern verkaufte, ohne ihm und den mehr als fünftausend Leuten, die »den Laden« am Laufen gehalten hatten, etwas vom Millionenerlös zu überlassen. Auch die neuen Herrn schenkten Rudi Tourini nichts, als sie ankamen und überlegten, wie man die Fabrik noch rentabler arbeiten lassen, wie man die Griechen, Türken, Jugoslawen und Deutschen an den Reifenpressen noch mehr antreiben und den Kaufpreis schnell wieder herauswirtschaften lassen könne. Von einem Kollegen im weißen Mantel, den die Hauptverwaltung für Rationalisierungsstudien hergeschickt hatte, erfuhr er: »Im produktiven Bereich sind die Kapazitäten ausgeschöpft, Einsparungen können nur noch im Wartungs- und Verwaltungsbereich erzielt werden.« Für Rudi Tourini war das ein Alarmzeichen, er würde Arbeit bekommen, denn als Betriebsrat mußte er die Interessen seiner Kollegen vertreten.
Schon bei der Krise 66/67 hatte er kämpfen müssen gegen den Abbau von Sozialleistungen. 50,– Mark für einen Monat ohne Fehltage – eigentlich nicht das, was er sich wünschte, weil es kranke Kollegen an der Werkbank hielt. Aber was man einmal hat, soll man nicht mehr hergeben, sondern mehr dazu bekommen. Die Unterkünfte der ausländischen Kollegen waren ein anderes Problem, in das er sich verbissen hatte, im Stich gelassen sogar von vielen deutschen Vertrauensleuten, die gedankenlos meinten, »zu Hause haben es die auch nicht besser, da hausen die genauso verwahrlost«.
Tourini war Sozialdemokrat. Aber einer, der sich als Mitglied einer Arbeiterpartei fühlte, die einmal von Liebknecht und Bebel gegründet worden war. »Immer weitermachen, dann kommen wir schon einmal da hin, wo wir hin wollen«, hatte er oft gesagt. Ja, das habe ich auch im Nachruf auf ihn in der Betriebszeitung geschrieben. Denn Tourini kann nicht mehr weiterkämpfen, ein Herzinfarkt ließ ihn den Bleistift weglegen, kaum daß er seine fünfzig Jahre voll hatte. Jetzt müssen andere weitermachen, wie sie es von Rudi gelernt haben – gegen den entnervenden Leistungslohn, der bei Metzeler eingeführt werden soll, gegen das unmenschliche »Hinausrationalisieren« älterer Angestellter in eine hoffnungslose Arbeitslosigkeit, als Dank für jahrzehntelange ›Mitarbeit‹.
Eingangstor zur Gummifabrik, den ›G’stingadn‹ in der Schwanthalerhöh. Trotz Ruß und Gestank nahm das Unternehmen ständig an Umfang zu.
Aber nicht nur bei Metzeler. Ich werde mit Jochen reden müssen. In der Gewerkschaft ist er schon, ist damit weiter als viele andere Angestellte, die mit ihm bei der Versicherung arbeiten, Angst haben wie er. Rudi Tourini hat sich zu viel einsetzen müssen, bis sein Herz die dauernde Aufregung nicht mehr verkraftete. Wenn die Jochens ihre Herzen nicht mit der Angst belasteten – wenn sie gemeinsam kämpften, dann könnten die Tourinis sehr alt werden, die Jochens auch, ohne Angst.
Wem gehören die Städte?
Ich bin Münchener, lebe in der heimlichsten Hauptstadt des bundesdeutschen Großkapitals. Doch in den vergangenen Wochen, die mich durch viele andere Großstädte führten, fand ich überall Ähnlichkeiten, auch wenn nicht vor jeder Stadt die Rüstungsbetriebe wuchern wie bei mir zu Hause. In Köln, in Kassel, in Frankfurt fand ich vor, was ich von München schon kannte, und überlegte, wie es dazu kommen konnte.
Städte sind die bisher höchste Form organisierten Zusammenlebens der Menschen. Seit es Städte gibt, nützten sie den dort lebenden Menschen zur Weiterentwicklung der Produktivkräfte, der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Aber heute? Ich wohne in einer Vorstadt, deren Bewohner in den vergangenen hundert Jahren München zur Industriestadt gemacht haben, indem sie ihre beiden Hände den Fabrikherren verkaufen mußten. Mein Urgroßvater ist hier zugezogen vom Land, mein Großvater lebte hier, meine Eltern. Ich kann nicht sagen, wie lange ich noch hier wohnen kann, wie lange meine Nachbarn.
Als mein Urgroßvater herkam, hauste er noch in Elendsquartieren. Mein Großvater gründete eine Genossenschaft mit, damit seine Kinder besser leben sollten. Im letzten Krieg wurde viel zerstört und wieder aufgebaut. Aber heute fehlt es an Grünflächen, Kinderspielplätzen, die alten Schulen vom Anfang unseres Jahrhunderts sind schon ziemlich verbraucht. Neu hingegen sind einige Betonhochhäuser, die den Profit eines Kaufhauskonzerns und etlicher Banken vermehren sollen. Doch die Konzernherren sind noch unzufrieden, wollen eine Umgebung, in die kaufkräftige Kunden ziehen. Fordern von der Stadtverwaltung, mit entsprechenden Maßnahmen ihre Ziele zu fördern.
Und von wem fordern die Bewohner der alten Vorstädte »mehr Lebensqualität«, die nicht in einem Karstadtkaufhaus zu Schlußverkaufspreisen zu haben ist, von wem die in die neuen Stadtrandsiedlungen Vertriebenen, die nun die weiten Wege von und zur Arbeitsstelle haben, zu ständig höher werdenden Verkehrstarifen oder auf blechgefüllten Straßen, deren Erweiterung noch mehr von der alten, gewachsenen Stadt frißt? Sind es nicht ihre Städte, die da ohne Rücksichten auf die, denen sie Heimat sind, die sie mit gebaut haben, Stück um Stück, Haus um Haus, zerstört werden? Wieso kann eine kleine radikale Minderheit, deren Eigenart darin besteht, daß sie sich den Mehrwert aus der Arbeit unserer Väter und Großväter angeeignet hat, aneignet aus der unseren, über unsere Heimatstädte verfügen zu ihrem alleinigen Vorteil und Nutzen?
Es wird höchste Zeit, finde ich, daß wir unsere Städte wieder in die eigene Verwaltung nehmen. Weil nur wir wissen, was uns nottut, was uns und unseren Kindern nützt. Ich denke, UZ-Leser haben schon damit angefangen, sehen wir zu, daß wir bald mehr werden. Nur unsere Mehrheit kann unsere Städte wieder menschlich machen.
Anstelle eines Nachsatzes: Dialog mit einem jungen Familienvater aus meinem Viertel. Angesichts einer Planierraupe, die mit einem Schaufelbaggervorsatz die Pflasterung eines Großparkplatzes aufreißt:
Er: »Wird da jetzt auch zugebaut?«
Ich: »Nein, da kommt jetzt der Spielplatz hin, den wir schon lange von der Stadt gefordert haben. Fünf Jahre hat’s gedauert.« Er: »Was, ihr paar Kommunisten habt das gefordert?«





























