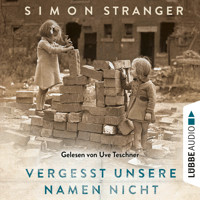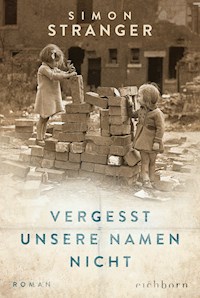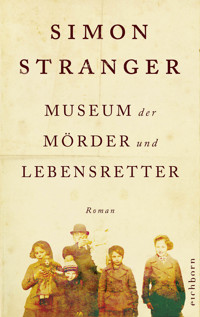
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Norwegen 1942. Rakel und Jacob Feldmann wagen den mutigen Versuch, vor dem nationalsozialistischen Regime nach Schweden zu fliehen. Doch kurz vor dem Ziel werden sie von ihren eigenen Fluchthelfern ermordet. Nur wenige Wochen darauf gelingt einer anderen jüdischen Familie die Flucht; sie übersteht den Krieg im Exil. Zwei Generationen später entdeckt der Autor Simon Stranger, dass die Schicksale dieser beiden Familien eng miteinander verbunden sind - eine Erkenntnis, die auch seine eigene Familiengeschichte in ein völlig neues Licht rückt.
Eindringlich schildert Stranger, wie eng Gut und Böse oft beieinanderliegen und wozu Menschen fähig sind, wenn das eigene Leben bedroht ist. Ein kluger, bewegender Roman von trauriger Aktualität.
»Ein Buch wie ein Stolperstein« Frankfurter Rundschau über Vergesst unsere Namen nicht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Foyer
Saal 1
Saal 2
Saal 3
Saal 4
Saal 5
Saal 6
Saal 7
Saal 8
Saal 9
Saal 10
Saal 11
Saal 12
Ausgang
Übersicht über das Museum
Zitate
Dank
Über das Buch
Norwegen 1942. Rakel und Jacob Feldmann wagen den mutigen Versuch, vor dem nationalsozialistischen Regime nach Schweden zu fliehen. Doch kurz vor dem Ziel werden sie von ihren eigenen Fluchthelfern ermordet. Nur wenige Wochen darauf gelingt einer anderen jüdischen Familie die Flucht; sie übersteht den Krieg im Exil. Zwei Generationen später entdeckt der Autor Simon Stranger, dass die Schicksale dieser beiden Familien eng miteinander verbunden sind - eine Erkenntnis, die auch seine eigene Familiengeschichte in ein völlig neues Licht rückt.
Über den Autor
Simon Stranger, geboren 1976, hat seit 2003 mehrere Romane, Kinder- und Jugendbücher veröffentlicht, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Sein Roman Vergesst unsere Namen nicht (2018) erhielt den norwegischen Buchhandelspreis und den Riksmål-Preis und erschien in über zwanzig Ländern. Museum der Mörder und Lebensretter war für den norwegischen Buchhandelspreis 2023 nominiert. Simon Stranger lebt mit seiner Familie in Oslo.
SIMON STRANGER
MUSEUM DER MÖRDER UND LEBENSRETTER
Roman
Übersetzung aus dem Norwegischen von Thorsten Alms
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der norwegischen Originalausgabe:»Museum for mordere og redningsmenn«
Für die Originalausgabe:Copyright © 2023 by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslowww.aschehoug.no
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2025 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Trainingkünstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille nach einem Design von Exil Design/Egil HaraldsenEinband-/Umschlagmotiv: Egil Haraldsen & Ellen Lindeberg | exil designeBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-7445-1
luebbe.delesejury.de
Die Ereignisse der Vergangenheit gleiten langsam in die Vergessenheit und verschwinden, wie die Spiegelungen der Wolken auf einer ruhigen Wasseroberfläche. Gleichzeitig ist die Vergangenheit stets ein Teil von allem, was wir tun, und lebt in jedem einzelnen Gegenstand fort, den wir berühren oder betrachten. Die Vergangenheit weilt in den Straßen, die wir entlanggehen, in den Gebäuden, die wir bewohnen, und in den Zimmern, in denen wir essen, schlafen, arbeiten und lieben. Die Vergangenheit ist in unseren Gedanken und Ideen gegenwärtig, in unseren Sprachbildern und Gesten, so eingewebt in unsere Vorstellungen von der Welt, dass sie unsichtbar bleibt. Nur ganz selten werden Fragmente der Vergangenheit durch den Raum und die Zeit aufsteigen und sich plötzlich ans Licht drängen, so wie in diesem Fall:
Es ist ein Nachmittag Ende Mai im Jahr 1943, am Skrikerudtjern, einem See in den Wäldern zwischen Norwegen und Schweden. In den Säulen aus mildem Abendlicht, das durch die Bäume fällt, leuchten die Schwärme schwirrender Mücken. Ein Specht hackt in einen Baumstamm. Dann bricht etwas Dunkles durch die Wasseroberfläche.
Es ist die Schulter eines Mannes.
Jetzt kommt auch sein haarloser Kopf zum Vorschein und wippt ein paar Mal auf und ab. Die Bewegung lässt kleine Wellen an der Oberfläche entstehen, die sich in konzentrischen Kreisen auf dem See ausbreiten, wie Notsignale. Seine Haut ist blauschwarz, und seine Gesichtszüge sind von der Zeit unter Wasser weggewischt. Der Körper wird vom Wind langsam durch den See getrieben.
So vergehen ein paar Stunden, bis das Geräusch von Schritten auf dem Pfad die Stille durchbricht. Ein Junge taucht zwischen den Baumstämmen auf und schaut nach dem Ruderboot, an dem er im vergangenen Winter mitgebaut hat. Jetzt liegt das Holzboot schief und krumm am gegenüberliegenden Ufer, voll mit Regenwasser. Das muss ausgeschöpft werden, denkt der Junge. Dann fällt sein Blick auf das dunkle Etwas an der Wasseroberfläche. Die Überreste eines Mannes, in ein Seil oder ein Netz gewickelt, entstellt und aufgedunsen. Der Junge läuft zum nächstgelegenen Hof, hämmert mit den Fäusten ans Tor und bewegt den Bauern dazu, die Polizei anzurufen.
Der zuständige Lensmann als Leiter der örtlichen Polizei eröffnet die Ermittlungen, erkennt aber sofort, dass diese sich als schwierig erweisen werden, denn das Gesicht des Toten ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Hosentaschen sind nach außen gekrempelt, und alle persönlichen Dokumente, die er bei sich gehabt haben könnte, sind verschwunden. Der Blick des Lensmanns bleibt an etwas Kantigem und Hartem unter der Weste hängen. Er öffnet die Knöpfe und entdeckt den Stein, der auf der Brust platziert wurde, befestigt mit einem stramm um den Körper gewickelten Metalldraht. Wahrscheinlich ein Versuch, die Leiche davor zu bewahren, entdeckt zu werden, was jedoch missglückt ist, da der Körper von den Gasen, die bei der Verwesung entstanden sind, aufgedunsen ist und sich der Schwerkraft widersetzt hat. Der Lensmann lässt die unidentifizierte Leiche zur Obduktion nach Oslo transportieren, aber es ist das Jahr 1943. Der Weltkrieg tobt, und er hat keinerlei Anhaltspunkte.
Der Waldsee birgt noch mehr Geheimnisse, denn nur eine Woche später steigt die aufgequollene Leiche einer Frau mittleren Alters an die Oberfläche, mit Mantel, Rock und braunen Strümpfen. Auch sie ist mit Metalldraht umwickelt, zwei flache Steine sind ihr unter die Strickjacke geschoben worden. Die Obduktion deutet darauf hin, dass beide Leichen seit Herbst 1942 im Wasser gelegen haben. In dem Herbst, in dem in Norwegen jüdische Familien verhaftet und in den Tod geschickt wurden.
Nur diejenigen, die an geheimen Orten versteckt oder über die Grenze nach Schweden transportiert wurden, unter Säcken von Brennholz oder Heuschobern, hatten die Möglichkeit, ihre Familienlinie weiterzuführen.
Eine von ihnen warst du, Ellen.
Liebe Ellen.
Du bist die Großmutter meiner Frau, die Urgroßmutter meiner beiden Kinder. Jede einzelne Abstammungslinie ist so zerbrechlich, dass ein einziger Riss eine Familie auslöschen kann, aber du wurdest von Fremden in ein sicheres Versteck gebracht. Du warst sechzehn Jahre alt, als der Krieg ausbrach, genauso alt, wie meine Tochter jetzt ist. Ich weiß, dass der Krieg dir deine Ambitionen und Träume genommen hat. Das Haus deiner Kindheit mit seinen Möbeln. Die Kleider, die Notenhefte und die Bücher. Ich weiß, dass der Krieg und die Verfolgung dir die Sicherheit geraubt und unsichtbare Wunden zugefügt haben, die du für den Rest deines Lebens mit dir getragen hast.
Ein sonderbarer und makabrer Teil dieser Geschichte ist gleichwohl verborgen geblieben, bis jetzt, denn achtzig Jahre nach den Leichenfunden im Skrikerudtjern löste sich ein Fragment aus der dunklen und moderigen Vergessenheit und stieg an die Oberfläche unserer Familiengeschichte. Es war nur eine Notiz eines Forschers vom Jødisk Museum, aber diese Notiz offenbarte, dass die Erzählungen von deiner Flucht, von den Mördern und dem ermordeten Ehepaar miteinander zusammenhängen. Dass du und deine Geschwister von einem Mörder gerettet wurdet.
EIN PORTRÄT DER FAMILIE GLOTT, mit Vettern und Cousinen, aufgenommen im Einfamilienhaus von Moritz Glott Anfang der Dreißigerjahre. Ellen und ihre Zwillingsschwester Grete tragen identische Kleider mit weißem Kragen, sehen sich so ähnlich, dass man unmöglich sagen kann, wer von ihnen wer ist.
EINE ABITURIENTENMÜTZE AUS ROTEM STOFF, der Name Ellen mit weißer Farbe auf die dunkle Krempe geschrieben.
DIE HISTORISCHE WETTERVORHERSAGE FÜR MITTE SEPTEMBER 1942, handschriftlich notiert und fünfzig Jahre lang in den Archiven des Meteorologischen Instituts aufbewahrt, bevor sie digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
Die notierten Wetterdaten zeigen, dass der Himmel in jenen Tagen über Oslo seine Schleusen öffnete und die Straßen zu kleinen Flüssen, die Treppen zu kleinen Wasserfällen und die Wege unter den Brücken zu kleinen Seen verwandelte.
Jedes Mal, wenn der Himmel sich so öffnet, läuft meine Tochter ans Fenster, vollkommen aufgeregt, dann eilt sie hinaus in den Garten. Während wir anderen im Haus bleiben, amüsiert und verwundert, legt sich meine Tochter auf die Terrasse, streckt die Arme zur Seite aus und lässt die Regentropfen dunkle Flecken auf ihren Kleidern bilden.
Wo war Ellen in diesen Septembertagen, als der Sicherheitsdienst an ausgewählte Adressen fuhr, mit dem Befehl, die Eigenheime und die Geschäfte wohlhabender Juden zu beschlagnahmen?
An einer Stelle im Talmud, dem heiligen Buch der Juden, steht, dass wir die Welt nicht so sehen, wie sie ist, sondern so, wie wir sind. Unsere Vorstellungen und Erfahrungen, unsere Vorurteile und Erwartungen färben das, was wir sehen, und bestimmen, worauf wir Wert legen und was unserer Aufmerksamkeit entgeht. So läuft auch jeder Versuch, die weißen Flecken in dieser Erzählung auszufüllen, und jeder Versuch, eine Brücke heraufzubeschwören zwischen den Bruchstücken, von denen ich weiß, und jenen, die verschwiegen worden sind. Den Erinnerungen, die zu schmerzhaft gewesen sein mussten, um sie teilen zu können.
Ich stelle mir das Villenviertel vor, in dem Ellen lebte, mit weißen Lattenzäunen, hinter denen krumme Obstbäume in den Gärten wuchsen.
Dort kommt sie gerade von ihrer Klavierstunde nach Hause, den Kopf unter dem Regenschirm, ihre patschnassen Stiefeletten gurgeln und quietschen mit jedem Schritt.
Dreimal die Woche geht sie zu Rieflings Klavierinstitut, um ihre Technik zu verbessern und der Rückmeldung der Pädagogin zu lauschen. An den anderen Tagen übt sie zu Hause an ihrem Flügel. Achtet darauf, sich vor jeder Übung aufzuwärmen, lässt niemals die Tonleiterübungen schleifen, verpasst niemals das Dehnen der Unterarme und Finger im Anschluss, weil es bei ihrem Vorhaben, als Konzertpianistin zu leben, nicht nur darum geht, anspruchsvolle und emotionale Kompositionen vorzuführen, sondern auch die physischen Voraussetzungen zu erfüllen, die dafür vonnöten sind. Sich bloß keine Sehnenscheidenentzündungen einzuhandeln. Geschmeidige und starke Finger zu haben. Mehr als alles andere geht es in einem Leben als Pianistin darum, die raschen Phrasierungen einer Fuge von Bach oder die großen Sprünge in einer Etüde von Chopin ohne Verzögerungen zu spielen, ohne den Anflug eines Fehlers, mit derselben Leichtigkeit und Eleganz, die man auch von einem Turner erwartet. So hat sie es von Kindesbeinen an geübt. Wenngleich es immer noch ein weiter Weg bis nach oben zu den Klaviervirtuosen ist, die sie wirklich bewundert, weiß Ellen ganz genau, dass sie Talent hat und dass sie es in sich trägt, als Pianistin Karriere zu machen. Dieser Weg beginnt mit ihrem Debütkonzert im Frühjahr. Obwohl draußen der Weltkrieg tobt, und obwohl Norwegen besetzt ist, verlaufen die jährlichen Konzerte und Talentwettbewerbe wie geplant. Im kommenden Frühjahr wird sie sich an den Flügel in der großen Aula setzen dürfen. Auf dem Pianohocker unter Munchs strahlender Sonne, so hat sie es sich vorgestellt, immer und immer wieder, und den Augenblick herbeigesehnt, an dem sie endlich aus ihrer Rolle als Zuschauerin heraustritt und stattdessen selbst herbeigeklatscht wird. Diejenige zu sein, auf die die Blicke und Erwartungen aller gerichtet sind, und nur noch die Nervosität und das Lampenfieber überwinden zu müssen, damit sie ihnen zeigen kann, was sie gelernt hat.
Die achtzehn Jahre alte Ellen geht den Weg entlang, ihre quietschenden Stiefeletten klatschen auf die Pflastersteine. Schon bei der Einfahrt kann sie erkennen, dass etwas geschehen sein muss, denn dort stehen zwei schwarze Wagen von der Tabakfabrik. Die Großeltern sind wohl vorbeigekommen, aber die Familie benutzt nie zwei Autos zur selben Zeit, es sei denn, sie machen einen längeren Ausflug. Und warum um alles in der Welt sollten sie jetzt, bei diesem Unwetter, einen Ausflug machen wollen? Sie eilt durch die Pforte, spürt den knirschenden Kies unter den Füßen und schüttelt, sobald sie unter dem Dachvorsprung steht, das Wasser vom Regenschirm.
Sie öffnet die Eichentür. In der Eingangshalle hat sich die gesamte Familie versammelt: Großvater Moritz und Großmutter Rosa Olivia, Ellens Mutter, Tante Solveig und die kleine Cousine Astrid. Auch der Vater Thorleif ist bereits von der Arbeit gekommen, obwohl er sonst niemals so früh zu Hause ist. Ihr Chauffeur steht neben ihnen, die Uniformmütze in den Händen, in den Gesichtern der Familie liegt ein fremder, ernster Ausdruck.
»Wir haben versucht, dich im Institut anzurufen«, sagt die Mutter. »Aber du warst gerade losgegangen.«
»Die Deutschen haben unser Haus beschlagnahmt«, sagt ihr Großvater und erzählt, dass vor anderthalb Stunden plötzlich drei deutsche Offiziere mit einem Schreiben der Behörden vor ihrem Haus in Nordstrand standen. Die Dokumente hielten fest, dass die Besatzungsmacht von jetzt an die rechtmäßige Eigentümerin sowohl des Wohnhauses als auch des Inventars sei. Möbel, Kunst, Kleider, Schmuck, eingekochte Zwetschgen, Geschirr, Gläser, Teppiche. Alles gehörte jetzt ihnen.
Ellen möchte ihn fragen, wie die Behörden ihren Beschluss begründen, reißt sich aber zusammen, bevor ihr die Worte über die Lippen kommen, denn die Antwort ist natürlich der Teil ihrer Identität, der gerade schlummert, den sie verborgen hält. Weil er Jude ist. Obwohl es bereits fünfzig Jahre her ist, dass Großvater Moritz norwegischer Staatsbürger wurde, hat er das Recht auf sein Eigentum verloren.
Der Gedanke schickt nervöse Zuckungen durch Ellens Inneres, sie senkt den Blick und starrt hinunter auf das Teppichmuster, denn jetzt versteht sie, warum die Großeltern einen Hof im Gudbrands-Tal kauften, als der Krieg ausbrach. Jetzt versteht sie, warum der Großvater so vorausschauend war, sämtliche Anteile an der Tabakfabrik an andere Familienmitglieder zu überführen, wie beispielsweise an ihren Vater. Weil er damals bereits wusste, dass ihm alles aus den Händen gerissen würde.
*
Wie alt warst du, Ellen, als dir bewusst wurde, dass du ein Erbe mit dir herumtrugst, das dich von den meisten anderen Schülern unterschied? Wie alt musstest du werden, ehe du verstandest, dass die Familien, die deine Eltern als die Dworskys und die Kleins kannten, einen Hintergrund hatten, den viele verdächtig und abstoßend fanden? Dass es etwas in dir gab, das anders war? Ein Unterschied, der durch Gegenstände und Bräuche sichtbar gemacht wurde. Wie etwa den siebenarmigen Leuchter bei deinen Großeltern, oder die Geschäfte, die ihr normalerweise besuchtet, die von Juden betrieben wurden, oder die paar Worte, die du auf Jiddisch sagen konntest. Die Freude, auf einem Jugendball für den jüdischen Nachwuchs tanzen zu dürfen, wurde von der spürbaren Furcht nach den Novemberpogromen 1938 und von den ständig gehässigeren und judenfeindlichen Reden von Quisling zerstört. Bald darauf kam der Krieg ins Land, und bald versteckten du und deine Familie ihr jüdisches Erbe, aus Furcht vor der Verachtung oder der Wut, die es bei anderen auslösen konnte.
Ich versuche mir den Abschied vorzustellen. Ein Chaos aus Umarmungen, feuchten Augen und Glückwünschen, bevor die Großeltern wieder hinaus zum Auto eilen und davonfahren. Ich sehe vor mir, wie du ein paar Sekunden stehen bleibst, so erschüttert, wie du es nicht mehr warst, seit der Fliegeralarm über der Stadt heulte, als der Krieg ausbrach.
DREI TROMPETENGLEICHE SIRENENTÖNE als Warnung vor einem Fliegerangriff. Wie in dem griechischen Mythos über die Sirenen, die Seeleute mit ihrem hypnotisierenden Gesang in den Tod zogen, holte der heulende Fliegeralarm die Familie am Morgen des 9. April 1940 aus den Betten und trieb sie nach draußen auf die Straße, wo immer mehr Familien zusammenströmten, alle mit demselben verwirrten Gesichtsausdruck und denselben fragenden Blicken: Geschieht das hier gerade wirklich? Ist der Krieg tatsächlich auch bei uns angekommen?
EINE SCHWARZWEISSFOTOGRAFIE der Osloer Universitätsaula mitten im Zentrum der Stadt, April 1940, an ihrer Fassade Banner mit Hakenkreuzen auf beiden Seiten der Eingangssäulen, der Universitätsplatz gefüllt mit begeisterten Mitgliedern der norwegischen Nazipartei »Nasjonal Samling«, Nationale Vereinigung. Junge Menschen in Uniformen, alle Gesichter in dieselbe Richtung gewandt, strahlend wie Sonnenblumen auf einem Acker, wie sie den Anblick von Quisling am Rednerpult in sich aufsaugen und sich von seiner pathetischen Rede mitreißen lassen, über die Prüfungen, die Norwegen bevorständen. Über die Notwendigkeit, die Bolschewiken auszumerzen, das Weltjudentum auszuradieren und den Weg in eine neue Zeit zu bahnen.
EIN PORTRÄT DES SS-OBERFÜHRERS HANS LORITZ, mit dem Totenkopf auf der Uniformmütze, ein Emblem, das ursprünglich von den Leibwachen des deutschen Kaisers getragen wurde:
Hans Loritz war Lagerkommandant des Konzentrationslagers Sachsenhausen vor den Toren Berlins und dafür verantwortlich, dass mehr als zehntausend sowjetische Kriegsgefangene mit Genickschüssen hingerichtet wurden. Er wurde nach einem Korruptionsskandal aus dem Amt entfernt, weil er Kriegsgefangene dafür benutzt hatte, ein Bootshaus neben seiner Villa zu bauen. Zur Strafe wurde er nach Norwegen geschickt. Dieser Lagerkommandant ist einer von den drei Deutschen, die vor dem Eigenheim von Großvater Moritz in Nordstrand auftauchen, um es zu konfiszieren, und er ist derjenige, der in das Haus einziehen würde, der in einem der Betten schlafen würde, der die hinterlassenen Vorräte und den Branntwein genießen würde und die Aussicht über den Fjord, über den Kriegsschiffe und Frachter glitten.
EINE MOMENTAUFNAHME VON ELLEN, mit ihren Geschwistern und ihrem Großvater Moritz Glott, aufgenommen irgendwann in den Dreißigerjahren. Ellen steht ganz links im Bild mit einer Puppe in den Händen. Sie hat wohl viel länger mit Puppen gespielt als üblich, als wollte sie die Welt nicht loslassen, die sie selbst kontrollieren konnte. Der Zaun, den man im Hintergrund des Bilds erkennen kann, deutet darauf hin, dass das Foto vor der Villa der Großeltern in Nordstrand aufgenommen worden ist.
EINE ZIGARETTENSCHACHTEL AUS METALL, DIE VORDERSEITE BEDRUCKT MIT DEM WORT Akaba.
Moritz Glott floh vor den Pogromen und der Armut aus der ländlichen Gegend um Kyjiw und studierte Tabakanbau in England, ehe er sich im Jahr 1890 in Norwegen niederließ. Hier lernte er die Nordnorwegerin kennen, die Ellens Großmutter werden sollte, Rosa Olivia. Gemeinsam bauten sie sich ein Leben auf, von einem winzigen Tabakladen in Grünerløkka bis zu einer Fabrik mit über hundert Mitarbeitern und einem solchen Gewinnüberschuss, dass die Familie sich nie wieder Gedanken über Geld machen musste. Bis jetzt.
Im vergangenen Jahr hat sich die Politik gegenüber allem Fremden verschärft, und in den letzten Monaten ist sehr deutlich geworden, dass die Besatzungsmacht nur auf einen Anlass gewartet hat, um eine größere und härtere Aktion gegen die Juden im Land durchzuführen.
Der 22. Oktober 1942 bringt den Anlass, auf den die Behörden gewartet haben. Ein Pistolenschuss, abgefeuert auf einen Polizisten in einem Zug von Oslo nach Halden. An Bord des Zuges befindet sich Herman Feldmann, der Sohn des Ehepaars, dessen Leichen später im See gefunden werden. Er ist auf der Flucht vor den Behörden. Diese Flucht, und dieser Schuss, sollten die Verfolgung aller norwegischen Juden in Gang setzen.
EIN EINFACHER STEMPEL der Buchstabe J für JUDE, aus Blei gegossen, aus dem Bestand des Jüdischen Museums in Trondheim.
So einfach und zuverlässig kann eine Tötungswaffe aussehen: ein Buchstabe und ein Stempelkissen. Eine Markierung für uns und eine für sie, wie bei den alttestamentarischen Markierungen aus Blut an den Torpfosten oder Türen ausgewählter Familien.
DER PERSONALAUSWEIS VON HERMAN FELDMANN mit dem vom zuständigen Sachbearbeiter fehlerhaft buchstabierten Nachnamen.
Es ist Donnerstag, der 22. Oktober 1942, die Türen zur Halle des Ostbahnhofs schwingen auf, als Herman Feldmann durch den Eingang eilt. Herman presst seinen Arm fest gegen die Jacke, um sicherzustellen, dass der Umschlag mit dem Geld nach wie vor dort ist. Zweitausend Kronen haben ihm seine Eltern gegeben, damit er genug Mittel hat, um in Schweden zurechtzukommen. Zweitausend Kronen – ein halbes Jahresgehalt. Und jetzt steckt ein halbes Arbeitsjahr in seiner Brusttasche.
Herman lässt seinen Blick über die Menschenmenge schweifen. Er darf jetzt nicht nervös oder verzweifelt wirken, falls irgendwelche Nazis in Zivil sich unter den Passagieren verstecken, also blickt er ungezwungen zur Bahnhofsuhr hinauf, schlendert zum Bahnsteig und versucht, sich so normal und unauffällig wie möglich zu bewegen. Eine Gruppe von jüdischen Pärchen steht nicht weit von ihm entfernt, sieben oder acht Personen. Herman bemerkt, dass einer der Männer zu ihm hinüberschaut, und sieht schnell in eine andere Richtung, damit nicht irgendein Fremder mitbekommt, dass sie einander kennen. Er ist also nicht der Einzige, der mit diesem Zug fahren will. Herman lässt den Blick weiter über die Bänke schweifen und entdeckt seinen Kameraden, mit dem er gemeinsam fliehen wird. Willy kommt mit einer Zeitung unter dem Arm an den schwarzen, gusseisernen Pfeilern vorbei auf ihn zu. Er lächelt nervös und reicht ihm die Hand zum Gruß.
»Dann warten wir nur noch auf den Letzten im Bunde«, sagt er. Herman nickt und sieht einen Mann mit glatt gekämmtem Mittelscheitel auf sie zuschlendern. Herman braucht eine Weile, bis er die Verkleidung durchschaut und Karsten Løvestad erkennt. Bauernsohn aus dem Grenzgebiet, der regelmäßig den Laden von Hermans Eltern aufsuchte, um dort Leder und Pelze zur Kleiderproduktion zu verkaufen. In den ersten Kriegsjahren hat er auch Kleidung gegen Nahrungsmittel vom Hof seiner Eltern getauscht. Jetzt streckt ihm Karsten die Hand entgegen, klopft Herman auf die Schulter und bittet die beiden Freunde, ihm zu folgen. Herman schaut hinunter auf die Gleise, sein Blick folgt den Schienen aus der Bahnhofshalle hinaus, wo der Regen herabstürzt und einen grauen Vorhang bildet.
So schmal kann der Weg zum Überleben sein: zwei parallel verlaufende Schienen aus blankgewetztem Metall, hier und da braun vom Rost, die sich vom Osloer Hauptbahnhof ostwärts nach Schweden strecken. Zwei Schienen, Schwellen aus grob gehauenem Holz, ein Waggon aus Eisen, Holz und Glas, der sie in die Freiheit führen soll.
»Dort kommt unser Zug«, sagt Karsten und deutet mit einem Kopfnicken zu der Lokomotive, die langsam aus dem Regenwetter in die Bahnhofshalle einrollt, mit einem solchen Lärm, dass alle Gespräche automatisch unterbrochen werden. Ein Strom von Fahrgästen, ein paar Minuten Gedränge und Geschubse, dann steigen die drei Männer in einen der letzten Waggons und finden drei freie Plätze auf den rot bezogenen Sitzen. Es vergehen ein paar Sekunden, dann bläst der Schaffner in seine Pfeife.
Die Pfeiler auf den Bahnsteigen gleiten an den Zugfenstern vorbei, und kurz darauf bricht der Zug ins Tageslicht. Die Regentropfen ziehen schiefe und unvorhersehbare Bahnen über die Fensterscheiben.
»Auf nach Halden«, sagt Karsten und klatscht sich mit der flachen Hand auf die Knie.
Das rhythmische Poltern des Zuges über die Gleise pflanzt sich durch den Waggon fort und weiter durch Hermans Körper. Er hat seine Aufmerksamkeit auf den Fjord gerichtet. Dunkle Wolken hängen über der Insel Hovedøya, und die Festung Akershus liegt teilweise verborgen hinter einem Vorhang aus Regen. Kindheitserinnerungen an die Ausflüge zur Festungsanlage steigen in ihm auf, gemeinsam mit der Frage, ob er jemals wieder nach Hause zurückkehren wird.
Der Zug hält am Bahnhof von Ljan. Niemand kommt, um sie zu kontrollieren. Auch nicht an den Bahnhöfen von Ski, Moss oder Skjeberg. Jetzt sind es nur noch wenige Haltestellen bis Halden. Dort wird Karstens jüngerer Bruder sie im Schutz der nächtlichen Dunkelheit über den schmalen Sund zwischen Norwegen und Schweden rudern und sie in die Freiheit und Sicherheit entlassen.
Plötzlich wird die Tür zu ihrem Waggon aufgerissen. Der Lärm des ratternden Zuges dringt in ihr Abteil, als sich zwei Männer in Anzügen vor ihnen aufbauen.
»Ausweise, bitte!«, sagt der vordere der beiden und zieht eine Polizeidienstmarke aus der Brusttasche. Herman sieht zu Karsten hinüber. Die Angst pocht in seinem Bauch, doch er weiß nichts anderes zu tun, als seinen Ausweis zu ziehen, auf dem der Buchstabe J wie JUDE über seinem Passbild aufleuchtet.
»Aha? Wohin sind Sie denn unterwegs?«, fragt der Polizist.
»Nach Halden«, antwortet Herman und versucht so ruhig und freundlich wie möglich zu klingen.
»Und was haben Sie dort vor, so spät am Abend?«, fragt der Polizist.
»Wir sind zu einer Gesellschaft eingeladen«, antwortet Karsten, klar und deutlich.
Der Polizist nickt, wirkt aber nicht überzeugt. Er nimmt die Ausweispapiere von Karsten entgegen. Betrachtet erst das Bild, dann Karsten, bevor er den Namen vorliest.
»Harald Jensen?«
Karsten nickt.
»Und Sie kommen aus?«
»Halden.«
»Tatsächlich?«
Der Polizist prüft das Bild, wirft einen nachdenklichen Blick auf Karstens Gesicht, und dann scheinen sich die Falten in seinem Gesicht zu glätten.
»Kommen Sie drei bitte mit nach draußen auf den Gang«, sagt der Polizist, dann dreht er sich zu seinem Kollegen um und sagt etwas, das Herman nicht versteht. Herman sieht gerade noch, wie Karsten etwas aus der Innentasche seines Mantels holt, im nächsten Moment zuckt er beim ohrenbetäubenden Knall einer Pistole zusammen.
Der Widerhall des Knalls wird von den Wänden des Waggons verstärkt.
Der getroffene Polizist kann Karsten noch mit der Faust ins Gesicht schlagen, bevor er auf dem Boden zusammensackt. Dort bleibt er liegen, spuckt Speichel und Blut. Der andere Polizist ist verschwunden, um Hilfe zu holen.
»Verdammte Scheiße!«, ruft Willy.
»Wir müssen abhauen!«, sagt Karsten, mit blutender Nase.
Abhauen, denkt Herman. Aber wie?
Karsten steigt über den leblosen Körper auf dem Boden und reißt die Tür zwischen den Waggons auf, dann winkt er Herman und Willy hinter sich her. Vor dem Fenster fliegen die Schwellen und Felder vorbei. Wie schnell fahren sie? Fünfzig Kilometer in der Stunde? Mehr? Der Abhang ist voller Schotter.
Karsten reißt mit Gewalt die Zugtür auf.
»Springt mir hinterher!«, ruft Karsten. Der Wind lässt seine Haare gerade zur Seite stehen und in sein Gesicht peitschen.
»Das ist doch verrückt«, murmelt Willy. Gleichzeitig wissen sie, dass Polizeiverstärkung auf sie warten wird, sobald der Zug in den nächsten Bahnhof rollt.
Karsten wartet noch ab. Der Zug überquert eine Eisenbahnbrücke, fährt an einer Kirche vorbei, dann folgt eine lange Strecke mit Feldern auf beiden Seiten der Gleise. Allmählich verlangsamt der Zug seine Fahrt.
»Der Zug bremst schon für den nächsten Bahnhof, und dort wird die Polizei schon auf uns warten – wir müssen hier abspringen!«, ruft Karsten. »Viel Glück!«, wünscht er noch, dann wirft er sich in die Dunkelheit.
Alles geht so schnell. Herman sieht seinen Fluchthelfer nur noch mit ausgebreiteten Armen durch die Luft flattern. Sieht, wie seine Jacke nach oben schlägt, und erblickt für einen kurzen Moment eine Schuhsohle, dann landet Karsten auf dem Feld und rollt sich ab.
Er muss sich beeilen, sie dürfen nicht zu weit voneinander entfernt landen, denkt Herman, klammert sich an den Türrahmen und spürt, wie sein Körper sich sträubt.
PARAGRAF 2 AUS DEM GRUNDGESETZ VON 1814: Juden ist die Einreise ins Reich weiterhin untersagt.
DER BESCHLAGNAHMUNGSBESCHLUSS der deutschen Sicherheitspolizei der festlegt, dass auch Ellens Elternhaus im Heggeliveien von hochrangigen Deutschen übernommen und die ganze Familie hinausgeworfen wird.
Es ist erstaunlich, worüber wir schweigen. Aus dem Elternhaus vertrieben zu werden, wird ein Trauma gewesen sein, das sich für den Rest des Lebens festgebrannt haben muss, aber niemand in der jetzigen Generation der Familie hat die Eltern oder Großeltern je darüber sprechen hören. Nichts ist niedergeschrieben, bis auf die Listen der beschlagnahmten Gegenstände im Reichsarchiv. Dort ist die Szenografie des Familienlebens aufgelistet, Raum für Raum, Gegenstand für Gegenstand.
Ich stelle mir die schwarzen Autos vor, die vorgefahren sind. Die deutschen Amtsträger oder Offiziere, die an der Haustür klingeln, unterstützt von Männern mit Waffen und kalten Augen. Dann kommt der Bescheid, dass die Familie gehen muss und nur zwanzig Minuten hat, um ihre Sachen zu packen. Die Wut und die Angst müssen wie dunkle Wolken in den Zimmern geschwebt haben. Ich sehe Ellens Vater vor mir, der auf seinem Schuldeutsch mit norwegischem Akzent sagt, dass er in Norwegen geboren sei. Dass seine Mutter Norwegerin ist. Dass er in der Uranienborg-Kirche getauft wurde, aber all das hilft nichts. Ich sehe die Schubladen und Schränke vor mir, die geöffnet werden, höre das Klappern der Schuhe in den Fluren und imaginiere das frenetische Suchen nach den Dingen, die sie mitnehmen wollen. Ellen steht wie gelähmt in ihrem Schlafzimmer, außer Stande zu begreifen, was sich vor ihren Augen abspielt, während die Gegenstände, die sie bisher als selbstverständlich angesehen hat, mit einer neuen und beinahe glänzenden Bedeutung hervortreten:
Das Bett, die Bücher, die Decke und das Bettzeug. Der Kleiderschrank, die Zeichnungen an der Wand, die Abiturientenmütze, die an einem Nagel hängt. All das muss sie jetzt einfach hinter sich lassen. Für immer? Und wo sollten sie jetzt hin?
Nach Schweden ziehen können sie nicht, da es verboten ist, die Grenze zu überqueren, denkt Ellen und stopft ein paar Unterhosen in die Seitentasche ihres Koffers. Und wenn sie doch nach Schweden fliehen müssen, auf illegalem Wege, dann darf sie das Debütkonzert in der Aula nicht geben. Dann war das gesamte Üben und Schinden vergebens, denkt sie, aber versteht auch allzu gut, dass dies das Letzte ist, an das sie jetzt denken sollte. Sie müssen einfach ein neues Zuhause finden, aber wo? Wo um alles in der Welt sollen sie wohnen? Die Familie verlässt das Haus, es folgt die beschämende Untersuchung durch die Wachleute. Sie verlangen, alles durchzusehen, was die Familie eingepackt hat. Sämtlicher Schmuck wird konfisziert. Auch das Goldkreuz, das die Mutter stets um den Hals trägt. Ellens Mutter bricht in Tränen aus, und Thorleif erklärt, dass sie das Schmuckstück von ihrer Mutter geerbt hat, doch das spielt keine Rolle, denn der Wachmann antwortet nur: Und jetzt gehört es uns.
EINE MASCHINENGESCHRIEBENE LISTE DER BESCHLAGNAHMTEN GEGENSTÄNDE aus Ellens Elternhaus, mit dem durchgestrichenen Namen einer unbekannten Person:
Ihr Flügel. Die elf Stühle im Esszimmer. Ein Sofa, auf dem sie hin und wieder lag und las. Alles zusammen mit der größten Selbstverständlichkeit von einem Nazi übernommen, der einzog und das Haus zu seinem machte.
Die genauen Details aus dem Leben von Ellen und ihrer Familie sind im Tal des Schweigens versunken, in Vergessenheit geraten. Aber da die Eltern offensichtlich entschieden haben, in Norwegen zu bleiben, müssen sie auch eine neue Bleibe gefunden haben, wahrscheinlich über Thorleifs Kontakte.
Eine Wohnung, in die sie sozusagen direkt einziehen können, und mit einem Zimmer hinter der Küche für das Dienstmädchen, wie bisher. Sie müssen versucht haben, ihr bisheriges Leben fortzusetzen, Schule, Arbeit, Klavierstunden am Institut, aber Anfang Oktober erreicht sie die Nachricht über den Ausnahmezustand in Trondheim. Über die Juden, die dort verhaftet oder getötet worden sind, über die vom Staat beschlagnahmten Geschäfte. In jüdischen Kreisen schwirrt die Frage umher, ob man es wagen kann zu bleiben oder ob man eine Flucht versuchen sollte.
EIN RASIERMESSER, EIN RASIERPINSEL MIT WEICHER BORSTE UND EINE DOSE MIT SCHÄUMENDER SEIFE.
Die beiden Geschäfte von Rakel und Jacob Feldmann lagen nur ein paar hundert Meter von der Glott’schen Tabakfabrik entfernt. Sie sind mit der Unterstützung von Moritz Glott gegründet worden. Im hinteren Teil eines der beiden Lokale befand sich ein Barbier. Ist es nicht wahrscheinlich, dass Thorleif Glott gelegentlich dort vorbeigegangen ist, um sich die Haare stutzen und den Bart rasieren zu lassen, und dabei einen kleinen Plausch zu halten?
Ich stelle mir vor, wie Thorleif an einem Nachmittag im Oktober 1942 vorbeischaut, getrieben von dem Drang, sich Klarheit zu verschaffen, über die Gerüchte, die Feldmanns hätten begonnen, ihr Warenlager abzuverkaufen. Ich stelle mir vor, wie er den Herrenausstatter Nobel betritt, wie das Glöckchen über der Tür läutet, und wie sich Jacobs Gesicht erhellt, als er ihn erblickt.
Thorleif setzt sich in den Barbierstuhl, und während Wangen und Hals mit weißem Schaum eingeseift werden, erzählt Jacob von den Plänen, an den letzten friedlichen Ort in Nordeuropa – Schweden – zu fliehen und dort erneut Fuß zu fassen. Das Geschäft ist leer. Niemand kann sie hören, also öffnet sich Jacob, berichtet über die bevorstehende Flucht seines Sohnes Herman und ihre Pläne, ihm auf der Flucht zu folgen. Deswegen würden sie auch ihr Warenlager abverkaufen, sagt Jacob, bevor er Thorleif mit einem Handtuch die Schaumreste aus dem Gesicht wischt.
Thorleif bezahlt und wünscht ihnen viel Glück, dann nimmt er seinen Mantel und geht zum Auto. Ich stelle mir die folgenden Tage vor, bei der Arbeit, am Klavier, in der Schule und im Studium. Herbstlaub, das sich braun färbt und in den Parks zu Boden fällt.
Der Nachmittag des 22. Oktober 1942 bricht an.
Der Zug nach Halden verlässt den Hauptbahnhof von Oslo. Ein Schuss wird abgefeuert, und Herman Feldmann steht in der Türöffnung eines fahrenden Zuges, sieht Büsche und kleine Bäume vorüberziehen und überlegt, ob er springen soll.
EINE FOTOGRAFIE DER ZUGSTRECKE, AUF DER HERMAN WÄHREND DER FAHRT ABGESPRUNGEN IST.
Wie viele Male hat Herman sich in seinem Leben auf einen Sprung vorbereitet? Als kleines Kind aus dem Bett? Vom gezimmerten Rand einer Sandkiste? Von einer Bank? Einem Zaun? Einem Sprungbrett in einer Schwimmhalle?
An warmen Sommertagen hat Herman auf einer Klippe auf Bygdøy am Fjord gestanden, hat auf das glitzernde Wasser hinausgesehen, um zu prüfen, ob es klar war, ehe er sich hineinwarf. Seine Arme ruderten in der Luft, dann traf er mit einem dumpfen Klatschen auf die Wasseroberfläche und erzeugte Tausende von mikroskopisch kleinen Luftblasen. Er war auch von einer Klippe am Lysakerfluss gesprungen und vom Sprungturm eines der öffentlichen Bäder in der Stadt, aber dieser Sprung ist etwas anderes, denn es ist nicht Sommer.
Es ist kein Wasser unter ihm, und er steht auch nicht auf einer Klippe, umgeben von den Stimmen seiner Freunde, von Vogelgezwitscher, Gelächter und summenden Insekten. Es ist Ende Oktober, es ist eiskalt, und der Gedanke, sich von einem klapprigen Zug zu werfen, ist ebenso verwirrend wie furchterregend, aber dasselbe gilt für das, was ihn erwartet, wenn er jetzt stehen bleibt. Karsten ist bereits gesprungen, der Zug wird immer langsamer in der Anfahrt auf den nächsten Bahnhof. Jetzt oder nie, denkt Herman und wirft sich hinaus in den Regen und die Dunkelheit, die Arme ausgestreckt, um das Gleichgewicht zu halten.
Der Luftdruck presst gegen seinen Körper, er spürt die Wassertropfen auf seiner Haut. Hört das Donnern des Zuges auf den Schienen, vor seinen Augen nichts als Wildnis aus Sträuchern, dann trifft er den Boden und wird herumgeworfen.
Die Luft entweicht aus seinen Lungen. Er schließt die Augen, liegt mit dem Bauch auf dem nassen Boden, versucht, sich mit den Händen hochzustemmen, spürt aber einen stechenden, unerträglichen Schmerz, der ihm durch den rechten Arm fährt.
»Herman?«, ruft Willy von irgendwo. Herman schafft es nicht, sich zu orientieren, er weiß nicht, woher die Stimme kommt.
»Ich bin hier!«, stöhnt er ins klatschnasse Gestrüpp hinein, rollt sich langsam auf die Seite, damit der verletzte Arm freikommt. Er ist gebrochen, das spürt er in einem Augenblick der Verzweiflung, er hat seinen Tennisarm ruiniert. Den Arm, den er zum Aufschlag und zum Return braucht. Das Regenwasser tropft ihm vom Kinn und von den Fingerspitzen.
»Willy?«
»Hier!«, antwortet sein Kamerad, und jetzt hört er das Rascheln im Gestrüpp nebenan, sieht Karsten und Willy aus der Dunkelheit kommen, klatschnass und lädiert. Willy hängt ein trockener Zweig im Haar.
»Wie geht es euch?«, fragt Karsten.
»Ich glaube, ich habe mir was gebrochen«, antwortet Herman und hebt vorsichtig den Arm.
»Und ihr?«
Willy nickt nur. Die Haut an seinem Kinn ist aufgeratscht, eine blutige Wunde klafft auf seiner Stirn, sein Hosenbein ist am Knie aufgerissen.
Karsten hat einen Schnitt an der Hand, er drückt sie gegen die Lippen, um die Wunde zu reinigen. Schwarze Schlieren von Haarfärbemittel laufen ihm die Wange hinunter.
»Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um nach uns zu suchen. Am besten wäre es also, wenn wir uns trennen. Jeder geht in eine andere Richtung. Das macht es wahrscheinlicher, dass zumindest einer von uns durchkommt. Einverstanden?«
Willy und Herman sehen einander an. Wie viele Soldaten und Polizisten kann es in diesem Grenzgebiet schon geben?
»Schweden ist dort«, sagt Karsten und zeigt gen Osten zu einem Wald. »Viel Glück!«
Ein kurzes Nicken, dann dreht Karsten sich um und eilt mit gekrümmtem Rücken auf die Bäume zu.
»Ich kann in diese Richtung gehen«, sagt Herman und deutet mit einem Kopfnicken zu dem Hang auf der anderen Seite der Gleise.
»Wir sehen uns in Schweden«, sagt Willy.
»Wir sehen uns in Schweden«, erwidert Herman. Erneut ein kurzes Nicken, dann verschwindet jeder von ihnen in seine Richtung.
Herman versucht, den Arm ruhig zu halten, spürt den Schmerz des Bruches aber bei jedem Schritt. Was soll er tun? Es sind immer noch Dutzende von Kilometern bis Schweden, also beschließt er, in der Nähe Unterschlupf zu suchen. Eine Schlinge für den Arm zu bekommen, vielleicht jemanden um Hilfe zu bitten. In der Hoffnung, dass es noch jemanden auf den Höfen in dieser Gegend gibt, der ihn wie einen Menschen behandelt.
DAS TITELBLATT DER INTERNATIONALEN PROPAGANDASCHRIFTUmennesket (Der Untermensch) . Die Broschüre wurde ursprünglich auf Deutsch herausgegeben, aber in mindestens zehn Sprachen übersetzt und veröffentlicht. Die norwegische Ausgabe wurde von der Druckerei Aas & Wahl in Oslo hergestellt und beginnt mit der Wiedergabe einer Rede von Heinrich Himmler aus dem Jahr 1935, in der er den »vom Juden geführten Kampf gegen die Völker« mit dem »Kampf des Pestbazillus gegen den gesunden Körper« verglich.
Es ist August 1942, und einer der Angestellten in der Druckerei kontrolliert die Druckqualität der Broschüre, bevor sie die Herstellung starten. Er heißt Aksel, ist Jude und wohnt zusammen mit seiner Frau und zwei kleinen Söhnen in einem Mietshaus neben der Synagoge in der Calmeyers gate. Jetzt sieht er die antisemitischen Fotografien und die hasserfüllten Texte und ist angewidert von dem, was er da herstellen soll. Von der Propaganda, die behauptet, der deutsche Einmarsch sei eigentlich ein Verteidigungskrieg. Ein notwendiger Krieg, um das Gesunde, Arische und Reine gegen die niederträchtige und gnadenlose Ausrottung zu verteidigen, die die Juden laut Nazipropaganda angeblich planten.
Er sieht Bilder von arischen Frauen, Männern und Kindern durch die Druckmaschine wirbeln, sorgt dafür, dass alle Broschüren richtig geheftet sind, und lässt die Stapel mit den fertigen Druckwaren wegtragen, wobei ihn die Gesichter der Juden auf der Titelseite des Untermenschen anglotzen. Wahrscheinlich nehmen ihn Nazis so wahr, als einen Untermenschen, denkt er auf dem Heimweg von der Druckerei nach dem beendeten Arbeitstag. Das Augustlicht scheint warm auf das Kopfsteinpflaster, und die Seiten der Broschüre, bei deren Produktion er gerade noch mitgeholfen hat, kleben sich in seinen Gedanken fest und weigern sich zu verschwinden: Bilder von ärmlich wirkenden Juden in krasser Gegenüberstellung zu Fotografien blonder Kinder, die mit Eimerchen und Schaufeln an einem norwegischen Strand spielen, oder Gruppenaufnahmen vitaler, arischer Mädchen in hellen, kurzen Röcken bei der Leibesertüchtigung.
Ich stelle mir Aksel vor, wie er durch die Straßen der Innenstadt geht. Vielleicht kommt er auf dem Weg an den Geschäften von Rakel und Jacob Feldmann vorbei, ehe er die Calmeyers gate überquert, hinüber zum Mietshaus neben der Synagoge, nach Hause zu seinen Söhnen, die immer noch so klein sind, so unfertig und so schön. Vielleicht isst er zu Abend, ruht sich ein wenig auf dem Sofa aus, küsst seine Frau und streichelt ihr mit der Hand über den Rücken. Vermutlich lebt er in der Illusion, die er mit den meisten Menschen teilt – uns kann nichts passieren. Dass es immer so weitergehen wird wie an Tagen wie diesen, mit der Familie, der Arbeit und warmem Licht in den Fenstern. Niemand wird sich vor unserer Tür aufbauen und uns verhaften, unsere Kinder verhaften, uns in den Tod schicken.
DIE SCHLAGZEILE VOM 23.10.1942: Polizist von zwei Juden erschossen.
Es ist der Vormittag des 23. Oktober, und Jacob Feldmann versucht, einen Kunden beim Kauf einer im Preis reduzierten Jacke zu beraten, als das Telefon klingelt. Jacob entschuldigt sich, hofft, dass es Herman ist, der seine Ankunft in Schweden melden möchte. Aber er ist es nicht. Der Anrufer stellt sich nicht einmal vor, sondern bittet Jacob einfach nur, den Aufmacher des Tages zu lesen, ehe er wieder auflegt. Jacob bekommt keine Antwort auf die Frage, worüber die Zeitung schreibt, bleibt einfach nur einen Augenblick mit klopfendem Herzen und dem Freizeichen im Ohr stehen, dann reißt er sich los, nimmt den Mantel vom Haken und eilt zum nächsten Zeitungskiosk am Youngstorget. POLIZIST VON ZWEI JUDEN ERSCHOSSEN, lautet die Schlagzeile, und Jacob spürt, wie um ihn herum alles zusammenbricht, Trauer und Furcht jagen ihm durch den Körper, während er in der Jackentasche nach Münzen sucht, sie dem Mädchen hinter dem Tresen gibt und den Artikel so schnell wie möglich durchliest:
Nach der Untat sprangen die beiden Juden und ein weiterer Mitfahrer aus dem Zug.
[…] Die Suche nach diesen drei, dem Schneider Willy Schermann, geboren 1918 in Oslo, dem Volontär Herman Feldmann, geboren 1918 in Trondheim […]
Er entfernt sich ein paar Schritte von dem Kiosk, muss sich zwingen, ruhiger zu atmen, ehe er weiterlesen kann:
Um 6:30 Uhr am Morgen erreichte einer der Juden, Herman Feldmann, den Hof Slang in Skjeberg. Er war von der Flucht versehrt und hatte sich den Arm verletzt.
Hatte sich den Arm verletzt. Was soll das bedeuten? Jacob liest den Artikel noch einmal von vorn, spürt, wie ihm das Atmen immer schwerer fällt, und eilt in das andere Geschäft, um Rakel die Schlagzeile zu zeigen, reicht ihr wortlos die Zeitung, er weiß, dass sein Blick und sein Schweigen alles sagen.
Rakel liest laut, schert sich nicht um die Kundin, die direkt neben ihr steht. Dann ruft sie aus, genau das habe sie schon immer gesagt, sie hätten vor langer Zeit weggehen sollen, und ihre Tränen fallen auf die Zeitung. Jacob weiß nicht, wohin mit seinen Händen, er sieht, wie die Kundin sich vorsichtig aus dem Geschäft schleicht.
Rakel verbirgt ihr Gesicht in den Händen und fragt, was sie mit ihrem Jungen vorhaben. Jacob lässt sich auf einen Stuhl sinken und schüttelt den Kopf. Die Antwort hängt stumm in der Luft zwischen ihnen, denn sie beide wissen genau, wie ein Fluchtversuch bestraft wird, und schlimmer noch, welche Strafe auf denjenigen wartet, der einen Polizisten im Dienst tötet. Rakel putzt sich die Nase. Eine konzentrierte Stille hat sich auf ihr Gesicht gelegt.
»Jetzt ist unser Name in der Öffentlichkeit«, sagt sie und wischt die Tränen weg. »Jetzt werden sie kommen und auch uns holen«, fügt sie hinzu, bevor sie zu Jacob hinübersieht und sagt, dass sie so schnell wie möglich nach Schweden müssen.
»Aber wie?«, fragt Jacob, aber Rakel ist schon auf dem Weg ins Hinterzimmer. Jacob folgt ihr bis zur Tür und sieht, wie sie die Scheine aus dem Geldschrank holt und in eine Tasche steckt.
»Wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass Karstens Familie uns helfen kann«, sagt Rakel und schiebt sich an ihm vorbei, nimmt die Schlüssel für das Geschäft vom Haken, dann leert sie die Registrierkasse.
Jacob kneift ein paar Mal die Augen zu, versucht alles zu verarbeiten, was um ihn herum geschieht, dann kann er Rakel ansehen, wie sie sich allmählich darüber aufregt, dass er nicht in Fahrt kommt.
»Hallo? Wir müssen uns beeilen, Jacob!«, faucht sie.
»Ja.«
»Gehst du ins Nobel und holst das Geld aus der Kasse?«
»Ja.«
Jacob zieht die Taschenuhr aus der Westentasche und sieht nach der Zeit.
»Jetzt beeil dich doch!«, sagt Rakel und schiebt Jacob aus der Tür.
Jacob eilt im Laufschritt zurück zum Nobel und erzählt der erschrockenen Frau hinter dem Schalter, dass sie jetzt schließen müssen, dann leert er die Registrierkasse und den Safe und steckt eine Flasche Sprit in seine Tasche.
»Schließen? Wie lange denn?«
»Auf unbestimmte Zeit«, antwortet Jacob, wirft einen letzten Blick in das Geschäft, dann eilt er zurück zu Rakel.
Rakel steht, den Telefonhörer in der Hand, mit dem Rücken zur Tür, und Jacob hört, dass sie Jiddisch spricht, also hat sie wohl ihre Schwester angerufen, um ihr zu erzählen, was Herman widerfahren ist.
Jacob ist der Gedanke bis jetzt gar nicht gekommen. Wie diese Trauer sich verdoppeln wird, denn Nina ist nicht nur Rakels Schwester, sondern auch Hermans biologische Mutter.
Rakel beendet das Telefonat, versucht sich zu sammeln und bittet Jacob, ihr zu folgen. So verlassen sie also das Leben, das sie sich in den letzten dreißig Jahren gemeinsam aufgebaut haben, und eilen zur Bushaltestelle, mit nichts außer dem, was sie bei sich tragen. Rakel und Jacob nehmen den Linienbus nach Strømmen, wollen sich vor ihrer Flucht von ihrer Familie verabschieden, und sie werden hereingelassen. Dort steht Nina, das Gesicht in Tränen aufgelöst. Die Worte zwischen den beiden Frauen werden von der Zeit ausgelöscht. Dasselbe gilt für die Verzweiflung und die Liebe zwischen ihnen. Zwei Schwestern, die Mütter desselben Jungen sind.
EINE PORTRÄTAUFNAHME VON RAKEL UND JACOB FELDMANN. Sie stehen dicht beieinander, den Blick auf den unbekannten Fotografen gerichtet, nicht wissend, dass ausgerechnet dieses Bild als Beweis in dem Prozess vorgelegt werden wird, in dem es um ihren Tod geht.
Jacob Feldmann wurde im Jahr 1891 in einem Schtetl vor den Toren Kyjiws geboren. Er muss als Heranwachsender gleichermaßen verzweifelt und entschlossen gewesen sein, denn laut historischer Quellen soll der junge Mann damals die ganze Strecke von Kyjiw, das zu jener Zeit vom Russischen Zarenreich besetzt war, bis nach Norwegen zu Fuß zurückgelegt haben, wo er sich nach einem kurzen Zwischenstopp in Trondheim in Oslo niedergelassen und ein Modegeschäft mit Barbiersalon im hinteren Teil eröffnet haben soll, das Grand Herreekvipering AS.
Rakel wurde in der Stadt Gomel geboren, die mittlerweile in Belarus liegt. Auch sie floh vor Pogromen und Verfolgung, kam nach Norwegen und fühlte sich dort so wohl, dass sie ihre Schwester Nina überredete, mit ihrem Ehemann nachzukommen.
Rakel und Jacob müssen im jüdischen Milieu sehr bekannt gewesen sein. Bestimmt besuchten die Leute die Geschäfte der beiden am Youngstorget, unterhielten sich mit ihnen über Gott und die Welt und kauften bei ihnen ein. Sicherlich sind sie ihnen in der Synagoge begegnet, auf Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten. Das Ehepaar bezog ein Eigenheim in Grefsen, wo ihr Sohn Herman zur Schule ging und sich bald als großes Tennistalent herausstellen sollte. In den Archiven finde ich eine Fotografie, auf der Jacob einen Pokal überreicht, den Gewinn einer Tanzveranstaltung, die Rakel und er organisiert hatten. Hier finde ich auch die Übersicht über die Möbel, die sie besaßen, die Kleidung, die sie in den Schränken zurückgelassen hatten, den Schmuck, der immer noch im Schmuckkasten lag, als Rakel sich auf die Flucht begab, das Service, von dem sie aßen, die Tischtücher, die sie am Schabbat und zu anderen Feierlichkeiten benutzten, und die Weingläser, die sie im Laufe der Jahre an ihre Lippen gehoben hatten, mit der Hand gespült und zum Trocknen auf die Spüle gestellt. Im Spätsommer strömte das Nachmittagslicht durch die Fenster und warf halbdurchsichtige Schatten der Gläser an die Küchenwand.
So ist das Leben. Augenblicke der Schönheit, des Alltags, inklusive Erkältung und Streit und Missverständnissen. Augenblicke des Lachens, plötzliches Vertrautsein und Begehren, Augenblicke der Berührung und der Liebe, bis sich alles zusammen für immer schließt und verschwindet.
EINE KINDERZEICHNUNG, ANGEFERTIGT MIT FARBSTIFTEN. Rakels Schwester und ihre gesamte Familie wurden verhaftet und am 26. November 1942 mit dem Frachtschiff Donau außer Landes deportiert. Auf den Stolpersteinen, die in Strømmen vor ihrer Wohnung platziert sind, stehen ihre Namen und die Geburtsdaten der gesamten Familie. Bernhard und Nina Davidsen, mit den Kindern David, Michael, Ruth und dem Nachzügler John. Keiner von ihnen überlebte.
John war sieben Jahre alt und wurde direkt nach ihrer Ankunft in Auschwitz zusammen mit der Mutter und der Schwester vergast. Ein paar Monate früher schenkte John einem Klassenkameraden eine Zeichnung, die jetzt im Jüdischen Museum in Oslo ausgestellt ist. Eine Zeichnung voller alter Waldschrate mit Bärten, Teekannen und Äpfeln sowie huttragenden Frauen. Eine Welt, die verschwand.
DIE VICTORIA TERRASSE IN DER OSLOER INNENSTADT eine Fassade aus feinverputztem Mauerwerk und gebogenen Turmdächern aus grauem Schiefer. Im Volksmund wird das Gebäude Gestapopalast