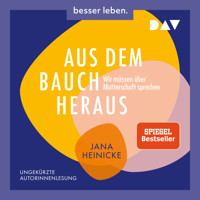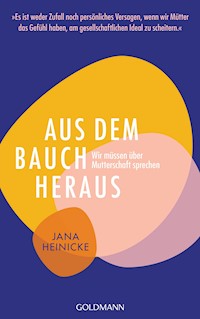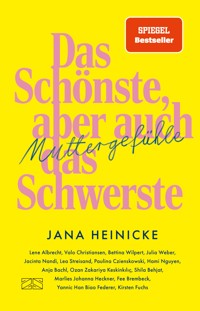
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ZS - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In den letzten Jahren sind viele Stimmen laut geworden, die unser geltendes Mutterideal hinterfragen. Dennoch steht die unbedingte Mutterliebe nach wie vor im Vordergrund und gilt als Motivation und Lohn für Care-Arbeit und Entschuldigung für Ungleichheit. Muttergefühle stehen synonym für ein einziges Gefühl, das über dreihundert Jahre den faktischen Blick auf das Muttersein versperrt und in rechtskonservativen Ideologien aktuell wieder Aufschwung erhält. Dabei ist es Zeit, die Gefühle von Eltern neu zu definieren und das Narrativ der immer glücklichen Mutter aufzubrechen und darzulegen, wie viele unterschiedliche und komplexe Emotionen zur Mutterschaft dazugehören – zu denen natürlich auch, aber eben nicht nur, Liebe und Glück zählen. Fünfzehn Autor*innen beschreiben in kurzen Texten, wie es ist, Mutter oder Eltern zu sein, und zeigen, was sich alles hinter dem Begriff Muttergefühle verbirgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ich war in Paris, längst bevor ich physisch nach Paris gereist war. Ich war schon öfters ein Mann … Ich war krank. Ich war alt. Ich war verwirrt. Ich sah Freunde sterben. Ich war schon öfters gestorben.Aber kaum je war ich Mutter, bevor ich mein erstes Kind gebar. Es gibt viele Geschichten unglücklicher Kinder. Geschichten von Eltern gibt es hingegen erst wenige. Es bräuchte viele, um uns mit Bildern zu füttern, aus denen wir wählen können.
Micha Friemel
Inhalt
Vorwort
Lene Albrecht: Care-Maschine, kaputt
Valo Christiansen: Und sie schnurrt
Bettina Wilpert: Almas Augen
Julia Weber: Ich sehe dich
Jacinta Nandi: Deine Mutter hat eine Geschichte zu erzählen
Lea Streisand: Schneewittchens Mutter
Paulina Czienskowski: Spuren des Mangels
Hami Nguyen: Über Grenzen hinweg
Anja Bachl: Glitch
Ozan Zakariya Keskinkılıç: Vater unser
Shila Behjat: Söhne
Marlies Johanna Heckner: Stillen
Fee Brembeck: Nicht ihre Mutter zu sein
Yannic Han Biao Federer: Alles wieder gut
Kirsten Fuchs: Vielleicht bin ich eine Aalmutter
Jana Heinicke: Liebe F.
Literaturverzeichnis
Glossar
Über die Mitschreibenden
Dank
fand ich kürzlich folgende Nachricht, die ich im Sommer 2020 an sie schrieb:
Wie kann etwas, das so vereinnahmend ist wie Mutterschaft, das all meine Lebensbereiche durchdringt, sie auf den Kopf stellt und völlig neu ordnet, immer nur schön sein? Wie kann ich all das immer nur lieben und lieben sollen und nichts anderes fühlen dürfen – vor allem, weil doch auch meine Mutterschaft von all dem Leben, dem Sollen und Müssen gerahmt und durchkreuzt wird … wie soll das gehen, dieses Immernurglücklichsein?
M. hat das Baby auf dem Arm und macht einfach. Alles sieht leicht aus bei ihm. Nichts von dem, was er tut, hat ein jahrhundertealtes Echo. Er kann sich als Vater immer wieder neu erfinden und jede seiner Handlungen ist mehr als genug. Was er fühlt? Keine Ahnung. Vermutlich ist er genauso müde wie ich, genervt hin und wieder – und er liebt dieses Kind, er liebt es abgöttisch. Aber das eine beeinflusst das andere nicht, er kann einfach lieben UND … es ist normal für ihn, dass seine Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist –
du liebst nicht genug, wenn … // würdest du wirklich lieben, dann …
ist doch egal, was die anderen sagen, sagt er, und manchmal werde ich richtig wütend, weil ich ihn so beneide um seine Freiheit – weil er der Vater ist und für Väter Gefühle nicht so sehr genormt werden, dass sie Vatergefühle heißen.
Es war der erste Coronasommer, mein erster Sommer als Mama, und ich steckte in einer handfesten Krise. Ich arbeitete damals an einem Exposé, dem die Idee für dieses Buch zugrunde lag. Ich sehnte mich nach Austausch mit anderen Müttern, die so wie ich, ein ganz bestimmtes Mutterideal verinnerlicht hatten und nun daran scheiterten, ihm zu entsprechen. Ich wollte radikale Ehrlichkeit. Und ich wollte mich weniger alleine fühlen in dem Schmerz, der sich auftat zwischen meiner Vorstellung von Mutterschaft, die mein ganzes Leben unwidersprochen durch Bücher, Filme, Werbung gefüttert worden war – und der Realität, in der ich mich befand.
Damals wollte kein Verlag etwas wissen von meinem Exposé. Ich schrieb ein anderes Buch, in dem ich meine persönlichen Erfahrungen des Mutterwerdens mit dem westlichen Mutterideal und seiner Instrumentalisierung verknüpfte. Aber die Idee zu diesem Buch ließ mich nicht los. Erst recht, weil ich merkte, dass meine Perspektive alleine nicht ausreichte, dass ich ja selbst durchdrungen bin von den Strukturen, die ich kritisiere, dass es also diversere Stimmen braucht, um wirklich einen Riss zu kratzen in die glatte Fassade dieses Ideals.
Im Herbst 2019, als ich hoch schwanger war, wurde Mutterschaft in den Sozialen Medien fast ausschließlich als größtes Freizeitglück weißer, normschöner, junger (aber nicht zu junger) cis Frauen in perfekten heteronormativen Paarbeziehungen vor dem Hintergrund beiger Designerküchen inszeniert. Und ich passte perfekt in dieses Bild. Ich konnte mich mit jenen Frauen identifizieren – vielleicht abgesehen vom beigen Interior. Alles schien immer leicht, alles schien immer schön. Die Geburt, so dachte ich, wäre vielleicht eine kleine Herausforderung – aber wäre mein Baby erst da, würde die Liebe alle Schmerzen vergessen machen, und was folgen würde, wäre dieser Teil diffuser Glückseligkeit, der in Märchen immer mit »… und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute« abgekürzt wird.
Was die Märchen der Gebrüder Grimm mit unserem heutigen Mutterideal und seinem Ursprung zu tun haben, darauf geht später Lea Streisand in ihrem Essay ein. Eingangs schreibt sie: »Mutter zu werden, war der größte Schock meines Lebens« – und auch damit kann ich mich, seit ich Mutter bin, identifizieren. Denn obwohl jenes Mutteridealbild exakt für Frauen wie mich entworfen wurde, wurde ich ihm nie gerecht – und dafür schämte ich mich. Ich schämte mich dafür, mein Kind nicht von der ersten Sekunde an über alles zu lieben; ich schämte mich dafür, stattdessen eine ganz andere Palette tiefgreifender Gefühle zu haben, die zwar in direktem Zusammenhang mit meiner Mutterschaft standen, aber so gar nicht zart und weich und lieblich waren – also eben keine richtigen Muttergefühle, sondern rau und brachial, identitätssprengend und alles erschütternd. Valo Christiansen schreibt in deren Essay, das Unweiblichste, was dey je getan habe, sei, schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen. Und auch wenn dey diese Worte im Kontext nonbinärer Elternschaft wählt und ich eine cis Frau bin, legen sie etwas in mir frei, ein Gefühl vielleicht, eine Art Vibration, die mitschwingt, unter allem mir Sagbaren über diese ersten Tage und Wochen nach der Geburt. Und auch dafür schämte ich mich. Später dann schämte ich mich, dass ich mich schämte; ich schämte mich, dass ich reingefallen war auf dieses Mutterideal, dass ich so tief gefallen war, dass mir der Boden unter den Füßen wegbrach; ich hätte es doch besser wissen können, besser wissen müssen, ich hatte mich nicht gut genug informiert. Überhaupt ist Scham eines meiner intensivsten und präsentesten Gefühle als Mutter, oft treibt sie alle anderen Empfindungen vor sich her oder legt sich auf sie, umhüllt sie, unterdrückt sie, lässt sie an anderer Stelle umso größer, intensiver, dringlicher wieder hervortreten. Scham war lange die Füllmasse zwischen der Mutter, die ich bin, und jener, die ich zu werden gedacht hatte, und manchmal frage ich mich, wie ich als Mutter geworden wäre ohne all die fixen Bilder im Kopf. Wenn Liebe und Fürsorge nicht an ein Geschlecht geknüpft wären und an diese Liebe nicht allerhand Ansprüche und Auflagen … Ich lese den Essay von Marlies Johanna Heckner, lese, wie sie sich mit eitrigen, blutigen Brustwarzen quälte, ihr erstes Kind weiter zu stillen, weil sie fürchtete, sonst keine gute Mutter zu sein, nicht genug zu lieben; die Scham war größer als die körperlichen Schmerzen. Und dann lese ich Paulina Czienskowski, die sich manchmal schämt, zu sagen, wie sehr sie ihr Kind liebt, wie gerne sie Mutter ist – das, »nur« das – aus Angst, die Sache zu verraten, die neuen Mütter, die beginnen, sich herauszuschälen aus einem jahrhundertealten Korsett. Wie falsch sich das anfühlt, anfühlen muss, die Scham, der Liebe wegen / die Scham, weil die Liebe (vermeintlich) fehlt. »Ich will wissen, wie wir lieben würden, wenn wir nicht mehr reagieren müssten«, schreibt Czienskowski – ich will das auch wissen. Und dann will ich weder Raben- noch Helikoptermutter sein, sondern so wie Kirsten Fuchs vielleicht einfach eine Aalmutter, die sich aaler Fremdzuschreibungen zum Trotz eben so durchschlängelt. Ich will mit Jacinta Nandi im Tropical Island sitzen, und während unsere Kinder die Wasserrutsche runterrutschen, einen Sex on the Beach mit ihr trinken und ganz offen über Schwangerschaftsabbrüche sprechen.
Als ich Ende 2024 schlussendlich dieses Buch zu planen begann, lautete der Arbeitstitel Muttergefühle – eine Begriffssprengung. Ich wollte nicht mehr nur ein bisschen am Mutterideal kratzen, ich wollte Muttergefühle aufbrechen, dehnen, neu vermessen, sie dekonstruieren.
In den letzten Jahren haben sich viele kritische Stimmen mit den gesellschaftspolitischen Strukturen, unter denen Elternschaft gegenwärtig stattfindet, auseinandergesetzt: Ungleich verteilte Sorgearbeit, geringere Chancen für Mütter und gebärende Elternteile auf dem Arbeitsmarkt, katastrophale Bedingungen in der Geburtshilfe, Altersarmut, psychische Belastungserscheinungen, u. v. m. Auch bedingt durch die Coronapandemie sind bestimmte Missstände so sehr hervorgetreten, dass es nahezu unmöglich war, weiterhin wegzuschauen. Gleichzeitig sind in dieser globalen Ausnahmeära die politische Rechte und der Wunsch erstarkt, einfache Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Und wie schon zur Zeit der Aufklärung, die ebenfalls mit großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen einherging, wurde auch in den Coronajahren das Mutterideal als einfacher Taschentrick bemüht, um über strukturelle Schieflagen hinwegzutäuschen.
Es waren vornehmlich die Mütter, die während der Lockdowns im Homeoffice neben dem Haushalt auch die Kinderbetreuung und das Homeschooling übernahmen. Einfach, weil es doch in ihrer Natur läge, die liebevolleren Eltern zu sein, weil ihre unerschöpfliche Mutterliebe schon ausreichen würde, um die Erschöpfung, die in diesen Jahren bis ins Mark ging, zu übertönen.
Aber dass Liebe allein eben nicht ausreicht, um Kindern ein sicheres und kindgerechtes Umfeld zu schaffen, davon zeugt u. a. die Nachfrage an Therapieplätzen aus dieser Zeit: In der Gruppe der Kinder und Jugendlichen war sie 2021 sogar um sechzig Prozent angestiegen.
Bereits in den 1980er-Jahren hatte sich die Philosophin Élisabeth Badinter mit dem Mythos vom Mutterinstinkt auseinandergesetzt. Für die US-amerikanische Ausgabe ihres Buches Die Mutterliebe. Geschichte eines Gefühls hatte ihr Verlag den damals hoch angesehenen Psychoanalytiker Bruno Bettelheim angefragt, ein Vorwort zu verfassen. Bettelheim aber wollte nicht – seine Begründung:
»Natürlich gibt es keinen natürlichen Mutterinstinkt, sonst hätten nicht so viele Kinder meine professionelle Hilfe gebraucht. Aber das zu demonstrieren, zu zeigen, dass so viele Mütter ihre Kinder ablehnen, würde nur andere von ihren Schuldgefühlen befreien … ich kann meinen Namen nicht dafür hergeben, dieses letzte Bollwerk zu beseitigen, das so vielen unglücklichen Kindern noch einen Schutz vor der Zerstörung bietet.«1
Bettelheims Worte machen eindrücklich deutlich, welcher enorme Druck auf Müttern lastete und noch immer lastet, und dass ihre Schuldgefühle, ihre Scham, gewollt, ja einkalkuliert sind, gewissermaßen als Sollbruchstelle fungieren, die jedoch niemals brechen darf. Denn täte sie es, und oft genug tut sie es (wir reden nur nicht so gerne darüber), verlagert sich die Sollbruchstelle einfach weiter auf die Kinder.
Bettina Wilpert beschreibt in ihrem Essay eine Situation, in der eine Mutter ihre hochkochende Wut nicht mehr an sich halten kann und ihr Kind anbrüllt. Die Angst in den Augen des Kindes. Es ist eine Situation maximaler Anspannung und Belastung auf allen Seiten und Wilpert schreibt: »Wenn ich wütend auf meine Kinder reagiere, habe ich zu wenig geschlafen, hatte einen stressigen Arbeitstag oder bin erkältet – kurz: In den meisten Fällen, in denen ich wütend werde, bin ich erschöpft und müde. Ich bin mütend.«
Ich denke, die allermeisten Eltern kennen das Gefühl, mütend zu sein, nur zu gut – vor allem jene, die viel auf sich allein gestellt sind.
In den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt war nicht ich, sondern M., mein Mann, die erste Bezugsperson unseres Kindes. Ich konnte es aufgrund der Geburtsverletzungen, der körperlichen und der seelischen, nicht sein.
Meine Scham war niemals größer als in dieser Zeit. Meine Freundin F. sagte damals zu mir: »Ich weiß, gerade willst du es nicht annehmen, aber vielleicht kannst du versuchen, darin eine Chance zu sehen, dass ihr langfristig eine gleichberechtigte Elternschaft führen könnt.« In der Situation wollte ich wirklich nichts davon wissen, aber mittlerweile bin ich, wenn auch nicht für die Umstände, dann doch für das, was daraus erwachsen ist, sehr dankbar. Dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der seinen Teil der Sorgearbeit selbstverständlich trägt, der unserem Kind ein liebevoller und zugewandter Vater ist, so einer, den ich in meiner Kindheit schmerzlich vermisst habe. Manchmal denke ich, dass es auch in mir etwas heilt, zu sehen, was für ein inniges Verhältnis die beiden haben. Und ich weiß, dieses Verhältnis ist alles andere als alltäglich.
Ich sitze auf dem Fußboden unseres Wohnzimmers, es ist nachts um 1:30 Uhr, ich versuche die Essays der hier versammelten Autor*innen, die auf losen Blättern um mich herum verteilt liegen, in eine Ordnung zu bringen. Ich lese Vater unser von Ozan Zakariya Keskinkılıç; eine Vatergeschichte, die erzählt vom Ringen eines Sohnes nach der Anerkennung, der Liebe seines Vaters, der, wie so viele Väter, unfähig ist, seine Liebe zu geben, vielleicht sogar selbst schon sehr früh verlernt hat, sie zu spüren. Ich lese von Wundrändern, die an den Leerstellen dieser Liebe klaffen, die weitergegeben werden, vom Vater zum Sohn, »ein Sohn erbt das Trauma«, schreibt Keskinkılıç, er lerne vom Vater, stark zu sein und sich zu maskieren, und ich markiere in Neonrosa einen Satz, an dem ich immer wieder hängen bleibe, wenn ich seinen Essay lese: »Eine Maske zu tragen bedeutet, das Innere aufzuspalten und den Kummer und die Trauer hinter Wut zu verstecken. Es bedeutet, süchtig nach Arbeit zu sein, um vor den Gefühlen zu fliehen.« Die Zuschreibungen, wer wie zu lieben hat, lieben darf oder soll, machen in ihrer Umkehrung auch vor den Vätern keinen Halt. Und sie unterdrücken, wie Shila Behjat aufzeigt, am Ende uns alle, alle Eltern, alle Kinder gleichermaßen. Und auch in ihrem Essay Söhne markiere ich einen Satz in Neonrosa, und ich mag, was passiert, wenn sich beide Sätze begegnen: »Wenn er [der Sohn] lernt, dass Tränen nicht falsch sind und es schön ist, wenn er laut lacht … dann lehre ich ihn, dass seine Existenz nicht nach Außenform, sondern nach Innenraum bewertet werden darf.«
In beiden Texten, in Keskinkılıçs und in Behjats, geht es aber nicht nur um unterdrückte Gefühle und Bedürfnisse, sondern auch um Elternschaft im Kontext von Rassismuserfahrungen. Perspektiven, die im gegenwärtigen Diskurs über Elternschaft, der immer noch sehr weiß und cis-heteronormativ ist, viel zu kurz kommen. Dabei sind gerade die Realitäten, die in einer bestimmten Norm nicht mitgedacht werden, geeignet, ebendiese Norm zu dekonstruieren. Hami Nguyen schreibt in ihrem Essay über das Gefühl thương, das sie mit ihrer vietnamesischen Herkunftsfamilie verbindet und für das es im Deutschen keine eindeutige Entsprechung gibt. Sie übersetzt es hier mit liebsorgen. Als ich ihren Essay zum ersten Mal lese, denke ich sofort an Mutterliebe, aber beim zweiten und dritten Mal scheint mir thương viel praxistauglicher zu sein. Weder bezieht es sich nur auf ein Geschlecht noch auf eine bestimmte Familienordnung; alle Familienmitglieder können füreinander liebsorgen, thương ist mehr als ein diffuses, mystisch aufgeladenes Gefühl, es denkt Sorgearbeit ganz konkret mit.
Ich frage mich, wie es den westlichen Blick auf Mutter- und Elternschaft verändern würde, wenn thương einen festen Platz in unserem Denken, unserem Erleben, unserem Handeln hätte. Würden sich auch Personen wie Fee Brembeck gesehen und mitgemeint fühlen, die zwar rein formal keine Mütter sind, aber selbstverständlich elterliche Aufgaben übernehmen, ein Kind lieben wie eine Mutter? Würde liebsorgen hier einen eigentlich künstlich konstruierten Widerspruch auflösen? Wie würde Sorgeverantwortung innerhalb einer Familie und der Gesellschaft bewertet und verteilt werden?
Sprache schafft Realität. Sie beeinflusst, wie wir auf die Welt schauen. Was wir für normal, also für die Norm halten. Sprache kann uns begrenzen – aber auch unseren Horizont erweitern. Und ich bin jedes Mal aufs Neue tief beeindruckt, wenn es Personen gelingt, eine Sprache zu finden, um Gefühle, um ein Erleben greifbar zu machen, für das es eigentlich kaum Worte gibt. Julia Weber gelingt das in ihrem Text Ich sehe dich auf sehr poetische Weise, wenn sie vom Verlust einer Schwangerschaft erzählt, der in eine existenzielle Krise mündet und die Fragen stellt: Welche Mutter will ich sein? Welche Mutter kann ich sein? Welche Mutter bin ich, und was bin ich noch? Und auch Yannic Han Biao Federer legt einen Essay von großer literarischer Wucht vor, der sich dem Tod seines ersten Kindes widmet und davon erzählt, wie das Leben unter dessen Prämisse weitergeht.
Aber nicht nur Sprache schafft Realität – unsere Realität bestimmt auch maßgeblich, wie wir schreiben und ob wir überhaupt die Ressourcen dazu haben. Und damit einhergehend, ob wir gelesen werden, welche Perspektiven Gehör finden und welche eben nicht. Von den insgesamt vier alleinerziehenden bzw. getrennt erziehenden Eltern, die ich für diese Anthologie angefragt habe, konnten zwei ihre Texte nicht innerhalb der Frist fertigstellen. Eine Person hat ihre Zusage zurückgezogen, bevor sie die Arbeit am Text überhaupt beginnen konnte, weil es dringendere To-dos gab, die keinen Aufschub duldeten. Die zweite Autorin, Anja Bachl, hat bis zur letzten Sekunde mit ihrem Text gerungen oder vielmehr mit den Umständen, unter denen ihr Schreiben stattfand. Ihr Text blieb bis zuletzt fragmentarisch und er kam zu spät, um das Lektorat zu durchlaufen. Also den Prozess, in dem Dritte einen Text auf inhaltliche Unklarheiten, stilistische Schnitzer usw. gegenlesen. Ich habe mich in Absprache mit der Autorin dennoch entschlossen, ihren Essay zu veröffentlichen. Zum einen, weil ich ihre Perspektive als alleinerziehende, armutsbetroffene und chronisch kranke Mutter wichtig finde, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Realität Sichtbarkeit verdient. Zum anderen, weil ihr Text in seiner Rohheit und brutalen Dringlichkeit eine Schönheit entwickelt, die ich trotz allem, oder gerade deswegen, absolut lesenswert finde.
Lene Albrecht schreibt in ihrem Essay: »… solange unser Inbegriff für Fürsorge die Mutter ist, kann die Mutter keine Fürsorge einfordern. Die Mutter als Heilige, als Mater Dolorosa, also Schmerzensmutter, die sich aufopfert und alles erträgt, kann keine gesunde Mutter sein. Und wenn eine Mutter krank ist, leidet nicht nur sie, sondern krankt das ganze System, das auf ihr lastet.« Albrecht führt aus, dass Krankheit und Behinderungen Zustände sind, die uns alle früher oder später ereilen werden. Wir verdrängen das nur gerne. Sie endet auf: »Vielleicht sollten wir … alle mehr Steine schmeißen, nicht nur die Kranken, sondern auch die Noch-Nicht-Kranken.«
Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Anfang.
Jana Heinicke, im Juli 2025
Lene Albrecht
EINS
Na, dann überlegen Sie doch mal, was Ihnen Ihr Körper sagen will. In diesem Satz sind sich alle einig; die Osteopathin und der Physiotherapeut, die Feldenkrais-Frau und die Chiropraktikerin mit dem Stiernacken, ein Orthopäde mit Pendel und eine Orthopädin mit wenig Zeit, dafür mit einer Spritze. Sie alle kontaktiere ich innerhalb eines Jahres wegen der Schmerzen. Es sind diffuse Schmerzen, Blockaden, die mich wenige Wochen nach der Geburt meines zweiten Kindes, mitten in der Pandemie, heimsuchen und sich dreist festsetzen.
Ich frage das Internet, während ich das Baby stille. Es ist heiß und die Laken riechen sauer nach Milch. Von chronischen Rückenschmerzen spricht man dann, wenn die Beschwerden länger als zwölf Wochen andauern. Ich zähle rückwärts. Das Baby ist drei Monate alt.
Das Internet sagt auch viele andere Dinge:
Ein schmerzender Rücken sei Ausdruck einer verletzten Seele.
In der Hüfte sitze die Scham.
Oder einfach nur: Chronische Rückenschmerzen, heilbar?
Während wir bei Krankheiten im Allgemeinen von einem kurzfristigen Zustand ausgehen, tragen chronisch Kranke das Gewicht der Zeit, denn es gibt für sie keine Heilung.
Was also sagt mein Körper? Ich sehe ihn mir an, weich und winterweiß ist er. Es ist Anfang März, die Geburt liegt nur wenige Wochen zurück. Die Brüste groß, schwer und mit empfindlichen Brustwarzen. Die Wirbelsäule seit Kurzem schief, eine Schulter steht höher als die andere, alles ist irgendwie verzogen. So liegt er ausgeliefert auf einer schwarzen Liege, die nackte Haut auf rauem, weißem Hygienepapier. Das Gesicht in ein winziges Loch gepresst, Augen, Mund und Nase zum Boden gerichtet. Dahinter steht die Orthopädin mit Stiernacken und bearbeitet ihn, den Körper, mit einer Maschine, die wie ein Tacker klickt. Kurze Stöße, die in die Wirbelkörper fahren. Seltsam, murmelt sie, seltsam … hatten Sie mal ein Schleudertrauma? Ich verneine und denke an diese eine Frau in der Notaufnahme im Krankenhaus, ein Neugeborenes im Arm, so wie ich. Ich sehe, wie sie sich zu ihrem Partner herunterbeugt. Gerade ist sie aus dem Behandlungszimmer getreten. Mit dünner Stimme flüstert sie, sie wisse nun, warum sie solche Schmerzen habe, vermutlich habe sie sich bei der Geburt vor wenigen Tagen die Rippe gebrochen. Vielleicht auch nur angebrochen. Sie sagt das, als wäre es ein Schnupfen, nicht der Rede wert.
Zum Abschied legt die Chiropraktikerin beherzt meine Hand zwischen ihre Beine. Sehen Sie, sagt sie, Sie müssen an Ihrem Beckenboden arbeiten, so; und spannt an und es ist, als würde ich einen Stein berühren.
ZWEI
Die Wahrheit ist: Ich war noch nie dieser kraftstrotzende Brocken, mein Körper ist wie mein Wesen: butterweich, sanft und durchlässig. Ich bin ein Softie und habe lange gebraucht, um mir das einzugestehen. Noch länger, um zu verstehen, dass ich soft und trotzdem widerständig sein kann.
Ein weiterer Versuch, Körper, hallo? Aber mein Körper spricht nicht, er wird besprochen. Seine Mängel werden aufgezählt, während er bis auf die Unterhose entkleidet begutachtet wird. Dieses Mal bei einer Osteopathin. Einmal abrollen. Nach rechts lehnen, jetzt nach links. Einmal bis zur Tür laufen, wieder zurück. Schmerzen? Arme strecken. Beckenschiefstand. Hohlkreuz. Gewicht verlagern. Krafttraining. Anziehen. Die Osteopathin kommt ganz nah an mein Gesicht heran. Ihre Eltern haben Ihnen zu wenig Grenzen gesetzt, sagt sie. Ich will widersprechen, aber sie würgt ab. Ein Tropfen ihrer Spucke landet auf meiner Wange. Ihr Atem riecht nach verdauten Zwiebeln. Ich will aufstehen und die Tür hinter mir zuknallen, aber ich bleibe sitzen, bedanke mich höflich. Die Spucke wische ich mir erst aus dem Gesicht, als ich ihr Behandlungszimmer verlassen habe. Später sage ich alle Folgetermine telefonisch ab.
DREI
Mit jedem neuen Behandlungszimmer probiere ich eine andere Erzählung. Vielleicht kann ich mein Leiden einfach nicht glaubhaft genug machen? Nachdem ich einer Orthopädin von der Risikoschwangerschaft mit Kleinkind berichtet habe, in der ich keinen Sport treiben durfte, sagt sie: Na, dann müssen Sie jetzt halt nacharbeiten, und schaut streng. Ich fühle mich, als wäre ich in der Schule beim Schummeln erwischt worden. Gleich darauf werde ich wütend. Als wäre es ein Vergnügen gewesen, neun Monate auf Bewegung und Sex zu verzichten. Jede Woche musste ich zu Kontrollterminen, wurde geschallt, gewogen und vermessen. Ganz zu schweigen von den Albträumen. Manchmal fasste ich mir nachts zwischen die Beine, um nach Blut zu fühlen. Aufgrund einer seltenen Nabelschnur-Anomalie könne das Baby innerhalb weniger Minuten verbluten, sagten damals die Ärzt*innen. Ich weiß nicht, wie viele Hände meine Vulva berührt haben in dieser Zeit. Irgendwann hörte ich auf, meinen Körper als meinen Körper zu betrachten. Ich gab auf, um nicht verrückt zu werden. Die Orthopädin rät mir zu Yoga, Pilates und Krafttraining. Dazu am besten Joggen. Ich frage, ob das für den Beckenboden nicht etwas viel wäre, vier Monate nach der Geburt. Die Orthopädin schaut hoch, zum ersten Mal schaut sie mich richtig an. Dann walken sie halt, sagt sie. Und als ich aus der Tür trete, ruft sie mir nach: Besorgen Sie sich BHs mit mehr Halt, und deutet schwere, hängende Brüste an. Die Arzthelferin, die mir gerade entgegenkommt, hat es gehört und sieht mich erschrocken an. Im Flur schießen mir Tränen in die Augen. Ich bin wütend auf die Orthopädin, aber noch wütender auf meinen Körper, diesen miesen Verräter.
Von hier aus betrachtet kommt es mir so vor, als hätte ich bereits mit der Schwangerschaft die Rolle einer Patientin angenommen, die mit einer extravaganten Diagnose zu viele komplizierte Fragen stellt. Nur: Nun, da das Baby gesund auf die Welt gekommen ist, interessiert sich niemand mehr für den Körper. Er ist eine leere Geschenkverpackung, achtlos weggeworfen. Das denke ich, und komme mir dramatisch vor. Das Baby ist da, es ist wunderschön, es riecht gut und die Zeit kommt nicht mehr zurück. Die kommenden Monate sind geprägt von Empörung und Scham. Warum muss ich die Schmerzen aushalten?, und gleichzeitig: Wenn es niemand ernst nimmt, muss ich wohl übertreiben. Ich perfektioniere meine Rolle als Patientin und stelle jedem Arztbesuch mein kleines Skript voran: Dass ich schon sechs Wochen nach der Geburt wieder arbeiten musste. Dass ich gerne Sport treibe. Ja, auch Rückbildung gemacht habe. Ich sage all das, um ja nicht den Eindruck einer faulen Mutti zu erwecken.
It is hard work behaving as a credible patient. So lautet der Titel einer norwegischen Studie von 2023 über chronische Muskelschmerzpatientinnen. Die Forscherinnen stellen fest, dass es für Frauen vielfach schwieriger ist, ihre Symptome sichtbar zu machen und damit ernst genommen zu werden.2 Weder wollten die Frauen in der Studie aufgrund ihrer Erfahrungen zu stark, noch zu schwach auftreten, nicht zu gesund, aber auch nicht zu krank wirken, nicht zu hübsch, aber auch nicht hässlich sein, nicht zu smart, aber auf keinen Fall zu durcheinander erscheinen. Richtig harte Arbeit, die laut den Forscherinnen auf dem Klischee der schwierigen Patientin beruht. Sie will nicht gesund werden, hungert nach Aufmerksamkeit. Sie dramatisiert und ist hysterisch. In vielen Studien ist belegt, dass Frauen in Behandlungszimmern öfter eine Skepsis trifft, ihr Empfinden wird infrage gestellt, sie werden zurückgewiesen, als empfindlich und die Beschwerden als psychosomatisch abgetan. Nicht zuletzt entwickelten Frauen, deren Körper von dem, was wir als gesund bezeichnen, abweichen, häufig Schuldgefühle. Der dysfunktionale Körper ist für sie bedrohlich. Noch bedrohlicher, wenn die Frau zu einer marginalisierten Gruppe gehört. Wenn sie nicht weiß oder trans ist. Erstmals bei der Journalistin Eva Biringer lese ich in »Unversehrt« das Wort Gender Pain Gap. Ein Mann, steht auf dem Buchrücken, bekommt Schmerzmittel. Eine Frau etwas für die Nerven.3 Dahinter verbirgt sich die ganze lange Medizingeschichte, in der ein männlicher, heterosexueller, weißer, nicht-behinderter Körper die Norm darstellt.
VIER
In ihrem Essay »Große Universaltheorie über den weiblich Schmerz« schreibt die US-amerikanische Autorin Leslie Jamison über die Ambivalenz des real empfunden Schmerzes und den Fetisch der kranken, verwundeten Frau, deren Zerbrechlichkeit attraktiv ist, weil sie so nicht mächtig sein kann.4 Laut Jamison laufen wir immer Gefahr, den weiblichen Schmerz zu romantisieren und ihn so als konstitutiven Bestandteil der Erfahrung von Frauen hinzunehmen. Diese Idee ist mindestens so alt wie die Bibel: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gebären.5 Und tatsächlich gilt es auch heute noch als der Königinnenweg, Kinder vaginal und ohne PDA zu bekommen, entschieden vertreten von Verfechter*innen der Natürlichkeit, die beim leisesten Kopfschmerz oder nach einer wilden Nacht unverzüglich eine Schmerztablette einwerfen.
Mittlerweile ist es Sommer geworden. Dass mein Schmerz eventuell dramatisiert oder eingebildet ist, vermuten nicht nur die Ärzt*innen. Auch mein Partner, Freund*innen und Familie reagieren skeptisch, nachdem Monate vergangen sind und immer noch keine Besserung eingetreten ist. Als könnte das nicht sein, ein Schmerz, für den es keine Erklärung gibt. Sie sagen es nicht direkt. Ich merke es an ihren ausweichenden Blicken, einem Mitgefühl, das schwindet, als wäre das eine Ressource, die versiegen kann. Die einzige Person, die nicht an ein psychosomatisches Leiden glaubt, ist ausgerechnet meine Therapeutin, die mich seit vielen Jahren begleitet: Das Psychosomatische ist auch Indikator für die Hilflosigkeit der Behandelnden, die eine somatische Ursache (evtl. noch) nicht finden können. Es markiert das Unerklärliche, die Grenzen der Medizin. Nimmt man die Diagnose an, ist das Problem medizinisch gelöst, stellt man sie infrage, ist man einfach noch nicht einsichtig genug. Wissen Sie, sagt meine Therapeutin, bis vor wenigen Jahrzehnten wurden in der Palliativmedizin die Möglichkeiten der Schmerzbehandlung nur extrem eingeschränkt eingesetzt. Viele Sterbende mussten so unnötig starke Schmerzen leiden. Im Krankenhaus wurden sie in sogenannte Sterbezimmer abgeschoben, weit weg vom restlichen Betrieb. Der Schmerz, das verstehe ich langsam, stellt auch die ganz grundsätzliche Frage danach, wie viel man davon anderen zumuten kann. Wie sehr ich mich meinem Umfeld zumute.
FÜNF
Zu den Schmerzen kommt die Erschöpfung. Ich muss mich mehrmals am Tag hinlegen. Nachts liege ich wach und grüble, wie es weitergehen soll. Ich muss arbeiten, Geld verdienen. Wieder auf die Beine kommen. Für die Kinder da sein. Tragen, trösten, versorgen. Das Elterngeld reicht hinten und vorne nicht. Aber die Pandemie ist noch nicht vorbei, die Chancen als selbstständige Autorin wenig aussichtsreich. Ich habe bereits viel zu viel für alternative Behandlungen ausgegeben. Schmerzmittel nehme ich nur dann, wenn ich es nicht mehr aushalte, um weiterhin stillen zu können. Immerhin das geht. Immerhin hier kann mein dysfunktionaler Körper performen. Trotzdem weine ich, auch vor dem großen Kind, das mich mitfühlend ansieht: Hast du Rückenschmerzen, Mama? Dabei streichelt es meinen Arm. Ich werde wütend und sage, dass es nicht seine Aufgabe ist, mich zu trösten. Danach fühle ich mich schuldig. In meiner ganzen fatalistischen Hilflosigkeit befrage ich ein Orakel im Internet.
Ich frage: Wird mein Rücken dieses Jahr noch besser?
Es antwortet: Wenn du mich fragst: Nein.
Ich bin sprachlos. Dann frage ich:
Wird es irgendwann wieder richtig gut?
Vermutlich nicht.
Jetzt bin ich richtig wütend.
Ey, Orakel. Bist du ein Arschloch?
Ich kann nicht alles wissen.
Um sicherzugehen, dass diese ganze Sache hier wirklich absurd ist, gebe ich noch einmal die Frage vom Anfang ein.
Wird mein Rücken besser werden?
JA!
SECHS
Schwangerschaft und Geburt bedeuten eine Krise für den Körper. Nicht selten begegnen wir hier erstmals – oder zumindest in einem besonderen Maße – unserer eigenen Verletzlichkeit, der Fragilität von Leben. Die Erkenntnis, von anderen Menschen abhängig zu sein, ist darüber hinaus für viele im Kapitalismus Sozialisierte ein Schock, und trotzdem könnte man meinen, die größte Herausforderung läge genau darin, nach der Geburt möglichst schnell die lästige mom-pooch, ein Fettpolster um Bauch und Hüfte, loszuwerden, glaubt man dem Insta-Feed. Hier teilen Frauen ihren »After-baby-body«, oft in einer Vorher-Nachher-Ästhetik. Dabei scheint der Fluchtpunkt immer das Vorher zu sein. Und der Maßstab der wertende Blick von außen. Bilder aber verraten selten etwas über die Gesundheit oder darüber, wie wohl man sich in seinem Körper fühlt. Etwas, das sich nur schwer messen lässt, zumal ich behaupten würde, dass die wenigsten Mütter Zeit haben, sich überhaupt irgendwie zu fühlen, weil sie in erster Linie funktionieren.
Im Herbst hat meine Müdigkeit einen Punkt erreicht, an dem ich mich willenlos fühle. Mein Kind springt von Pfütze zu Pfütze, ich schiebe den Kinderwagen, es kostet mich unendlich viel Kraft. Kehrmaschine, ruft das Kind da plötzlich, Kehrmaschine, kaputt und deutet mit seinen kleinen Fingern aufgeregt auf eine Raupe der BSR, die zwar ein Geräusch macht, aber sich nicht vorwärts bewegt. Ich höre Care-Maschine und denke entrüstet: Das bin ja ich.
SIEBEN
Die Sache ist: Solange unser Inbegriff für Fürsorge die Mutter ist, kann die Mutter keine Fürsorge einfordern. Die Mutter als Heilige, als Mater Dolorosa, also Schmerzensmutter, die sich aufopfert und alles erträgt, kann keine gesunde Mutter sein. Und wenn eine Mutter krank ist, leidet nicht nur sie, sondern krankt das ganze System, das auf ihr lastet. Die immer verfügbare Mutter als Verkörperung für Care ist auch ein Problem, wenn es darum geht, anderen Unterstützung anzubieten; wie oft bin ich selbst davor zurückgeschreckt, weil ich dachte, ich müsste dann zu jeder Zeit da sein, immer erreichbar. Die Autorin, Pädagogin und Trainerin für transformative Gerechtigkeit und Behindertengerechtigkeit Mia Mingus hat mit Pod-Mapping ein Tool entwickelt, bei dem Personen insbesondere vulnerabler Gruppen sogenannte Pods benennen – Menschen, die im Leben dieser Person eine Rolle spielen und im Falle eines Übergriffes oder einer Krise unterstützen. In ihren Workshops werden die Teilnehmenden eingeladen, über ihre Ressourcen nachzudenken und konkrete Absprachen zu treffen – bevor die Krise eintritt. Dazu gehört es, sich unbequeme Fragen zu stellen: An wen könnte ich mich im Falle eines sexuellen Übergriffs wenden? Aber auch: An wen kann ich mich wenden, wenn ich selbst jemandem Leid zugefügt habe? Ziel der Methode ist es, eine verbindende und gerechtere Form des Zusammenlebens zu (er)finden. If everyone had a pod, imagine how much more resourced and supported we could all be. Imagine how much more accountable and brave we might attempt to be,6fordert Mingus uns auf. Dabei geht es explizit auch darum, die Verantwortung zu lösen, die auf familiären Verflechtungen lastet. Natürlich macht es Sinn, Fürsorge in Krisen auf mehrere Schultern zu verteilen. Wenn wir aufhören würden, die Mutter als Personifikation von Care zu sehen, wenn auch Partner*innen, Kolleg*innen, Freund*innen, Institutionen, Politik, kurz: die Gesellschaft fürsorglicher wären, würde es allen besser gehen. Nicht nur den Müttern, sondern auch all jenen, die von ihnen abhängen.
ACHT
Schließlich überweist mich meine Hausärztin zum MRT. Es ist ein letzter Versuch, meinen Körper sprechen zu lassen. Sein Leiden aus der Unsichtbarkeit ans Licht zu zerren.
Ich wähle die Nummer der Radiologie, schlüpfe in meine Patientinnen-Rolle.
Radiologie: Haben Sie Metall im Körper oder Platzangst?
Ich: Ich weiß nicht genau, ob ich nicht vielleicht Platzangst bekomme, woher soll ich …
Radiologie: Metall im Körper?
Ich: Nein.
Radiologie: Ok. Dann kommen Sie bitte übermorgen.
Dass sie einem ein Gitter über das Gesicht legen. In der Röhre beginnt ein Metal-Konzert, auf das ich nicht vorbereitet war. Ich halte den Notfall-Knopf in der rechten Hand wie einen Gebetskranz auf dem Bauch. Nicht drücken, nicht drücken, NICHT drücken! Als ich nach Hause komme, notiere ich: Platzangst im eigenen Körper. Ich tue, was ich schon immer getan habe in Krisen. Schreiben, um nicht durchzudrehen. Lieben, um nicht zu verzweifeln. Der Bericht schließt einen Bandscheibenvorfall aus. Ich bin nicht sicher, was ich mir mehr gewünscht habe: endlich eine Diagnose oder die Bestätigung, dass nichts irreparabel kaputt ist und damit die Hoffnung, dass alles am Ende gut wird. Ich denke darüber nach, was es bedeutet, in einem Körper zu sein, den man nicht verlassen, nur schreibenderweise kurzzeitig ablegen kann. Ich weine viel. Manchmal merke ich es selbst gar nicht mehr, sondern erkenne es in den fragenden, auch erschrockenen Blicken der Menschen, die meinen Weg kreuzen, nachdem ich die Kinder in die Kita gebracht habe. Mein Partner fragt schon lange nicht mehr. Auch er sieht müde aus, ist gereizt und braucht Zeit für sich. Es ist doch alles schon anstrengend genug, sagen seine halbherzigen Umarmungen.
Jemandem den Rücken kehren
Jemandem den Rücken stärken
Jemandem in den Rücken fallen
Sich den Rücken krumm arbeiten
Etwas im Rücken haben
(K)ein Rückgrat haben
Jemandem den Rücken freihalten
Etwas fällt einem in den Rücken
Etwas auf dem Rücken von jemandem austragen
Etwas läuft kalt den Rücken hinunter
Mit dem Rücken zur Wand stehen
(…)
Am Ende ist es vielleicht nicht der Körper, der spricht, sondern unsere Sprache, die ihn verrät.
NEUN
Im Herbst geht es mir besser, erst unmerklich, dann wundere ich mich selbst darüber. Die Schmerzen sind noch da, aber ich habe aufgehört, in den wenigen freien Zeitfenstern Ärzt*innen aufzusuchen, die mir dann doch nicht helfen können. Ich versuche, Pausen zu machen und mich dafür nicht zu entschuldigen. Ich bewege mich so, dass ich Spaß daran habe, nicht weil ich denke, ich müsste es tun. Ich fahre übers Wochenende mit einer Gruppe befreundeter Autorinnen, die auch Mütter sind, in ein kleines Haus in Brandenburg. Wir arbeiten nicht, das müssen wir uns vornehmen, sondern kochen, reden, trinken Wein und schlagen uns die Bäuche mit Raclette voll. Wir sind so gierig nach Gesprächen, dass wir erst um vier Uhr mit glühenden Wangen ins Bett steigen. Am nächsten Tag besuchen wir den Tierpark und sehen den Braunbären bei der Fütterung zu. Wie sie sich auf die Stücke des rohen und roten Fleisches stürzen. In den Augen purer Überlebenswille. Zurück im Haus habe ich fünf verpasste Anrufe meiner Agentin. Dass ein großer Verlag meinen zweiten Roman kaufen will, sagt sie, und nennt eine Summe, die mir in diesem Moment horrend groß erscheint. Ich weine vor Freude, vor allem aber vor Erleichterung, weil ich weiß, wie ich mich und meinen Anteil an der Familie im nächsten Jahr finanzieren kann. Dass ich weiter werde schreiben können. Eine von uns fährt zur Tankstelle und kommt mit einem Crémant zurück.
Vielleicht liegt es am Austausch. Je mehr ich mit anderen spreche, Scham überwinde, desto weiter wird mein Blick für die Transformation des Körpers, die in Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt steht und weit über straffe Haut oder Gewichtszunahme hinausgeht. Kaum eine Person, lerne ich, hat nach dieser tiefgreifenden Veränderung keine Baustelle. In einem Artikel der ZEIT verweist Carla Baum auf eine aktuelle Studie, laut der ein Drittel aller Gebärenden Rückenschmerzen hat, ein Drittel Schmerzen beim Sex und ein Viertel eine Depression bekommt.7 Auch Herz-Kreislauf-Probleme oder Nierenschäden könnten eine Langzeitfolge sein. Geburtstraumata, hormonelle Störungen, verlorene Zähne, chronische Blasenentzündungen, Beckenbodenschwäche. Auf einmal sind die Versehrten überall. Diese faulen Muttis, also Frauen wie ich. Sie arbeiten, sind ehrgeizig, sie wollen eine gute Mutter sein, zumindest good enough, denken bindungsorientiert, quetschen irgendwo noch ein Pilates-Training dazwischen. Sie jammern nicht. Leiden unter Schlaflosigkeit, Schmerzen beim Sex, Panikattacken. Sie nehmen das alles hin, weil sie keine Wahl haben. Oder haben sie eine Wahl? Laut Baum setzt sich das Problem aus einem fehlenden medizinischen Netz einerseits und dem weit verbreiteten Glauben andererseits, man müsse dieses Leid im Tausch gegen das Kind eben ertragen, zusammen.8 Dass Kinderkriegen Knochenarbeit ist, unbezahlte wohlgemerkt, darf man trotzdem kaum laut sagen.
Das Erste, was ich mir vom Vorschuss kaufe, ist eine Wellness-Reise. Ich fühle mich unanständig dekadent. So viel Geld nur für mich allein auszugeben. Eine Woche im Odenwald. Weder muss ich kochen noch danach abspülen. Es gibt gutes, nahrhaftes Essen. Jeden Tag bekomme ich eine Massage. Es ist November und unwahrscheinlich sonnig. Nachmittags laufe ich über saftig grüne Wiesen, durch Täler, in den Wald, höre dabei Musik, setze mich in die torfige Erde und weine, weil ich am Leben bin und glücklich.
ZEHN
Das könnte ein Happy End sein. Eigentlich. Aber da ist noch etwas. Die Körper-Krise hat in mir etwas Beunruhigendes freigelegt. Im Internet studiere ich stundenlang Bilder von Skoliose, denke dabei an den Glöckner von Notre Dame, diese bucklige Gestalt. Voller Faszination, auch Horror. Ich bin ein schüchternes und scheues Kind mit ausgeprägtem Hohlkreuz gewesen. In der Pubertät machte ich dann eine Verwandlung durch. Ich fing an zu tanzen, ging aufrecht und merkte am eigenen Körper den Unterschied: wie anders Menschen einem begegnen, wenn man einen Raum mit Präsenz füllt. Zwanzig Jahre später stand ich vorm Spiegel und fiel in mich zusammen. Egal wie sehr ich mich bemühte, ich konnte mich nicht gerade halten. Wenn die Mutter die Heldin ist, die blasse Kranke vornehm und begehrenswert, dann ist die chronisch kranke oder behinderte Frau monströs. Da war er, mein internalisierter Ableismus. Mein Körper wisperte, er verriet mich, und zugleich legte er die Last ab, unverletzlich, verlässlich und stark zu sein.
Dabei ist Krankheit gewiss eine kapitalistische Erfindung, die auf Binarität fußt: Wer krank ist, kann nicht arbeiten und wer arbeitet, ist deshalb gesund. Jemand, der immerzu auf Hilfe angewiesen ist, gilt daher als abnormal. Wir verdrängen, dass wir alle einmal behindert sein werden. Being not disabled means NOT YET, sagt die Autorin und Aktivistin Johanna Hedva treffend in einem Talk auf YouTube. No matter how it arrives, disability will arrive.9 Anders als bei Queerness oder Blackness ist Krankheit, Dysfunktion und in logischer Konsequenz auch der Tod des Körpers ein Schicksal, das uns alle erwartet – manche früher, andere später.
ELF
Ich sitze auf dem Balkon; die Vögel gehen ab, die Sonne scheint. Es ist Mai und das kleine Kind schon über ein Jahr alt. Der Frühling kam spät. Fast sah es so aus, als würde er gar nicht kommen, und dann ist er da; wuchtig, irgendwie obszön, wie die Blüten des Blauregens vor unserem Küchenfenster. Es ist ausgerechnet Muttertag und ich versuche, einen Faden aufzunehmen. Immer di