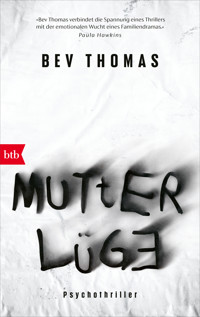
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Therapeutin ist sie erfolgreich. Als Mutter eine Versagerin. Doch das weiß niemand. Bis ein Patient kommt, der beide Rollen in ihr anspricht.
Ruth Hartland ist Leiterin einer renommierten Traumatherapie-Einrichtung. Sie ist selbstbewusst und beruflich anerkannt. Aber ihr Privatleben liegt in Scherben: Vor mehr als einem Jahr ist ihr 17-jähriger Sohn Tom verschwunden, und sie quält sich mit Selbstvorwürfen: Hat sie ihren Beruf über die Familie gestellt? War sie keine gute Mutter? Als ein neuer Patient zu ihr kommt, der Tom erschreckend ähnlichsieht, weiß sie als Therapeutin genau, was zu tun ist. Aber als verzweifelte Mutter trifft sie eine ganz andere Entscheidung. Mit fatalen Konsequenzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Als Therapeutin ist sie erfolgreich. Als Mutter eine Versagerin. Doch das weiß niemand. Bis jemand zur Behandlung kommt, der beide Rollen in ihr anspricht.
Ruth Hartland ist Leiterin einer renommierten Traumatherapie-Einrichtung. Sie ist selbstbewusst und beruflich anerkannt. Aber ihr Privatleben liegt in Scherben: Vor mehr als einem Jahr ist ihr 17-jähriger Sohn Tom verschwunden, und sie quält sich mit Selbstvorwürfen. Hat sie ihren Beruf über die Familie gestellt? War sie keine gute Mutter? Als ein neuer Patient zu ihr kommt, der Tom erschreckend ähnlich sieht, weiß sie als Therapeutin genau, was zu tun ist. Aber als verzweifelte Mutter trifft sie eine ganz andere Entscheidung. Mit fatalen Konsequenzen.
BEVTHOMAS war viele Jahre als klinische Psychologin tätig. Ihr Thriller-Debüt Mutterlüge erhielt großes Presselob und wurde von den Leserinnen und Lesern für die besondere psychologische Tiefe bei der Figurengestaltung gefeiert. Derzeit arbeitet sie als Beraterin für psychische Gesundheit in verschiedenen Unternehmen. Sie lebt mit ihrer Familie in London. Ein weiterer psychologischer Thriller bei btb ist bereits in Vorbereitung.
Bev Thomas
Mutterlüge
Psychothriller
Aus dem Englischen von Yvonne Eglinger
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel A Good Enough Mother bei Faber & Faber, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Die Übersetzerin dankt dem Land Baden-Württemberg und dem Freundeskreis zur Förderung literarischer und wissenschaftlicher Übersetzungen e.V. sehr herzlich für ein Arbeitsstipendium, mit dem die vorliegende Übersetzung gefördert wurde.
Deutsche Erstveröffentlichung Januar 2025
Copyright © der Originalausgabe 2019 by Good Enough Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
Covermotiv: Umschlagmotiv: © Shutterstock / Cafe Racer, Marusoi, Ensuper
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MA · Herstellung: BB
ISBN 978-3-641-23953-4V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Colin
1
Auf dem Papier wirkte Dan Griffin kein bisschen außergewöhnlich. Er war ängstlich, er stand unter Druck, er war wie jeder andere Patient bei uns in der Trauma-Abteilung. »Unauffällig«, so beschrieb ich ihn der Polizei. Als die Beamten in meinen Aufzeichnungen jener ersten Therapiesitzungen nach Antworten suchten, lasen sie vom Bluterguss auf seinem Gesicht, von der Angst in seiner Stimme und den Flashbacks, die so stark waren, dass es ihm den Atem verschlug, aber nichts deutete auf Gewaltbereitschaft hin. Absolut nichts ließ erahnen, wozu er imstande war. Ich brauchte eine Weile, ehe ich verstand, dass die entscheidende Frage nicht lautete: »Warum habe ich es nicht kommen sehen?«, sondern: »Warum bin ich nicht aus der Schussbahn gegangen?«
Dans Erstgespräch findet an einem Freitagnachmittag im April statt, am Ende einer schwierigen Woche – Unmengen von Neuaufnahmen, eine E-Mail über Budgetkürzungen und dann, just an jenem Morgen, der unerwartete Anruf zum Tod eines Patienten, Alfie Burgess. Die Hospizschwester ist einfühlsam, als sie mir davon berichtet. »Friedlich«, sagt sie, »im Kreis seiner Familie.« Dann noch ein paar weitere Einzelheiten, die ich nicht höre. »Sie sagen es Ihrem Team?«, fragt sie am Ende des Gesprächs. Natürlich sollte ich als Abteilungsleiterin allen davon erzählen, und früher wäre ich Führungsaufgaben wie dieser nur allzu gern nachgekommen. Ich war gut darin, die Arme auszubreiten und den Kummer meiner Abteilung aufzufangen. Kompetent, fähig. Doch an jenem Tag, so kurz vor Toms Geburtstag, zittert mir die Hand, als ich auflege.
Es ist schlimmer geworden, dieses Gefühl. Das einstige Flattern in der Magengrube ist zu einer starken Spannung im Brustbereich geworden. Es überfällt mich bei jeder Todesmeldung, ganz gleich, wer gestorben ist; ob es sich um den Freund eines Nachbarn handelt oder ich nur in der Zeitung davon lese. Doch wenn es jemand ist, den ich gut kenne, wie Alfie, wird das Spannungsgefühl stärker, bis ich mich nur noch mit Mühe bewegen kann. Nie entsteht ein Bild oder eine Vorstellung in meinem Kopf, da ist nur dieses schleichende Grauen in Bezug auf Tom. Ich versuche, mich auf Alfie zu konzentrieren, und wie ich es dem Team sagen werde, aber mein Körper ist ganz starr, als ob er in Deckung gegangen wäre.
Toms Geburtstag ist zur Obsession geworden. Das war mir schon vorher klar. Letztes Jahr war es genauso. Neuerdings kann mir so gut wie jedes Ereignis die verstreichende Zeit vor Augen führen; die ersten bunten Blätter im Herbst, der erste zarte Raureif oder die ersten lila und gelben Kleckse der Krokusse. Alles kleine Hinweise, dass die Welt sich ohne ihn weiterdreht. Aber der Tag seiner Geburt? Sein Geburtstag? Welche Mutter möchte sich nicht in den wunderbaren Kokon dieses Augenblicks zurückversetzen, egal wie alt ihr Kind ist? Da ist so eine nervöse Vorfreude, von der ich weiß, dass sie ins Leere laufen wird. Das Datum wird ohne ihn kommen und gehen, die Hoffnung wird in sich zusammenschrumpfen, wie ein leerer Luftballon, und manchmal ist es mir schon zu viel, ihn wieder in die gewohnte Form zu pumpen. Ich hatte bereits früher solche Tage, und ich weiß, sie gehen vorüber. Trotzdem bin ich in diesem Moment zu sehr davon eingenommen. Ginge es um jemand anderen, irgendein anderes Mitglied meines Teams, würde ich der Person klarmachen, dass sie bei der Arbeit nichts verloren hat. »Geh nach Hause«, würde ich sagen, »und gönn dir eine Pause.« Aus offensichtlichen Gründen ist zu Hause der letzte Ort, an dem ich sein will.
An jenem Tag bin ich wie eine übervolle Badewanne. Tropf, tropf, tropf. Die Last macht mich schwer, als würde ich beim nächsten kleinen Anliegen überschwappen, mich über den ganzen Boden ergießen. Und doch bürde ich mir immer noch mehr auf. Eine neue Patientin? Eine weitere Supervisionsgruppe? Eine Präsentation auf einer Konferenz? Ja, ich mach’s, höre ich mich sagen. Und ich tue es in der Hoffnung, dass es die Leere füllen wird. Ich suche nicht nach einer Rechtfertigung. Es gibt keine. Doch mein Gemütszustand an dem Tag, als ich Dan Griffin kennenlerne, lässt sich nicht leugnen.
Nach dem Anruf sitze ich noch eine Weile am Schreibtisch. Ich stelle mir vor, wie ich den anderen das mit Alfie erzähle, und ich weiß genau, wie es ablaufen wird. Ernste Gesichter. Trauer, Tränen, gedämpfte Stimmen und Umarmungen. Wir werden Tee kochen und uns an ihn erinnern, an sein munteres »Na, alles klar?«, wenn er in die Aufnahme kam. In Gedanken werden wir bei seinen Eltern sein, die ihr Schicksal still und mit Würde getragen haben; gemeinsam werden wir unserer Wut über all die Ungerechtigkeit Luft machen. Wir werden einander daran erinnern, dass er krank war, dass Porphyrie eine degenerative Erkrankung ist. Dass er alle Erwartungen übertroffen hat. »Er hat sich so gut geschlagen«, werden wir schließlich sagen, »wenn man bedenkt …«
Bei aller Kameradschaft und Anteilnahme wird man den untergründigen Wettstreit spüren: Wer kannte ihn am besten, wer hat das Anrecht auf die größte Trauer? Wir werden daran denken, wie lange er schon wegen seiner Spritzenphobie zu uns kam, mit Unterbrechungen seit über acht Jahren, vielleicht länger. Ich weiß noch, wie ich Tom einmal von ihm erzählt habe. Natürlich, ohne seinen Namen zu nennen. Tom hatte Albträume, und ich wollte ihn beruhigen, seine Ängste ins Verhältnis setzen. Mit weit aufgerissenen Augen saß er da, während ich ihm Alfies Panik schilderte, und wie wir ihm zu helfen versuchten. »Siehst du«, sagte ich und strich Tom übers Haar, »jeder hat seine Probleme.«
Wir werden uns in Erinnerung rufen, wie gut es Alfie zu gehen schien, als er zuletzt gekommen ist. Wir werden auf einer Beileidskarte unterschreiben und Geld für einen Kranz sammeln; mich schwindelt, wenn ich nur daran denke. Aufgaben, die ich über Jahre gern erledigt habe und die mir zudem leichtgefallen sind, scheinen mir heute kaum zu bewältigen.
Ich will nicht noch mehr Kummer. Noch mehr Tod. Ich fühle mich schon jetzt davon verfolgt. Ich will den Hörer auflegen und so tun, als wäre nichts passiert. Aber das geht nicht. Es würde auf mich zurückfallen. Ruth Hartland. Leiterin der Trauma-Abteilung. Ich trage die Verantwortung. So steht es auf dem Schild an meiner Tür.
Diesmal habe ich Glück. Nachdem ich es meinen Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarbüros erzählt habe, laufe ich im Flur Paula in die Arme, und da sie ganz in ihrer neuen Stellung als Büroleiterin aufgeht, bin ich mir sicher, dass sie es dem Rest des Teams mitteilen und bis zum Mittag die Sammlung für den Kranz organisiert haben wird.
Den restlichen Morgen über gehe ich weiteren Begegnungen und Gesprächen aus dem Weg, aber am Nachmittag muss ich bei der Hauptverwaltung die Akten für die neu eingewiesenen Patienten anlegen. Ich nehme die leise Trauer ringsum wahr. Auch stoischer Widerstand ist dabei. Schau her, scheint einem die Atmosphäre zu sagen, wir sind Klinikpersonal, wir wurden dafür ausgebildet, mit schwierigen Gefühlen umzugehen – inklusive unserer eigenen. Tom hat oft darüber gewitzelt. »Mum«, sagte er immer, »du bist jetzt zu Hause, du musst nicht mehr die Therapeutin spielen.« Und doch stelle ich eine gesteigerte Empfindsamkeit fest, alle gehen sehr vorsichtig miteinander um, als wären sie besonders verletzlich. Nach zehn Minuten bekomme ich wegen all der Liebenswürdigkeit und mitfühlenden Blicke keine Luft mehr.
Diese Stimmung ändert sich bald; der Tod macht uns selbstsüchtig. Irgendwann ziehen wir uns in uns selbst zurück und denken über das eigene Leben und unsere Familien nach. Ausnahmsweise bin ich dankbar für Paula, die stets überschwänglich im Namen des Teams spricht. Sie sieht von ihren Papieren auf. »Ein solches Ereignis erinnert uns daran, wie viel wir oft als selbstverständlich hinnehmen«, sagt sie und wirft einen Blick in die Runde. »Ich will jetzt einfach nur nach Hause und meine Kinder in den Arm nehmen.« Sie schlingt die Arme um sich selbst und drückt sich fest. »Das geht uns sicher allen so.«
Ich sage nichts. Ich nehme sie nicht beiseite und erinnere sie an Eve, die keine Kinder hat, sich aber welche wünscht. Ich lächle nur und nicke. Ich rede nicht von mir selbst. Das kann ich nicht. Niemand weiß Bescheid. So ist es besser.
Dan Griffin ist an jenem Nachmittag mein letzter Patient. Mein Zimmer liegt nahe beim Wartebereich, und ich brauche nur etwa eine Minute, um einen Patienten von dort abzuholen – ein Gang, den ich in den letzten 25 Jahren Hunderte Male gemacht habe. Als Tom und Carolyn noch klein waren, haben sie mich manchmal hier besucht. Ich weiß noch, dass Tom den »Kreiselstuhl« in der Hauptverwaltung mochte, wo er ab und zu saß und aus dem Fenster über die Baumwipfel blickte. Sie wären beide überrascht, wie wenig sich hier verändert hat; der Teppich und die Möbel sind noch immer dieselben. Im Lauf der Jahre ist an den Flurwänden ein bisschen was dazugekommen: der gerahmte Beacon Award für exzellente medizinische Einrichtungen, das Anerkennungsschreiben der Stiftung für herausragende klinische Leistungen. Aber davon abgesehen, ist alles beim Alten; das Meeresbild beim Aufzug, die Reihe abstrakter Gemälde mit versprengten geometrischen Formen und das Motiv, das Tom am liebsten mochte: der durch den Regen springende zottige Hund. Genau das bieten wir unseren Patienten: ein Gefühl der Beständigkeit, etwas Gleichbleibendes und Verlässliches, das stark traumatisierte und von schrecklichen Ängsten geplagte Menschen so dringend brauchen. Heutzutage würde David bei solcherlei psychologischer Theoretisierung mit den Achseln zucken. »Was macht das schon für einen Unterschied?«, würde er fragen. Vielleicht wegen dem, was mit unserer eigenen Familie passiert ist.
Wenn ich einen neu überwiesenen Patienten abhole, nehme ich mir in der Regel kurz Zeit, um mich zu sortieren; ich richte meine Gedanken auf die neue Person und den Prozess aus, der vor uns liegt. Heute tue ich das nicht. Gern würde ich behaupten, dass ich an Alfie und seine Eltern gedacht habe, aber das wäre gelogen.
Meine Schritte sind langsam und zielstrebig, den Blick halte ich auf die schwimmbadblauen Teppichfliesen gesenkt. Erst als ich am Treppenhaus vorbei bin, schaue ich auf und entdecke ihn im Wartezimmer am Ende des Flurs. Ich bleibe stehen und starre ihn an. Alles andere schwindet, tritt in den Hintergrund.
Er sitzt zusammengekauert auf dem Stuhl neben der Tür, den Kopf in die Hände gestützt, die Haare hängen ihm über die Finger. Ich höre mich selbst einen Laut ausstoßen, wie ein erstickter Schrei, und dann rollt eine sanfte Woge durch mich hindurch. Plötzlich fühle ich mich leicht. Wie hochgehoben. Er hat sich die Haare wieder lang wachsen lassen. David würde es hassen. Aber ich freue mich. Kurz bevor ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, hatte er sie sich völlig abgesäbelt und lange goldene Locken im Waschbecken hinterlassen, bei deren Anblick ich am liebsten losgeheult hätte. Jetzt sind sie bis auf die Schultern nachgewachsen. Lange Haare stehen ihm, denke ich, während ich mit einer Hand Halt an der Wand suche.
Als ich näher komme, sehe ich seine Donkeyjacke. Die, die wir ihm mal zu Weihnachten geschenkt haben. Mit dem Schottenkaro als Innenfutter. Mein Herz pocht jetzt heftig. Er trägt ein neues T-Shirt, das ich nicht wiedererkenne, und ein roter Rucksack liegt auf seinem Schoß. An den Füßen: Doc Martens. Immer diese schwarzen Stiefel. Wie ich sie so sehe, muss ich lächeln. Tom, da bist du ja, denke ich, oder vielleicht sage ich es auch laut. Mein Brustkorb hebt und senkt sich, und dann renne ich unbeholfen los, sodass die Patientinnen und Patienten im Wartezimmer aufschrecken. Ein paar schauen hoch. Auch Tom. Als er den Kopf hebt, fährt mir ein dumpfer Schmerz in die Magengrube, wie ein Schlag. Er ist es nicht.
Ich halte abrupt inne. Taumele zurück. Eine seltsam torkelnde Bewegung. Der junge Mann, der aufblickt – eigentlich noch ein Junge –, sieht mich kurz mit ausdruckslosem Gesicht an, dann blickt er wieder nach unten in seine Handflächen. Ich bemerke das blaue Auge, den Bluterguss auf der Wange und den Kopfverband. Es ist nicht Tom. Mir ist schwindlig, geradezu schlecht. Ich greife nach dem Türrahmen und halte mich daran fest.
Ich bin es gewohnt, meinen Sohn an den unterschiedlichsten Orten zu sehen. Ich habe inzwischen verstanden, dass das normal ist, dass es uns allen so geht. In den letzten anderthalb Jahren habe ich ihn oft »gesehen«. Erst letzte Woche lief er den Hügel zu seiner alten Grundschule hoch. Es war kurz vor seinem Wachstumsschub in der vierten Klasse. Er war mit Finn unterwegs, trat nach dessen Tasche, lachte und alberte herum, während sie einander anrempelten.
Manchmal sehe ich ihn, wie er schon älter ist. Eine winzige Kleinigkeit kann mich in den Bann ziehen; die gekräuselten Haare im Nacken, wenn er aus der U-Bahn steigt, oder sein leichter, schwebender Gang, wenn er einen Strand entlangläuft. Manchmal, und das macht mich immer am traurigsten, sieht er genauso aus wie zu der Zeit, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Siebzehn, mit ruhelosem Blick und einem grausamen Haarschnitt. Diese flüchtigen Eindrücke verfliegen jedes Mal schnell, Bilder, die aufschimmern und wieder verschwinden, sobald ich genauer hinschaue. In der Regel weiß ich sehr gut, was ich da tue; dass ich ihn willentlich heraufbeschwöre, dass ich das Gesicht ahnungsloser Fremder in jenes verwandle, das ich sehen will. Als ich an diesem Tag im Türrahmen stehe, verblasst oder verschiebt sich die Ähnlichkeit nicht, sie ist klar und hart und beunruhigend.
»Dan Griffin?«, frage ich und lasse den Blick durchs Wartezimmer schweifen. Ich weiß genau, wer gleich aufstehen wird. Beim Klang seines Namens fährt er verlegen hoch und nickt mir zu. Danach erinnere ich mich an fast nichts mehr. Vielleicht schwitzt er, vielleicht zittern ihm die Hände, als er nach seinem Rucksack greift; nichts davon ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich achte kaum auf ihn. Während ich zurück zu meinem Büro gehe, richte ich all meine Kraft darauf, meinen Körper aufrecht zu halten und meine Schritte gerade und gleichmäßig über die blauen Teppichfliesen zu lenken.
Auf dem Überweisungsschein stand, dass er zweiundzwanzig ist, aber er sieht viel jünger aus. Er wurde mit dringlicher Überweisung von Dr. Jane Davies zu uns geschickt, einer Vertretungsärztin aus Hackney, die ich nicht kenne.
Sehr geehrte Ruth Hartland,
ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen jungen Mann, der neu in die Gegend gezogen ist, vordringlich beurteilen könnten. Dan Griffin hatte kürzlich ein höchst traumatisches Erlebnis, und er zeigt die klassischen PTBS-Symptome. Über den Vorfall konnte er nicht sprechen, aber ich vermute, dass es ein übler Angriff in einem Park war. Angesichts seiner starken Ängste habe ich ihn allerdings nicht gedrängt, mir Einzelheiten zu nennen. Ich habe die Aufzeichnungen seines früheren Hausarztes angefordert …
Mit kollegialen Grüßen usw., Dr. Davies
Dan schaut zu Boden und drückt den Rucksack an die Brust. Sein Körper ist angespannt, der Blick verunsichert. Ich stelle mich ihm vor, frage, wie ich ihm helfen kann. Es folgt eine lange Pause. Er sieht auf, schluckt mehrmals, dann starrt er mich so intensiv an, dass ich am liebsten den Blick abwenden würde.
Vielleicht bemerkt er meine Bedrängnis nicht, weil er so sehr mit seiner eigenen beschäftigt ist. Mein rotes Gesicht, das noch immer wie wild pochende Herz; es scheint mir unmöglich, dass er das unter meinem taillierten blauen Blazer nicht sieht. Ist es der Schock? Die Enttäuschung? Wut oder Scham über meine eigene Dummheit? Was habe ich mir nur gedacht? Was hätte David sich gedacht? Ich stelle mir sein Augenrollen vor, aber zugleich frage ich mich wirklich, ob er gesehen hätte, was ich gerade sehe.
Zu Beginn der Sitzung redet Dan viel. Seine Stimme klingt abgehackt und atemlos, als er mir erzählt, dass er »verzweifelt« ist, es »nicht auf die Reihe« kriegt, und mir das Ausmaß seiner Flashbacks offenbart. Ich bin dankbar für diese Informationen und nutze die Chance, mich unauffällig wieder zu fangen. Aber sogar während er spricht, spüre ich Widerstand in mir aufbranden, wilde und hoffnungsvolle Gedanken, die abstreiten wollen, wer da wirklich vor mir sitzt. Ich bewege mich nicht. Ich atme.
Bald spüre ich meine Beine wieder, sehe meine Hände im Schoß liegen, und ich höre ihm zu, als er von seinen Symptomen abkommt und sich über die Klinik beschwert, seiner Enttäuschung Luft macht. Wie klein sie sei. Wie runtergekommen. Wie schwer zu finden.
»Das hat mich überrascht«, sagt er, »bei einer Einrichtung mit einem solchen Ruf.« Er erwähnt den abgewetzten Teppich. Den kaputten Aufzug. Die Wände, die »ein wenig Farbe vertragen« könnten und die spärliche und widersprüchliche Beschilderung. »Ich meine: Geht’s noch?«, sagt er. »Soll das so eine Art Test sein, oder was? Eine Orientierungsprobe?« Und dann ein vager Anflug von Paranoia: »Als ob ihr wollt, dass wir hier noch mal komplett abfucken.« Und er redet weiter, füllt die Sitzung mit Beschwerden und Unmut. »Die Abteilung wurde mir sehr empfohlen. Fachleute auf ihrem Gebiet. Einmal die Woche, stand auf der Überweisung. Sechs Termine? Das reicht doch hinten und vorne nicht.« Er klingt nicht wütend, eher resigniert. Die Klinik. Unser Ansatz. Ich. Er hatte mehr erwartet. Wir haben ihn jetzt schon enttäuscht. Und aus irgendeinem Grund überrascht ihn das nicht. Ich erkenne ziemlich schnell, dass er das gewohnt ist. Dass er mittlerweile damit rechnet. Er sieht die Welt durch eine Brille der Enttäuschung. Er zuckt mit den Achseln. »Ich schätze, ich hab gedacht, das Ganze würde ein bisschen …«, und er hält inne, sucht nach dem passenden Wort, »besonderer werden.«
Als ich ihn frage, was er sich für sich persönlich von der Abteilung erhofft, meint er, er wolle, »dass die Dinge wieder so werden wie früher«. Und bei diesen Worten beugt er sich vor, nimmt eine vertrauliche Haltung ein, als wären wir gute Bekannte, oder Freunde, die sich nach längerer Zeit wiedersehen. Ich muss mich sehr anstrengen, um keine Regung zu zeigen. Widerstehe dem Drang, mich ihm zu nähern. Mit dem Finger zieht er eine unsichtbare Linie über sein Jeansbein.
»Vorher … und nachher, und ich will wieder hierhin zurück«, meint er und tippt energisch auf den »Vorher«-Bereich seines Oberschenkels. Erwartungsvoll sieht er mich an.
Daran erinnere ich mich am deutlichsten aus dieser ersten Sitzung mit Dan Griffin: sein Kreisen darum, fast schon seine Besessenheit, wieder so zu werden, wie er »vorher war«. Es ist ein Wunsch, den viele unserer Patienten teilen, und ich bin erleichtert, zurück auf vertrautem Terrain zu sein, in einer Welt, über die ich Kontrolle zu haben meine.
»Wenn etwas Schlimmes passiert«, sage ich, »ist es verständlich, sich wieder in ein Davor zurückzuwünschen.« Ich erkläre ihm, dass, egal was vorgefallen ist, das Ziel einer Therapie nicht darin besteht, ein Ereignis auszulöschen. Ganz im Gegenteil. »Hier in unserer Abteilung arbeiten wir daran, das traumatische Erlebnis oder die Erlebnisse wieder in Ihr Leben zu integrieren«, sage ich.
Steif sitzt er auf seinem Stuhl, Schweißperlen stehen ihm eine neben der anderen auf der Stirn.
Ich spreche, wähle die richtigen Worte, nicke und stelle all die passenden Fragen, während meine Augen ihn begierig abtasten, so wie die Finger eines Blinden ein Gesicht ertasten. Ich kitzle alle Tom-haften Anteile aus ihm heraus. Die Art, wie ihm das Haar in die Stirn fällt. Die Rundung seines Kinns. Die Verletzlichkeit, die sich manchmal in seinem Gesicht zeigt. »Wir können schlimme Dinge, die uns zugestoßen sind, nicht wieder ungeschehen machen«, sage ich. Und natürlich kann ich das mit voller Überzeugung tun. »Alle Erlebnisse aus Ihrer Vergangenheit machen Sie zu dem, der Sie heute sind …«
»Ich hab das schon mal geschafft«, fährt er dazwischen. »Mir ist schon früher was zugestoßen … vor Jahren. Das hab ich einfach ausgeblendet.« Er schaut mich sehr aufmerksam an. »Damals hat es funktioniert …« Ich öffne den Mund, um etwas zu erwidern, aber er redet weiter. »Ich habe es einfach nicht an mich rangelassen. Es hat nichts bedeutet.« Seine Stimme wird lauter, dann schüttelt er den Kopf und fährt rasch mit der Hand durch die Luft, als würde er eine Fliege verscheuchen. »Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass es auch diesmal funktioniert.«
Er sieht mich trotzig an, als würde er mich zum Widerspruch auffordern. Kurz blitzt Wut in seinen Augen auf. Und darüber bin ich froh. Meiner Erfahrung nach ist das häufig ein gutes Zeichen. Wut darüber, was einem zugestoßen ist. Wut kann ein Hinweis auf den gesunden Teil der Psyche sein. Auf den Teil, der kämpfen will. Auf den Wunsch, dass es einem wieder besser geht. Es kann ein Anzeichen für Energie sein, für Hoffnung. Aber nicht immer.
»Das, was da passiert ist … das war so dämlich«, faucht er, »ein paar Arschlöcher. Ein paar dumme Wichser im Park, und jetzt, gucken Sie hier.« Er hebt die Hand, um mir seinen Tremor zu zeigen. »Was zur Hölle?« Und dann schlingt er die Arme wieder um seinen Rucksack. »An manchen Tagen komme ich gar nicht aus dem Bett. Ich gehe nicht zur Uni. Früher bin ich überall hingelaufen. Hab mich unbesiegbar gefühlt. Wie der Terminator.« Er lacht. »Jetzt …«, er schüttelt den Kopf. »Schon allein, heute hierherzukommen …« Er stockt. »Einer von denen war wohl auf Bewährung. Ich meine, Scheiße noch mal! Bewährung? Was läuft falsch bei denen? Warum können die Menschen ihre Arbeit nicht anständig machen?« Er sackt in seinen Stuhl zurück, klein und unterlegen. Vielleicht liegt es an seiner Verzweiflung, dem sich verdüsternden Schatten auf seinem Gesicht, jedenfalls fange ich langsam an, mir Sorgen zu machen.
In mir regt sich ein starker Drang, ihm zu helfen, ihn nicht zu enttäuschen. Dieses Gefühl zu registrieren, gehört zu meinem Job. Wahrzunehmen, was zwischen uns vorgeht. Warum können die Menschen ihre Arbeit nicht anständig machen? Das ist der Moment, um seine Enttäuschung über »das System«, über die Abteilung zu thematisieren und laut zu überlegen, ob er sich sorgt, dass auch ich mich als Enttäuschung erweisen könnte. Doch die Gegenübertragung fühlt sich in diesem Augenblick undurchsichtig und trüb an. Also sage ich nichts.
Schweigend sitzen wir da. Ich lausche seinen raschen Atemzügen, und er schaut hinab auf seine nun reglosen Hände. Ich spähe zu der sich gelb verfärbenden Prellung auf seiner Wange, den Stichen an der Lippe und dem schmuddeligen Verband um die linke Hand. Als er wieder spricht, ist seine Stimme nur mehr ein Flüstern. Ich muss mich vorbeugen, um ihn zu verstehen. Als ich mich nähere, sehe ich Toms Mund, die Art, wie seine Lippen sich um die Wörter formen. Die Art, wie er auf der Unterlippe herumkaut, wenn er nervös ist. Ich beobachte seinen Mund, der mir erzählt, wie die Welt sich für ihn verändert hat. Die Panikattacken, die Flashbacks und die schlaflosen Nächte. Dennoch umgeht er das, was vorgefallen ist, nennt es jedes Mal »die Sache im Park«. Ich dränge ihn nicht, mir mehr zu erzählen. Ich weiß, ich muss warten. Zu früh nachzufragen, kann sich für den Patienten wie ein weiterer Übergriff anfühlen.
Ich stelle andere Fragen, vielleicht mehr als sonst. Ich erkundige mich nach seiner Familie. »Eltern? Geschwister?«
»Keine Familie«, sagt er und klingt abweisend. »Vater tot. Keine Brüder oder Schwestern. Und meine Mutter hab ich verloren.«
»Das tut mir leid …«
Er schüttelt den Kopf. »Nicht so, wie Sie denken – sie lebt noch. Soweit ich weiß.« Er zuckt mit den Achseln. »Ich hab sie an jemand anderen verloren.«
»An jemand anderen?«, wiederhole ich, zugleich fasziniert und verwirrt von seiner Wortwahl.
Er blockt ab. »Über meine Familie will ich nicht reden.« Er klingt forsch. Dann fügt er leiser, fast schon entschuldigend hinzu: »Ich will einfach nur, dass es mir wieder besser geht. Ich will das hinter mir lassen und weitermachen. Mir vielleicht ein paar Techniken oder Hilfsmittel aneignen.«
»So was gibt es bei uns nicht«, erwidere ich. Ich erkläre ihm, dass wir einen Ort zum Reden anbieten. »Gesprächstherapie. Und da Sie hergekommen sind, gibt es ja möglicherweise ein paar Dinge, über die Sie sprechen möchten.«
Ich erkundige mich nach dem Fragebogen. »Den wir Ihnen per Post zugeschickt haben?«
Er sieht mich ausdruckslos an. »Ich hab keinen Fragebogen gekriegt.«
Ich angle einen aus meiner Schublade und bitte ihn, das Blatt auszufüllen und am Empfang abzugeben. Er nimmt es entgegen, faltet es in der Mitte zusammen und steckt es sofort in seinen Rucksack. Er hat eindeutig nicht die Absicht, den Bogen zu bearbeiten.
Ich warte kurz und lehne mich dann vor. »Viele Menschen, die zu uns kommen, wünschen sich eine schnelle Lösung. Aber so läuft das leider nicht. Der Fragebogen hilft mir zu verstehen, welche Bedeutung Ihr traumatisches Erlebnis für Sie hat. Darum gibt es auch keine vorgefertigten Hilfsmittel. Es geht einzig und allein darum, nachzuvollziehen, wer Sie sind.«
Einen Augenblick wirkt er ergriffen.
Ich erkläre ihm, dass unsere Patienten zu uns kommen, weil sie nicht weiterleben können wie bisher. »Oft werden sie von etwas geplagt, das erschütternd, gewaltsam oder brutal ist, nicht selten in der Form von Flashbacks und Zwangsgedanken.«
Er rührt sich nicht.
»Es ist, als hätte das Ereignis etwas in ihnen zerrissen«, sage ich. »Eine Art Schutzschicht. Das Trauma ist zu einer Wunde geworden, die nicht von allein verheilt.«
»Eine Wunde«, wiederholt er, »ja, so fühlt sich das an.«
»Manchmal öffnet sich diese Wunde, weil sie an etwas anderes rührt – eine Assoziation oder ein Erlebnis aus der Vergangenheit. Und das ist es«, erkläre ich, »was man angehen muss, um weitermachen zu können.«
Ich habe seine volle Aufmerksamkeit, sein Blick weicht nicht von meinen Lippen.
Ich erkläre ihm, dass es typisch für ein Trauma ist, bei Menschen das Gefühl zu hinterlassen, die Welt sei zu einem gefährlichen Ort geworden, »willkürlich, chaotisch und unsicher«.
Zum ersten Mal nickt er bei meinen Worten. »Mir kommt es vor, als hätte mir jemand meine Welt weggenommen.« Er tut so, als würde er einen Ball auf seine Fingerspitzen legen und ihn dann umdrehen. »Und sie auf den Kopf gestellt«, er spricht immer schneller über die empfundene Machtlosigkeit, »alles ist völlig außer Kontrolle.«
»Haben Sie sich früher schon einmal so gefühlt?«, frage ich. »In der Vergangenheit?«
»Ob ich mich schon mal so gefühlt habe?«, erwidert er und nickt erneut. »Ja, und es ist ekelhaft.« Und eingehender beschreibt er mir den Schwindel, die Benommenheit. »Die Welt wird ganz verschwommen, als würde ich ohnmächtig.«
Da bemerke ich es zum ersten Mal. Seine Angewohnheit, eine Frage zu seiner Vergangenheit zu beantworten, indem er sie wiederholt und die Antwort dann schuldig bleibt. Es vermittelt einen zugleich konzentrierten und vagen Eindruck und, am Ende der Sitzung, eine schale Vertrautheit – als wüsste ich alles und nichts über ihn. Und da ist noch mehr: der Wunsch nach der »schnellen Lösung«, sein Widerwille, über Vergangenes zu sprechen. Es fühlt sich an, als gäbe es eine Kluft zwischen seinen Bedürfnissen und meinen Fähigkeiten. Als wäre er hungrig. Ausgehungert, und bei mir bleibt ein Gefühl zurück, als könnte ich diesen Hunger niemals stillen. Damals habe ich das dem Umstand zugeschrieben, dass er nur schwer Vertrauen aufbaut, durchaus üblich bei Patienten, die traumatisiert und enttäuscht wurden. Nichts von alldem ist ungewöhnlich. Es sind einfach Dinge, die man zur Kenntnis nimmt. Ein paar Anhaltspunkte zu der Seelenlandschaft, die einen erwartet. Und doch ist unsere Sitzung, natürlich, keine normale erste Sitzung. Nachdem er an jenem Tag mein Zimmer verlassen hat, ist da keine weiße Leinwand, um den Beginn unserer Arbeit zu skizzieren. Tabula rasa? Es herrschte schon ein vollgekritzeltes Durcheinander, bevor wir überhaupt angefangen haben.
Erst später, als ich mir meine Fallnotizen mache, fällt mir noch etwas auf. Wie er über die Welt gesprochen hat, die aus den Angeln gekippt sei. »Die Welt ist nicht sicher«, schreibe ich hin, aber als ich mir das Geschriebene noch einmal ansehe, stelle ich fest, dass er das so überhaupt nicht gesagt hat. Seine wahren Worte könnten das Gleiche bedeuten – oder etwas völlig anderes.
»Ich fühle mich nicht sicher«, so hat er es ausgedrückt. Ich weiß das, als ich die niedergeschriebenen Wörter anstarre. Doch aus irgendeinem Grund, den ich mir selbst nicht erklären kann, und sehr viel später auch meinem Anwalt nicht, nehme ich die Änderung in meinen Notizen nicht vor.
2
Man sagt, wie Babys auf die Welt kommen, ist eine kleine Schablone dafür, wie sie ihr weiteres Leben leben werden. Meine Tochter Carolyn war die Erste – und während sie aufwuchs, erwies sie sich als ebenso pünktlich und zielstrebig. Nach ihrem rotgesichtigen und entrüsteten Einzug in die Arme von Beatrice, der Hebamme, beruhigte sie sich rasch, auf eine Weise, die ich im Lauf der Jahre immer wieder bei ihr beobachten konnte.
Nach der glitschigen, überstürzten Ankunft meiner Tochter legte sich eine schläfrige Ruhe über den Kreißsaal. Beatrice umkreiste das Bett; das Geräusch von Gummisohlen auf Linoleum, das sanfte Piepen des Monitors und die leisen, ruckartigen Atemzüge des Neugeborenen auf meiner Brust. Es gab keine Ängste oder Sorgen in Bezug auf ihren erwarteten Zwillingsbruder, keine medizinische Erklärung für seine Verspätung, und so wertete man seine Zurückhaltung als seine freie Entscheidung.
»Der fühlt sich wohl dadrinnen«, meinte Beatrice lachend und tätschelte meinen Arm. Sie hatte einen starken jamaikanischen Akzent und lange Wimpern. »Er will Sie ein paar Minuten ganz für sich haben … will seine kleinen Beinchen von sich strecken. Und wer sollte ihm das verübeln?« Sie lächelte mir und meinem Mann zu.
Doch während die Minuten verstrichen, begann mein Mann sich zu sorgen, und keine fantasievolle Erzählung, die man rund um dieses zweite Baby spinnen mochte, konnte Davids Angst in irgendeiner Weise dämpfen.
»Was ist los?«, fragte er beunruhigt und schon leicht verzweifelt. Dann und wann erhaschte ich einen Blick auf sein blau aufblitzendes Shirt, während er im Zimmer auf und ab lief. Er war kräftig und gutaussehend. Das war das Erste gewesen, was ich ganz zu Beginn anziehend an ihm gefunden hatte. Seine Größe, seine körperliche Präsenz. Wie er einen Raum ausfüllte. Aber wenn er angespannt oder ängstlich war, schien er in sich zusammenzufallen, wurde klein und schlaff. Behutsam schlug Beatrice vor, dass er sich einen Kaffee holen oder »draußen ein bisschen frische Luft schnappen« könne. Was mich betraf, so wusste ich, was kommen würde, und schaltete ab, schloss die Augen, wie ein Tier, das in den Winterschlaf fällt.
Vielleicht war es dieser Selbstschutz oder einfach die Gegenwart von Beatrice, die sich summend und wortlos um mein Bett bewegte – doch woran es auch lag, ich fühlte mich ruhig. David allerdings hielt nicht lange stand und rief schließlich den Arzt.
Beatrice beugte sich lächelnd über mich und gab mir Eisstückchen zu lutschen. »Ihr Junge kommt, wenn er so weit ist. Sie werden schon sehen«, meinte sie und drückte mir die Hand. »Das ist ein Kerlchen, der macht die Dinge gern auf seine Art. Der verbiegt sich nicht für uns.«
Als Tom endlich zum Vorschein kam, tat er es mit einem wütenden, zerknitterten Gesichtchen, hinein in das blendend helle Licht und ein Gewimmel grüner und blauer Kittel. »So viele Leute. So viel Lärm«, gluckte Beatrice, als sie ihn hochnahm, und manchmal frage ich mich, ob es ein Schock war, von dem er sich den Rest seines Lebens erholen musste.
Nachher erfuhr ich, dass achtundzwanzig Minuten zwischen den Geburten meiner Kinder gelegen hatten. Dass die durchschnittliche Zeitspanne zwischen den Geburten von Zwillingen siebzehn Minuten betrug. Wenn ich Jahre später an diese achtundzwanzig Minuten dachte, stellte ich mir Tom vor, zum ersten Mal seit neun Monaten ruhig und allein. Und obwohl schon viel über Zwillinge und ihr enges Verhältnis geschrieben wurde, bedenkt man selten, dass sie so gut wie nie für sich sind. Von der Empfängnis bis zur Geburt und während der ersten Lebensjahre sind sie ständig zusammen, schlagen sich immerfort an der Seite eines Geschwisterchens durchs Leben.
Meine Mutter rauschte an jenem Nachmittag mit glasigem Blick ins Stationszimmer und wollte unbedingt die Babys sehen. Wie üblich war sie mitten in einem Satz, als sie in der Tür auftauchte, und als sie sich zu mir niederbeugte, bemerkte ich den Hauch des mittäglichen Gins und das verräterische ärgerliche Zucken an ihrer Schläfe. Doch ich war vollgepumpt mit Medikamenten und Hormonen, und ihre Worte glitten einfach an mir ab.
»Carolyn kam herausgeschossen«, erzählte ich etwas atemlos und wirr, »wie eine Gewehrkugel. Aber Tom, der wollte noch ein wenig drinbleiben. Er wollte Raum für sich. Sich seine Zeit nehmen …«
In meiner postnatalen Euphorie war ich nicht wie sonst auf der Hut. Während ich die Geburten meiner Kinder zu Merkmalen ihrer Persönlichkeit ausgestaltete, vergaß ich die Regeln unserer Beziehung.
»Es war fast so, als wollte er bei mir bleiben«, faselte ich weiter, »sich dem Ansturm der großen weiten Welt entziehen.« Meine Mutter versuchte zuzuhören. Sie neigte den Kopf. Nach einer Weile bemerkte ich, dass ihr Gesicht wie erstarrt wirkte.
»Hör schon auf mit dem Quatsch«, meinte sie spöttisch, als wäre ich ein Kleinkind, das sich am Esstisch schlecht benimmt. »Das liegt alles an der Fruchtblase. Das kann das Kind gar nicht selbst entscheiden.« Dann streckte sie die Hände vor, um mit einem letzten, die Ordnung wiederherstellenden Akt die Krankenhausdecke glatt zu streichen. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, mit abgeklärtem Blick, zufrieden, dass alle Hirngespinste aus dem Zimmer verjagt worden waren.
Es lag nicht nur an den Medikamenten und Hormonen, dass ich an jenem Tag immun gegen sie war. Es lag an mir. Mit je einem Baby im Arm war ich verändert. Während sie unbeirrt alle Einzelheiten ihrer Anreise ausbreitete – der unfähige Taxifahrer, die Schwierigkeit, zur Rushhour nach London reinzufahren, das Benefizessen, das sie hatte absagen müssen –, fühlte ich mich so reich und voll, dass ihr verzweifeltes Brüllen nicht zu mir durchdrang. Ich war wund und zerbeult, aber ich hörte sie kaum. Ich sah zu, wie sich ihr Mund bewegte. Buchstaben, die Wörter bildeten, die sich zu verdrehten Sätzen verbanden. Viel los auf der Autobahn. Alles so furchtbar knapp. Keine Zeit, mich darauf einzustellen. Hätte es gern etwas früher gewusst. Diese Wörter. Diese kleinen wütenden Kügelchen prallten einfach an mir ab. Während sie vor Zorn anschwoll, schwoll in mir die Liebe. Und wie sie so neben meinem Bett saß, mit Fingern, die es juckte, sich in das Fleisch meiner Neugeborenen zu graben, fühlte ich mich plötzlich mächtig. Ich lächelte und drückte meine Babys an mich wie einen Schutzschild. Ich gewann an Größe, weil ich wusste, dass ich zum allerersten Mal etwas besaß, das nicht ihr gehörte. Etwas, das sie nicht haben konnte.
Nachdem sie gegangen war, kletterte David zu mir ins Bett. Er hatte wieder Farbe im Gesicht und nahm schüchtern die Babys in den Arm, eins nach dem anderen, und grinste wie ein Idiot. Als er zur Cafeteria ging, um Getränke und Snacks zu besorgen, legte ich sie vorsichtig in ihr Bettchen und sank auf mein Kissen zurück. Draußen fiel die Aprilsonne durch die Baumkronen und schien durchs Fenster. Ich sah zu, wie die Blätterschatten auf meiner Bettdecke tanzten und zitterten. Es waren noch ein paar Besucherinnen und Besucher auf Station, und der Klang der Gespräche ringsum lullte mich ein. Eine Unterhaltung erregte meine Aufmerksamkeit. Sie kam von den zwei Frauen gegenüber. Ich hatte sie schon zuvor beobachtet. Die Frau im Bett reichte ihr Baby behutsam der anderen, die ich für ihre Mutter hielt, die frischgebackene Großmutter. Als sie die Arme nach dem Neugeborenen ausstreckte, erstrahlte ihr Gesicht voller Freude und Stolz. Ich hörte, wie sie über jemanden namens Alex sprachen. Über einen Zaun, den man würde reparieren müssen.
»Wollt ihr ihn taufen lassen?«, fragte die Ältere, »oder habt ihr euch das noch nicht überlegt?«
»Keine Ahnung«, erwiderte ihre Tochter.
Die Frau nickte, und die Unterhaltung huschte weiter zwischen ihnen hin und her. Diese winzigen Finger. Die langen Wimpern. Seine rosige Haut. Es war so schlicht, leicht und unkompliziert. Ich bewunderte sie. War neidisch auf diese Leichtigkeit. Diese Normalität.
»Wozu?«, fragte meine Mutter, das Gesicht vor Unwillen verzogen, als ich erwähnte, dass ich stillen wollte. »Ich habe das nie gemacht.« Sie sprach bestimmt, als hätte sich die Sache damit aus irgendeinem Grund erledigt.
»Ich weiß.«
»Alle beide?«, fragte sie ungläubig.
In jenen ersten Wochen war meine Mutter vom Zufüttern wie besessen. Schon der kleinste Schrei oder ein Murren von einem der Babys bestätigte ihr, dass die beiden furchtbar unterernährt waren. »Hunger«, sagte sie nickend und beäugte das Kind, das jeweils gerade an meinen prallen Brüsten hing. »Ausgehungert«, schloss sie, und ihre Finger schwebten bereits über der Packung mit Folgemilch, an der sie sich festzuklammern pflegte wie an einer Handtasche.
Am Ende war es David, der sich auf recht unmittelbare Art ihrem eigenen unstillbaren Hunger annahm.
»Komm mit«, sagte er und hakte sich bei ihr unter. »Wir gehen ein bisschen Kuchen kaufen.«
Meine Tochter machte sich ans Trinken, wie sie später so gut wie alles im Leben tun würde: Sie widmete sich der Aufgabe gewissenhaft und energisch, bis sie zu einem Muster an Effizienz wurde. Doch fast ebenso schnell, wie sie die Herausforderung gemeistert hatte, wurde sie ihr langweilig, und das Auftanken war ihr bald eine lästige Pflicht; etwas, das man nun mal erledigen musste, während der Blick durchs Zimmer schweifte und nach anderen, aufregenderen Dingen suchte. Turboladerin nannten wir sie in diesen ersten Lebensmonaten.
Tom war das genaue Gegenteil. Er tat sich jedes Mal schwer, aber wenn er endlich »angedockt« hatte, wie man so sagt, war er hoch konzentriert. Anders als seine Schwester blickte er zu mir auf, die kleinen graublauen Murmelaugen auf meine geheftet, und seine winzigen Finger umklammerten den Saum meiner Strickjacke.
Was mir aus diesen ersten Jahren am klarsten im Gedächtnis geblieben ist: wie körperlich das alles war. Kleine Finger an meiner Wange. Ein Bäuchlein, das gegen meine Hüfte drückt. Beine, die auf meinen Schoß krabbeln. Eine Hand, die sich stumm in meine schiebt. Und das alles in einem Schleier des Schlafmangels. Tom war der schlechtere Schläfer, aber sie hatten beide ihre Phasen. Und über Monate kam der Morgen als brutaler Schock, und wir fanden uns zu dritt, sehr oft auch zu viert, kreuz und quer über die Laken verteilt, wie ramponiertes, angespültes Treibgut. Dennoch lag so viel Glück in dieser Körperlichkeit. Verschlungene Körper. Eng aneinandergedrückt. Sicher.
Während sie von Babys zu Kleinkindern wurden, beobachtete ich ihre unterschiedlichen Herangehensweisen ans Leben. Carolyn war schnell und aufgeweckt, sie musste mir nur einmal bei etwas zuschauen und probierte es sofort selbst aus. Sie hatte ein natürliches Verständnis für die Welt, einen angeborenen Scharfsinn, gepaart mit unbändiger Selbstständigkeit, wodurch ich mich oft überflüssig fühlte. Es war nicht so, dass Tom nichts hinbekam, aber er hinkte ihr grundsätzlich einen Schritt hinterher. Gerade dann, wenn er sich einer Sache zuwandte, war seine Schwester schon bei der nächsten.
Ich erinnere mich an diese typischen Situationen in jungen Familien, wenn das eigene Kind aufsteht, den ersten Schritt macht oder zum ersten Mal einen Strich aufs Papier zeichnet, und alle Anwesenden überschlagen sich vor Begeisterung. In solchen Fällen blickte Carolyn auf, senkte anschließend den Kopf und strahlte, und dann wiederholte sie die Handlung, ihr ganzer Körper leuchtete, wie elektrisiert von der Anerkennung. Tom hingegen schien für äußeren Beifall unempfänglich. Oft erschrak er ob all der Aufmerksamkeit und wandte sich ab, stirnrunzelnd und verlegen.
Manche Zwillingseltern geben sich große Mühe, die Verschiedenheit und Individualität ihrer Kinder zu betonen. So waren wir nicht. Für uns waren sie immer »die Zwillinge«, ab der Sekunde ihrer Geburt und sogar schon lange davor. Ich mochte es, wenn Unbekannte in der Stadt in den Kinderwagen schauten. »Ah, Zwillinge«, schienen ihre Blicke zu sagen, und es lag eine Mischung aus Überraschung, Bewunderung und Staunen darin, alles in einem.
In den ersten Jahren sahen sie gleich aus. Wir haben so viele Fotos von ihnen; die gleichen wilden Locken, kaum auseinanderzuhalten. Tom war draußen immer am glücklichsten. Er liebte die Weite – Strände, Gebirge und Felder –, lief voll Freude umher, kletterte auf Bäume und sammelte Stöcke. Sogar zu Hause fand ich ihn oft ganz hinten in unserem Londoner Garten, wie er in der Erde wühlte oder sich im Gebüsch eine Höhle baute. Carolyn dagegen konnte stundenlang an einem Tisch sitzen und mit bunten Filzstiften kleine, komplizierte Skizzen anfertigen. Sie malte vor allem Kleider: gemusterte Kleidchen und Röcke und schrille Schuhe, die sie sorgfältig ausschnitt und zu wunderschönen Outfits kombinierte. Ich blicke mit großer Zärtlichkeit auf diese Zeit zurück, bevor die starre Struktur der Schule begann. Es waren unsere goldenen Jahre, die Jahre, als sie noch klein waren. Als wir noch genau wussten, wo sie waren und was sie gerade taten. Damals drehten sich unsere Sorgen um sehr konkrete Gefahren: den Straßenverkehr, die schartige Kante einer Rutsche oder einen tiefen Gartenteich. Als sie älter wurden, war es mir umso rechter, dass sie zu zweit waren. Ich betonte weiterhin ihre Ähnlichkeit, und gemeinsame Ausflüge und Verabredungen mit Freundinnen und Freunden förderte ich vermutlich länger, als ich es hätte tun sollen. Ich behauptete damals, das täte ich, weil die Kinder es mochten, aber heute weiß ich, dass ich es für mich selbst tat. Dass es dazu diente, die Unterschiede zwischen ihnen zu kaschieren, die ich nicht sehen wollte.
*
Eine der letzten glücklichen Erinnerungen an meinen Sohn liegt eineinhalb Jahre zurück, ein paar Tage vor dem Unfall. Wir waren im Garten. Es war ein warmer Nachmittag, der letzte Tag im Juli; ein klarer blauer Himmel mit winzigen Schäfchenwolken, und nach dem Regen der Vorwoche erstrahlte der Rasen in glitzerndem Hellgrün. Der Fingerhut blühte, keck und aufrecht mit seinen weiß-lila Glöckchen. Tom hatte die beiden ersten Trimester seiner Schreinerlehre abgeschlossen, und wir hatten uns an den Geruch von Holzspänen und an seine leicht eingestaubten Kleider, Haare und Wimpern gewöhnt, wenn er von der Arbeit nach Hause kam.
Seit dem Frühling jobbte er an den Wochenenden im Kanuverein, und es war schon eine Weile her, dass er Julie zum ersten Mal erwähnt hatte.
»Sie ist eine von den Vollzeitkräften dort«, erzählte er. »Sie teilt die Ehrenamtlichen ein. Sie ist echt nett.« Er grinste. »Sie hat pinke Haare, und sie weist mir für meine Gruppen die lustigen Kids zu.« Er lachte. »Und sie macht mir immer eine Tasse grünen Tee, wenn ich reinkomme«, worauf er das Gesicht verzog. »Sie meint, das ist gesünder als der ganze schwarze Kaffee, den ich in mich reinkippe. Und so langsam komme ich echt auf den Geschmack, aber das kann ich ihr auf keinen Fall sagen.« Es war das erste Mal überhaupt, dass ich ihn über ein Mädchen reden hörte. Ich hatte so viele Fragen. Wie ist sie so? Wie alt ist sie? Vielleicht kannst du sie ja mal zu uns einladen. Pinke Haare? Ich öffnete den Mund. Dann klappte ich ihn wieder zu. Mit der Zeit redete er immer häufiger von ihr.
»Wir sind nur Freunde«, meinte er, wenn ich ihn fragte. Aber jedes Mal, wenn er ihren Namen erwähnte, wurde er ein bisschen rot.
Einmal habe ich sie getroffen, als ich ihn im Freizeitzentrum abholte. Sie standen am Empfang, hatten die Köpfe zusammengesteckt und lachten. Ich gab mir Mühe, nicht zu interessiert zu wirken. Das Wichtigste war, wie glücklich er aussah. Es war offenkundig, dass ihm die viele Arbeit an der frischen Luft gut bekam. Er wirkte verändert, irgendwie älter. Seine Schultern waren breiter geworden, und sein Körper war in die Länge gegangen, schien seine endgültige Form gefunden zu haben. Die Haare waren lang und sonnengebleicht. Er wurde schnell braun, und seine Haut hatte eine tiefe goldbraune Färbung. Der Schrecken des vergangenen Jahres schien weit zurückzuliegen. Ausgelöscht von der Sonne, der Arbeit und seinem neu gewonnenen Selbstvertrauen. Ich weiß noch, dass ich in jenem Moment sehr zufrieden mit mir war. Sogar etwas selbstgefällig; ich gönnte mir ein wenig Entspannung. Vielleicht war das mein Fehler.
Ich stand an der Gartentür, beschirmte mit einer Hand die Augen und blickte über den kleinen grasbewachsenen Hügel, von dem die Zwillinge als Kinder heruntergekugelt waren. Tom war hinten im Garten, auf einer Leiter, und hielt den Nistkasten an den Stamm der Birke. Die Brutsaison hatten wir schon verpasst, wie David prophezeit hatte, und es nicht geschafft, den Kasten im Frühjahr anzubringen. Tom meinte, er würde es jetzt tun. »Man weiß nie«, sagte er lachend, »vielleicht erwischst du noch ein paar Nachzügler.«
»Hier?«, rief er mir jetzt von der Leiter aus zu. »Dann kannst du’s von der Küche aus sehen.«
»Gut«, gab ich zurück, »so ist es super.«
Er stellte den Nistkasten auf einem Ast ab und zog einen Nagel aus der Tasche, steckte ihn sich zwischen die Zähne und griff nach dem Hammer.
Der Nistkasten war sein Weihnachtsgeschenk an mich gewesen.
Toms Geschenke waren oft etwas willkürlich und hingen von seinen schwankenden Gefühlen gegenüber den Übeln der Konsumgesellschaft ab. In jenem Jahr überraschte er uns alle, als er hübsch eingepackte Geschenke verteilte, obwohl die Geschichte des Aussteigers Christopher McCandless damals so großen Eindruck auf ihn gemacht hatte.
Meines war in ein Papier mit kleinen silbernen Engelchen eingeschlagen.
»Vielen Dank! Wie wunderbar«, sagte ich und starrte auf das Päckchen in meinem Schoß.
Carolyn saß am anderen Ende des Zimmers und ärgerte sich sichtlich über meinen Überschwang.
»Das ist nicht nur irgendein oller Nistkasten«, meinte Tom, als ich das Geschenk ausgewickelt hatte und mich bei ihm bedankte. »Da ist eine Kamera eingebaut.« Er beugte sich zu mir, um sie mir zu zeigen. »Wenn ein Vogel brütet, kannst du sie mit dem Fernseher verbinden und alles live mitverfolgen.«
»Das ist ja toll«, sagte ich. »Was für eine schöne Idee, Tom.«
Ganz aufgeregt lehnte er sich auf seinem Stuhl vor. »Das ist dann wie das Haus von Big Brother«, meinte er, »nur für Vögel.«
Wir lachten. Sogar Carolyn.
*
Jetzt, eineinhalb Jahre später, ist der Garten verwildert, der Nistkasten unter dichtem, undurchdringlichem Laub verborgen. Man müsste schon ein Frettchen sein, um sich seinen Weg bis zum Loch zu kämpfen.
Im Frühling nach Toms Verschwinden war ein Vogel eingezogen. Eine Amsel. Ich aktivierte täglich die Kamera und sah der Mutter allabendlich dabei zu, wie sie aus Zweigen, Flaum und Blättern sorgsam ein Nest wob. Sie legte vier gesprenkelte Eier von hellem Türkis hinein. Als die Zeit des Schlüpfens näher rückte, beeilte ich mich stets, von der Arbeit nach Hause zu kommen, und verbrachte ängstliche Stunden auf dem Sofa bei den samtschwarzen Federn. Obwohl ich wusste, dass sie mich nicht sehen konnte, schien es mir, als würden wir beide übereinander wachen. Wie ich da so ruhig im Wohnzimmer saß, fühlte ich mich sicher unter ihrer kleinen, orange eingefassten Augenperle. Auf naive Weise kam es mir vor, als könnte ihre Ankunft Toms Rückkehr einleiten.
Als die Babys schlüpften, wurde das Nest zu einem zuckenden Bewegungsrausch. Ich erhaschte nur einen kurzen Blick darauf, ehe ich zur Arbeit musste. Sie waren grau und hilflos und verlangten blind nach Futter, während die Mutter der Reihe nach geduldig ihre offenen Schnäbel füllte.
Ich weiß noch, dass es ein ungewöhnlich warmer Märztag war, und die Therapieräume waren schwül und stickig, sogar bei weit geöffneten Fenstern. Den ganzen Tag über spürte ich eine drängende Ungeduld, und als eine Patientin ihren Nachmittagstermin absagte, machte ich früh Feierabend.
Zu Hause schaltete ich den Fernseher ein. Der Bildschirm blieb leer. Es war nichts zu sehen. Ich überprüfte die Verbindung, drückte auf der Fernbedienung herum. Nichts. Nur das dunkelbraune Innere des Nistkastens. Die Amsel war weg, und als ich stärker hineinzoomte, erkannte ich die im Nest verstreuten leblosen Körper der Vogelbabys, wie übrig gebliebene Fleischreste.
3
Am Montagmorgen finden die Fallbesprechungen für unsere Abteilung statt, und diesmal bin ich dran, einen Fall vorzustellen. Es ist klar, wen ich zur Diskussion stellen sollte. Erst drei Tage zuvor hatte ich Stephanie, unserer neuen Therapeutin in Ausbildung, das Format erklärt. »Herausfordernde Patientinnen und Patienten«, sagte ich, »ein Ort, um das Unbewusste zu ergründen, und wie es sich möglicherweise auf unsere Arbeit auswirkt.«
Sie nickte eifrig, und die Unterkante ihres Bobs schnitt ordentlich vor und zurück durch die Luft.
Ich erwähnte die »Projektion von Gefühlen« und sprach mit Nachdruck über Übertragung und Gegenübertragung. Ich verwendete absichtlich Fachbegriffe, die ihr unbekannt sein dürften. Doch an den Stellen, wo ich mit Fragen rechnete, mit der Bitte, etwas näher zu erläutern, oder zumindest mit Verwirrung, kam nichts.
»Alle zwei Wochen?«, wollte sie wissen, während sie das Datum in den Kalender ihres Smartphones tippte.
Stephanie hatte sich schon lange vor ihrem Ausbildungsbeginn einen Namen in der Abteilung gemacht. Während der zwei Wochen davor mailte sie entweder täglich oder rief an. Größtenteils ging es um administrativen Kleinkram: eine Parkerlaubnis, einen Ausweis für die Bibliothek und Bitten um Formulare, die sie nicht brauchte. Die Nachrichten, die an mich weitergeleitet wurden, betrafen die Anfrage, an einer Konferenz über Trauma- und Bindungstheorie teilnehmen zu dürfen, und eine Bitte um »relevante Literatur«, die sie schon vorher lesen könnte.
»Wirkt sehr motiviert!«, schrieb Paula unter den weitergeleiteten Text.
Als ich ihre Zeugnisse durchlas, zeichneten sie das Bild einer Spitzenstudentin; sie war unter den besten Bachelorabsolventinnen ihres Oxford-Jahrgangs und hatte (genau wie ich, vor vielen Jahren) mit nur einjähriger Berufserfahrung einen Platz in einem Ausbildungsgang für klinische Psychologie angeboten bekommen. Ihre letzten drei Stellen waren allerdings in der kognitiven Verhaltenstherapie angesiedelt gewesen. Sie hatte keine Erfahrung mit unserem Therapieansatz, und wenn man ihr Motivationsschreiben las, ging daraus nicht recht hervor, warum sie ihre fachliche Ausbildung ausgerechnet bei uns machen wollte. Als ich ihren akkuraten, symmetrischen Bob und die manikürten Fingernägel musterte, begriff ich, dass Paula sich geirrt hatte. Es war Angst, die Stephanie antrieb, nicht Motivation.
Gegen Ende unseres ersten Kennenlernens hatte ich versucht, einen Zugang zu ihr zu finden, indem ich sie nach meinen Lektüretipps fragte.
»Die waren gut«, erwiderte sie.
»Wie fanden Sie Melanie Klein?«, hakte ich nach, weil ich wusste, dass die meisten Studierenden mit ihrem dichten Schreibstil zu kämpfen haben.
»Total interessant.« Stephanie nickte höflich. »Vielen Dank, dass Sie sie mir geschickt haben.«
Und da verstand ich meine Irritation. Sie hatte nichts damit zu tun, dass Stephanies Verständnis und ihr theoretisches Fachwissen Lücken aufwiesen. Auch nicht mit ihrer Vermeidungshaltung oder der Fähigkeit, sich etwas vorzumachen. Sondern mit der Tatsache, dass sie ihre Außenwirkung für glaubhaft hielt. Dass sie aus irgendeinem Grund dachte, mich täuschen zu können.
Auf dem Weg zum Gruppenraum gehe ich im Geist meine möglichen Fälle durch. Ich weiß, dass ich über Dan nicht sprechen kann. Dan einzubringen, würde bedeuten, auch über Tom zu reden – und ohne Tom gab es zu Dan wenig zu sagen. Also wähle ich stattdessen eine andere Patientin aus, die mich auf eine ganz andere Weise fordert.
Der Großteil der Belegschaft ist anwesend, nur Stan und Maggie fehlen, weil sie das Team bei Alfies Beerdigung vertreten. Der Raum ist voll, und außer Stephanie haben wir diese Woche noch einen Medizinstudenten zu Gast. Er ist mit seinem Handy beschäftigt und trägt eine furchtbare knallrote Krawatte. Es ist nicht schwer, die angehenden Chirurgen zu erkennen: auffällige Accessoires, zur Schau gestellte Geschäftigkeit – alles Vorboten einer Einstellung, die psychologisches Denken kaum anders bewertet als ein Seminar über Heilsteine.
»Hayley Rappley«, verkünde ich, und als ihr Name fällt, erfüllt gespannte Erwartung den Raum. Sogar Aufregung. Die Leute holen Luft, beugen sich vor.
Ich habe Hayley vor einem Monat als neu eingewiesene Patientin angenommen. Rückblickend war ich bei der damaligen Patientenzuteilung bereits überlastet, brauchte keinen weiteren Fall. Schon gar nicht so einen. Doch als ich die Einzelheiten hörte, zögerte ich nicht. An jenem Tag hatte Maggie die Sitzung geleitet und mir Hayley sofort zugeteilt. Erleichterung machte sich breit. Seit meiner Arbeit mit Matt Johnson landen alle komplexen jungen Patienten bei mir. Ich kann nicht anders. Es ist ein Sog, sich dort hineinzustürzen. Zu helfen. Für Besserung zu sorgen.
»Den meisten hier sind die tragischen Umstände des Falls bekannt«, fahre ich fort, öffne die Akte und hebe den Blick. »Ich habe Hayley jetzt dreimal gesehen, und wie ihr wisst, hat sie zugestimmt, zu den üblichen sechs Terminen zu kommen.« Die Gruppe nickt und denkt vermutlich an die ungewöhnliche Abmachung zwischen Hayley und ihrem Vater.
»Keine Anzeichen für Flashbacks … oder Intrusionen«, erkläre ich und überfliege meine Notizen, »und ich bin immer noch der Meinung, dass sie Hilfe braucht, aber nicht unbedingt von uns …«
»Das verstehe ich nicht«, meint Stephanie. »Warum nicht?«
»Weil Menschen nach einem traumatischen Erlebnis nicht zwangsläufig auch eine Traumareaktion zeigen. Vielleicht kämpfen sie mit der Erfahrung, finden es schwierig, damit umzugehen, aber sie müssen nicht unbedingt PTBS-Symptome entwickeln. Und ich bin mir nicht sicher, dass Hayley welche hat«, erläutere ich.
Ich erzähle den anderen, dass sie wie vereinbart zu unseren Terminen erscheint. »Aber sie hakt sie ab wie Punkte auf einer Einkaufsliste. In der zweiten Woche hat sie den Großteil der Sitzung geschwiegen und aus dem Fenster gestarrt. Die Abmachung mit ihrem Vater ist mir nur zu bewusst – und wie sie meine Arbeit beeinflusst. Sie hat ihm versprochen zu kommen. Er stellt Erwartungen an mich. Ich fühle mich unter Druck, und mir ist auch bewusst, dass ich sie deshalb zum Mitmachen bewegen will.«
Am Ende der zweiten Sitzung hatte ich sie gebeten, etwas mitzubringen, das sie an ihre Mutter erinnert.
»So etwas mache ich normalerweise nicht«, erkläre ich, »aber wie ich schon sagte, liegen die Dinge in diesem Fall etwas ungewöhnlich.«
Ich berichte der Gruppe, dass Hayley, als ich sie beim letzten Mal im Wartezimmer abholte, ein eng anliegendes rotes Kleid, High Heels und eine dicke Schicht Make-up trug.
»Sie ist ins Zimmer gestakst gekommen, hat ein Ta-da! ausgestoßen und mit den Händen ihren Körper entlanggewiesen. Und dann hat sie mich angesehen, mit sehr wütendem, angespanntem Gesicht. Die Sache, die mich an meine Mutter erinnert, hat sie gesagt. Sie wollten, dass ich was mitbringe. Hier, bitte. Ich habe es an!« Ich ließ den Blick über die Gruppe wandern und fuhr dann fort. »Es hat sich herausgestellt, dass der Streit, den Hayley und ihre Mutter zur Zeit des Unfalls hatten, sich um ebendieses rote Kleid drehte. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Sie hat immer noch nicht darüber gesprochen. Im Grunde hat sie über so gut wie gar nichts gesprochen.«
Ich will gerade weiterreden, da fällt mir Jamie mit seinem sanften schottischen Singsang ins Wort. »Ruth«, sagt er und beugt sich vor, »du meintest zu Beginn, dass du dich unter Druck fühlst, sie zum Mitmachen zu bewegen …« Er hält kurz inne. »Ich frage mich, wie es wäre, wenn dem nicht so wäre.« Während er spricht, fährt er sich mit dem Finger über den Nasenrücken. Er ist von Natur aus schüchtern und hat sich diese Geste angewöhnt, wann immer er sich öffentlich äußert.
Alle Augen wandern von Jamie zu mir, sie warten auf meine Antwort.
Jamie ist gut. Kein Wunder. Ich war seine Supervisorin. Er tut genau das, was ich an seiner Stelle getan hätte. Er weiß, dass ich auf Nummer sicher gehe, dass ich mich auf die Details des Falls konzentriere, die Aufmerksamkeit von mir selbst ablenke. Er angelt nach mir, während ich mich nach Kräften bemühe, vom Haken zu springen.
Alle im Zimmer sehen mich erwartungsvoll an. Stephanie sitzt neben mir, mit erhobenem Stift. Ich spüre, wie mein Nacken heiß wird. Ich will nicht, dass sie mich weiter anschauen.
»Wenn ich sie nicht zum Mitmachen bewege?«, wiederhole ich langsam. »Dann ist sie verloren, fürchte ich. Verloren und wütend. Viele fünfzehnjährige Mädchen fühlen sich so, verloren und wütend.« Ich zögere. »Nur wenige haben den Tod der eigenen Mutter miterlebt.«
»In Abwesenheit ihrer echten Mutter musst du ihr helfen, die ›gute Mutter‹ zu internalisieren, die sie gekannt hat«, bemerkt Jamie. »Auch wenn sie nicht mehr da ist.«
Kurz erläutert er für Stephanie und den Studenten Kleins Konzept der »guten Mutter« und wie Winnicott Kleins Ideen später weiterentwickelte. Stephanie kritzelt wie wild in ihr Notizbuch. Der Medizinstudent späht auf seine Uhr.
Jamie wendet sich wieder an mich.
Ich nicke. »Im Moment sind ihre Mutter und ich recht eindeutig die ›bösen Objekte‹«, erkläre ich. »Ihre echte Mutter, weil sie sie verlassen hat. Und ich ganz einfach, weil ich nicht ihre Mutter bin und sie dazu bringe, über ihren Verlust zu sprechen. Es dürfte ihr schwerfallen, mich auf irgendeine andere Art zu sehen.«
»Natürlich.« Jamie nickt.
»Wut ist sicherer«, fahre ich fort, »leichter. Viel weniger schmerzhaft.«
»Und was ist mit dir?«, fragt Jamie und rückt mich erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit. »Du hast dich dazu entschieden, sie heute zum Thema zu machen. Da muss es einen starken mütterlichen Impuls geben. Wo stehst du in alldem, was fühlst du?«
Ich schweige einen Moment.
»Was ich fühle?« Kurz schließe ich die Augen. »Ich fühle … ich fühle eine enorme Verantwortung.« Ich bin bestürzt, als ich Tränen aufsteigen spüre. Schnell blicke ich nach unten und greife nach meiner Akte. »Ich habe das Gefühl, dass ich keinen Fehler machen darf«, sage ich, »dass ich einen Weg finden muss, ihr zu helfen.«
»Das vermittelt uns also vielleicht einen Eindruck davon, was Hayley fühlt«, regt Jamie sanft an, »enorme Verantwortung.«
Am Ende der Sitzung ist immer ein wenig Zeit für die Besprechung der Neuaufnahmen reserviert. Ich gehe die Liste durch, und als ich Helen Cassidys Namen nenne, hebt Eve die Hand.
»Sie wurde mir zugewiesen. Kann ich sie bitte an jemand anderen abgeben?« Sie zögert. »Ich wusste nicht, dass sie schwanger ist.«
Im Raum ist Unruhe spürbar.
Ich erröte. Ich kann nicht glauben, dass ich eine schwangere Patientin einer Mitarbeiterin zugewiesen habe, die gerade erst eine Fehlgeburt hatte.
»Das tut mir furchtbar leid …«
»Schon okay«, meint Eve schnell, »war nicht deine Schuld. Ihr Hausarzt hat es nicht in den Überweisungsbrief geschrieben. Ein Formfehler. Nicht so schlimm. Irgendwelche Freiwilligen?«
Nachdem wir den Fall neu vergeben haben, sehe ich mir den Arztbrief noch einmal an.
»Hatten wir das nicht schon mal?«, frage ich. »Bei demselben Arzt?« Einige nicken, und ich schüttle den Kopf. »Wir sind auf verlässliche Informationen von den Hausärzten angewiesen. Oftmals unsere einzige Informationsquelle. Ganz abgesehen davon, dass die Patientin zusätzliche Betreuung durch die Geburtsmedizin brauchen wird.« Ich nehme die Akte an mich. »Ich hake da mal nach.«
Als wir weitermachen, wäre es für mich an der Zeit, darum zu bitten, dass jemand anderes Dan Griffin übernimmt. Einen verletzlichen, von seiner Mutter entfremdeten Patienten. Einen Patienten mit offensichtlichen Bindungsproblemen.
Ein Patient, der aussieht wie mein Sohn.
»Gibt es noch irgendetwas zu klären?«, frage ich und blicke in die Runde.
Viele schütteln die Köpfe. Dann meldet sich Anna zu Wort. »Nur eine kurze Rückmeldung. Andrew Doornan …« Sie lächelt. »Er arbeitet wieder.«
Allgemeines Nicken und anerkennendes Gemurmel.
»Sehr gut«, sage ich. »Tolle Arbeit. Sonst noch was?«
Ich sehe um mich.
Eve weist uns auf Matt Johnsons neuen Blog hin. »Könnte interessant für unsere Studierenden sein, die Perspektive eines Patienten zu lesen.« Sie nickt den angesprochenen Personen zu.
Es ist eine gute Anregung, aber gleichzeitig frage ich mich, ob es auch ein Beschwichtigungsversuch an mich sein soll, nachdem sie meine unachtsame, ungeschickte Patientenzuteilung offengelegt hat.
»Gute Idee. Auf jeden Fall eine lehrreiche Lektüre. Matt ist Notfallmediziner«, ergänze ich und schaue den Medizinstudenten gezielt an.
Stephanie macht sich einen Vermerk.





























