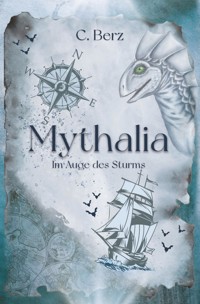
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Auge des Sturms ist trügerisch. Mach dich bereit für den Orkan … Nachdem Linnea eine Drachenklaue schwer verwundet hat, senden die Ghule ihre stärksten Verbündeten aus, um dieses Verbrechen zu sühnen. Die mächtigsten Mythalier stellen sich ihr in den Weg – und dennoch nimmt Linnea ihr Schicksal an, um Menschen, Elfen und Drachenmenschen zu verteidigen. Marion hat ihren Vater verloren und ihren Geliebten ermordet. Doch Hagels Andenken will nicht weichen. In ihrer Zerrissenheit bemerkt sie nicht, wie sie sich selbst verliert und denjenigen von sich stößt, der sie aus tiefstem Herzen liebt. Auch Späher muss beschwerliche Entscheidungen treffen, um den Erwartungen seiner Anhänger gerecht zu werden. Ein falscher Schritt und alles ist verloren. Wird er seine Familie rächen und sein Schicksal erfüllen können oder werden seine Taten sie alle in den Abgrund reißen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C. Berz
Mythalia
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by C. Berz
Umschlag: © 2023 Copyright by Acelya Soylu
Illustration: Sandra Meyer
Lektorat: Claudia Barthelmes
Verantwortlich
für den Inhalt: C. Berz
c/o autorenglück.de
Prolog
Die Tür loderte gold-orange auf, als die Flammenzungen an dem Mandelpalm-Holz leckten. Hagel beobachtete fasziniert, wie das Feuer sich ausbreitete, von seiner Fackel genährt. Es wuchs in die Höhe, bis es auf die schweren Wandbehänge übergriff. Bunt bestickte Teppiche, Vorhänge und Gemälde erstrahlten in feurig rotem Glanz – erblühten ein letztes Mal, bevor sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannten. Das rötliche Holz hatte ihm nie gefallen. Genau wie all die verspielten Möbel und geschwungenen Details an Decke und Wänden, die Ludwig Reichenherz für prunkvoll hielt. Wenn dieses Haus erst ihm gehörte, würde sich einiges ändern.
Entsetztes Kreischen riss den siebzehnjährigen Hagel zurück ins Hier und Jetzt. Er hörte die Schritte mehrerer Personen die steinerne Treppe emporsteigen. Dem leichtfüßigen Tapsen nach mussten es Frauen sein – vermutlich barfuß. Gerade als die Zofen mit wehenden Nachtgewändern den Treppenabsatz erreichten, wirbelte Hagel herum und huschte durch eine Tür. Der Türrahmen brannte bereits lichterloh, er spürte die Hitze der Flammen im Nacken.
Verzweifelt durcheinander rufend, näherten sich die Frauen der Tür, die Hagel soeben hinter sich zuzog. Er zögerte einen Augenblick. Hatten sie ihn gesehen? Egal, er durfte keine Zeit verschwenden. Also steckte er seinen Arm durch den Türspalt und schleuderte die brennende Fackel mitten ins Treppenhaus. Schwungvoll warf Hagel die Tür ins Schloss und schob mit einer behandschuhten Hand einen gewaltigen Eisenriegel vor. Das dicke Holz erstickte die Hilfeschreie der Frauen.
Für einen Moment blieb er an der Tür stehen, die Augen geschlossen, um den Gedanken an die Sterbenden auf der anderen Seite zu verdrängen. Es muss so sein, rief er sich in Erinnerung.
Er konnte es nicht mehr ungeschehen machen. Das Feuer würde alles und jeden verschlingen. Er musste fliehen, bevor es auch ihn auffraß. Der Gedanke, er könnte derjenige hinter dieser Tür sein, drehte ihm den Magen um.
Denk an den Reichtum!, schalt er sich knurrend. Denk an das, was du erreichen wirst!
Und dann sah er sie vor sich. Dieses Mädchen mit dem schulterlangen dunklen Haar, das ihr bildhübsches Gesicht rahmte. Auf einer Seite hatte sie es hinter ihr Ohr gesteckt, mit einer großen roten Muschelrose. Am Morgen war eine Kolonne von Kutschen an ihm vorbeigerattert – dunkle geschlossene Gefährte, gezogen von stattlichen blauen Kaiserpferden. Das waren Kutschen des Grafen von Ruder. Die Insassen hatte er nicht sehen können, nur das Mädchen hatte sich aus dem Kutschenfenster gebeugt und ihm zugewinkt. Ein sanfter Windstoß hatte ein rotes Blü-tenblatt aus ihrem Haar gelöst. Es war durch die Luft geflattert, getragen vom Fahrtwind der Kutschen. Hagel hatte der Kolonne und dem Mädchen noch lange hinterher geschaut.
Nun stand er hier, in dem düsteren Haus unter der Erde und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander, als könne er noch das Blatt der Muschelrose fühlen, das er gefangen hatte.
Hagel seufzte. „Marion …“
Einige Male waren sie einander bereits begegnet. Er bewunderte das bildhübsche Mädchen schon länger. Eines Tages würde er sie zur Frau nehmen, das hatte Grau ihm versprochen. Doch das ging nicht, wenn er hier starb!
Ruckartig wandte Hagel sich von der Tür ab, rückte Langbogen und Köcher auf seiner Schulter zurecht und rannte den Flur entlang. Das Klappern seiner Pfeile hallte in dem verwaisten Korridor wider, bis er den kleinen Empfangsraum erreichte, den eine einzelne blaue Fackel erhellte. Auch diese Tür warf er schwungvoll hinter sich ins Schloss. Er wollte schon das Haus verlassen – da fiel sein Blick auf die blaue Fackel in der Wandhalterung. Rasch fasste er einen Entschluss. Hektisch stöberte Hagel in seiner ledernen Gürteltasche, bis er ein kleines Fläschchen aus Ton fand. Ihm wurde immer heißer, obwohl er nur eine Kniebundhose und ein dünnes Leinenhemd trug. Trotzdem nahm er sich die Zeit, das Tongefäß zu entkorken und den Inhalt auf dem Boden auszuschütten. Zähflüssiges blassrotes Funkeröl ergoss sich auf die Steinfliesen und sickerte unter der Tür hindurch. Hagel verspritzte auch noch die letzten Reste von dem Öl auf das rötliche Mandelpalm-Holz der Tür und die Wände.
Schließlich riss er die Fackel aus ihrer Halterung, holte tief Luft – und ließ sie fallen. Eine blaue Stichflamme loderte auf und mit stürmischem Rauschen erfassten blaue und gelb-goldene Flammen den gesamten Empfangsraum.
Hagel gelang es gerade noch, dem Feuer auszuweichen, indem er sich mit einem Hechtsprung durch die Tür ins Freie rettete. Geistesgegenwärtig riss er sich im Fallen den Langbogen vom Rücken, bevor er hart auf seiner Schulter landete. Er stöhnte vor Schmerz, als er sich am rauen Stein der Eingangstreppe sein Hemd aufriss und seine Haut blutig schrammte. Hell klappernd sprang eine Handvoll Pfeile mit schwarzen Fieberdohlen-Federn aus seinem Köcher und die Treppenstufen hinab.
Aus dem Eingangsportal züngelten Flammen hervor und leckten nach Hagels Füßen. Der Siebzehnjährige atmete erleichtert aus, als er erkannte, dass ihn das Feuer nicht erreichen konnte. Am liebsten wäre er einfach liegen geblieben, so erschöpft war er. Schließlich war es tief in der Nacht und Hagel hatte schon in den vergangenen Nächten kein Auge zugetan. Doch die Intrige war noch immer nicht vorbei, also erhob er sich schwerfällig auf die Knie und rappelte sich auf. Hastig sammelte er all seine Pfeile ein, rannte die Treppe hinunter und auf die Wiese vor dem Löwenhaus.
Von hier aus konnte er das gepflegte langgezogene Gebäude mit der weiß getünchten Fassade in seiner ganzen Pracht überblicken. Der Sitz der Familie Reichenherz besaß nicht viele Fenster, da der Großteil des Löwenhauses unter der Erde lag. Hagel zählte insgesamt siebzehn Fenster auf dieser Seite. Aus mindestens der Hälfte schlugen Flammen und färbten die schneeweiße Außenmauer rußschwarz. Verzweifelte Schreie von Menschen im Todeskampf mischten sich unter das tosende Rauschen des Feuers. Ein beißender Geruch setzte sich in Hagels Nase fest und der giftige Geschmack von Asche belegte seine Zunge.
Hagel keuchte auf, als er das Ausmaß der Zerstörung begriff. Was hatte er getan? Er senkte den Kopf und betrachtete seine hohen Lederstiefel, die mit Ascheflocken bedeckt waren. Das alles hat einen Zweck. Sie müssen sterben, damit wir siegen können.
Wenn das Feuer im Löwenhaus gelöscht und der Frei-herr von Löwen Geschichte war, konnten Hagel und Grau ihren Plan in die Tat umsetzen. Sicher würde man die Toten der Familie Reichenherz hier bestatten und das Haus zu einem Mausoleum machen. Es dürfte vielleicht ein oder zwei Jahre dauern, bis es nicht mehr nach Rauch und Tod stank. Dann konnte man mit der Renovierung beginnen. Bis dahin wäre der Ruf des Grafen von Ruder längst Geschichte und Grau würde seinen Platz einnehmen. Und dann würde auch Hagels große Stunde kommen.
Bei dem Gedanken an das prunkvolle Leben als Freiherr von Hagel stahl sich ein grimmiges Lächeln auf seine Lippen. Gewissenhaft zupfte er seine schwarzen Lederhandschuhe zurecht, zog den ersten Pfeil aus seinem Köcher und legte ihn in die Sehne seines Langbogens.
Er musste nicht lange warten. Die ersten, die ihr Glück in der Flucht durch die Fenster suchten, waren der Koch und seine Gehilfen. Hagel beobachtete voller Abscheu, wie sich der fette alte Mann abmühte, auf das Fenstersims zu klettern. Sein rußgeschwärztes Gesicht war knallrot – ob vor Anstrengung oder durch die Hitze des Feuers, konnte Hagel nicht sagen. Es interessierte ihn auch nicht. Seelenruhig hob er den Bogen und zog die Sehne zurück. Hagel schmeckte das Leder seiner Handschuhe, als er die Finger an seinem Mundwinkel einhakte, um den Pfeil zu stabilisieren. Widerwillig verkniff er sich das Lächeln, damit seine Gesichtsmuskeln nicht unter seinen Fingern zuckten.
Hagel löste den Griff und der Pfeil schoss auf sein Ziel zu. Zufrieden registrierte er, wie das Geschoss durch die Luft pfiff, gefolgt von einem dumpfen Aufschlag und einem gellenden Schrei. Hagel legte bereits den nächsten Pfeil in die Sehne, während er zusah, wie sich die weiße Kittelschürze des Kochs über dessen Brust blutrot färbte. Zu seiner Enttäuschung kippte der sterbende Mann nicht aus dem Fenster, sondern wurde von seinen Gehilfen zurückgezogen. Zwei Frauen und ein Mann waren es. Sie hatten Hagel entdeckt und duckten sich verängstigt unter das Fenstersims. Sie fürchteten ihn. Gut so.
Doch aus dem Fenster quoll bereits dichter schwarzer Qualm und Hagel hörte die Küchenhilfen ununterbrochen husten. Sie saßen in der Falle und würden sich bald entscheiden müssen, welchen Tod sie sterben wollten.
Er konnte warten. Sollten sie sich überlegen, ihr Glück auf der anderen Seite zu versuchen, so würden sie ebenfalls in den Tod laufen. Denn dort warteten zwei seiner Verbündeten nur darauf, die Fliehenden aufzuhalten.
Es dauerte nicht lange, da machte eine Frau den Fehler, über das Fenstersims zu spähen. Im selben Moment spritzte dunkelrotes Blut auf, als Hagels Pfeil ihr Auge durchbohrte. Als er den nächsten Pfeil aus dem Köcher holte, erregte eine Bewegung weiter rechts seine Aufmerksamkeit.
Ein Gardist, gekleidet in Gambeson und Lederharnisch, stieg dort aus dem Fenster. Hagel bewegte den Bogen zur Seite und schoss sofort. Doch der Mann bückte sich in eben diesem Augenblick, sodass der Pfeil ihn um Haaresbreite verfehlte. Unwillkürlich entfuhr ihm ein entsetzter Schrei. Dann wandte er den Kopf und bemerkte Hagel, weil dieser laut fluchte. Offenbar in wilde Panik verfallen, beeilte sich der Gardist nun umso mehr, aus der Schusslinie zu kommen. Er hängte sich an das Sims, um sich ins Gras fallen zu lassen. Der Mann schrie nicht, als der nächste Pfeil seinen ungeschützten Hals durchschlug, sondern gab nur ein ersticktes Röcheln von sich. Dann fiel er zu Boden und blieb verdreht liegen.
Hagels Herz hämmerte in seiner Brust und seine Ohren klingelten. Fahrig fuhr er sich über die Lippen, wo sich Speichel angesammelt hatte. Er begann heftiger zu atmen, als er spürte, wie ihn der Blutrausch übermannte. Er kannte dieses Gefühl bereits und begrüßte seine Wirkung. Von nun an würde das Töten noch einfacher werden. Wie in Trance wandte er sich wieder dem ersten Fenster zu, wo die Küchenhilfen einen erneuten Fluchtversuch wagten, weil Hagel für einen Moment abgelenkt gewesen war.
Die zweite Frau starb durch einen Schuss in die Brust, worauf sie wie eine leblose Puppe vom Sims rutschte und im Gras aufschlug. Der Mann war schneller. Er nutzte die Zeit, die Hagel benötigte, um einen neuen Pfeil nachzuladen, sprang aus dem Fenster und strauchelte einen Moment lang. Bevor er sicher auf den Füßen stehen konnte, setzte sich Hagel in Bewegung. Im Laufen griff er an seinen Gürtel und zückte ein Messer. Der törichte Kerl lief ihm praktisch in die Arme. Hagel packte ihn um die Mitte und drückte ihn fest an sich. Dann stieß er ihm die Klinge zwischen die Rippen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Das Stöhnen des Verletzten und das schmatzende Geräusch, wenn das Messer das Fleisch zerschnitt, waren Musik in Hagels Ohren. Als ihm das Gewicht des Sterbenden zu schwer wurde, trat er einen Schritt zurück und ließ den Körper hart zu Boden fallen.
Wo bleibt der nächste?
Flammen und dichte Rauchschwaden drangen inzwi-schen aus jedem Fenster. Mit ihnen quollen weitere fliehende Menschen und Drachenmenschen aus dem Löwenhaus. Hagels Mundwinkel zuckten bei deren Anblick. Es würde sich wohl erst später lohnen, die Klinge zu säubern. Er steckte das Messer zurück in die Scheide an seinem Gürtel, packte erneut den Bogen und griff nach dem nächsten Pfeil.
* * *
Nach knapp einer Stunde versiegte der Strom von Flüchtenden. Die Schreie wurden leiser und weniger. Das Rauschen der Flammen und das Knacken berstender Balken verschluckte alle anderen Geräusche der Nacht. Eine breite Wolke aus glühend orangefarbenem Rauch erhob sich in den schwarzen Himmel wie ein gewaltiger Turm. Nun würde es nicht mehr lang dauern, bis der Graf von Ruder seine Soldaten schickte. Wie töricht Ludwig Reichenherz doch war, seine eigenen Gardisten alle im Löwenhaus wohnen zu lassen. Wenn Hagel erst Freiherr war, würde er ihnen diesen Luxus nicht bieten. Baracken würden es auch tun. Mit genügend Abstand zum Haus, damit so etwas wie hier gar nicht erst passieren konnte.
Hagel hatte gerade das Messer gesäubert und sammelte seine Pfeile wieder ein. Soeben riss er einen davon aus der Schulter eines toten Dieners, da kam doch noch jemand aus einem Fenster geklettert. Eine kleine Gestalt in rußgeschwärztem Nachthemd stieg mit dürren wackligen Beinen auf die Fensterbank. Ein Kind. Das Mädchen hatte sich ein schmutziges Tuch über Mund und Nase gebunden, sein dunkelbraunes Haar war völlig zerzaust und stellenweise angesengt. Hagel langte mit einer Hand über die Schulter und zog einen Pfeil aus dem Köcher. Das Mädchen bemerkte ihn nicht.
Da erschien der Kopf einer Frau hinter dem Kind. Sicher eine Zofe oder ein Kindermädchen. Hagel stockte einen Moment der Atem, als er sie sah. Sie musste einmal schön gewesen sein. Doch ihr Haar war fast vollständig verbrannt und eine Seite ihres Gesichts war zu einer Masse aus Brandblasen, verkohlter Haut und glänzend rotem Fleisch verschmolzen. Für eine Weile war er so entsetzt von ihrem entstellten Antlitz, dass er zuließ, wie sie dem Mädchen half, hinunter ins Gras zu springen.
„Warte hier einen Moment“, hörte Hagel sie sagen, ehe sie die Hände nach einem zweiten Kind ausstreckte.
Hagels Gesichtszüge verhärteten sich, als er den Jungen erkannte. Er war nicht viel jünger als er selbst, sein eigentlich braunes Haar war weiß von Asche und er war in einen edlen, aber verkohlten Samtpyjama gekleidet. Das war Luraniel von Reichenherz, der Erbe der Familie. Hagel hatte Ludwig und Felicia in ihrem Schlafgemach eingeschlossen, doch ihr Sohn musste bei seinem Kindermädchen übernachtet haben. Zorn stieg in ihm hoch, während er den Bogen hob und die Sehne zurückzog. Er war wütend auf sich selbst, weil er diesen Umstand nicht bedacht hatte. Nun musste er es eben auf diese Weise erledigen.
Das Kindermädchen half Luraniel, sich am Sims herab zu hangeln und ins Gras fallen zu lassen, ehe sie sich abermals umdrehte. Vermutlich, um ein weiteres Kind zu holen. Hagel zögerte keinen Augenblick. Doch gerade als der Pfeil auf ihn zuschoss, machte der Junge einen Schritt zur Seite, sodass er in die Schulter getroffen wurde.
Er schrie vor Schmerz auf und geriet durch die Wucht des Einschlags ins Taumeln. Auch das Mädchen kreischte verängstigt und riss sich dabei das Tuch vom Gesicht. Sie hatten Hagel entdeckt. Er musste eilig handeln, denn auch die Frau schickte sich nun an, aus dem Fenster zu klettern, um die Kinder vor ihm zu retten. Einen Herzschlag lang spielte er mit dem Gedanken, sie als Erste zu erschießen. Doch der Junge hatte Priorität. Also schnappte er sich einen neuen Pfeil, zog noch in derselben Bewegung die Sehne zurück und schoss.
Bösartiges Vergnügen wärmte sein Inneres, als der Pfeil die Brust des Jungen durchbohrte. Diesmal hatte er richtig gezielt. Mitten ins Herz. Luraniel war tot, noch bevor sein Körper im Gras landete.
Die Frau brüllte vor Entsetzen und ihr Blick flog von der Leiche des Jungen zu Hagel. In den Armen hielt sie ein mit Stoff umwickeltes Bündel.
„Du Bastard!“, schrie sie aus voller Kehle.
Doch Hagel legte ungerührt den nächsten Pfeil auf, zielte auf die Frau – und erstarrte in der Bewegung. Das dritte Kind, das sie geholt hatte, war ein Säugling. Sie hatte das kleine zarte Wesen in ein Tuch gewickelt und presste sein Köpfchen schützend an ihre Brust. Aus dem samtenen Stoff lugte ein rosafarbenes Füßchen hervor. Es war so winzig. Hagels Verstand ratterte. Seine Brust hob und senkte sich rasch. Beiläufig registrierte er, wie sich das Mädchen neben Luraniel hockte und einen edel verzierten Dolch aus seiner erschlafften Hand löste.
Kann ich es riskieren, sie laufen zu lassen? Nein, was denke ich denn?! Niemand darf überleben!
Seine Schulter schmerzte inzwischen.
Da bückte sich die Frau, hielt dem kleinen Mädchen den schlafenden Säugling hin und rief über das Tosen des Feuers hinweg:
„Hier, nimm ihn. Gib mir den Dolch. Los, Tia!“
Jetzt, da er der Frau nicht mehr in ihre flehenden Augen blickte, sondern von der Seite die verbrannten Hautfetzen ihres Gesichts sah, fiel ihm die Entscheidung leicht. Gemächlich und fast geräuschlos zog er die Sehne an sein Gesicht heran, bis seine Finger seinen Mundwinkel berührten. Als die Frau Tia den Säugling übergab und nach dem Dolch griff, ließ Hagel den Pfeil fliegen.
Er traf sie genau ins Herz. Der Zofe entfuhr ein Schrei. Dann brach sie vor Tia zusammen. Auch das Mädchen schrie, fiel auf die Knie und hätte beinahe den Säugling fallen lassen. Daraufhin begann auch dieser lauthals zu brüllen. Das Kind beachtete Hagel überhaupt nicht, sondern hockte nur im Gras, presste den kleinen Jungen an sich und beugte sich schluchzend über die Frau.
„Mama!“
Mit einem Mal sah Hagel anstelle des fremden Mäd-chens seine eigene Schwester vor sich. Wie hatte sie damals um ihre Mutter geweint …
Verblüfft stellte Hagel fest, dass die Frau noch nicht tot war. Ihr Körper bebte und sie brachte kaum ein Flüstern hervor. Die Worte, die sie zu Tia sagte, wurden vom Rauschen der Flammen verschluckt.
Da sammelte das Mädchen all seinen Mut zusammen, als würde es aus einer Trance erwachen, packte den Säugling und hob den Dolch vom Boden auf. Der große Rubin in dessen Knauf glühte im Feuerschein, als sei er lebendig. Hagel hielt den Bogen gespannt. Er zitterte wie das Mädchen, das herzzerreißend heulte. Glitzernde Tränen rannen über ihre rußgeschwärzten Wangen, als sie ihn mit ihren rehbraunen Augen ansah.
Plötzlich rannte die Kleine los. Hagel keuchte auf und hob den Bogen. Er zog den Pfeil zurück – diesmal so weit, dass er die Leitfeder an seinem Wangenknochen fühlte. Das Mädchen rannte weiter, ohne sich umzudrehen. Es war klein, doch aus dieser Entfernung ein leichtes Ziel. Hagel presste die Federn des Pfeils dicht an sein Gesicht.
Im Inneren des Löwenhauses zerbarst etwas unter der Gewalt des tosenden Feuers. Hagels Augen zuckten für einen winzigen Augenblick zur Seite. Da war das Mädchen verschwunden. Und er hielt den Pfeil noch immer zwischen den Fingern.
Was hab‘ ich getan?
Nun war er es, der den Mund aufmachte und lauthals in die Nacht hinein schrie. Dabei öffnete er endlich seine Finger und löste den Schuss. Der Pfeil verschwand in der Dunkelheit, ohne ein Ziel zu treffen. Ein schmervolles Zischen entfuhr Hagel, als ihm die Feder die Haut seiner Wange aufriss. Mit einem Knurren presste er die behandschuhte Hand darauf, während er sich gemächlich um sich selbst drehte und sich umsah.
Es war heiß. Rinnsale von Schweiß liefen ihm unter dem Leinenhemd über den Rücken. Aus sämtlichen Fenstern des Löwenhauses züngelten immer noch rot-goldene Flammen, das Dach war zum Teil eingestürzt und ließ dichte Rauchwolken in die Luft emporsteigen. Der Himmel dahinter strahlte inzwischen ebenso leuchtend rot. Die Sonne ging auf.
Mit Anbruch des Tages kamen sie endlich. Hagel spürte die Vibrationen im Boden, hörte die lauten Ausrufe und das Wiehern der Rösser. Kurz darauf erblickte er blaue auf und ab hüpfende Flammen zwischen den Bäumen des Waldes. Angestrahlt durch das Licht der Fackeln und Laternen, erkannte er die schemenhaften Umrisse von mindestens zwei Dutzend gerüsteten Reitern.
Panik erfasste ihn und schnürte ihm die Kehle zu. Jedoch nur so lange, bis ein noch lauteres Donnern die Geräusche der Pferdehufe übertönte. Es war das vertraute Stampfen gewaltiger Tiere, das Hagel erleichtert aufatmen ließ. Noch ehe die Reiterei den Wald verließ, bogen zwei Panzernashörner um eine Ecke des Löwenhauses und stürmten schnaubend auf ihn zu. Es waren enorm kräftige Biester mit kurzen muskelbepackten Beinen, die vom Kopf bis zum Schwanz in glänzenden Plattenrüstungen steckten. Auf ihren Nasenrücken über den faltigen Mäulern saßen Hörner, länger als Hagels Unterarm.
Grau hockte, über den massigen Hals seines Nashorns gebeugt, im Sattel. Sein schulterlanges silbergraues Haar und sein völlig von Asche verstaubter Umhang flatterten durch die Luft. Er preschte ein gutes Stück an Hagel vorüber, ehe es ihm gelang, das schnaubende Tier zu zügeln. Der Name seines Begleiters war Reesp, ein blasser glattrasierter Mann mit dunklem kurz geschorenem Haar. Reesps Augen waren so strahlend grün, dass sie in der Dämmerung zu leuchten schienen. Sein Panzernashorn stieß ein markerschütterndes Röhren aus und zog mit seinen stämmigen Beinen tiefe Furchen ins Gras, als er es direkt neben Hagel zum Stehen brachte.
„Komm schon!“ Reesp lehnte sich zur Seite und streckte Hagel seine Hand entgegen, der sie sogleich ergriff und sich hinter ihm in den Sattel schwang.
Grau führte sein Panzernashorn dichter an das von Reesp heran und ließ die beiden mit einem anerkennenden Grinsen wissen: „Gute Arbeit, Männer. Nur noch ein paar Jährchen Geduld. Wenn erst der Graf von Ruder aus dem Weg ist, gehört all das hier uns.“
Damit wendete er sein Nashorn und schlug ihm kräftig mit der Hand gegen die Seite, um es anzutreiben. Reesp tat es ihm gleich. Die Hufschläge der Reiterei hinter ihnen verebbten, als die Brandstifter sich vom Schauplatz des Verbrechens entfernten.
Nachdem sie eine Weile schweigend einer Straße gefolgt waren, die aufgehende Sonne im Visier, meldete sich Reesp wieder zu Wort: „Eines verstehe ich nicht. Hätte es nicht gereicht, den Ruf des Freiherrn von Löwen zugrunde zu richten? So wie beim Grafen von Ruder?“
Hagel schluckte und antwortete nicht. Grau ignorierte Reesp ebenfalls.
„Ich meine … wieso mussten wir Reichenherz töten? Und dazu seine ganze Familie?“
Obwohl Reesp ihn fragend über die Schulter anblickte, sah Hagel ihn nicht an, sondern schaute an ihm vorbei in die Ferne. Vor seinem inneren Auge sah er den jungen Luraniel zusammenbrechen, mit dem Pfeil im Herzen. Zornig ballte er die Hand zur Faust, mit der er sich nicht an Reesps Hüfte festhielt. Diese Finger hatten den Pfeil auf seinen Weg geschickt. Wie einen Phantomschmerz spürte er noch immer den Druck der Sehne auf Zeige-, Mittel- und Ringfinger.
Mehr zu sich selbst sagte er: „Vergiss nicht, wer Ludwig Reichenherz war. Der Cousin des Königs wird nicht einfach in Ungnade fallen und verbannt, weil wir seine Ehre beschmutzen. Sein Tod ist die einzige Lösung.“
„Und der wird schon bald in aller Munde sein“, plauderte Grau gut gelaunt und wandte sich im Sattel um. „Mit diesem Feuer haben wir ganze Arbeit geleistet.“
Doch Hagel blickte nicht zurück. Die Schreie des Mädchens und seiner Mutter hallten in seinem Kopf nach. Mit weit geöffneten Augen starrte er in den strahlend hellen Kreis der Sonne, die knapp über dem Horizont hing. Seine Augen brannten und wurden feucht, aber er wollte sie nicht schließen. Wenn er lange genug in das glühende Gestirn blickte, würde er sie vielleicht nicht mehr sehen. Diese rehbraunen, unschuldigen Augen …
Getrennte Wege
Die Noah war weniger als ein Wrack. So, wie sie im Trockendock lag, ähnelte sie eher dem Rohbau eines völlig fremden Schiffes. Sie hatte keine Masten mehr. Der vordere Mast war ein verkohlter Haufen Asche. Der Hintere, nicht mehr als ein morscher, verschimmelter Baumstamm, wurde soeben mithilfe eines großen Krans von Bord gehoben. Der Rumpf sah nicht besser aus. Als Hexenschiff war die Noah schon immer schwarz gewesen. Doch die Flammen hatten die dunkle Farbe vom Holz gelöst. Anstatt im Sonnenlicht pechschwarz zu glänzen, waren die Planken jetzt verkohlt, rau und brüchig.
Im Bauch der Noah stand noch immer jede Menge Wasser. Unablässig schöpften die Werftarbeiter randvolle Eimer heraus. Dabei blieb ihnen der mühselige Weg über das Deck erspart, denn der Rumpf hatte so große Löcher, dass die breitschultrigen Arbeiter bequem ein- und ausgehen konnten.
Wie das Gerippe eines gestrandeten Wals lag die Noah also mit ihren klaffenden Wunden auf dem Trockenen. Bedrückt beobachtete Linnea die Männer bei ihrer Arbeit. Es tat ihr weh, das Schiff so zu sehen. Jedes Mal, wenn sie sich abwenden wollte, fiel ihr Blick durch eines der Löcher im Rumpf. Zuerst erblickte sie die kleine Bar, in der sie einige ihrer schönsten Abende an Bord verbracht hatte. Die Bühne und der Tresen waren zusammengebrochen und zwischen den verkohlten Tischen lagen vom Feuer zerfressene Stuhlbeine verstreut. Auch ins Atrium konnte sie hineinschauen. Dort war die Bombe explodiert und hatte den Raum völlig verwüstet. Fast die gesamte Galerie war eingestürzt und die Audienzräume des Grafen im oberen Stockwerk waren ausgebrannt. Der Boden war übersäht von Trümmerteilen und weißer Asche. Linnea schaute noch genauer hin und entdeckte das Kompassmodell, das Tuk in die Planken geschlagen hatte. Als sie die verbogenen Nägel erblickte, wurde der Schmerz doch zu groß und Linnea drehte sich ruckartig weg. Mit einem tiefen Seufzen ließ sie den Blick über den Hafen schweifen, ohne wirklich etwas zu sehen.
Frisuriens Küste war von unendlich langen Stränden überzogen, unterbrochen nur durch vereinzelte kleine Küstenorte mit überschaubaren Häfen. Der mit Abstand größte Hafen des ganzen Landes war Moränstedt. Es war nicht der erste Hafen, den sie vom Pfauenreich aus hätten erreichen können – ganz im Gegenteil. Der Hafen Moränstedt lag etwa in der Mitte der gesamten Küstenlinie, die zu Frisurien gehörte. Doch eben diese zentrale Lage machte ihn zu einem der beliebtesten Häfen auf der ganzen Welt. Moränstedt war von fünf Ländern in etwa gleich weit entfernt, was es zu dem Umschlagpunkt für alle Händler in der Gegend machte. Praktisch jedes Schiff, das auf dem Mondscheinmeer unterwegs war, passierte früher oder später diesen Hafen. Zudem gab es nur wenige Häfen in der Nähe, die groß genug für eine Schiffswerft waren.
Außer dem Hafen hatte die Stadt selbst nicht viel zu bieten. So gut wie jedes der flachen Häuser aus Magenta-Lehm war direkt am Wasser oder wenigstens in zweiter Reihe zum Hafen gebaut. Das Land war flach und gut geeignet für einen weiten Ausbau der Stadt, doch keiner der Bewohner hatte großes Interesse daran, ins Landesinnere zu ziehen und Felder zu bestellen. Die Menschen lebten von Fischfang und Handel. Die dicht aneinandergereihten Bauten zogen sich am Hafen entlang soweit das Auge reichte – und noch weiter. In jedem zweiten Haus befand sich entweder ein Ladengeschäft, eine Schänke oder ein Bordell. Mehr war nicht notwendig, um die zahlreichen Besucher aus aller Welt zufrieden zu stellen.
Die daraus entstehenden Gerüche waren schier überwältigend. Einerseits roch es stets penetrant nach Salz und Fisch, aber ab und zu trug die Meeresbrise herrlichen Essensduft heran, wenn eine der Türen quietschend aufschwang. Dabei wehten Linnea Stimmengewirr, raues Seemannsgelächter und die durchdringende Musik von Fiedeln und Maultrommeln entgegen.
Die Sonne stand schon tief über den orange glitzernden, sanften Wellen und tauchte das geschäftige Treiben am Hafen in ein warmes Licht. Trotz der späten Stunde war in Moränstedt noch viel los, denn die Flut nahte heran. Ein Schiff nach dem anderen fuhr in die langgezogene Bucht ein und wartete darauf, einen Liege- oder Ankerplatz zugewiesen zu bekommen. Die meisten wurden mit bereitgestellten Ochsenkarren, Kränen und jeder Menge starker Hände am Kai erwartet. Kam ein Schiff um diese Zeit noch unangemeldet, musste es in zweiter Reihe ankern und mit dem Löschen der Ladung bis zum Morgen warten.
Soweit hatte Linnea die Prozedur inzwischen durchschaut. Sie beobachtete schon seit einiger Zeit mit wachem Interesse das Be- und Entladen der gigantischen Schiffe. Sicher, Linnea hatte die letzte Zeit selbst auf einem sehr großen Schiff verbracht. Doch die Noah war ein Hexenschiff und daher so verzaubert, dass sie innen enorm viel Platz bot. Außen jedoch war sie kompakt genug gebaut, um auch Flüsse und kleine Seen befahren zu können.
Die Schiffe, die hier in Moränstedt lagen, waren ausschließlich für den Ozean gefertigt. Viele von ihnen waren doppelt oder dreimal so breit und fünfmal so lang wie die Noah. Allein über Wasser hatten die meisten Schiffe ein halbes Dutzend Decks und jedes von ihnen war mindestens ein Dreimaster. Gegen diese Ozeanriesen wirkte auch die Steinspalter so mickrig wie eine einfache Schaluppe. Mit ihren lediglich zwei Masten ging sie zwischen den Drei-, Vier oder Fünfmastern unter und hätte sie nicht so einen schimmernden und eigentümlich geformten Rumpf aus Stahl, würde man sie in dem großen Hafen glatt übersehen.
Im Moment war die Steinspalter das einzige Schiff in Moränstedt, das seine Ladung nicht löschte – ganz im Gegenteil. Mit Kränen und Muskelkraft wurde Kiste um Kiste an Bord gebracht und an oder unter Deck verstaut. Einzelne Seemänner machten sich bereits an den Tauen zu schaffen, während andere Matrosen die Masten emporkletterten und die Takelage lockerten. Die Steinspalter wurde zur Abfahrt bereitgemacht und würde mit der Flut auslaufen. Auch Linnea würde mit an Bord sein und die Noah schweren Herzens in Moränstedt zurücklassen. In den frühen Morgenstunden hatte sie diesen Entschluss gefasst …
* * *
Die orangefarbene Sonne hing noch sehr dicht über dem endlosen Horizont aus glitzernden Wellen. Der starke salzige Wind war von nun an ein ständiger Begleiter und flaute nur in den späten Abendstunden ein wenig ab. In der Nacht gewann er an neuer Kraft. Egal wie früh man morgens aufstand – der Wind war stets als Erster wach. Obwohl die Sonne erst vor einer Stunde aufgegangen war, hatte sich bereits fast die gesamte Mannschaft der Noah an Deck der Steinspalter versammelt. Die Steinspalter wiegte ihre Besatzung sanft hin und her, während die gerefften Segel über ihnen flatterten, die Takelage knarzte und die Seevögel kreischten. Der Wind milderte die Wärme der Morgensonne zwar ab, doch Linnea schwitzte trotzdem.
„Ist es in den Dingern immer so warm?“, fragte sie schwer schnaubend.
„Du wirst dich daran gewöhnen“, erwiderte Ling knapp und strich sich das lange blonde Haar aus dem Gesicht, um ihre Arbeit begutachten zu können.
Linnea trug bereits einen langärmeligen dicken Gambeson, der ihr fast bis zu den Knien reichte. Zudem hatte Ling sie eben noch in eine ärmellose Lederrüstung eingeschnürt. Nun nahm die Lizardorin noch zwei sogenannte Beintaschen aus Leder in die Hand, die als Oberschenkelschutz dienen sollten.
Prüfend hielt sie die Beintaschen an den unteren Rand der Lederrüstung und murmelte dabei: „Das müssen wir noch kürzen.“
„Warte ab, bis du dich im Kampf darin bewegen musst. Dann wird dir erst richtig heiß“, warf Ben von der Seite her ein.
Unwillkürlich musste Linnea schmunzeln. Ganz kurz nur trafen sich ihre Blicke – Linnea blickte zu Boden. Sogleich wurde ihr noch wärmer, als sie scharlachrot anlief. Ob der Elf sie noch ansah, konnte sie nicht sagen. Die beiden hatten nicht mehr über das gesprochen, was im Bordstall geschehen war. Dennoch war da auf einmal etwas zwischen ihnen, das Linnea nicht erklären konnte – eine Art unsichtbares Band, das Linnea innerlich zu ihm hinzog, selbst wenn sie von anderen umringt waren. Und das waren sie seit dem Zusammentreffen der beiden Schiffe praktisch andauernd. Sie hatten seit ihrem Kuss nicht einen einzigen privaten Augenblick mehr gehabt.
Als die Beintaschen provisorisch angelegt waren, durfte Linnea zur Seite treten und dem Nächsten Platz machen. James und Hannah hatte man schon eingekleidet, Tuk und First Tapfer fehlten noch. Als die Grabmäuler die Noah gekapert hatten und Linnea und Tuk gezwungen waren, in schlecht sitzende Kettenhemden zu schlüpfen, war diese Idee geboren worden. Ben hatte als Erster ausgesprochen, dass ordentlicher Schutz für einen Frontgänger unverzichtbar war. Und wie üblich hatte der Graf von Heroldstadt den Rat von Bruder Ben beherzigt. Im Hafen von Moränstedt waren die nötigen Materialien besorgt worden. Und nun war es soweit: jedem Frontgänger wurde seine persönliche Rüstung maßgeschneidert.
Es war Linnea unangenehm gewesen, im Mittelpunkt zu stehen, während Kapitän Ling ihr die Rüstung unter den Augen aller angelegt hatte. Doch jetzt, da die Lizardorin von ihr abgelassen hatte, stand Linnea einen Moment lang etwas unschlüssig da. Sie konnte die Blicke der Anwesenden noch immer auf sich spüren und wusste vor Nervosität nicht recht wohin mit ihren Gliedmaßen. Ein bisschen beklommen hob sie die Hände vor die Brust, aber der Lederharnisch schnürte sie zu sehr ein und der dicke Gambeson erlaubte es ihr nicht, die Arme zu verschränken. Also ließ sie sie wieder sinken und trat von einem Fuß auf den anderen, während sie unauffällig ihre Freunde beäugte. Fast sofort fiel ihr Blick auf Ben und ohne dass sie es bewusst wollte, bewegten sich ihre unsicheren Füße ein wenig in seine Richtung.
Doch bevor sie sich ihm weiter nähern konnte, wurde sie von Tuks ungehaltener Stimme abgelenkt.
„Ich hab‘ doch gesagt, ich brauche keine Rüstung!“, sagte der junge Lizardor laut.
Alle Köpfe wandten sich zu Tuk um, der neben Hannah auf einer großen Holzkiste saß.
Matthäus stand vor Tuk, einen Brustharnisch in den Händen. „Du weißt doch, dass das die neue Vorschrift ist.“
„Mein lieber Tuk.“ Louise, die sich leise mit First Tapfer unterhalten hatte, trat vor. „Es ist ab sofort Pflicht, dass jeder von euch Frontgängern – “
Plötzlich sprang Tuk ruckartig auf und unterbrach sie:
„Dann bin ich eben kein Frontgänger mehr!“
Er murmelte noch etwas, das sich wie „Mir reicht’s“ anhörte, bevor er zügig an Louise und Matthäus vorbeirauschte und über die Rampe von Bord ging. Im Vorbeigehen streifte er wohl nicht ganz unabsichtlich mit der Schulter Matthäus, sodass dieser reflexartig zupacken musste, damit ihm die schwere Rüstung nicht aus den Händen glitt. Einen Augenblick lang starrten alle Tuk hinterher, bis sie ihn nicht mehr sahen und nur noch seine Schritte auf der Holzrampe hörten.
First Tapfer kam als Erster zur Besinnung und rief:
„Tuk!“
Der First wollte ihm eben nacheilen, da trat ihm Louise in den Weg. „First Tapfer, dann Ihr bitte als Nächster.“ Sie wies mit der Hand auf Matthäus, der mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck symbolisch den Brustharnisch hochhob.
Bevor der First widersprechen und eines seiner üblichen Wortgefechte mit Louise austragen konnte, sprang Hannah von der Holzkiste und warf rasch ein: „Ich sehe nach ihm. Linnea?“ Hannah winkte ihr auffordernd zu.
Linnea war Hannah unheimlich dankbar für diese Gelegenheit, das Schiff verlassen zu können. „Ich komm‘ mit.“
Selbst so früh am Morgen herrschte bereits reger Betrieb im Hafen und Linnea konnte die Blicke der neugierigen Hafenarbeiter auf sich spüren. Eine Menschenfrau und eine Drachenfrau, die zur Hälfte fertiggestellte Rüstungen trugen und eilig die Schiffsrampe hinunterpolterten, mussten einen skurrilen Anblick bieten. Doch als Türmerin war Linnea es gewohnt, angestarrt zu werden. So fiel es ihr leicht, die Blicke zu ignorieren und gezielt nach Tuk Ausschau zu halten. Der Lizardor war noch nicht weit gekommen.
„Tuk!“
Er blieb stehen. Seine hellbraunen Augen glänzten feucht, als er sich zu Hannah und Linnea umwandte. Anfänglicher Argwohn verwandelte sich in Erleichterung, als er sie erkannte.
„Ihr seid es“, sagte er, während er sich beiläufig die Augen rieb. „Tut mir leid, dass ich gerade so laut geworden bin.“
Linnea warf ihm einen besorgten Blick zu. „Was ist los? Geht es dir gut?“
Tuk zuckte als Antwort mit den Achseln, doch sein Gesichtsausdruck sagte ganz deutlich: „Nein.“
„Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich muss euch was erzählen.“ Offensichtlich nervös rang er mit den Händen und schabte dabei gedankenverloren Ruß unter seinen Krallen hervor. „Wenn die Steinspalter nach Laterne zurückfährt, um die Elfen abzuholen … dann werde ich mitfahren. Ich begleite Kreuz nach Hause.“
„Natürlich, das solltest du machen!“, erwiderte Hannah sogleich freundlich, die ganz offenkundig mit einer schlimmeren Nachricht gerechnet hatte.
„Ich komme nicht mehr zurück“, stieß Tuk tonlos hervor und senkte den Blick.
„Was?“, fragte Hannah leise. „Aber Tuk …“
„Ich kann das nicht mehr. Ich sehe immer nur Backstein vor mir, wie er … “ Tuk brach ab und schüttelte den Kopf.
Auch Linneas Unterbewusstsein beschwor unweigerlich ein Bild von Backsteins Leichnam herauf, aus dessen Brust ein Pfeil ragte. „Du machst dir schon wieder Vorwürfe.“
„Ich weiß, was du gesagt hast. Dass das alles Helenas Schuld ist. Einfach alles, was passiert ist. Und du hast Recht, aber … Kreuz und Backstein hätten mir nicht folgen dürfen. Ich hätte einfach nur meinen Mund halten müssen. Ich bin eine Gefahr für euch.“
„Wer weiß, wie es ohne die Hilfe der beiden ausgegangen wäre. Backstein hat uns das Leben gerettet.“
„Das habe ich nicht vergessen. Aber ich habe nicht geschafft seines zu retten. Ich ertrage es nicht, wenn so etwas nochmal passiert. Mir war nicht klar, wie gefährlich, wie tödlich das hier ist.“
„Wir gehen mit dir“, sagte Hannah auf einmal.
Sie nahm Tuks Hände, deren Finger noch nervös an seinen Krallen herumspielten, in ihre. Da blickte er auf und die Blicke der beiden Lizardoren trafen sich. Doch Linnea ließ diesen Moment unsanft zerplatzen.
„Ähm, Hannah. Wir können doch nicht einfach die Frontgänger verlassen.“
Hannah winkte sogleich ab.
„Das meine ich doch nicht.“ Die Lizardorin wandte sich wieder Tuk zu und drückte seine Hände. „Wir begleiten dich und Kreuz so weit, wie es geht. Ich will mich nicht von dir verabschieden. Lass uns diese letzte Fahrt gemeinsam machen.“
Ein freudiges Lächeln stahl sich auf Tuks Lippen. Er schüttelte den Kopf, obwohl seine Augen leuchteten.
„Das geht nicht. Und das müsst ihr auch nicht“, sagte er in wenig überzeugendem Tonfall.
Nun schaltete sich auch Linnea ein. „Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis die Noah wieder seetüchtig ist. Und bis die Steinspalter mit den Elfen zurück ist, kommen die anderen sowieso nirgendwo hin“, meinte sie achselzuckend und erntete ein dankbares Lächeln von Hannah.
„Ich kann mir Schöneres vorstellen, als mit Ben und Matthäus allein übers Meer zu fahren. Euch beide dabeizuhaben, wäre echt toll“, murmelte Tuk.
Er senkte verlegen den Kopf und betrachtete seine Hände, die noch immer in Hannahs lagen. Hannah folgte seinem Blick und löste hastig ihren Griff.
Jedoch nur, um Linnea und Tuk jeweils einen Arm um die Schulter zu legen und zu sagen: „Dafür sind Freunde da.“
* * *
Hannah sah überhaupt nicht glücklich aus. Und so erstarb Linneas Hoffnung auf gute Nachrichten sofort, als sie die schwarze Lizardorin auf der Rampe erblickte. Hannah fing ihren Blick auf, während sie missmutig über die Holzplanken zum Pier hinunter stapfte. Sie schüttelte den Kopf und ihr weißblondes Haar, das sie heute offen trug, flatterte in wilden Strähnen umher. Als sie Linnea erreichte, streifte sie brummend ihre schwarzen Lederstiefel ab, ehe sie in die Hocke ging und sich neben Linnea an den Rand des Piers setzte. Ihre enormen Klauen ließ sie dabei neben Linneas nackten Füßen an der Kaimauer herabbaumeln.
„Die lassen mich nicht mitkommen.“
Linnea seufzte und senkte den Kopf. „Scheiße.“
Hannah blickte hinab auf die sanften Wogen, die wieder und wieder gegen den Stein unter ihnen schlugen, wobei keine Welle der anderen glich. „Bei dir drücken sie gerade noch ein Auge zu, weil du Kreuz ein kleines bisschen länger kennst. Aber ich hab‘ da keine Chance. Sie wollen nicht, dass die Gruppe sich zu sehr aufspaltet.“
„So ein Schwachsinn“, murmelte Linnea kopfschüttelnd.
„Du bringst ihn wieder zurück, ja? Er darf uns nicht verlassen!“
„Natürlich. Das war unser Plan, oder? Sag bloß, du wolltest ihn echt nur begleiten und dann Lebewohl sagen.“
„Selbstverständlich nicht! Ich wollte Tuk begleiten, um ihn unterwegs zum Bleiben zu überreden. Das musst du jetzt allein schaffen. Wir dürfen nicht zulassen, dass er all das verpasst.“
Linnea nickte zustimmend. „Er hat selbst gesagt, dass das hier das Größte ist, das er je erlebt hat. Er würde es ewig bereuen, jetzt zu gehen.“
Still saßen sie nebeneinander und betrachteten die Wellen, die Seevögel und die Hafenarbeiter, während die Gischt an ihren Füßen leckte.
Schließlich ergriff Hannah erneut das Wort. „Der Graf will mich sprechen. Er hat mich für morgen zu sich bestellt.“
„Oh. Warte … Unser Graf? Oder der andere Graf?“
Hannah schmunzelte. „Das ist echt verwirrend, oder? Der Graf von Wintertal.“
„Vielleicht sollten wir sie einfach nur noch Heroldstadt und Wintertal nennen“, schlug Linnea feixend vor.
Daraufhin konnten die beiden sich ein Kichern nicht verkneifen.
„Ich möchte mitkommen! Mann, ich werde das hier vermissen.“ Hannah seufzte.
Linnea wollte ihre Freundin aufmuntern und stieß ohne nachzudenken hervor: „Weißt du, wenn der Graf dich sprechen will, dann kann das nur was Gutes bedeuten.“
„Wie kommst du darauf?“
„Also, weil … “ Linnea spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Ihr Herz hämmerte heftig in ihrer Brust. „Er ist ein guter Mann. Das weiß ich“, sagte sie ausweichend.
Linnea hatte in den vergangenen Tagen häufig versucht, den Grafen von Wintertal einmal allein zu erwischen, um wenigstens ein paar Worte mit dem Mann zu wechseln, der in einem anderen Leben ihr Stiefvater gewesen war. Doch vergebens. Der Graf hatte andauernd Verabredungen und Verpflichtungen, die wichtiger waren.
Hannah legte den Kopf schräg und sah Linnea auffordernd an. Linnea biss sich auf die Lippe. In einem plötzlichen Anflug von Mut lockerte sich doch ihre Zunge und sie plapperte drauf los.
Allein zu Zweit
Die Äste der Bäume rund um das Lager im Wald ächzten und knarrten unaufhörlich unter der Last der Menschen, die über die Hängebrücken liefen oder sich an den Strickleitern emporhangelten. Blätter und Zweige am Waldboden waren inzwischen festgetreten und es zeichneten sich Trampelpfade ab, wo die Vogelfreien täglich ihre Runden drehten. Die stetigen stumpfen Schläge von Äxten und Beilen hallten durch das Lager, ab und an durchbrochen von Warnrufen, bevor ein weiterer Baum geschlagen das Haupt neigte und unter lautem Krachen zu Boden fiel. Mit dem Zuwachs an Geächteten wuchs auch die Anzahl der Tiere, sodass die provisorische Koppel rasch zu klein wurde. Die Pegasi wurden ohnehin längst auf einer zweiten Koppel untergebracht, doch die Geächteten besaßen inzwischen fast ein ganzes Dutzend Pferde, einiges an Federvieh und sogar eine Inselhorn-Kuh. Zwangsläufig mussten also Bäume gefällt werden – einerseits, um Platz zu schaffen und andererseits, um aus dem Holz vernünftige Zäune zu bauen.
Der Großteil der Männer und Frauen hatte gerade das Mittagessen beendet und war soeben zur täglichen Arbeit zurückgekehrt. Die meisten Männer waren mit der Erweiterung des Lagers und dem Bau der Koppel beschäftigt oder drehten als Wachposten ihre Runden durch den Wald. Ein Teil der Frauen räumte die Tafeln ab und machte sich daran, das Geschirr zu reinigen, während andere Frauen die Feuerstellen löschten und wieder andere die Planen der Zelte öffneten, um Felle und Laken auszuschütteln.
Marion kaute noch immer gedankenverloren auf den Resten ihres Schießfisches herum, bis sie allmählich registrierte, dass sich alle anderen bereits vom Tisch erhoben hatten. Sie spürte deutlich, dass ihr die Frauen besorgte Blicke zuwarfen, es aber offensichtlich nicht wagten, sie anzusprechen. Ohne den Kopf zu heben, stand Marion schließlich von der Holzbank auf und ergriff ihr Geschirr, das als Einziges noch auf dem Tisch lag. Sie hielt den Blick weiterhin gesenkt, während sie sich zögerlich zu den anderen Frauen gesellte. Doch die meiste Arbeit war schon getan und die Frauen machten ihr zügig Platz, um sich andere Aufgaben zu suchen.
Lediglich Robin und Sarah traten an ihre Seite und tauschten unsichere Blicke.
„Marion?“, fragte Robin zaghaft. „Möchtest du – “
„Ich mach schon“, erwiderte Marion und schob sich an den beiden vorbei, ohne sie anzusehen.
Ihr Empfindungsvermögen war in den letzten Tagen so sehr abgestumpft, dass sie gar nicht bemerkte, ob sie jemanden verletzte. Hatte Robin sie eben an der Schulter berührt? Marion fühlte nichts, also fuhr sie damit fort, Löffel und Messer mit Sand zu säubern. Es war ihr gleichgültig, dass sich die beiden Frauen mit hängenden Schultern entfernten.
Nachdem sie das Besteck beiseitegelegt hatte, fiel ihr Blick auf ihren hölzernen Teller und sie seufzte leise. Mehr als die Hälfte des Schießfisches lag noch darauf und starrte sie mit trüben, vorwurfsvollen Augen an. Daneben lagen zwei Kartoffeln und eine halbe Donnerknolle. Stillschweigend zog sie ein altes Leinentuch aus der Tasche, an dem noch die Reste vom Frühstück klebten und begann ihr Abendessen darin einzuwickeln.
Nachts kaum mehr schlafen zu können, daran hatte sich Marion inzwischen gewöhnt. Doch tagsüber fiel es ihr schwer, sich zu konzentrieren und zu viele Menschen um sie herum machten sie nervös. Sie hatte oft das Gefühl, eingeengt zu sein und konnte kaum atmen, wenn sie von den Geächteten umringt war. Während der Mahlzeiten war es ganz besonders schlimm. Deshalb rührte sie ihr Essen kaum an und stahl sich immer häufiger mit den Resten davon, um im Wald ihre Ruhe zu haben.
Nicht weit entfernt hörte sie ein fröhliches Lachen. Unwillkürlich blickte Marion auf. Robin und William lagen Arm in Arm im Gras und Robin kicherte. Marion senkte rasch den Kopf und beeilte sich, endlich weg zu kommen. Doch es war zu spät – in ihren Gedanken war ein Bild entstanden. Sie sah sich selbst, wie sie ihren Vater umarmte, ebenso kichernd wie Robin. Marion fragte sich, wann er sie zuletzt im Arm gehalten hatte, doch sie konnte sich nicht entsinnen. Wenn sie es sich vorstellte, war sie stets ein kleines Mädchen und ihr Vater kein gebeugter ergrauter Mann, sondern ein stattlicher Graf.
Doch auch das Leben als einfache Gutsherren, das sie zuletzt geführt hatten, war gut gewesen. Alles hatte sich richtig angefühlt. Marion hatte seit Langem wieder eine echte Familie gehabt. Wenn Grau sie doch bloß nie auf seine Burg bestellt hätte … Marion zerbrach sich wieder und wieder den Kopf darüber. Der Graf von Ruder hätte sie einfach in Ruhe lassen sollen. Sie wären keine Gefahr gewesen. Doch Grau wollte sie aus dem Weg haben und das war ihm gelungen. Nun war Marions Leben ein einziger Scherbenhaufen.
Marion schniefte und rieb sich mit den Fingerknöcheln die feuchten Augen. Hastig schnürte sie das Essen ein, um den traurigen Blick des Schießfisches nicht mehr ertragen zu müssen. Dann schob sie den in das Tuch eingepackten Fisch in eine Innentasche ihres Kleides und prüfte, ob der Trinkschlauch an ihrem Gürtel noch voll war.
Diese Augen gingen ihr nicht aus dem Kopf. Sie sah die dunklen Augen ihres Vaters vor sich, der sie anstarrte wie der Fisch. Nein, nicht die ihres Vaters. Diese waren dunkler. Die Augen ihres Vaters waren nicht so schwarz. Nicht so wie die des Mannes, den sie getötet hatte.
Energisch schüttelte sie den Kopf und kehrte Robin und William den Rücken. Dann stapfte sie über das weiche Gras in den Wald hinein, der sie nach nur wenigen Schritten in seinem sanften dunklen Grün verschluckte.
* * *
Die beruhigende Idylle des Waldes legte sich über Marion und sie fühlte sich augenblicklich besser. Mit jedem Schritt schien mehr von der Last auf ihrem Herzen abzufallen und je weiter sie sich vom Lager der Geächteten entfernte, desto freier konnte sie atmen. Nach kurzer Zeit hatte sie auch die Wachposten hinter sich gelassen, die um das Lager Patrouille liefen.
Marion schloss die Augen und atmete tief ein. Dabei sog sie den frischen Duft von Eselskraut und Rinde genussvoll ein und konzentrierte sich einen Moment lang bewusst auf all ihre Sinne. Sie lauschte den Geräuschen des Waldes, genoss den Duft der Bäume, spürte Erde und Wurzeln durch die Sandalen an den Zehen und schmeckte zu ihrem Bedauern noch immer den Schießfisch auf der Zunge.
Nach einer Weile setzte sie sich wieder in Bewegung und schlenderte einen mit zertretenen Sträuchern überwucherten Trampelpfad entlang – bis schließlich sanftes Wasserplätschern an ihre Ohren drang.
Als der Pfad eine Kurve nach links machte, ging Marion langsamer. Bedacht setzte sie einen Fuß vor den anderen und trat an die Stelle, wo der Weg seine Biegung machte. Zu ihren Füßen gähnte ein Abgrund von mindestens 100 Schritt Tiefe. Der Waldboden wich nacktem Fels, der lediglich starken Kletterpflanzen Halt bot. Knallrotes Flammenblatt spross aus zahlreichen Felsspalten und hing wie ein roter Vorhang hinab bis zur Wasseroberfläche. Der Bach, der sich tief unten zwischen den Felsen hindurchschlängelte, reflektierte die Farbe und wirkte daher wie ein roter Strom.
Marion wandte sich schließlich nach links und damit bergan, wo der Weg parallel zur Schlucht dem Fluss folgte. Je höher Marion gelangte, desto tiefer wirkte der Abgrund unter ihr – inzwischen waren es fast 200 Schritt. Irgendwann verbreiterte sich die Schlucht und das Plätschern des Wassers wurde zu einem Rauschen.
In einer weiteren Biegung erhaschte sie zwischen den kargen Bäumen einen ersten Blick auf ihr Ziel. Der Pfad stieg noch ein ganzes Stück weiter an, fast bis zur Spitze des Hügels. Auf der anderen Seite der Schlucht erhob sich ein identischer Hügel, an dessen Spitze ebenfalls ein Weg in den Wald hineinführte. Eine schmale Brücke verband die beiden Hügel miteinander. Marion hatte diesen Anblick in den letzten Tagen häufig genossen. Dennoch raubte er ihr stets aufs Neue den Atem.
Zwischen den beiden bewaldeten Hügeln schossen in ungeheurer Geschwindigkeit die rot glitzernden Wassermassen hervor, die Gischt spritzte hoch und benetzte das unnachgiebige Flammenblatt, das sich verbissen an die Felsen klammerte. Die Brücke, die sich über den gefährlichen Abgrund spannte, war nur eine einfach Holzkonstruktion mit dicken Halteseilen als Geländer. Marion hatte sich zu Anfang davor gefürchtet, sie zu betreten. Doch mit der Zeit gewöhnte sie sich an das Schwanken und streckte die Hände nur noch ab und zu nach den Seilen aus.
Das Holz ächzte unter Marions Gewicht, während sie behutsam einen Fuß vor den anderen setzte. Zwischen den dunklen Brettern klafften kleinere und größere Lücken, durch die sie den Abgrund und den roten Fluss blitzen sah. Marion überquerte die Brücke, hielt jedoch inne, bevor sie die andere Seite erreichte. Wie so oft zog sie die Tiefe magisch an. Marion trat an den Rand und streckte beide Hände nach dem Geländer aus. Das raue Seil fest umklammernd, lehnte sie sich nach vorn und blickte hinunter.
Ihr Herz flatterte und ihr wurde flau im Magen, als sie die Wassermassen betrachtete, die sich unaufhörlich ihren Weg durch die Schlucht bahnten. Gleichzeitig spürte sie auf einmal das Verlangen, dort unten zu sein. Sie fragte sich, wie es wohl wäre, hinunter zu stürzen. Es war so tief. Sicher würde sie eine Ewigkeit fallen.
Plötzlich sah sie wieder die dunklen Augen jenes Mannes vor sich. Tiefgründig waren sie. Marion erinnerte sich, wie sie zum letzten Mal in diese Augen geblickt hatte.
„Wie hat es sich angefühlt, zu fallen?“, fragte sie unvermittelt in das Tosen.
Ein wohliger Schauer durchfuhr ihren Körper, als er tatsächlich antwortete: „Es war grauenvoll. Ich könnte davon erzählen, wie befreiend es sich anfühlt, den Wind zu spüren. Oder dass ich mein Leben an mir vorbeiziehen sah. Aber das ist völliger Schwachsinn. Der einzige Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war die Tatsache, dass ich unaufhaltsam auf den Tod zurase. Glaub mir, Marion. Das willst du nicht.“ Seine Worte waren voller Bitterkeit, doch Marion badete im Klang seiner Stimme.
„Halt mich fest, Hagelchen“, flüsterte sie voller Sehnsucht, ohne sich umzudrehen.
Im nächsten Moment schlang er seine in schwarzes Leder gekleideten Arme um sie und zog sie vom Geländer weg. Marion ließ zu, dass er sie fest an sich drückte. Sie seufzte, schloss die Augen und ließ ihren Kopf gegen seine Schulter fallen. Dann hob sie eine Hand und strich ihm sanft über die muskulösen Oberarme, die seine Kleidung wunderbar betonte.
Eine ganze Weile genoss Marion seine Wärme, die sie umschloss, spürte seinen heißen Atem an ihrem Hals, lauschte dem Rauschen des Wassers. Sie wünschte, dieser Augenblick würde niemals enden.
Marions Stimme hob sich kaum über das Brausen hinweg, als sie sagte: „Es tut mir leid, dass ich dich getötet habe.“
„Warum sagst du das? Es ändert nichts. Diese Momente gehören uns.“
Marion nickte trübselig und lehnte sich wieder gegen Hagel, der sie fester drückte.
Auf einmal lockerte er seinen Griff und zischte warnend: „Da kommt jemand!“
Tatsächlich spürte Marion, wie die Brücke leicht vibrierte.
Protestierend drehte sie sich zu ihm um, wollte ihn wieder zu sich heran ziehen – doch Hagelchen hatte sich aufgelöst wie eine Fata Morgana.
„Marion?“, fragte stattdessen eine andere Stimme, zaghafter und vorsichtiger.
Späher stand am Rand der Brücke und kam mit zögerlichen Schritten auf sie zu. Das Holz unter ihren Füßen erzitterte erneut.
„Was tust du hier? Ich mach- wir machen uns Gedanken.“
„Das müsst ihr nicht“, antwortete Marion, die noch immer abwesend auf die Stelle starrte, wo der Freiherr eben verschwunden war. „Mir geht’s gut.“
Weil Marion ihn nicht ansah, wagte Späher es offensichtlich nicht, näher zu kommen. Er rang die Hände und suchte wohl nach den richtigen Worten.
„Gut. Das … ist gut. Also … “ Er verstummte und setzte erneut an: „Marion. Da gibt es etwas … Ich hätte es dir von Anfang an erzählen sollen. Es gab eigentlich keinen Grund, dir nicht zu vertrauen, aber – “
Doch Marion unterbrach ihn gereizt: „Du musst nichts sagen. Ich weiß, du machst dir Sorgen.“
Späher, offenkundig vor den Kopf gestoßen, stammelte:
„Das war eigentlich nicht das, was ich – “
„Ist schon gut“, fiel sie ihm abermals ins Wort. „Aber weißt du, wenn das wahr ist, dann bitte: Lass mir Zeit. Es ist viel geschehen. Die Zeit allein tut mir gut. Lass mir bitte meine Ruhe.“
Späher blinzelte und vertrieb damit den gekränkten Ausdruck in seinen türkisgrünen Augen, den Marion gar nicht bemerkt hatte. Dann nickte er verstehend und wandte sich zum Gehen. Doch bevor er auch nur einen Schritt getan hatte, fuhr er erneut herum und trat nun doch mit entschlossener Miene auf sie zu.
„Es tut mir leid, dass wir deinen Vater nicht retten konnten. Die Entscheidung, zu fliehen … sie ist mir unendlich schwergefallen. Wir hatten vor, ihn am nächsten Morgen zu befreien. Aber sie haben ihn an den Pranger gestellt und da waren so viele Leute. Es gab kein Durchkommen. Es tut mir leid.“
Marion atmete zitternd ein. Das hatte sie nicht erwartet.
„Ihr habt getan, was möglich war. Ich weiß, dass mein Vater auch dir sehr viel bedeutet hat“, brachte sie schließlich hervor und bemühte sich, ihre Stimme sanfter klingen zu lassen.
Späher nickte dankbar, bevor er ergänzte: „Weißt du, ich hab‘ mit ihm gesprochen. Im Verließ. Bevor sie ihn an den Pranger gestellt haben … konnte ich noch ein paar Worte mit ihm wechseln.“
„Wirklich?“, fragte Marion und hatte nun zum ersten Mal wieder Interesse daran, eine Unterhaltung mit jemand anderem als Hagelchen zu führen.
Späher lächelte, ergriff ihre Hand und drückte sie sanft.
„Er ist stolz auf dich. Das hat er mir gesagt. Stolz auf die Frau, zu der du geworden bist.“
Marion war seine Berührung zuerst unangenehm, denn für einen absurden Moment fürchtete sie, Hagel könnte sie sehen. Doch als Späher von diesen letzten Worten ihres Vaters erzählte, hoben sich ihre Mundwinkel für ein schwaches Lächeln und sie umfasste mit beiden Händen die seinen.
Dann fragte sie mit bebenden Lippen:
„Was hat er noch gesagt?“
„Zum Großteil hat er mich belehrt und mir eingeschärft, auf dich aufzupassen und dich auf keinen Fall mit hineinzuziehen in meinen … Wie hat er es genannt? Konflikt mit dem Adel.“ Späher grinste makaber. „Das hat wohl nicht geklappt. Er wollte Grau zwar genauso gern beseitigen wie wir, aber er hat mir geraten, eine andere Richtung einzuschlagen. Der einzige Weg, um Markt Ruder wirklich zu befreien, ist der politische Weg.“
Marion hob eine Augenbraue. „Wie hat er das gemeint?“
„Sicher können wir dem Grafen weiter die Stirn bieten und ihm ab und zu einen Denkzettel verpassen, um ihn auf Trab zu halten. Das wird den Menschen auch weiterhin Hoffnung geben. Aber um Grau durch einen guten und gerechten Grafen zu ersetzen und Markt Ruder von seinem Elend zu befreien, müssen wir auf politischer Ebene handeln. Das ist etwas, worüber ich mit dir reden will. Wir brauchen den König auf unserer Seite. Grau zu töten würde nur dazu führen, dass sein Platz von einem anderen herrischen Idioten eingenommen wird.“
Marion seufzte tief. „Es war dumm von mir, ihn ermorden zu wollen.“
Späher schüttelte den Kopf und zog sie mit seinen Händen ein wenig zu sich heran. „Ich kann dich gut verstehen. Du wolltest Gerechtigkeit.“
„Ich wollte Rache. Ihr habt mich aus der Burg gerettet. Zweimal. Und ich Dummkopf gehe einfach wieder zurück und bringe euch dadurch alle in Gefahr. Also musstet ihr mich sogar dreimal da rausholen“, sagte Marion und senkte betreten den Kopf.
„Du hast ihn aber nicht umgebracht. Und wir sind alle heil da rausgekommen.“
Seine letzten Worte versetzten Marion einen heftigen Stich. „Nicht alle“, sagte sie und presste die Kiefer aufeinander, um ihre Lippen vom Zittern abzuhalten.
Späher schnaubte und ließ abrupt ihre Hände los. „Ich bin kein Mörder. Und du bist es auch nicht. Aber wir können es nicht ungeschehen machen“, sagte er nüchtern.
Er sprach es nicht aus, doch Marion las zwischen den Zeilen und verstand den versteckten Vorwurf. Komm‘ endlich drüber hinweg. Das sagten seine Augen, während er sprach.
„Ich sagte, ich brauche Zeit“, stieß Marion in ungewollt scharfem Tonfall hervor.
Späher nickte knapp und diesmal spürte Marion deutlich, dass sie ihn verletzt hatte. „Ich wollte … nur nach dir sehen“, murmelte er und wandte sich zum Gehen.
Marion war versucht, ihm zu danken, ihn an der Schulter zu berühren, ihn irgendwie zu trösten – doch das Gefühl, dass Hagelchen dies sehen und missbilligen könnte, war stärker.
Am anderen Ende der Brücke angekommen, straffte Späher die Schultern, bevor er mit seltsam tonloser Stimme sagte: „Wenn du einmal reden möchtest … Marion, ich bin ein guter Zuhörer.“
Sie setzte zu einer Erwiderung an, doch der Kloß in ihrem Hals erstickte die Worte, ehe sie sie aussprechen konnte. Ein schlechtes Gewissen überkam sie und schnürte ihr die Kehle zu.
Schließlich ermahnte er sie noch: „Pass‘ auf dich auf, besonders wenn es dunkel wird. Es ist gerade nicht ungefährlich im Wald.“
Marion presste mit großer Mühe ein kläglich leises „Danke“ hervor, bevor Späher zwischen den Bäumen verschwand. Mit hängenden Schultern lehnte sich Marion gegen das dicke Seil, das als Brückengeländer diente. Ihr war elend zumute.
„Er hat Recht. Du solltest nicht so oft zu mir kommen.“
Der Freiherr von Hagel stand nur wenige Schritte entfernt am Rand der Brücke, zwischen den langen Schatten, den die Bäume im Licht der untergehenden Sonne warfen. Der besorgte Ausdruck in seinen schwarzen Augen gefiel ihr nicht. Trotzdem war sie erleichtert, dass er wieder da war. Raschen Schrittes ging sie zu ihm.
„Aber du brauchst mich doch“, sagte sie. Stets war Hagel es gewesen, der sich nach ihrer Aufmerksamkeit und Liebe gesehnt hatte. Und nun war sie es, die ihn nicht loslassen konnte.
Das Knarren seiner Kleidung und der vertraute, ledrige Geruch lösten ein wohliges Gefühl der Geborgenheit in Marion aus, als er sie in seine starken Arme schloss. Sanft strich er ihr über das lange dunkle Haar und wandte ein:
„Ich könnte auch im Lager bei dir sein. Du musst es nur wollen. Ich könnte in deinem Zelt bleiben und wann immer du Sehnsucht hast …“
„Das geht doch nicht. Wenn ich den halben Tag nur in meinem Zelt bin, werden sich alle fragen, was ich da mache. Das wäre noch auffälliger als meine Waldspaziergänge“, widersprach Marion, den Kopf an seine Brust gelehnt. „Und wenn jemand hört, wie ich mit dir rede …“
„Nur reden?“, fragte Hagel gespielt empört.
Forsch umfasste er mit einem Arm ihre Hüften und zog sie so dicht zu sich heran, dass sie jeden Teil seines Körpers durch seine enge schwarze Lederkleidung fühlen konnte. Mit der freien Hand hob er ihr Kinn an, sodass sie ihn ansehen musste. Das Verlangen in seinen Augen war genauso stark wie ihres, das sie in diesem Augenblick mehr denn je spürte. Sie sehnte sich so unendlich nach ihm. Seine Lippen waren so nah. Endlich zog er sie ganz an sich, sodass sie die kurze Distanz überbrücken und seine Lippen erreichen konnte. Ihr Mund presste sich hart auf seinen und sie küssten sich leidenschaftlich. Doch ihren Körper verlangte es nach mehr.
„Ich werde mir etwas überlegen. Damit wir zusammen sein können“, hauchte sie und strich mit den Lippen über die dunklen Bartstoppeln auf seiner Wange. Sie spürte sein Lächeln. „Aber bis dahin …“
„Bis dahin darfst du nicht mehr so häufig hierher kommen.“
„Aber – “
„Integriere dich mehr im Lager. Rede mit den Leuten. Sie werden dich am Ehesten in Ruhe lassen, wenn sie sich nicht ständig um dich sorgen müssen.“
Marion verzog das Gesicht. „Das ist ekelhaft fürsorglich von dir.“
Hagel lachte auf. Er drückte sie fest und küsste sie noch einmal. Dann schob er sie entschieden von sich.
Sie versuchte sich zu erinnern, wann sie das letzte Mal in ihrem Dirnenzelt mit ihm geschlafen hatte. Damals hatte sie noch mit Tia das Zelt geteilt. Es musste kurz vor jenem schicksalhaften Abend gewesen sein, als sie Tia dabei geholfen hatte, das Attentat auf Hagel zu verüben. Ihre Freundin war anschließend geflohen und sie hatte sie seither nie wieder gesehen.
Widerstrebend löste sie sich von ihm und betrat die Brücke, als Hagel zum Abschied sagte: „Vergiss nicht, ich kann jederzeit bei dir sein, wenn du es willst.“





























