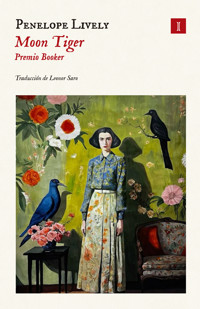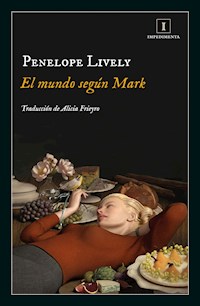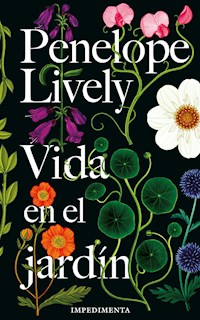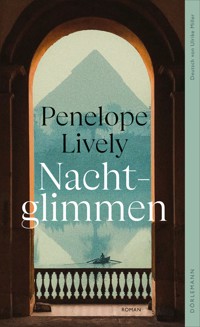
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Claudia Hampton war Kriegsreporterin, sie ist Schriftstellerin und Historikerin. Eine kluge und selbstbewusste Frau, berühmt, in ständiger intellektueller Auseinandersetzung mit ihrer Umgebung und sich selbst. Jetzt, todkrank in einem Krankenhausbett, blickt sie zurück. Persönliche Erinnerungen gehen nahtlos über in politische Ereignisse. Sie erzählt von einer Kindheit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. Alles in ihrem Leben ist Gegenwart: Kindheit und Krieg, Ägypten und England, die ganze Welt und ihre Vergangenheit. Aber Claudias Geschichte ist auch mit anderen verwoben, und sie muss denen, die sie kannten und liebten, die Möglichkeit geben, zu sprechen. Da ist Gordon, ihr Bruder und Rivale. Jasper, ihr unzuverlässiger Liebhaber und Vater von Lisa, Claudias kühler, konventioneller Tochter. Und dann ist da noch Tom, ihre einzige große Liebe, und jener tragische Zwischenfall in der Wüste. »Was mich interessiert, ist das Gedächtnis, die Art und Weise, wie Menschen und Landschaften aus Erinnerungen zusammengesetzt sind«, schreibt Penelope Lively. Und darum geht es in Nachtglimmen: Die ganze Welt steckt voller Erinnerungen, die Vergangenheit ist allgegenwärtig – man muss nur, wie Claudia Hampton, bereit sein, die Augen zu öffnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Penelope Lively
Nachtglimmen
Roman
Aus dem britischen Englisch von Ulrike Miller
Dörlemann
Vorwort
Penelope Livelys außergewöhnlicher, mit dem Booker Prize ausgezeichneter Roman Nachtglimmen fesselt von der ersten Zeile an. »Ich schreibe eine Geschichte der Welt«, sagt die Hauptfigur. »Und während sie sich entfaltet: meine eigene.« Ich erinnere mich noch daran, wie ich diesen eindrucksvollen Anfang zum ersten Mal las – das ist inzwischen viele Jahre her – und dann innehielt und darüber nachdachte, wie unerwartet diese Sätze aus dem Mund einer Frau waren. Eine alte, kranke, sterbende Frau ist die letzte Person, der man eine so kühne Behauptung zutrauen würde. »Mich selbst will ich ins Auge fassen, in meinem Kontext: alles und nichts.«
Auch wenn es in unserer Gesellschaft selten laut ausgesprochen wird, die Wahrheit ist: Wir sind es nicht gewohnt, dass Frauen den Anspruch erheben, für die gesamte Menschheit zu sprechen, dass sie das Persönliche und das Kollektive mit so viel Selbstbewusstsein so untrennbar miteinander verknüpfen. Genau genommen sind wir das Gegenteil gewohnt: Die Erinnerungen von Frauen sollen in ihren eigenen Schubladen bleiben, verschlossen und verriegelt, klar getrennt von der großen Weltgeschichte, die hauptsächlich als männliche Geschichte verfasst und erinnert wurde und wird.
Die französische Philosophin, Schriftstellerin und Feministin Simone de Beauvoir verstarb 1986, nur ein Jahr vor dem Erscheinen von Nachtglimmen. Ich frage mich, was de Beauvoir wohl von Penelope Livelys Meisterwerk gehalten hätte, wenn sie die Gelegenheit gehabt hätte, es zu lesen. Ich glaube, sie wäre begeistert gewesen. De Beauvoir versuchte, die dualistischen Denkmuster aufzuzeigen, auf die sich das Patriarchat maßgeblich stützt. Sie legte dar, wie Männer sich zum Essenziellen, zum »Subjekt« erklärt haben und aus dieser Rolle heraus allgemeingültige Narrative erzählen, während Frauen nur aus ihrer partiellen, subjektiven Perspektive heraus sprechen können. Die bedeutende Literaturkritikerin Toril Moi hat diese Problematik weitergedacht: Von Frauen, schreibt sie, erwarte man nicht, dass sie »mit einem Anspruch auf Universalität sprechen, mit der vermessenen Forderung, dass man mit ihnen übereinstimmt – ein Recht, das Männer seit Jahrhunderten als selbstverständlich annehmen.« Diesen tief verwurzelten Gegensatz bringt Penelope Lively schon mit ihren ersten Zeilen ins Wanken.
Indem sie die unvergessliche Protagonistin Claudia Hampton erschuf und ins Zentrum ihrer Erzählung rückte, hat Lively mehrere Konventionen gleichzeitig gebrochen. Claudia ist intelligent, meinungsstark, leidenschaftlich selbstständig, zeitweise unnahbar, oft aber auch überraschend verletzlich und damit eine einnehmende, wenn auch komplexe Figur. Die Historikerin und ehemalige Kriegsberichterstatterin hat Geschichte nicht nur studiert, sie hat Geschichte gelebt. »War sie jemand Besonderes?«, fragt eine der Krankenschwestern. Und sie war tatsächlich jemand Besonderes. Forscherin, Zweiflerin, Beobachterin, Entdeckerin … Tochter, Schwester, Mutter, Geliebte … sie war eine »Myriade von Claudias«. Jetzt, im hohen Alter, liegt sie in einem Krankenhausbett und denkt über ihr langes, ereignisreiches Leben und die Welt ringsherum nach, und wir, ihre Leser*innen, begeben uns auf eine faszinierende Reise, die Geschichte, Erinnerung und Memoiren vereint. Persönliche Erinnerungen verschmelzen nahtlos mit umfassenderen politischen, sozialen und kulturellen Ereignissen. Nahtlos, nicht aber chronologisch. Unser Gedächtnis ist weder linear noch statisch, die Vergangenheit keine schnurgerade Abfolge von Zwischenfällen und Daten. Der Roman pendelt, analog zur nicht-chronologischen Funktionsweise menschlicher Erinnerungen, zwischen einer subjektiven und einer allwissenden Perspektive. Sich so weit von den traditionellen Normen des Romans zu entfernen, ist kein geringes Risiko, und wir sind dankbar, dass Lively es eingegangen ist, um diese ihr eigene Struktur zu entwerfen. Nachtglimmen ist wie Wasser: Es fließt gleichzeitig in verschiedene Richtungen, ohne je den Fokus oder Rhythmus zu verlieren. Der Roman empfängt die Feinheiten des Lebens mit offenen Armen, akzeptiert und ehrt seine Mehrstimmigkeit auf eine Art, wie nur großartige Literatur es vermag. »Die Stimme der Geschichte ist selbstverständlich eine vielfältige. Viele Stimmen, all die Stimmen, denen es gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen … Meine Geschichte ist mit den Geschichten anderer Menschen verstrickt.«
Das erste Mal habe ich Nachtglimmen damals in Istanbul gelesen, als junge aufstrebende Schriftstellerin, das zweite Mal erst kürzlich für dieses Vorwort. Ich war beeindruckt, wie lebhaft ich mich noch an den Roman erinnern konnte, obwohl so viel Zeit verstrichen war. Manche Bücher lesen wir mit Freude und legen sie dann irgendwo irgendwie sanft wieder beiseite. In andere Bücher verlieben wir uns und spüren, dass sie etwas in uns in Bewegung gesetzt haben. Diese Art Buch bleibt für immer ein Teil von uns. Nachtglimmen wird mich mein Leben lang begleiten.
Die Figur Claudia ist so komplex entworfen, dass sie die kaleidoskopische Natur der Weltgeschichte selbst aufgreift und widerspiegelt. Darin besteht Penelope Livelys Geniestreich. Claudia vereint eine Vielzahl von Eigenschaften in sich, die teilweise bewundernswert sind, teilweise nicht einfach wertzuschätzen; sie verkörpert, in unterschiedlichem Maße, Gutes und Schlechtes – wie wir alle. Claudia lässt sich unmöglich auf einen roten Faden oder ein Adjektiv reduzieren, sondern ist zutiefst menschlich. Während sie erzählt, erinnert sie sich pausenlos. Aber sind Erinnerungen verlässlich? Können sie je vollständig sein? »Bei jedem Schütteln des Kaleidoskops abwarten, was sich dabei ergibt.«
Einige Literaturkritiker*innen haben den Roman als »experimentell« bezeichnet. Ich würde Livelys Umgang mit Form jedoch weniger als experimentell beschreiben – vielmehr spiegelt sich in der Form des Romans sein Sujet wider. Geschichte ist mehrstimmig und erzählt außerdem vieles durch Schweigen – das Schweigen der Vergessenen, der Ausgelöschten. Indem Lively wechselnde Perspektiven, willkürliche Zufälle und »Was wäre, wenn …?«-Fragen in den Fokus rückt, fängt Nachtglimmen sowohl die Vergangenheit als auch deren Schweigen ein. Wenn alles, was wir als Gesellschaft als gegeben annehmen, in Bewegung gerät, dient die Erzählkunst als gemeinsamer Anker, als Verbindung zwischen uns allen. »Die Macht der Sprache. Sie bewahrt das Flüchtige – verleiht Träumen Gestalt, Sonnenstrahlen Dauer.« Die Erzählung wechselt zwischen Vergangenheitsform und Präsens ab. So entsteht ein höchst feines, vielschichtiges Narrativ. Es handelt sich dabei keineswegs um ein Mosaik oder eine Collage, bei denen jedes Teil seinen festen Platz hat. Nachtglimmen erinnert mich eher an türkische Ebru-Kunst – »Malen auf Wasser« –, bei der Farbpigmente in Wasser getropft werden und darin anfangen zu tanzen, sodass eigene Muster und Motive entstehen.
Poetisch, sinnlich und philosophisch zugleich schreckt Lively auch vor den rauen Realitäten der Politik nicht zurück. Doch selbst über die dunkelsten Kapitel der menschlichen Geschichte schreibt sie voll tiefem Mitgefühl und Weisheit, voller Bewusstsein für Claudias Schmerz, Leid und Verlust – sowie auch für Schmerz, Leid und Verlust der anderen: »Mutter, Gordon, Jasper, Lisa … Vater starb an der Somme«, und die sanfte, wohlmeinende Mutter »zog sich aus der Geschichte zurück«. Im Gesicht ihres Bruders Gordon spiegelt sich, auf schaurige Weise, immer das ihre. Die rührendsten Passagen des Romans handeln von Tom Southern, dem britischen Panzerkommandanten, den Claudia geliebt hat. Vor dem Krieg las Tom mit Leidenschaft Geschichtsbücher, dann hörte er damit auf. »Wenn alles aus dem Geleis ist, dann wird man unangenehm darauf gestoßen, dass Geschichte wahr ist und dass man selbst leider ein Teil von ihr ist.«
Nachtglimmen ist reich an solch brillanten Sätzen, die man immer und immer wieder lesen möchte. Wie die Unterströmung eines Flusses durchzieht das Buch ein bewusster Pazifismus. Claudia, eine Agnostikerin aus Instinkt, sagt: »Kriege werden von Kindern geführt. Von ihren verrückten, dämonischen Eltern ausgeheckt und dann von Jungen geführt.« Wenige Schriftsteller*innen können die existenzielle Angst, die eine sich rasch verändernde Welt mit sich bringt, mit so viel Tiefgang einfangen; den Moment, an dem wir aufhören, Geschichte als etwas zu betrachten, was irgendwann anders passiert ist, und begreifen, dass wir mittendrin sind, während sich Geschichte abspielt: hier und jetzt. In der kaputten Welt von heute ist Nachtglimmen noch ebenso relevant und allgemeingültig wie zum Zeitpunkt seiner Entstehung.
Literatur hilft uns, Nuancen wahrzunehmen, die Zerbrechlichkeit und Widerstandsfähigkeit der menschlichen Existenz zu begreifen, ebenso wie die Flüchtigkeit der Zeit, bei Lively symbolisiert durch die Asche, die sich sammelt, während der Moon Tiger langsam verbrennt. In diesem Buch stecken – zwischen Kairo zu Kriegszeiten und ländlichem England – ein enormer Rechercheaufwand und jede Menge Lebenserfahrung. Nachtglimmen ist Penelope Livelys siebter Roman. Er setzte sich im Jahr seiner Ehrung mit dem Booker Prize gegen eine sehr starke Shortlist durch, gegen Chinua Achebe, Iris Murdoch, Peter Ackroyd, Nina Bawden und Brian Moore. 2018 war er außerdem für den Golden Man Booker Prize nominiert, eine einmalige Auszeichnung für die fünf besten Romane aus der fünf Jahrzehnte langen Geschichte des Preises. Es ist einer der besten Romane der Weltliteratur. Im Gegensatz zu den Leser*innen, die Nachtglimmen von Anfang an für seine Differenziertheit und Livelys meisterhaftes Handwerkszeug hoch schätzten, wurde der Roman von der Kritik teils mit herablassendem und gönnerhaftem Blick betrachtet. Ob er von denselben Stimmen wohl wertschätzender besprochen und seine Universalität mehr anerkannt worden wäre, würde er aus der Feder eines Mannes stammen? Aber das Positive an großartigen Romanen von Frauen ist, dass sie das sexistische und elitäre Denken ihrer Kritiker*innen überdauern. Darauf kann man sich verlassen. Nachtglimmen ist das hervorragend geschriebene, höchst atmosphärische und zeitlose Buch einer Autorin, die die Kunst des Geschichtenerzählens perfektioniert hat.
Elif Shafak, 2024
1
»Ich schreibe eine Geschichte der Welt«, sagt sie. Und die Hände der Schwester halten einen Moment inne; sie schaut auf diese alte Frau, diese alte kranke Frau. »Ach, du meine Güte«, sagt die Schwester. »Das wird ja dann wohl ein ziemlicher Brocken, oder?« Und dann macht sie weiter, zupft und stopft und glättet – »So, ein bisschen hoch, meine Liebe, so ist’s brav – dann bekommen wir gleich eine Tasse Tee.«
Eine Geschichte der Welt. Um alles abzurunden. Warum auch nicht – kein Kleinkram mehr über Napoleon, Tito, die Schlacht von Edgehill, Hernando Cortez … Dieses Mal kommt alles auf den Tisch. Der ganze glanzvolle, mörderische, unaufhaltbare Katarakt – aus dem Dreck zu den Sternen, im Allgemeinen und im Besonderen, eure Geschichte und meine. Ich bin dafür gut gerüstet; Eklektizismus war immer schon mein Markenzeichen. Das hat man jedenfalls gesagt, auch wenn das Kind einen anderen Namen hatte. Claudia Hampton hat sich wieder etwas Ehrgeiziges vorgenommen, man könnte es auch anmaßend nennen: Das sagen meine Feinde. Miss Hamptons kühner konzeptioneller Schwung: meine Freunde.
Eine Geschichte der Welt, ja. Und während sie sich entfaltet: meine eigene. Leben und Zeit der Claudia H. Das Stück aus dem zwanzigsten Jahrhundert, mit dem ich wohl oder übel verkettet bin, ob mir das passt oder nicht. Mich selbst will ich ins Auge fassen, in meinem Kontext: alles und nichts. Die Geschichte der Welt, wie Claudia sie sieht: Fakten und Erfindungen, Mythen und Offenkundiges, Bilder und Belege.
»War sie jemand Besonderes?«, fragt die Schwester. Ihre Schuhe quietschen auf dem glänzenden Boden; die Schuhe des Arztes knarren. »Also, nach dem, was sie so sagt …« Und der Arzt schaut in seine Notizen und sagt, dass sie wohl doch etwas aus dem Rahmen gefallen zu sein scheint, offensichtlich hat sie Bücher und Zeitungsartikel geschrieben und … ähm … war einige Zeit im Nahen Osten … Typhus, Malaria … nicht verheiratet (eine Fehlgeburt, ein Kind, das sieht er, erwähnt es aber nicht) … aus den Aufzeichnungen lässt sich schon entnehmen, dass sie jemand Besonderes war, wahrscheinlich.
Eine Menge Leute würden es als typisch hinstellen, dass ich von vornherein mein Leben mit der Geschichte der Welt verbinde. Sollen sie. Ich hatte immer schon meine Anhänger, doch, auch die. Meine Leser kennen das natürlich schon, sie wissen, wie der Hase läuft. Ich werde alles Erzählerische fortlassen. Anreichern werde ich das Ganze, Leben und Farbe dazugeben, die Schreie und auch die Rhetorik. Oh, ich werde ihnen nichts ersparen. Die Frage ist nur: Soll es eine lineare Geschichte sein oder nicht? Ich fand immer, dass eine kaleidoskopische Sicht eine interessante Häresie sein könnte. Bei jedem Schütteln des Kaleidoskops abwarten, was sich dabei ergibt. Chronologie verwirrt mich. In meinem Kopf gibt es keine Chronologie. Ich bin aus einer Myriade von Claudias zusammengesetzt, die sich drehen und verbinden und auseinanderdriften wie funkelndes Sonnenlicht auf dem Wasser. Das Kartenspiel, das ich verwende, wird immer wieder ganz und gar durchgemischt; es gibt keine feste Abfolge, alles geschieht gleichzeitig. Die Maschinen der neuen Technologien beruhen, so wie ich es verstanden habe, im Grunde auf dem gleichen Prinzip: Das gesamte Wissen ist gespeichert und kann mit einem Knopfdruck abgerufen werden. In der Theorie klingt das nach mehr Effizienz. Einige meiner Knöpfe funktionieren nicht, für andere brauche ich Passwörter, Codes, nach dem Zufallsprinzip wirkende Aufsperrmechanismen. Die kollektive Vergangenheit liefert diese merkwürdigerweise. Sie ist Allgemeingut, aber gleichzeitig auch zutiefst privater Besitz. Jeder sieht sie auf seine Weise. Meine Viktorianer sind nicht eure Viktorianer. Mein siebzehntes Jahrhundert ist nicht eures. John Aubrey, oder Darwin, oder wer auch immer, spricht in einer bestimmten Tonlage zu mir, in einer anderen zu euch. Die Bilder meiner eigenen Vergangenheit kommen aus der allgemein verfügbaren Vergangenheit. Andere Leben fügen sich in mein eigenes Leben ein: ich, Claudia H.
Ichbezogen? Vielleicht. Sind wir das nicht alle? Warum klingt das immer wie ein Vorwurf? Jedenfalls war es so, als ich ein Kind war. Man fand mich schwierig. »Unmöglich« war genau genommen das Wort, das sie manchmal verwendeten. Ich selbst fand mich überhaupt nicht unmöglich. Mutter und das Kindermädchen waren unmöglich, mit ihren Verboten und Warnungen, ihrem Wahn von Milchpudding und lockigen Haaren und ihrem Terror vor allem, was in der freien Natur lockte – hohe Bäume und tiefes Wasser und das Gefühl von nassem Gras unter bloßen Füßen, der Reiz von Schlamm und Schnee und Feuer. Ich sehnte mich – brannte – immer danach, höher und schneller und weiter zu kommen. Sie warnten, ich gehorchte nicht.
Gordon auch nicht. Mein Bruder Gordon. Wir waren zwei von der gleichen Art.
Meine Anfänge; der Anfang, der für alles gilt. Aus dem Dreck zu den Sternen, habe ich gesagt … Also, der Urschlamm. Da ich nie eine konventionelle Historikerin, nie – wie erwartet – die mustergültige Chronistin war und auch nie so ein vertrockneter Knochen wurde wie diese Frau, die ich damals vor undenklichen Zeiten in Oxford über das Papsttum dozieren hörte, da ich für mein Einzelgängertum bekannt bin und mehr Kollegen zur Weißglut gebracht habe als ihr Gutenachtgebete geflüstert habt, werden wir es also auf einen Schock anlegen. Vielleicht sollte ich einmal aus der Sicht des Urschlamms erzählen? Eines dieser träge dahintreibenden fedrigen Krustentierchen erzählen lassen. Oder einen Ammoniten? Ja, einen Ammoniten, glaube ich. Einen Ammoniten mit einem Gespür für das Schicksal. Einen Sprecher der jurassischen Meeresströme, der erzählen soll, wie es gewesen ist.
Doch hier schüttelt sich das Kaleidoskop. Für mich ist das Paläolithikum nur durch eine kleine Verschiebung der Muster getrennt vom neunzehnten Jahrhundert, in welchem es überhaupt zum ersten Mal zur Kenntnis genommen wurde, als die Leute erfassten, auf welcher Grundlage sie sich eigentlich bewegten. Wer wäre nicht fasziniert von diesen majestätischen Gestalten, die backenbärtig und völlig übertrieben gekleidet über Strände und Hügel streiften, dabei in ihren Gedanken Gigantisches wälzend? Der arme irregeleitete Philip Gosse, Hugh Miller und Lyell und auch Darwin selbst. Zwischen Gehröcken und Bärten und dem Widerhall des Felsgesteins scheint es eine natürliche Affinität zu geben – Mesozoikum und Triasformationen, Oolith und Lias, Cornbrash und Grünsand.
Aber Gordon und ich, elf und zehn Jahre alt, hatten damals noch nichts von Darwin gehört; unsere Vorstellung von Zeit war privat und semantisch (Teezeit, Abendessenszeit, Zeit vertun …); unser Interesse an Asteroceras und Primocroceras betraf Erwerb und Wettbewerb. Um Gordon bei einem traumhaft wirkenden Streifen aus Juramatsch zuvorzukommen, war ich bereit, mit meinem blinkenden neuen Hämmerchen hundertfünfzig Millionen Jahre in Stücke zu klopfen und mir notfalls einen Arm oder ein Bein zu brechen, wie 1920, als ich am Strand von Charmouth ein Steilstück aus blauem Lias hinunterstürzte.
Sie klettert ein wenig höher, auf das nächste rutschige, schräge Plateau der Klippe, hockt sich hin und sucht um sich herum fieberhaft die blaugrauen Felsstückchen ab, späht nach diesen verführerischen Kringeln und geriffelten Spiralen, und einmal schlägt sie mit einem triumphierenden Zischen zu: ein Ammonit, noch fast ganz erhalten. Der Strand da unten ist jetzt ziemlich weit weg, die schrillen Schreie, das Gebell, die Rufe von dort sind laut und deutlich, aber doch von einer anderen Welt, ohne Bedeutung.
Und die ganze Zeit über achtet sie aus dem Augenwinkel heraus auf Gordon, der schon höher ist als sie und an einem Vorsprung herumklopft. Er hört auf zu hämmern, sie kann sehen, wie er etwas ganz genau anschaut. Was hat er da? Misstrauen und Rivalität brennen in ihr. Sie kriecht durch niedriges Gebüsch, zieht sich über ein Felsband.
»Das ist mein Platz«, schreit Gordon. »Du kannst nicht hierher. Das habe ich mir geschnappt.«
»Ist mir doch egal«, brüllt Claudia. »Ich geh sowieso noch höher – da oben ist es viel besser.« Und über magere Pflanzen und trockenen, steinigen Boden, der unter ihren Füßen in Kaskaden nach unten wegspritzt, schwingt sie sich hinauf zu einem verheißungsvoll lockenden grauen Vorsprung, wo Asteroceras sicher zu Hunderten schlummern.
Sie achtet nicht auf die Gestalten, die unten am Strand hin und her hasten; wie schwache Vogelschreie schweben Warnrufe nach oben.
Um auf dieses vielversprechende Felsband weiter oben zu gelangen, muss sie an Gordon vorbei. »Pass auf …«, sagt sie. »Tu dein Bein da weg …«
»Drängel nicht«, knurrt er. »Du kannst hier sowieso nicht her. Ich habe gesagt, das ist mein Platz, such dir selber einen.«
»Stoß du mich nicht. Ich will gar nicht auf deinen blöden Platz …«
Sein Bein ist ihr im Weg – es schlägt aus, sie tritt nach, und ein Stück aus der Klippe, aus dieser fest gefügten Welt, die sich nun als doch nicht so solide erweist, rutscht unter dem zupackenden Griff ihrer Hände … bröckelt … und sie fällt schräg auf ihre Schultern, ihren Kopf, ihren ausgestreckten Arm, sie schliddert plumpsend und sich drehend in die Tiefe. Keuchend landet sie in einem dornigen Busch, in ihr ein hämmernder Schmerz, und so beleidigt ist sie, dass sie nicht einmal schreit.
Er spürt, wie sie näher kommt, auf sein Gebiet vordringt, sie wird ihm die besten Fossilien wegschnappen. Er protestiert. Er streckt einen Fuß aus, um sie abzuwehren. Ihre heißen, aufdringlichen Glieder verknäueln sich mit seinen.
»Du stößt mich«, kreischt sie.
»Tu ich nicht«, faucht er. »Du drängelst doch. Das ist sowieso mein Platz, such dir einen anderen.«
»Das ist nicht dein blöder Platz«, sagt sie. »Das gehört allen. Und überhaupt …«
Und plötzlich gibt es furchtbare Geräusche von etwas, das reißt und plumpst, und dann ist sie weg, rutscht und kollert nach unten, und entsetzt und zufrieden schaut er ihr nach.
»Er hat mich geschubst.«
»Hab ich nicht. Ehrlich, Mutter, das hab ich nicht. Sie ist ausgerutscht.«
»Er hat mich geschubst.«
Und sogar in dem ganzen Tumult – die besorgten Mütter und Kindermädchen, die improvisierte Schlinge, die angebotenen Riechsalzfläschchen – kann Edith Hampton über die wütende Hartnäckigkeit ihrer Kinder staunen.
»Streitet nicht. Halt ruhig, Claudia.«
»Das sind meine Ammoniten. Er darf sie nicht kriegen, Mutter.«
»Ich will deine Ammoniten doch gar nicht.«
»Gordon, sei still!«
Sie hat Kopfschmerzen, sie versucht, die Kinder zu beschwichtigen und auf all die Ratschläge und Nettigkeiten einzugehen; sie schiebt alles auf diese gefahrvolle Welt, die so unzuverlässig, so bösartig ist. Und auf die Unnachgiebigkeit ihrer Sprösslinge, deren Emotionen den ganzen Strand mit Lärm erfüllen.
Die Stimme der Geschichte ist selbstverständlich eine vielfältige. Viele Stimmen, all die Stimmen, denen es gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen. Manche sind natürlich lauter als andere. Meine Geschichte ist mit den Geschichten anderer Menschen verstrickt – Mutter, Gordon, Jasper, Lisa und eine bestimmte Person vor allen anderen; auch ihre Stimmen müssen zu vernehmen sein, insofern werde ich den Konventionen von Geschichte Folge leisten. Die Regeln des Offenkundigen respektieren. Die Wahrheit, was immer das sein mag. Doch Wahrheit ist an Worte gebunden, an Gedrucktes, an die Beweiskraft eines Blatts Papier. Augenblicke rauschen vorbei, die Tage unseres Lebens verschwinden ganz und gar, substanzloser als wenn sie erfunden gewesen wären. Fiktion kann dauerhafter scheinen als die Realität. Pierre auf dem Schlachtfeld, die Bennet-Mädchen bei ihrer Näharbeit, Tess auf der Dreschmaschine – all das ist für immer festgenagelt, auf der beschriebenen Seite und in einer Million Köpfen. Andererseits ist das, was mir 1920 auf dem Strand von Charmouth passiert ist, historisch völlig zu vernachlässigen. Und wenn Sie und ich über Geschichte sprechen, meinen wir doch nicht das tatsächlich Geschehene? Das immerwährende, allgegenwärtige kosmische Chaos? Wir meinen das, was in den Büchern ordentlich verstaut worden ist, den gütigen, konzentrierten Blick der Geschichte auf Jahre und Orte und Personen. Historie enträtselt sich, die Begleitumstände ziehen es ihrer Wesensart gemäß vor, verhüllt zu bleiben.
Da nun also meine Geschichte auch ihre ist, müssen auch sie sprechen – Mutter, Gordon, Jasper … Doch natürlich habe ich das letzte Wort. Privileg der Historikerin.
Mutter. Nehmen wir für einen Moment Mutter. Mutter zog sich aus der Geschichte zurück. Sie hat sich ganz einfach entfernt. Sie entschied sich für eine Welt, die sie selbst geschaffen hatte, in der es nichts gab außer Floribunda-Rosen, unbeständigem Wetter und Wandteppichen mit geistlichen Motiven. Sie las nur die West Dorset Gazette, Country Life und die Mitteilungen der Royal Horticultural Society. Ihre gesamte Sorge konzentrierte sich auf die Launen des Klimas. Ein unerwarteter Frost konnte leichte Bestürzung auslösen. Ein schlechter Sommer bot Anlass zu mildem Tadel. Glückliche Mutter. Vernünftige, praktisch veranlagte Mutter. Auf ihrem Frisiertisch stand eine Fotografie von Vater, fesch in seiner Uniform, ewig jung, die Haare frisch geschnitten, sein Bart ein feiner Schatten auf der Oberlippe; kein rotes Loch in seinem Bauch, keine Scheiße keine Schreie kein weißer singender Schmerz. Mutter staubte diese Fotografie jeden Morgen ab; was sie dabei dachte, weiß ich nicht.
Geschichte hat Vater getötet. Ich sterbe an Darmkrebs, das ist etwas relativ Privates. Vater starb an der Somme, von der Geschichte weggeputzt. Er lag im Dreck, habe ich erfahren, die ganze Nacht über, schreiend, und als sie ihn schließlich holten, starb er auf der Bahre, zwischen dem Bombentrichter, der sein letztes Lager war, und dem Verbandsplatz. Dabei dachte er wohl, glaube ich, an alles andere als an Geschichte.
Für mich ist er also ein Fremder. Eine historische Figur. Nur nicht in einer verschwommenen Szene, als sich eine schwer zu erkennende männliche Gestalt bückt, um mich hochzuheben und – wie aufregend – auf ihre Schultern zu setzen, von wo aus ich die Welt herumkommandieren kann, eingeschlossen Gordon dort unten, der nicht so bevorzugt wurde. Sogar da stehen, wie Sie feststellen können, meine Gefühle Gordon gegenüber im Vordergrund. Doch ich bin mir nicht sicher, ob dieser unerkannte Mann Vater ist oder nicht, es könnte ein Onkel sein, ein Nachbar. Die Lebenswege von Vater und mir waren nicht lange miteinander verbunden.
Also werde ich mit den Felsen beginnen. Das passt. Die Felsen, aus denen wir entspringen und an die wir gefesselt sind, allesamt. Wie der erbärmliche Dingsda, wie hieß er doch, der an seinem Felsen …
»An einen Felsen gekettet …«, sagt sie. »Wie hieß der?«
Und der Arzt stutzt, sein Gesicht eine Armlänge von ihrem Gesicht entfernt, seine kleine silberne Taschenlampe schwebt über ihr, sein Name prangt in goldenen Buchstaben auf seinem weißen Kittel. »Wie bitte? Was sagten Sie, Miss Hampton?«
»Ein Adler«, erklärt sie. »Hackt immer an seiner Leber. Die condition humaine, verstehen Sie?«
Und der Arzt lächelt, voller Nachsicht. »Aha«, sagt er. Und er hebt ihr Augenlid und leuchtet hinein. In ihre Seele, vielleicht.
Prometheus, natürlich. Mythologie ist ein wesentlich besseres Thema als Historie. Denn sie hat Form, Logik, eine Botschaft. Früher dachte ich, ich sei eine Fee. Man hatte mich nach unten in den Salon gerufen, ich war ungefähr sechs Jahre alt und sollte dort eine Verwandte kennenlernen, die reicher und weltläufiger war als Mutter und vor der Mutter großen Respekt hatte. Plötzlich riss mich jemand hoch, diese wunderbar duftende Frau hielt mich knapp vor sich, und ich hörte sie ausrufen: »Und das ist sie also! Die kleine Fee! Eine richtig niedliche, rothaarige, grünäugige kleine Fee!« Als ich wieder oben im Kinderzimmer war, untersuchte ich im Spiegel meine Haare und Augen. Ich bin eine Fee. Ich bin niedlich. »Das reicht, Claudia«, sagt das Kindermädchen. »Edel ist, wer edel handelt.« Aber ich bin eine Fee, ich betrachte mich voller Zufriedenheit.
Claudia. Ein untypischer Anflug von Phantasie bei Mutter. Wie ein eitriger Daumen fiel ich unter all den Violets und Mauds und Norahs und Beatrices auf. Doch ich fiel ohnehin auf, wegen meiner Haare und unordentlichen Gedanken. Wenn wir am Strand von Charmouth in Sicht kamen, zitterten die Kindermädchen anderer Familien und versammelten ihre Meute um sich. Wir waren reichlich wilde Kinder, Gordon und ich. Ein Jammer, wirklich, wo Mrs Hampton doch so eine nette Person ist, und Witwe dazu … Sie lehnten uns ab und beobachteten uns voller Missbilligung, weil wir zu laut spielten, zu gefährlich, ein zerzaustes, ungebärdiges Paar.
Das ist lange her. Und wie gestern. Vom Strand von Charmouth besitze ich immer noch einen Brocken Blauen Lias, in dem zwei graue fossile Kringel hängen, er hat mir als Briefbeschwerer auf meinem Schreibtisch gedient. Zwei Asteroceras, hilflos in einem zeitlosen Ozean.
Vielleicht schreibe ich meinen Bericht über das Paläolithikum überhaupt nicht, sondern mache einen Film daraus. Einen Stummfilm zudem, in dem ich Ihnen zuerst die großen schlummernden Felsen des Kambriums zeige, von diesen zu den Bergen von Wales schwenke, zum Long Mynd, zum Wrekin, vom Ordovizium zum Devon, zum Red Sandstone und Kohlensandstein, weiter zu den üppigen, leuchtenden Hügeln der Cotswolds, dann zu den weißen Klippen von Dover … Ein impressionistischer, träumerischer Film, in dem sich die gefalteten Felsen erheben und blühen und wachsen und zur Kathedrale von Salisbury und zum Münster von York und zum Royal Crescent werden und zu Gefängnissen und Schulen und Wohnhäusern und Bahnhöfen. Ja, dieser Film erblüht vor meinen Augen, ohne Worte und ganz eigen, greift sich ein Kliff in Cornwall, Stonehenge, die Kirche von Burford, das Penninische Gebirge heraus.
Ich werde viele Stimmen einsetzen in dieser Geschichte. Ich halte nichts von dem unterkühlten Tonfall einer teilnahmslosen Erzählung. Vielleicht sollte ich es wie die Skribenten des ›Anglo-Saxon Chronicle‹ machen, die in einem Atemzug mitteilen, dass ein Erzbischof verblichen ist, eine Synode stattfand und feuerspeiende Drachen durch die Lüfte fliegend gesichtet wurden. Warum denn eigentlich nicht? Glaube ist relativ. Unsere Verbindung mit der Realität ist immer dünn. Ich weiß nicht, durch welchen Zauber auf meinem Fernsehschirm ein Bild erscheint oder wie ein Chip aus Kristall scheinbar unendliche Kapazitäten haben kann. Ich akzeptiere das ganz einfach. Und doch bin ich von Natur aus skeptisch – eine Fragende, eine Zweifelnde, eine instinktive Agnostikerin. Im gefrorenen Stein der Kathedralen Europas existieren nebeneinander die Apostel, Christus und Maria, Lämmer, Fische, Greife, Drachen, Seeschlangen und die Gesichter von Männern, die Blätter anstelle von Haaren tragen. Ich schätze solch freizügiges Denken.
Kinder sind unendlich vertrauensselig. Meine Lisa war ein langweiliges Kind, doch trotzdem kam sie immer wieder mit etwas an, das mich freute und überraschte. »Gibt es Drachen?«, fragte sie. Ich sagte Nein. »Hat es denn mal welche gegeben?« Ich sagte, alles, was wir wüssten, deutete auf das Gegenteil hin. »Aber wenn es das Wort ›Drache‹ gibt, müssen doch auch Drachen da gewesen sein.«
Genau. Die Macht der Sprache. Sie bewahrt das Flüchtige – verleiht Träumen Gestalt, Sonnenstrahlen Dauer.
Im Ashmolean Museum in Oxford gibt es einen Drachen auf einer chinesischen Schale, vor der Jasper und ich einmal standen, ungefähr acht Monate vor Lisas Geburt. Wie soll ich Jasper beschreiben? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, jede von ihnen unzureichend. Auf mein Leben bezogen war er mein Liebhaber und Vater meines einzigen Kindes, auf sein Leben bezogen war er ein schlauer, erfolgreicher Unternehmer, kulturell gesehen war er eine Mischung aus russischer Aristokratie und englischer Oberschicht. Er sah auch gut aus, war überzeugend, potent, energisch und selbstsüchtig. Für Jasper muss ich mich bei Tito bedanken, denn ich lernte ihn 1946 kennen, als ich an dem Buch über die Partisanen arbeitete und mit jedem sprechen musste, der irgendetwas mit der Jugoslawiengeschichte zu tun hatte. Ich aß mit ihm an einem Dienstag zu Abend, am Samstag darauf lagen wir miteinander im Bett. In den folgenden zehn Jahren lebten wir manchmal zusammen, manchmal nicht, kämpften, bereinigten alles wieder, trennten uns und kamen wieder zusammen. Lisa, meine arme Lisa, ein stilles und blässliches kleines Mädchen, war der greifbare, wenn auch wenig überzeugende Beweis unserer rastlosen Verbindung: Niemals sah sie so aus oder verhielt sich so wie einer von uns beiden.
Anders als ihr Vater, der ein ganz hübsches Abbild seiner Vorfahren gab. Gutes Aussehen und chevalereske Lebenseinstellung hatte er von seinem russischen Vater, seine unerschütterliche gesellschaftliche Sicherheit und sein Überlegenheitsgefühl von seiner Mutter. Isabel, Erbin einer ansehnlichen Portion Devon, jahrhundertelanger stiller Prosperität und stetigen Aufstiegs, hatte im Alter von neunzehn Jahren in Paris eigenartige Anwandlungen. Sie setzte sich über ihre Eltern hinweg und heiratete den unwiderstehlichen Sascha. Jasper kam zur Welt, als sie einundzwanzig war. Als sie zweiundzwanzig war, fand Sascha das Leben als Landedelmann in Devon bereits langweilig, Isabel konnte wieder klar denken, erkannte ihren fürchterlichen Fehler, und man arrangierte eine diskrete Scheidung. Sascha wurde von Isabels Vater dafür bezahlt, dass er sich aus der ganzen Szenerie entfernte und alle Ansprüche bis auf die einfachsten bezüglich Jasper aufgab. Er zog sich ohne zu klagen in eine Villa bei Cap Ferrat zurück. Isabel heiratete nach einer angemessenen Frist einen Freund aus Kinderzeiten und wurde Lady Branscombe of Sotleigh Hall. Jasper verbrachte seine Jugend in Eton und in Devon, mit gelegentlichen Ausflügen nach Cap Ferrat. Als er sechzehn war, wurden diese Fahrten häufiger. Der Lebensstil seines Vaters zog ihn an, er empfand ihn als einen angenehmen Gegenpol zu Jagdgesellschaften und Landbällen, lernte Französisch und Russisch, die Liebe zu den Frauen und wie man möglichst viele Situationen zum eigenen Vorteil wendet. In Devonshire seufzte seine Mutter bedauernd und machte sich Vorwürfe; ihr Gatte, ein Mann von stoischer Toleranz, dem ein Tod an der Küste der Normandie bestimmt war, versuchte, den Jungen für die Leitung eines Guts, für Forstwirtschaft und Pferdezucht zu begeistern, alles ohne Erfolg. Jasper war nicht nur Halbrusse, sondern auch gescheit. Seine Mutter entschuldigte sich noch heftiger. Jasper ging nach Cambridge, befasste sich mit allem außer Sport nur oberflächlich, machte einen erstklassigen Abschluss in zwei Fächern und gewann etliche nützliche Freunde. Später probierte er es mit Politik und Journalismus, glänzte im Krieg als jüngstes Mitglied von Churchills Mannschaft und ging aus alldem voller Ambitionen, mit guten Beziehungen und als Opportunist hervor.
Das ist in großen Zügen Jasper. In meinem Kopf besteht Jasper aus Fragmenten: Es gibt viele Jaspers, ungeordnet, ohne Chronologie. So wie es auch viele Gordons gibt, viele Claudias.
Claudia und Jasper stehen vor dem Drachen auf der chinesischen Porzellanschale im Ashmolean Museum, Jasper schaut auf Claudia und Claudia auf den Drachen, nimmt ihn dabei unbewusst für immer in sich auf. Genau genommen sind es zwei Drachen, blau gesprenkelte Drachen, die einander gegenüberstehen, die Zähne fletschen; ihre schlangenartigen Körper und Glieder legen sich wunderbar um den Rand. Sie scheinen Geweihe zu tragen, feine blaue Mähnen, Haarbüschel an den Ellenbogen, ein Zackenkamm verläuft vom Kopf zum Schwanz. Eine überaus genaue Beschreibung. Claudia starrt in die Vitrine, sie sieht ihr eigenes Gesicht und das von Jasper auf den Tellern reflektiert – die Gesichter von Geistern.
»Und?«, sagt Jasper.
»Und was?«
»Kommst du nun mit mir nach Paris oder nicht?«
Jasper trägt einen braunen Dufflecoat, einen Seidenschal anstelle einer Krawatte. Seine Aktentasche passt nicht dazu.
»Vielleicht«, sagt Claudia. »Mal sehen.«
»Das reicht nicht«, sagt Jasper.
Claudia betrachtet intensiv die Drachen, denkt an etwas ganz anderes. Die Drachen sind eine Theaterkulisse, doch sie werden bestehen.
»Also«, sagt Jasper. »Ich hoffe, du kommst mit. Ich rufe dich aus London an. Morgen.« Er sieht auf seine Armbanduhr. »Ich muss gehen.«
»Noch eins …«, sagt Claudia.
»Ja?«
»Ich bin schwanger.«
Stille. Jasper legt eine Hand auf ihren Arm, zieht sie wieder zurück. »Aha«, sagt er schließlich. Dann: »Was möchtest du … gerne tun?«
»Ich werde es bekommen«, sagt Claudia.
»Natürlich. Wenn dir das am liebsten ist. Mir wäre das wohl auch am liebsten.« Er lächelt – ein charmantes, zutiefst intimes Lächeln. »Also, Liebling, ich muss sagen, für eines bist du meiner Meinung nach überhaupt nicht geschaffen, und das ist die Mutterschaft. Allerdings wage ich zu behaupten, dass du dich in gewohnter Weise darauf einrichten wirst.«
Zum ersten Mal sieht sie ihn an. Sieht auf dieses Lächeln. »Ich werde es bekommen«, erklärt sie, »zum Teil, weil ich nicht anders kann, und zum Teil, weil ich es will. Möglicherweise hat beides durchaus miteinander zu tun. Und ich bin ganz sicher nicht der Ansicht, dass wir heiraten sollten.«
»Nein«, sagt Jasper. »Das kann ich mir vorstellen. Aber selbstverständlich möchte ich meinen Teil beisteuern.«
»O ja, du wirst mich nicht im Stich lassen«, sagt Claudia. »Du wirst der perfekte Gentleman sein. Sind Kinder kostspielig?«
Jasper betrachtet Claudia, die den ganzen Nachmittag über so kurz angebunden war wie nur Claudia es sein kann. Sie steht vor einer gläsernen Vitrine, offensichtlich ganz in Gedanken versunken angesichts chinesischer Keramik. In ihrem grünen Tweedkostüm sieht sie hübsch aus; an einem blauen Fleck auf dem Zeigefinger ihrer rechten Hand erkennt Jasper, dass sie heute Vormittag geschrieben hat.
»Möchtest du am nächsten Wochenende mit mir nach Paris fahren?«
»Vielleicht«, sagt Claudia.
Er möchte sie durchschütteln. Oder schlagen. Doch wenn er das täte, würde sie sehr wahrscheinlich zurückschlagen, und sie sind hier in der Öffentlichkeit, können jederzeit Bekannte treffen. Stattdessen legt er beschwichtigend eine Hand auf ihren Arm und sagt, dass er aufbrechen muss, um seinen Zug zu erreichen.
»Übrigens«, sagt Claudia und starrt dabei immer noch in die Glasvitrine, »ich bin schwanger.«
Ganz plötzlich ist er von einer intensiven Heiterkeit gepackt. Er will Claudia nicht mehr schlagen. Bei ihr, denkt er, kann man sich immer darauf verlassen, dass ihr etwas Neues einfällt.
Die meiste Zeit ihrer Kindheit verbrachte Lisa jeweils bei einer von beiden Großmüttern. Eine Londoner Mietwohnung ist nicht der richtige Platz für ein Kind, und ich war viel unterwegs. Lady Branscombe und meine Mutter hatten viel gemeinsam, nicht zuletzt die Kümmernisse, die ihre Sprösslinge verursachten und die sie überforderten. Tapfer stellten sie sich der Tatsache, dass das Kind unehelich war, seufzten sich am Telefon gegenseitig etwas vor und versuchten, für Lisa zu tun, was ihnen möglich war, indem sie skandinavische Au-pair-Mädchen holten und sich um Ganztagsschulen kümmerten.
Jasper hat nie mein Leben beherrscht. Er war wichtig, aber das ist etwas anderes. Er war von entscheidender Bedeutung für das Gesamtgefüge, doch das ist schon alles. Die meisten Lebenswege haben ihren Kern, ihren Mittelpunkt, das Zentrum, um das sich alles bewegt. Zu meinem werden wir zum gegebenen Zeitpunkt noch kommen, wenn ich so weit bin. Momentan befasse ich mich mit einzelnen Schichten.
Einer der Männer des viktorianischen England, die ich ganz besonders schätze, ist der Bauingenieur William Smith, der durch seine Aufgaben beim Bau von Kanälen die Möglichkeit hatte, die Felsen mit ihren fossilen Ablagerungen zu untersuchen, durch die seine Gesteinsschnitte getrieben wurden, und dort Entwicklungsstudien anzustellen. William Smith soll in meiner Geschichte der Welt einen Ehrenplatz einnehmen. Und John Aubrey ebenfalls. Im Allgemeinen ist nicht bekannt, dass Aubrey, ein meisterhaftes Klatschmaul, ein Schwätzer, der sich über Hobbes und Milton und Shakespeare ausließ, auch der erste kompetente Archäologe war und dass ihn überdies seine einfache, doch scharfsinnige Beobachtung an Kirchenfenstern – ein Baustil ist Vorläufer des nächsten, woraus sich dann eine Baugeschichte ableiten lässt – zu einem William Smith des siebzehnten Jahrhunderts macht. Und den Perpendicular- und Decorated-Stil zu Ammoniten der Architektur. Ich sehe Aubrey vor mir, wie er durch das Gras eines Friedhofs in Dorset streift, in der Hand seine Notizen, und die Arbeit eines Schliemann, Gordon Childe und das Abschlussexamen von Cambridge vorwegnimmt, wie ich auch William Smith mit seinem Zylinder sehe, auf dem Boden hockend und völlig vertieft in die Betrachtung der Schuttablagerungen eines Stücks Warwickshire.
Ich besitze den Abzug einer Fotografie – man kann ihn im Victoria and Albert Museum erwerben – von einer Dorfstraße in Thetford, 1868 aufgenommen, auf der William Smith nicht zu sehen ist. Die Straße ist leer. Es gibt einen Lebensmittelladen und einen Schmied und einen Karren am Straßenrand und einen großen, ausladenden Baum, doch keinen einzigen Menschen. In Wirklichkeit ging William Smith – oder irgendjemand oder mehrere Leute, auch Hunde, Gänse, ein Mann mit Pferd – unter dem Baum vorbei, betrat den Laden, verweilte einen Moment im Gespräch mit einem Freund, während die Fotografie aufgenommen wurde, doch er ist unsichtbar, alle sind unsichtbar. Die Belichtungszeit war so lang, sechzig Minuten, dass William Smith und jeder andere durch das Bild gingen und verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Nicht einmal einen so winzigen Abdruck wie diese allerersten Würmer, die durch den Schlamm des Kambriums von Nordschottland zogen und die leere Röhre ihrer Kriechspur im Felsen zurückließen.
Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ein hübsches Bild für das Verhältnis zwischen dem Menschen und der stofflichen Welt. Vergangen, vorbeigezogen und weg. Doch angenommen, William Smith – oder sonst jemand, der an diesem Morgen über diese Straße kam – hätte auf seinem Weg den Karren vom Punkt A zum Punkt B bewegt. Was würden wir dann sehen? Einen verschmierten Fleck? Zwei Karren? Oder angenommen, er hätte den Baum gefällt? Wir sind wirklich gut darin, in der physischen Welt herumzupfuschen – vielleicht schaffen wir es, sie einmal endgültig fertigzumachen. Finis. Und dann ist die Geschichte in der Tat zu Ende.
William Smith bezog seine Inspiration durch die Schichtenbildung. Meine Schichten sind nicht so leicht zu erkennen wie die der Felsen von Warwickshire, und im Kopf sind sie nicht einmal in Folgen angeordnet, sondern ein Wirbel aus Worten und Bildern. Drachen und Moon Tigers und Crusaders und Honeys.
Die chinesische Porzellanschale mit den Drachen ist immer noch im Ashmolean. Ich habe sie letzten Monat dort gesehen.
Ich war achtunddreißig, als Lisa geboren wurde, und ich stand ganz gut da. Zwei Bücher hatte ich vorzuweisen, einiges an polemischem Journalismus, einen Ruf als streitbare, provokative, beachtenswerte Autorin. Ich hatte so etwas wie einen Namen. Hätte der Feminismus damals existiert, so wäre das wohl etwas für mich gewesen; er hätte mich gebraucht. Doch so wie die Dinge lagen, habe ich ihn nie vermisst; eine Frau zu sein, schien mir immer ein wertvolles zusätzliches Plus. Mein Geschlecht war mir nie ein Hindernis. Und jetzt muss ich auch darüber nachdenken, dass es mir vielleicht das Leben gerettet hat. Als Mann wäre ich sehr wahrscheinlich im Krieg gefallen.
Ich weiß ziemlich genau, warum ich Historikerin wurde. Quasi-Historikerin, wie einer meiner Feinde es formuliert hat, irgend so ein verdorrter Prof, der viel zu viel Angst vor dem kalten Wasser hatte, um auch nur einmal einen Zeh aus seinem College in Oxford hinauszustrecken. Historikerin wurde ich, weil in meiner Kindheit abweichende Meinungen nicht sehr geschätzt wurden: »Keinen Streit, Claudia«, »Claudia, so etwas darfst du nicht antworten«. Auseinandersetzung ist natürlich der springende Punkt an der Geschichte. Widerspruch, mein Wort gegen deines, diese Sachlage gegen jene. Gäbe es so etwas wie absolute Wahrheit, dann würde die Debatte jeden Glanz verlieren. Ich jedenfalls hätte kein Interesse mehr daran. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als ich begriff, dass es bei Geschichte nicht um vorgefasste Meinungen geht.
Ich war dreizehn. In Miss Lavenhams Mädcheninstitut. In der 4b. Wir nahmen bei Miss Lavenham persönlich die Monarchen der Tudors durch. Miss Lavenham schrieb Daten und Namen an die Tafel, und wir schrieben sie ab. Sie diktierte uns auch die wichtigsten Merkmale jedes Regenten. Heinrich der Achte wurde wegen seiner ehelichen Exzesse verurteilt, war jedoch auch als König nicht gut. Königin Elisabeth war gut, sie wehrte die Spanier ab und regierte mit starker Hand. Sie köpfte auch die schottische Königin Maria Stuart, die eine Katholische war. Unsere Federn kratzten durch den langen Sommernachmittag. Ich hob die Hand: »Bitte, Miss Lavenham, fanden es die Katholiken richtig, dass sie Maria Stuart geköpft hat?« – »Nein, Claudia, ich nehme nicht an, dass sie das richtig fanden.« – »Bitte, sind die Katholiken jetzt dieser Meinung?« Miss Lavenham holte tief Luft: »Nun, Claudia«, sagte sie freundlich, »ich nehme an, einige von ihnen sind vermutlich nicht dieser Meinung. Menschen haben manchmal unterschiedliche Ansichten. Doch darum brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Schreib einfach ab, was an der Tafel steht. Nimm rote Tinte für die Überschriften, und schreib schön klar und deutlich.«
Und plötzlich reißt der fade graue Teich der Geschichte vor mir auf, birst in tausend miteinander kämpfende Wellen, ich höre das Gemurmel von Stimmen. Ich lege meine Feder aus der Hand und grüble, meine Überschriften sind nicht hübsch und deutlich mit roter Tinte geschrieben, am Ende des Schuljahres habe ich achtunddreißig Prozent, »das Klassenziel nicht erreicht«.
2
»Vor dem Zorn der Nordmänner, o Herr, errette uns …« Gibt einem das nicht einen Stich, wenn man auf seinem Sofa sitzt und so etwas liest, das Licht brennt, die Tür ist verschlossen, das zwanzigste Jahrhundert hüllt einen gemütlich ein? Und natürlich tat Er das nicht, oder nicht immer. Er tut es nie, aber das konnten sie damals nicht wissen. Er lieferte bloß die Worte, und der arme Mönch, der sie aufgeschrieben hat, endete vermutlich mit einem Pfund Wikingereisen in der Kehle oder ging mitsamt seiner Kirche in Flammen auf.
Als ich ungefähr neun Jahre alt war, bat ich Gott, meinen Bruder Gordon zu vernichten. Schmerzlos, aber endgültig. Das ereignete sich zufälligerweise in Lindisfarne, wohin man mit uns nicht etwa deshalb gefahren war, um über den Ansturm der Wikinger nachzusinnen, von dem Mutter wahrscheinlich nie etwas gehört hatte, sondern um über den Damm zur Insel zu spazieren und dort ein Picknick zu veranstalten. Und Gordon und ich rannten über diesen Fetzen Land um die Wette, und da Gordon ein Jahr älter und ein ganzes Stück schneller war als ich, war völlig klar, dass natürlich er gewinnen würde. Und ich schickte dieses Stoßgebet zum Himmel, voller Wut und Inbrunst, und ich meinte es wirklich ernst – o ja, ganz ernst. Nie wieder, sagte ich, werde ich Dich um irgendetwas bitten. Um überhaupt nichts. Nur dieses eine musst Du tun. Jetzt. Sofort. Es ist interessant, dass ich darum bitten musste, Gordon auszulöschen und nicht darum, aus mir eine schnellere Läuferin zu machen. Und selbstverständlich unternahm Gott nichts dergleichen, und ich schmollte den ganzen herrlichen Nachmittag hindurch, an dem der Wind den Geruch des Meeres trug, und wurde Agnostikerin.
Jahre später waren Gordon und ich wieder dort. Dieses Mal rannten wir nicht um die Wette. Wir gingen ganz ruhig, diskutierten, wie ich mich erinnere, über das Dritte Reich und den bevorstehenden Krieg. Und mir fiel dieses mönchische Gebet wieder ein, und ich sagte, jetzt sei es wieder so wie zu Zeiten der Wikinger, die blutroten Segel am Horizont, die klirrenden Schritte schwer bewaffneter Männer. Und die Möwen kreischten, und das Gras auf den Klippen federte wie ein weiches Polster aus wilden Blumen unter unseren Füßen, wie zweifellos auch damals im neunten Jahrhundert. Zwischen den Ruinen aßen wir Brote und tranken Ingwerlimonade, später lagen wir in einer Kuhle in der Sonne. Jasper war uns unbekannt, und Lisa. Sylvia. Laszlo. Ägypten. Indien. Noch nicht ausgeformte Schichten.
Wir sprachen über unsere Pläne, im Krieg und danach, falls es ein Danach gab. Gordon versuchte gerade, sich in den Geheimdienst hineinzumogeln (jeder arbeitete damals mit Tricks und zog an irgendwelchen Fäden). Ich wusste, was ich vorhatte. Ich würde Kriegsberichterstatterin werden. Gordon lachte. Er sagte, dass er mir keine großen Chancen dafür einräumte. Probier’s, sagte er, und ich wünsch dir das Beste, aber ganz ehrlich … Und ich ging weiter. Du wirst schon sehen, sagte ich. Du wirst sehen. Und er musste mich einholen und mich besänftigen. Wir waren immer noch Rivalen. Unter anderem. Neben anderem. Damals, und auch später.
Der Arzt bleibt stehen und schaut durch das gläserne Guckloch in der Tür. »Mit wem spricht sie? Hat sie Besuch?« Die Krankenschwester schüttelt den Kopf, einen Augenblick lang beobachten sie die Patientin, deren Lippen sich bewegen, deren Gesichtsausdruck … gespannt ist. Etwas Klinisches scheint nicht vorzuliegen, sie knarren und quietschen wieder den Korridor entlang.
Claudia steht vor Gordon, nicht im Seewind an der Küste von Lindisfarne, sondern 1946 in der rosafarbenen alkoholisierten Atmosphäre des Gargoyle. Sie spürt, wie sie glüht, entflammt ist von privaten Triumphen.
Gordon schaut finster. »Er ist ein widerlicher Kerl«, sagt er.
»Halt den Mund.«
»Er kann uns nicht hören. Der bastelt doch gerade an seiner Karriere.«
Jasper steht einige Meter weiter an einem anderen Tisch, spricht mit den dort Sitzenden. Sein gebräuntes Gesicht im Licht einer Kerze: ausdrucksvoll, gut aussehend. Er gestikuliert, bringt eine Pointe an, Gelächter bricht aus.
»Du hast in Bezug auf Männer immer schon einen zweifelhaften Geschmack gehabt«, sagt Gordon weiter.
»Tatsächlich?«, sagt Claudia. »Das ist doch mal eine interessante Feststellung.«
Sie starren sich an.
»Ach, hört doch auf, ihr beiden«, sagt Sylvia. »Das hier soll eine Feier sein.«
»Genau«, sagt Gordon. »Genau. Los, Claudia, feiern.« Er kippt den Rest aus der Flasche in ihr Glas.
»Das ist wirklich toll«, sagt Sylvia. »Dozent in Oxford! Ich kann’s immer noch nicht ganz glauben.« Ihre Augen ruhen immerzu auf Gordon, der sie kein einziges Mal ansieht. Sie zupft einen Faden von seinem Jackenärmel, berührt seine Hand, zieht ein Päckchen Zigaretten heraus, lässt es fallen, hebt es vom Boden auf.