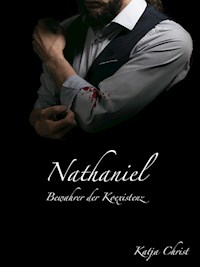
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Nathaniel ist ein Geschöpf der Nacht. Er ist einer der ältesten Vampire, die auf der Erde wandeln. Seine Aufgabe: die anhaltende Koexistenz der Vampire mit den Menschen zu schützen. Als Special Agent O'Dell wird Nathaniel mit der Untersuchung von Morden beauftragt, um sicher zu stellen, dass Vampire den Vertrag mit den Menschen nicht brechen. Er jagt abtrünnige Vampire und führt sie ihrer Strafe zu. • Es ist ein grausamer Mord an einer Prostituierten, zu dem er gerufen wird. Doch was kümmert es die vampirische Führung, dass es bei dem einen nicht bleibt, dem ersten in einer Reihe von perversen Verbrechen an Menschen? Zumindest nicht, solange keine Vampire involviert sind. Niemand ahnt, dass diese Morde nur die Spitze einer Verschwörung darstellen, die den Frieden zwischen Menschen und Vampiren zerstören soll. Eine Verschwörung, die die ganze Welt und das System, das er zu schützen geschworen hat, bedroht. Und diese Morde zerren ihn und seine menschlichen Mitstreiter in den Mittelpunkt der Katastrophe. Wird Nathaniel die Welt vor Chaos und Zerstörung retten? Oder wird dies der letzte Fall in der glanzvollen Karriere von Special Agent O'Dell?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Katja Christ
Nathaniel
Bewahrer der Koexistenz
Roman
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Impressum
Prolog
Die Tote in der Gasse
Der Werwolfmörder
Im Kreis der Alten
Kein Team
Feierabendkaffee
Kontrolle
Erinnerungen
Blick in die Akte
Familiendrama
Jagd
Belohnung
Recherche
Training
Wo es beginnt
Trance
Besuch
Konfrontation
Jäger und Gejagter
Transfusion
Transmutation
Trainingslager
Neue Ordnung
Epilog
Nachwort
Impressum
Nathaniel – Bewahrer der Koexistenz
Text: © 2021 Copyright by Katja Christ
Cover © 2021 Copyright by Andrea Cavallaro
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt:
Katja Christ
c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str.15 15
01237 Dresden
http://www.katjachristbooks.de
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung und Verwertung sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Autorin zulässig.
Alle in diesem Roman geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Mein Name ist Nathaniel, zumindest zurzeit. Zurzeit bedeutet für mich seit mehreren hundert Jahren und vielleicht noch weitere zwei Jahrhunderte, bevor der Name nicht mehr gebräuchlich ist. Ich bin ein Vampir, einer der ältesten Vampire, die jemals unter den Sternen wandelten. Fragen Sie mich nicht nach meinem genauen Alter. Das erachten Vampire, ähnlich wie Frauen, als unhöflich. Genügen Sie sich damit, zu wissen, dass ich Ende zwanzig war, in der Blüte meines Lebens stand, als ich zu dem wurde, was ich jetzt bin. Zu einem der ältesten Vampire – nicht der älteste, aber es gibt nur wenige Exemplare meiner Art, die bereits länger existieren als ich: die Mitglieder des „Kreises“. Meine lange Erfahrung gebietet es mir, ebenfalls im Kreis zu arbeiten, doch ich bevorzuge einen anderen Job. Ich sorge dafür, dass die Mehrheit der Menschen nicht an uns glaubt, uns für Figuren aus Gruselfilmen und Horrorromanen hält. Einige Vertreter meiner Art glauben, dass der Job meiner nicht würdig sei. Sie glauben, ich verrichte Drecksarbeit, die genauso gut andere für mich erledigen könnten. Doch da liegen sie falsch.
Nathaniel ist nicht mein erster Name und voraussichtlich auch nicht mein letzter, solange ich meinen Job gut mache. Ich kann behaupten, dass ich ihn verdammt gut mache. Seit die Koexistenz vereinbart wurde, sorge ich dafür, dass wir für die Mehrheit der Menschen Mythos, reiner Aberglaube bleiben. Oft genug hat die Vergangenheit gezeigt, dass der Mensch vernichtet, was er fürchtet. Die weltweite Aufdeckung unserer realen Existenz würde eine Massenhysterie hervorrufen, die nicht nur einen Krieg, sondern die totale Vernichtung beider Spezies zur Folge hätte. Wir sind mächtig, aber wir haben unsere Schwächen. Der Mensch mit seinen Waffen, seiner Technologie ist mächtig, aber nicht mächtig genug, um uns gänzlich zu zerstören. Die große Jagd würde ausbrechen, auf beiden Seiten. Wir würden als Sieger aus der Jagd hervorgehen. Genug Menschen würden die Gabe der Unendlichkeit mit offenen Armen empfangen und ihre eigene Art verraten. So ist der Mensch. Doch mit dem letzten Menschen, der uns zum Opfer fällt oder der gewandelt würde, wäre auch unser Untergang eingeläutet.
Endzeitfantasien, die mich immer wieder in meiner Überzeugung stärken. Niemals hätten wir die Koexistenz eingehen dürfen. Wir hätten im Untergrund, im Dunkeln der Nacht unserer Existenz frönen sollen. Doch der Kreis entschied anders. Deshalb trat ich aus. Ich hatte damals im 18. Jahrhundert dafür plädiert, die Schuldigen zu eliminieren, die verantwortlichen Menschen nach unseren Bedürfnissen zu lenken, bis sich die Panik legt. Nicht zum ersten Mal hatten unvorsichtige Artgenossen Menschen auf uns aufmerksam gemacht. Immer wieder passiert es jungen Vampiren, dass sie durch die Gier getrieben zu unvorsichtig werden. So wie 1725 Peter Plogojovitz. Nur zehn Wochen hatte er nach seiner Wandlung gebraucht, um das gesamte Dorf Kisolova in Angst und Schrecken zu versetzen, immerhin derart, dass sogar der kaiserliche Amtmann des Distriktes Gradiska darüber informiert wurde.
Die Reisen zu jener Zeit waren beschwerlich, vor allem für uns Vampire. Wie gesagt, wir sind mächtig, doch auch wir haben unsere Schwächen. Tageslicht ist eine davon. Und wir werden dagegen nicht immun. Als wir in Kisolova ankamen, war Peter Plogojovitz bereits gepfählt und verbrannt worden. Pfähle zur Hinrichtung, na ja, fraglich, aber Feuer funktioniert immer, hier sind Mensch und Vampir sich sehr ähnlich.
Weiter im Fall: ich stimmte dafür, den Schaden zu begrenzen, die Verantwortlichen zu manipulieren, dass sie das Volk beruhigten. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Zeugen ausfindig zu machen und ihre Erinnerung zu lenken. Doch der Kreis entschied sehr zu meinem Unmut anders. Sie zogen eine Kooperation mit den Menschen in Betracht und beschlossen zu beobachten, wie sich die Lage entwickelte. Die Vampirpanik, die über Europa hereinbrach, schien mir in die Hände zu spielen, machte den Kreis skeptisch, ob eine Koexistenz mit dem Menschen überhaupt möglich war, und ich hoffte, meine Stimme würde endlich Gehör finden.
Leider stellte ich nur ein paar Jahre später fest, dass dem nicht so war. Wieder in Serbien erregte ein frischer Vampir 1732 die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner. Ein Artgenosse hatte in einer unangenehmen Begegnung mit einem jungen Soldaten während der Nahrungsaufnahme bei diesem unabsichtlich die Weichen zur Wandlung gestellt. Der Kreis hatte ein Wandlungsverbot für osteuropäische Gegenden ausgesprochen, damit sich der Fall Plogojovitz nicht wiederholte. Aus Angst vor Bestrafung verschwieg der Vampir den Vorfall, so dass sich der Soldat nach einem Unfalltod tatsächlich in einen Vampir verwandelte. Ohne Führung, ohne Anleitung versetzte er sein Dorf in Angst und Schrecken, so dass man ihn nur vierzig Tage nach seinem Tod ausgrub und seinem Treiben ein Ende setzte. Leider interessierten sich die Behörden für diesen Fall, so dass Arnod Paole der am besten dokumentierte Vampir aller Zeiten wurde.
Wieder war ich dafür, die verantwortlichen Führungspersonen nach unseren Vorstellungen zu manipulieren, doch der Kreis entschied erneut anders. Schon lange war eine Koexistenz in Erwägung gezogen worden. Die wissenschaftliche Betrachtungsweise, die Exhumierungen und Obduktionen angeblicher Vampire bewegten sie dazu, den entscheidenden Schritt zu tun. Sie traten in Verhandlungen mit den Menschen. Oberste Vertreter der Kirche, staatliche Oberhäupter und ausgewählte Wissenschaftlicher nahmen an den Verhandlungen teil, bis ein Vertrag ausgehandelt worden war, der beide Seiten zufrieden stellte.
Keine Morde an Menschen von unserer Seite, keine Jagd auf Vampire ihrerseits bringt es sehr oberflächlich gesehen auf den Punkt. Beide Seiten verpflichteten sich, Verstößen gegen den Vertrag auf den Grund zu gehen und die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Viele geheime Treffen, Manipulationen, schriftliche Abhandlungen, kirchliche Verbote waren nötig, die Panik zu legen. Dann trat ich aus dem Kreis aus.
Seitdem kümmere ich mich darum, dass der Vertrag eingehalten wird – von beiden Seiten. Immer wieder kommt es vor, dass ein Vampir unvorsichtig wird. Ich kümmere mich darum, dass dies keine ernsthaften Folgen nach sich zieht. Immer wieder mal gibt es Vampire, die das Tötungsverbot ignorieren. Ich jage sie und ziehe sie aus dem Verkehr. Der Kreis entscheidet über ihre Bestrafung. Ich führe die Strafe aus. Das hat mir den Ruf eingehandelt, ein gnadenloser Henker zu sein, obwohl nicht jeder durch einen Vampir verursachte Tod eines Menschen mit Exekution bestraft wird. Aber ich werde gefürchtet. Angst verleiht Macht, Macht verleiht Respekt. Ein ewiger Kreislauf.
Sicher fragen Sie sich jetzt, warum ich ein Konzept schütze, dem ich nie zustimmte, weshalb ich den Kreis die Suppe nicht allein auslöffeln ließ, die sie sich eingebrockt hatten. Nun, das hätte ich sicher tun können, doch ich gebe zu, dass ich nur ungern die Fäden vollkommen aus der Hand gebe. Ich bin nicht der Typ, der andere machen lässt und sich das Spektakel aus der Ferne ansieht. Natürlich hatte ich mit dem Gedanken, mich abzuwenden und meine Zeit abzuwarten, hämisch zuzusehen, wie ihnen ihre Pläne und ihre Koexistenz um die Ohren fliegen, gespielt. Doch tatsächlich, in einem verräterischen kleinen Winkel meines Gehirns, hatte ich mich gefragt, welche Rolle ich spielen würde, wenn diese Koexistenz doch funktionieren sollte. Ich hatte beschlossen, mir einem Sitz in der ersten Reihe zu sichern, eine Position, die es mir nicht nur erlauben würde, den Kreis im Auge zu behalten, sondern auch, mir eine gewisse Bekanntheit in der Vampirwelt und damit ein gewisses Quäntchen Macht zu sichern.
Aber es ist nicht nur mein aus meiner Position als Vampirjäger und Henker resultierender Ruf, der mir Macht verleiht. Film- und Literaturvampire greifen immer wieder Eigenschaften und Fähigkeiten auf, die wir tatsächlich besitzen. Übermenschliche körperliche Kräfte, geschärfte sinnliche Wahrnehmung, hier vor allem Nachtsicht und Gehör, gesteigerte Widerstandsfähigkeit, um die bekanntesten zu nennen. Darüber hinaus verfüge ich über einige mentale Tricks, die es mir als einer der ältesten Vampire erlauben, sogar Artgenossen meinem Willen zu unterwerfen. Kurz, ich bin eine furchterregende Bestie hübsch verpackt. Nennen Sie es wegen mir Arroganz, doch mein äußeres Erscheinungsbild allein macht es fast zu leicht, Menschen wie Vampire in meinen Bann zu ziehen. Doch all diese Fähigkeiten kosten Energie – Energie, die genährt werden will. Sie wissen, was ich meine, ich spreche von Blut, menschlichem Blut. Wir brauchen Blut zum Überleben, wie Menschen Wasser. Tierblut lässt uns überleben, doch es verkrüppelt unsere Fähigkeiten. Nur menschliches Blut verleiht uns Macht. Nur menschliches Blut verleiht uns Menschlichkeit. Tierblut macht uns zu Bestien. Und hier sind wir schon beim Kern der Koexistenz angekommen. Die Menschen geben uns, was wir brauchen, und wir geben ihnen, was sie wollen: den Schein, die Welt zu beherrschen, die Krone der Schöpfung zu sein. Wir lassen sie ihre Gesetze aufstellen, ihre Kriege führen, ihre Gesellschaft gestalten und sie akzeptieren, dass wir uns von ihnen ernähren. Das ist die Koexistenz.
Es gibt Menschen, die uns erkennen. Sie haben die Fähigkeit uns als das zu sehen, was wir tatsächlich sind: Vampire. Diese Menschen könnten die Koexistenz gefährden, weshalb die Menschen dafür sorgen, dass sie mit Vampiren aufwachsen und uns als selbstverständlich erachten. Jedes Krankenhaus, jede Einrichtung, die mit der Geburt menschlicher Nachkommen zu tun hat, wird von der Regierung mit vampirischem Personal versehen, das die begabten Kinder zu erkennen sucht, denn bereits Neugeborene verfügen über die Fähigkeit. Ist ein Mensch als sensitiv aufgefallen, gerät er sofort in das Erziehungsnetz der Regierung und wird als Bewahrer der Koexistenz erzogen. Viele dieser Menschen dienen uns später als Spender und versorgen uns mit ihrem kostbaren Blut. Daher ehren Vampire ihre Spender und wir geben ihnen, was sie begehren.
Ich selbst habe zurzeit drei Spender, die ich hüte, wie meinen Augapfel. Gnade Gott demjenigen, der es wagt, sich meinen Spendern auf bedrohliche Weise zu nähern. Ich würde alles tun, um sie vor Üblem zu bewahren – alles! Sie sind mir wichtiger als alles andere auf der Welt. Und obgleich ich schon viele Spender habe altern und vergehen sehen, jeder einzelne von ihnen hat einen ganz besonderen Platz in meinem kalten Herzen. Auch wenn es so aussieht, als würden sie ein normales Leben führen, so wirkt ihr Leben für jemanden, der nur kleine Einblicke erhält, wohl alles andere als normal. Sie leben in meinem Haus, am Rande einer großen Stadt, die bereits eine lange Geschichte hinter sich hat, wenngleich nicht so lange wie ich selbst. Es ist ein Haus, das einem Vampir würdig ist, ein Haus, das selbst aus einer Gothic Novel zu stammen scheint. Kitschig, werden Sie denken, klischeehaft, doch Sie wären überrascht zu sehen, dass dies nur auf den ersten Blick so scheint. Auch Vampire wissen die Annehmlichkeiten moderner Technik zu schätzen. Auch Vampire lieben Ambiente und Gemütlichkeit. So ist mein Haus mit allem eingerichtet, was das Herz begehrt – vor allem die Herzen meiner Spender. Wenn man so lange auf dieser Erde wandelt wie ich, muss man sich über materielle Dinge keine Sorgen mehr machen. Reichtümer sammeln sich im Laufe der Jahrhunderte fast von allein. Und wozu sonst sollte ich meine unzähligen Reichtümer verwenden, als dazu, meine Spender zu verwöhnen?
Wir haben eine Übereinkunft. Ich versorge sie mit allem, was sie brauchen, ich schütze sie und lasse sie in meinem Haus leben und sie geben mir regelmäßig ihr Blut. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einem Vampir Blut zu spenden. Sind Sie Blutspender? Vielleicht beim Roten Kreuz? Nun, dann kennen Sie bereits eine Möglichkeit. Man kann seine Spender auf medizinische Art und Weise zur Ader bitten. Eine sehr nüchterne und pragmatische Art, die auf einer nüchternen und pragmatischen Zweckbeziehung basiert. Ich bevorzuge die persönlichere Möglichkeit, an das Blut meiner Spender zu gelangen, nämlich frisch aus den Adern. Zugegeben es ist eine sehr intime Vorgehensweise, die eine Menge Vertrauen auf Seiten des Spenders fordert. Vertrauen darauf, dass der Vampir weiß, wann er genug hat, dass er weiß, wann es genug ist, dass er seinem Spender nicht im Blutrausch den letzten Lebenstropfen raubt. Meine Spender vertrauen mir. Blut aus den Adern eines Menschen zu trinken, ist unglaublich berauschend, belebend, wie sonst nichts auf der Welt. Deswegen ist Bluttrinken für mich mehr als reine Nahrungsaufnahme und deswegen ist es wichtig, dass ich eine Verbindung zu einem möglichen zukünftigen Spender aufbaue, dass ich Nähe zu einem möglichen zukünftigen Spender aufbaue, dass ich Liebe zu einem möglichen zukünftigen Spender aufbaue. Es muss keine romantische Liebe sein, aber eine Liebe, die diesen Menschen für mich zu etwas Unersetzbaren macht. Dafür zahle ich einen hohen Preis. Den Preis des Verlustes, des Schmerzes und der Trauer, wann immer ich mich von einem meiner Spender verabschieden muss.
Die Tote in der Gasse
Genug der Erklärungen, lassen Sie mich mit der eigentlichen Erzählung beginnen. Wie ich bereits sagte, bin ich der Bewahrer der Koexistenz, was bedeutet, dass ich sehr eng mit den Menschen zusammenarbeite, in diesem Fall mit der Polizei. Ich gehöre einer Spezialeinheit an, die immer gerufen wird, wenn es zu ungewöhnlichen Todesfällen kommt; besser gesagt, ich bin die Spezialeinheit. Viele Polizisten kennen mich bereits, jedoch wissen nur wenige von meiner wahren Natur. Ich bin der seltsame Ermittler, der immer wieder an Tatorten erscheint, das Opfer und die Umgebung untersucht und dann wieder verschwindet. Der normale Beamte kennt mich nur von diesen kurzen Auftritten. Andere begleitete ich bereits mehrfach bei ihren Ermittlungen und unterstützte sie gegebenenfalls.
So kam es, dass ich auch an diesem Abend an eben einem solchen Tatort erschien. Die Spurensicherung war bereits im vollen Gange, als ich nach Sonnenuntergang in die abgelegene Gasse bog, in der das Opfer unter einer Decke versteckt lag. Nachdem ich, ohne aufgehalten zu werden, an den blau leuchtenden Streifenwagen vorbei ging, konnte ich bereits den alten Ermittler sehen, der an der Ecke zum besagten Tatort lehnte und mit seinem üblich verkniffenen Gesichtsausdruck eine Zigarette rauchte. Smith war sein Name, was mich jedes Mal grinsen ließ. Neben ihm stand eine junge Ermittlerin, der ich bisher noch nicht begegnet war. Sie redete, während der alte Ermittler, Sergeant Smith, nur nickte und brummte, dass ich die Vibration seiner Stimme fast spüren konnte.
„Diese Dinger werden sie umbringen, Smith!“, sagte ich amüsiert, als ich hinter ihnen zum Stehen kam. Ich konnte sehen, dass beide zusammenfuhren, da sie mich nicht hatten kommen hören. Ein Umstand, der mir nicht fremd war.
„Sergeant Smith“, verbesserte er mich und zog demonstrativ an der Zigarette.
„Wie auch immer“, erwiderte ich, wandte mich der jungen Frau zu, die mich überrascht anstarrte.
„Officer Taylor“, brummte der Sergeant, als er sie mit einer kurzen Kinnbewegung vorstellte. „Special Agent wie war gleich der Name?“
Ich lachte, denn ich wusste, dass es seine Rache für meine Ignoranz gegenüber seinem Rang war. Manchmal empfinde ich die Interaktion mit Menschen als amüsant. „O’Dell!“, stellte ich mich selbst vor und nickte ihr kurz zu, bevor sie ihre Hand ausstreckte. Es war nicht, wie es manche Vampirliteratur aufgreift, die Kälte meiner Hand, die Menschen grundsätzlich erstarren lässt, die mich so handeln ließ. Nachdem ich Blut getrunken habe, ist mein Körper gewöhnlich alles andere als eiskalt. Nein, vielmehr veranlassten mich die Handschuhe, die ich bereits übergestreift hatte, dazu, auf einen Händedruck zu verzichten.
„Was haben wir hier?“, fragte ich kurz, kniff die Augen zusammen und scannte die Umgebung nach untoten Spuren.
„Einen Mord“, murmelte Sergeant Smith. Ich war sicher, dass die junge Einsteigerin nicht bemerkte, dass ein Schmunzeln in seinen Mundwinkeln lag.
„Überraschung“, erwiderte ich. „Und wozu haben Sie mich angefordert?“
„Special Agent O’Dell, ich fordere Sie nicht an, Sie werden mir in solchen Fällen aufgedrückt.“
„Das tut mir leid“, erwiderte ich, doch sein hustendes Lachen ließ mich wissen, dass er verstand, dass mir dieser Umstand vollkommen egal war. Officer Taylor starrte mich immer noch an, ließ ihre Augen nur kurz zu ihrem alten Kollegen wandern. „Gefällt Ihnen, was Sie sehen?“, fragte ich daher, woraufhin unübersehbar Blut in ihre Wangen schoss und sie sich peinlich berührt abwandte.
„Baggern Sie nicht das Mädchen an, O’Dell, machen Sie lieber Ihre Arbeit! Ich habe keine Lust bis morgen früh hier zu stehen.“
„Ein Mord, also“, murmelte ich. „Da Sie mir offensichtlich die Überraschung nicht verderben wollen, werde ich selbst nachsehen, weshalb Sie mich anforderten.“
„Versauen Sie mir nur nicht den Tatort!“, rief er mir hinterher und sein tiefes, hustendes Lachen verfolgte mich, als ich die schmale Gasse betrat und mich langsam dem zugedeckten Opfer näherte. Die Leute der Spurensicherung kannten meine Auftritte während ihrer Arbeit und ignorierten mich. Noch nie hatte ich ihnen einen Tatort versaut, um es mit Sergeant Smiths Worten zu sagen. Und das würde auch niemals passieren. Vielmehr sorgte ich mich, dass sie bereits meinen Tatort verunreinigt hatten. Ich würde mir die Fotos später ansehen und mit meinen Eindrücken vergleichen müssen. Der Gerichtsmediziner vor Ort warf mir einen kurzen Blick zu, deckte die Leiche auf und trat wortlos zurück. Ich betrachtete sie eindringlich. Es war eine junge Frau, vielleicht Mitte zwanzig, die vor mir auf dem Bauch lag. Ihr Kopf schien ungewöhnlich positioniert, was daran liegen konnte, dass ihr Genick gebrochen war. Ihr platinblond gefärbtes Haar roch noch immer nach Blondierungsmitteln. Orangeroter Lippenstift auf ihren vollen Lippen, zu starker Lidschatten und zu viel Makeup zeugten davon, dass jemand eher Quantität, statt Qualität zu schätzen schien. Ihre Kleidung bestand aus einem kleinen Schwarzen. Der hohe Polyesteranteil – nämlich hundert Prozent – bestätigte das fehlende Geschick oder Geld für Qualität.
Ich atmete ein, schüttelte mich unmerklich aufgrund des Geruchs, der mich immer wieder abstieß. „Spuren sexueller Übergriffe“, murmelte ich.
„Spuren ist geschönt“, hörte ich die emotionslose Stimme des Gerichtsmediziners. „Sie wurde mehr als offensichtlich vergewaltigt. Missbraucht mit sicher nicht nur menschlichem Sexualwerkzeug.“
Ich deckte sie weiter auf, erkannte, dass sie barfuß war. Blutrinnsale liefen ihre mit Hämatomen übersäten Beine hinunter. Ich musste die letzten Zentimeter des Kleides nicht heben, um zu wissen, wo der Ursprung dieser Rinnsale lag. Vorsichtig hob ich ihre Haare, die ihren Nacken bedeckten und betrachtete ihn fasziniert. Die Haut war aufgerissen, die Muskulatur verletzt, als hätte jemand darauf herumgekaut.
„Da hatte jemand Appetit“, kommentierte der Mediziner hinter mir weiter.
„Nein“, widersprach ich. „Ihr Blut ist unangetastet.“
„Woher wissen Sie das?“
„Die Blutlache ist zu groß. Sie blutete einige Zeit, bevor man ihr das Genick brach, aber das Blut wurde nicht aufgefangen. Hätte jemand Appetit gehabt, hätten wir jetzt kein Blut.“
Der Mediziner war ein sensitiver Mensch, der wusste, weshalb ich die Leiche betrachtete, der wusste, dass er vor sich einen Experten hatte, was Appetit auf Blut anging. Er selbst arbeitete als praktizierender Arzt, wurde aber als Experte für vampirische Opfer genauso wie ich zu solchen Tatorten gerufen.
„Ein Werwolf vielleicht, der mehr auf handfeste Nahrung steht?“
Ich lachte. „Sie sind ein Fantast, Doc“, erwiderte ich. „Es gibt keine Werwölfe.“
„Es gibt auch Leute wie Sie“, murmelte er.
„Ja, aber keine Werwölfe! Menschen, die sich in Tiere verwandeln, weil der Mond aus unserer Sicht ganz von der Sonne angestrahlt wird, wie lächerlich ist das denn bitte?“
Der Mediziner lachte leise. „Wenn Sie das sagen! Dennoch war jemand auf der Suche nach fester Nahrung.“
„Auch diesbezüglich muss ich Ihnen widersprechen. Jemand wollte, dass es so aussieht, als sei jemand auf Nahrungssuche gewesen. Ihre Muskulatur ist zerfetzt, aber sie ist immer noch vorhanden.“
Der Mediziner seufzte. „Sie haben wie immer Recht.“
Ich wandte mich kurz zu ihm um. „Sie wollten mich testen“, sagte ich amüsiert. „Natürlich wussten Sie bereits, dass kein Stück fehlt.“
„Das wird die Obduktion zeigen.“ Er grinste breit.
Ich wandte mich wieder der Leiche zu, streckte die Hand aus und hielt sie wenige Zentimeter über die Wunde. Ich schloss die Augen und fühlte. Ich fühlte die Wunde, das Fehlen von Leben. Ich fühle niemals den Tod, immer nur die Abwesenheit des Lebens. Ich forschte nach Schwingungen, nach Spuren, die auf übernatürliche Energien schließen ließen. Nichts!
„Ich werde hier nicht gebraucht“, sagte ich schließlich, während ich mich umsah, meinen Blick durch die für Menschen dunkle Gasse schweifen ließ, aber keine vampirische Anwesenheit ausmachen konnte.
„Dann schönen Abend noch!“ Der Mediziner nickte, als ich mich ihm zuwandte und langsam wieder zu Sergeant Smith und seiner jungen Kollegin zurückkehrte.
„Special Agent Halloween kehrt zurück“, hörte ich den Sergeant auf weite Entfernung flüstern. Hatte ich etwas verpasst, als ich mir die Leiche angesehen hatte? Vermutlich, denn die Anwesenheit der beiden hatte mich nicht interessiert. Meine ganze Aufmerksamkeit hatte auf dem Opfer gelegen. Der Sergeant rief mich zu solchen Mordfällen, wie es die Vorschriften vorsahen, doch er betrachtete mich mit gemischten Gefühlen. Er hatte genügend Situationen erlebt, in denen meine Erkenntnisse und Erläuterungen ihm Schauer über den Rücken gejagt hatten. Er hatte genügend Situation erlebt, in denen ich selbst ihn hatte erstarren lassen, in denen ihm das Blut in den Adern gefroren war und sich seine Nackenhaare aufgestellt hatten. Dass er dies jedoch mit dem Welpen an seiner Seite teilte, überraschte mich dennoch. Ich würde ihn beizeiten darauf ansprechen.
„Und?“, fragte er an mich gewandt, als ich vor ihm stehenblieb.
„Damit, Sergeant, müssen Sie selbst fertig werden“, erwiderte ich. „Dieser Fall geht mich nichts an.“
Überraschung flog über sein Gesicht, als ich die Handschuhe von meinen Händen zog. „Jemand hat auf ihr herumgekaut!“
Ich nickte. „Und sie wurde auf das Übelste missbraucht, bevor sich jemand ihrer erbarmte und ihr das Genick brach. Sieht aus, als sei da ein Rollenspiel aus dem Ruder gelaufen.“
„Ein Rollenspiel?“
Die junge Frau musterte mich kritisch, sagte jedoch keinen Ton. Ihr Blick lag auf meinen Augen, doch ich konnte nicht ergründen, was in ihr vorging, während sie mich auf diese Art ansah.
Seltsam, dachte ich. Normalerweise konnte ich Gefühle spüren, Gedanken, nein, nicht lesen, aber antizipieren. Bei ihr nicht! Kurz überlegte ich, ob sie sensitiv war. Doch dann hätte sie bereits auffallen müssen, zudem fehlte ihr eine gewisse Ausstrahlung, die sensitive Menschen eindeutig als solche identifizierte. Ich würde sie überprüfen lassen.
„Können wir reden?“, fragte ich.
Der Sergeant warf einen kurzen Blick auf die junge Frau. „Taylor, gehen Sie schon einmal vor, wir sind hier fertig. Ich komme gleich.“
Sie zog die Augenbrauen zusammen, als wollte sie protestieren, doch dann wandte sie sich schweigend ab. „Ihnen auch noch einen angenehmen Abend, Officer Taylor!“, rief ich hinter ihr her, doch sie ignorierte es. Wenn das nicht einmal der mieseste Start zwischen mir und einem Menschen war, den ich je erlebt hatte. Sollte sie tatsächlich zukünftig mit Sergeant Smith fahren, um etwas zu lernen, wie er immer betonte ...
„Lassen Sie das Mädchen in Ruhe, O’Dell!“, unterbrach der alte Sergeant meine Gedankengänge.
„Keine Sorge“, murmelte ich. „Ich habe keinen Bedarf.“
Ich hörte ihn tief einatmen. „Zum Fall, O’Dell! Für mich sieht es eindeutig nach einem Monster aus!“
„Monster ja“, stimmte ich zu. „Aber keines meiner Art!“
„Etwas anderes, vielleicht? Ein Werwolf?“
Ich lachte. „Was habt ihr Menschen immer mit euren Werwölfen?“, fragte ich. Er musterte mich verwirrt. „Es gibt keine Werwölfe. Menschen, denen plötzlich Fell aus der Haut sprießt und eine Wolfsschnauze wächst, lächerlich!“
„Dachte ich auch von Vampiren. Untote, die tagsüber in Särgen schlafen und nachts menschliches Blut trinken, lächerlich! Und doch stehen Sie hier vor mir.“
„Ich schlafe nicht in einem Sarg!“ Ich grinste breit, als er die Augen verdrehte.
„Es war also kein Werwolf!“, begann er erneut.
„Nein! Es ist nicht mal Vollmond!“
„Es gibt sie wirklich nicht?“
„Solange ich auf Erden wandle, ist mir keiner begegnet. Und glauben Sie mir, wenn es welche gäbe, wäre mir mindestens einer begegnet.“
„Aber es gibt Legenden über Werwölfe wie über Vampire.“
„Ja, und ihr Ursprung geht auf eben jene zurück, Vampire. Vampire, die zu viel oder ausschließlich tierisches Blut zu sich nahmen.“
Der Sergeant musterte mich nachdenklich. „Du bist, was du isst!“, murmelte er.
Ich nickte. „Trinkst, in unserem Falle. Tierblut verwandelt uns in Bestien. In animalische, instinktgesteuerte Bestien, die keinen Hauch von Verstand mehr besitzen.“
„Werwölfe, also!“ Sergeant Smith grinste, als ich seufzte.
„Bestien!“, verbesserte ich ihn. „Vampiren wächst weder ein Fell, noch verlängert sich ihr Gesicht zu einer Wolfsschnauze.“
„Könnte solch eine Bestie Appetit auf Menschfleisch bekommen?“
Ich schüttelte den Kopf. „Es war kein Vampir. Auch eine Bestie hätte das Blut nicht zurückgelassen. Vor allem keine Bestie! Außerdem steht Fleisch nicht auf vampirischen Speisekarten.“
„Auch nicht auf bestialischen?“
„Nein! Wir können keine feste Nahrung zu uns nehmen und es fehlen Spuren untoter Beteiligung. Es ist kein Vampir involviert. Mit hundertprozentiger Sicherheit nicht! So sehr ich unsere Zusammenarbeit schätze, Sergeant, das ist allein Ihr Fall.“
„Was machen Sie, wenn Sie es mit einer Bestie zu tun haben?“, fragte er, als habe er meine letzte Erklärung nicht gehört.
„Da soll Sie nicht interessieren.“
„Schlachten Sie sie?“
Ich lachte. „Ich bin Henker, kein Schlachter, Sergeant. Einer Bestie kann man kaum einen Mord zur Last legen, denn sie handelt ihrem Instinkt entsprechend.“
„Sie lassen sie laufen? Wahllos morden?“
Ich schüttelte den Kopf. „Das würde unsere Koexistenz gefährden, richtig?“
„Was tun Sie also?“
„Wir fangen sie ein.“
Er ließ diese Information in seinem Kopf ein wenig kreisen. „Sie halten sich Bestien? Wie in einem Zoo?“
„Wie in einer Nervenanstalt, würde ich eher sagen. Wir versuchen, sie zu heilen.“
„Wie?“, fragte er nachdenklich, doch als ich ihn lange nur ansah, hob er schließlich eine Augenbraue und wandte sich angewidert ab. „Ich will es gar nicht wissen.“
„Das tun Sie bereits.“
„Ok, ich will es nicht aus Ihrem Munde hören. Ich will meine Ideen nicht bestätigt wissen. Machen Sie sich einen schönen Abend, während ich mir meinen Arsch wundarbeiten werde. Ich werde versuchen zu vergessen, dass wir dieses Gespräch geführt haben.“
Ich lachte. „Sammeln Sie Ihren Welpen ein, Sergeant“, sagte ich. „Ich bin mir sicher, dass sie sehr schlecht gelaunt ist, nachdem Sie sie nicht haben an unserem Gespräch teilhaben lassen.“ Er schmunzelte. „Ach, und Sergeant, sollten Sie mich nochmal gegenüber einem uneingeweihten ‚Special Agent Halloween’ nennen, werde ich überlegen, den Rinderhöfen der Umgebung öfter mal einen Besuch abzustatten.“
Im ersten Moment stutzte er, doch er kannte mich zu gut, um meine Drohung wirklich ernst zu nehmen. „Sie mit Ihrem eingebauten Abhörpeilsender! Sie können mich mal! Taylor äußerte, dass sie Sie unheimlich fand. Da wollte ich sie aufziehen.“
Ich horchte auf. Menschen fanden mich attraktiv, anziehend, gefährlich vielleicht, vor allem Frauen, aber nicht direkt bei einem ersten Treffen unheimlich, das kam erst mit der Zeit, es sei denn ...
„Sie ist keine Sensitive, O’Dell“, warf er ein, als ahnte er, welcher Idee ich nachging. „Sie wurde getestet. Sicher musste sie nur ihre Verlegenheit überspielen, nachdem Sie ihr nicht sehr charmant vor den Kopf gestoßen hatten.“
Ich ließ meinen Blick zu ihr in den Polizeiwagen wandern, wo sie saß und misstrauisch zu uns hinübersah. „Viel Erfolg bei Ihrem Fall, Sergeant, und schönen Gruß an den Welpen“, murmelte ich, bevor ich mich abwandte und langsam in der Dunkelheit verschwand.
„Egal, wie lange ich dich schon kenne, O’Dell“, hörte ich ihn murmeln, als er mich sicher nicht mehr sah. „Du bist unheimlich.“
Ja, das denken Menschen, die viel mit mir zu tun haben, dachte ich, während ich auf dem Dach eines nahen Hauses stand und seinem Wagen samt Officer Taylor hinterher sah. Und nicht nur Menschen! Ich folgte ihnen durch die Nacht, ohne dass sie Notiz von mir nahmen. Doch ihr Gespräch, das nach einigen Minuten des Schweigens langsam einsetzte, drehte sich um die tote Frau in der dunklen Gasse. Schließlich wandte ich mich ab und kehrte nach Hause zurück.
Der Werwolfmörder
Trish kam lächelnd in das opulente Wohnzimmer, auf dessen Sofa ich saß und die Zeitung las. Der Mord vor einigen Nächten nahm nur einen kleinen Teil ein, da die Polizei mit Informationen geizig umging und vermutet wurde, dass es sich um einen Mord an einer Straßenhure handelte. Niemand wollte genauer wissen, was wirklich passiert war, niemand interessierte sich wirklich dafür, außer Sergeant Smith und seine Abteilung. Ich erwiderte Trishs Lächeln, das mir eine warme Welle durch die Brust fahren ließ. Ihre feuerroten Locken hatte sie hochgesteckt, doch ein paar widerspenstige Strähnen fielen immer heraus und flogen fröhlich um ihr blasses Gesicht. Wenn nicht lustige, braune Sommersprossen auf ihrer Nase und ihren Wangen eine gewisse Farbe in ihr Gesicht gezaubert hätten, wäre ich sicher gewesen, dass ihre Haut bleicher erschien als meine eigene. Nein, nicht bleich. Ich war bleich, sie war blass. Vornehme Blässe, pflegte ich es zu nennen, wenn sie sich wieder einmal über ihren Teint beschwerte, was regelmäßig dann passierte, wenn die Tage länger und wärmer wurden und sie sich ohne Sonnenschutz kaum aus dem Haus wagte. Die Wandlung zwischen Mensch und Vampir würde für sie zumindest bezüglich der Sonne keinen großen Unterschied machen.
Sie trug einen hellen seidenen Morgenmantel, den sie locker unter ihrer Brust geschlossen hatte und der mich vor ihrem Dekolleté geteilt auf die weichen Rundungen ihrer Brüste blicken ließ. Sie hatte Kurven, die kleine Frau, weibliche Kurven, die ich liebte. Sie war anfangs immer etwas schüchtern und zurückhaltend gewesen, was ihre Figur anging, doch ich war mir sicher, dass sie mittlerweile stolz auf ihre Kurven war, auch wenn sie dies nicht zugab, sich immer als speckig bezeichnete und sich auf ihren runden Po schlug, wenn sie sich vor mir drehte und wendete.
Nun ließ sie sich elegant neben mir auf dem Sofa nieder, ein Bein auf dem Sofa unter ihrem Po angewinkelt, das andere ausgestreckt, dass ihr nackter Fuß sich auf meinen Schoß legte. Sie kannte die Wirkung, die sie auf mich hatte, wenn sie sich so in Pose warf. Ich legte die Zeitung beiseite.
„Du hast noch nichts getrunken, seit du aufgestanden bist“, sagte sie und lächelte. Sie streckte den Arm aus und hielt mir ihr Handgelenk entgegen. „Sieh mich nicht so überrascht an, ich habe mit Becca getauscht. Sie hat heute ein Date und hatte Sorge, dass sie zu blass wirkt.“
Ich lächelte kurz. „Rebecca hat ein Date?“, fragte ich.
„Ja, er ist Anwalt. Sehr gebildet und kultiviert. Ich glaube nicht, dass sie heute nach Hause kommt.“ Wie immer bemerkte sie, dass ich kurz die Augenbrauen zusammenzog. „Keine Sorgen, Nathaniel, sie gehen in ein namhaftes Restaurant. Gute Gegend und alles.“
„Auch Anwälte können Schattenseiten haben“, sagte ich.
„Er ist ein angesehener, aufstrebender junger Mann. Ich habe ihn gesehen und konnte in seiner Ausstrahlung nichts Bedrohliches erkennen.“
Ihre regelmäßigen Blutspenden für mich gaben ihnen leicht spiritistische Fähigkeiten, wie Ausstrahlungen deuten zu können. Ausstrahlung ist Energie, die jedes Lebewesen umgibt. Deswegen empfinden es Menschen als unangenehm, wenn jemand ungefragt den Persönlichkeitsabstand bricht. Die Energien vermischen sich und lassen den anderen unterbewusst die fremde Ausstrahlung spüren. Menschen mögen das nicht.
„Wenn er ihr etwas antut, werde ich vor seiner Tür stehen“, sagte ich, nahm ihr Handgelenk und küsste es zärtlich. Als ich aufsah, lächelte sie mich an. Ich ließ ihr Handgelenk sinken, griff nach ihrem Fuß und küsste den Spann. „Bist du sicher, dass du schon wieder spenden willst?“ fragte ich. „Es ist erst zwei Tage her.“
„Ja“, antwortete sie leise.
Ich ließ meine Lippen langsam ihr Bein hinaufgleiten, küsste ihre glatte, weiche Haut, die sie offensichtlich gerade erst rasiert hatte. Unter dem Duft des Rasiergels, des Duschschaums und der Hautlotion roch ich sie. Ich liebte ihren Duft, atmete ihn tief ein, um ihn für alle Ewigkeit in ihrem Platz in meinem Herzen zu bewahren. Ihr Blick lag auf mir, während ich langsam Zentimeter für Zentimeter ihr Bein hinaufküsste. Ich hob ihr Bein, um meine Nase durch ihre Kniekehle streichen zu lassen, wobei ihr Morgenmantel hinaufrutschte, und mir erlaubte, den Oberschenkel weiter hinaufzusehen. Ich erhob mich ein Stück, so dass sie auf dem Sofa zurückfiel und leise kicherte. Ich küsste ihren Oberschenkel, sah dabei in ihre grünen Augen, die mich beobachteten.
„Nicht meine fetten Beine“, flüsterte sie, woraufhin ich sie vorsichtig biss, ohne ihre Haut zu verletzten.
„Ich sehe keine fetten Beine“, erwiderte ich.
Sie ließ ihren Kopf zurückfallen, als ich ihre Kniekehle über meine Schulter legte und an der Stelle stoppte, wo ich den leichtesten Zugang zu ihrer Vene spürte. Ich verharrte dort, begann an ihrer Haut zu saugen, als wollte ich ihr einen dicken, schwarzen Knutschfleck machen, bis ich meine Zähne zielgenau in ihre Ader stieß und ihr liebliches Blut in meinen Mund laufen ließ. Sie gab ein ersticktes Glucksen von sich, während ich in kleinen Schlucken trank. Sie seufzte, legte ihren Handrücken an ihren Mund. Ich spürte, dass sie sich mir entgegenreckte, hörte, dass sie in schnellen Zügen geräuschvoll atmete, bis ich von ihr abließ, darauf achtete, dass kein Blut auf den seidenen Morgenmantel oder das Sofa tropfte, und ihre Wunde mit der Zunge so lange vorsichtig feuchtete, bis sie sich schloss. Ich richtete mich auf, hob sie auf meinen Schoß und drückte sie fest an mich. Ihr Kopf legte sich auf meine Schulter, ihre Stirn drückte gegen meinen Hals. Ihre Hände krallten sich in mein Hemd. Ich schloss die Augen, hielt sie fest umschlungen, während ihre Wärme durch meinen Körper fuhr und mich wohlig schaudern ließ. Erst als das Zittern ihres Körpers nachließ und sich ihr Atem normalisierte, legte ich sie sanft auf das Sofa und deckte sie zu. Gab mir ihr Blut Wärme, so fror sie oft durch den Blutverlust. Sie hielt die Augen geschlossen, kuschelte sich auf dem Sofa in sich zusammen. Ich verschwand im Bad, wo ich auf dem geschlossenen Toilettendeckel sitzend ihr Blut schmeckte, bis es gänzlich verschwunden war. Dann erst beugte ich mich über das Waschbecken und spülte meinen Mund aus. Eine Geste, die ich meinen Spendern zuliebe tat, denn auch wenn sie mir ihr Blut freiwillig überließen, so schauderte ihnen doch bei dem Gedanken daran, dass dieses Blut durch meinen Mund geflossen war, der sich in der folgenden Intimität durchaus auf ihre Haut legen konnte.
Als ich zu ihr zurückkehrte, lag sie unverändert da. Ich beugte mich über sie, küsste ihre Wange, ihr Ohr, ihre wilden Locken. „Ich danke dir“, flüsterte ich, spürte die Gänsehaut, die über ihre Haut ging.
Sie lächelte. „Es ist unbeschreiblich“, sagte sie stimmlos. „Unbeschreiblich! Jedes Mal!“
Ich wollte mich zu ihr auf das Sofa setzen, sie in meine Arme schließen, als es am Tor klingelte. Ich hasse es, wenn jemand in diesen zweisamen Momenten stört, in den Momenten, in denen ich meinen Spendern so nah bin. Missmutig ging ich zur Haustür, warf einen Blick auf den Monitor, der das Bild der Überwachungskamera wiedergab.
„Sie wissen genau, wann Sie stören, nicht wahr, Sergeant?“, knurrte ich in das Mikrophon, löste aber das Türschloss, dass er eintreten konnte. In seiner Begleitung befand sich Officer Taylor, die mit überraschter Bewunderung das Anwesen bestaunte. Sicher fragte sie sich, wie es dazu kam, dass ein Special Agent in solch einer Villa lebte. Ich beobachtete sie, während sie mit ernstem Gesichtsausdruck, der durch den strengen, schwarzen Flechtzopf noch ernster wirkte, um sich blickte. Selbst in der minderwertigen Aufnahme der Kamera konnte man erkennen, dass ihr Gesicht schön war, wenngleich sie es mit der zu strengen Frisur zu vertuschen suchte. Ihre großen Augen waren dunkel, von genauso schwarzen Wimpern gesäumt. Sie trug kein Makeup, wahrscheinlich um ihre natürliche Autorität, die sie in ihrem Job benötigte, nicht zu untergraben. Wer nahm schon ein Püppchen ernst, das besser auf der Damentoilette den Lippenstift nachziehen sollte, als sich mit schweren Jungs auseinanderzusetzen. Ich war mir sicher, dass sie hervorragende Kampfkünste an den Tag legen konnte, wenn sie wollte, dass sie in allen Bereichen der Polizeiausbildung hervorragend abgeschnitten hatte. Eine Streberin, ehrgeizig und zielstrebig, der es nur noch an Erfahrung fehlte und die sicher noch lernen musste, die Vorschriften nicht zu ernst zu nehmen, sondern nach ihrer Notwendigkeit zu dehnen.
„Wer ist es?“, hörte ich Trish aus dem Wohnzimmer.
„Sergeant Smith in Begleitung“, antwortete ich.
„Ist es schlimm, wenn ich liegen bleibe?“
Ich lachte, ging zu ihr hinüber und küsste ihre Locken. „Nein, Süße, bleib liegen! Wir huschen nur an dir vorbei.“
Sie lächelte, zog die Decke höher und kuschelte sich tiefer in das Sofa, während ich zur Haustüre zurückkehrte. Ich wusste, wie viel Zeit ich hatte, bis die beiden den langen Weg hinter sich gebracht hatten. Mit einem letzten Blick auf den Monitor, auf dem zu sehen war, dass sie die geschwungenen Treppen zur schweren Haustüre hinaufstiegen, öffnete ich die Tür.
„Sie müssen mich vermisst haben, dass Sie mich jetzt schon zu Hause belästigen, Smith.“
„Sergeant Smith“, betonte er wie üblich. „Können wir drinnen reden?“
Ich machte die Tür frei, ließ ihn an mir vorbei eintreten. Officer Taylor musterte mich wortlos, nickte allerdings, als sie in die Eingangshalle trat. „Ich hätte nicht gedacht, Sie so schnell wieder zu sehen, Officer Taylor“, sagte ich und legte mein laut Trish charmantestes Lächeln auf.
„Lassen Sie das Mädchen in Ruhe, O’Dell“, knurrte der Sergeant, woraufhin ich leise lachte.
„Also? Was ist so dringend, dass Sie mich privat aufsuchen?“
„Sehen Sie sich doch bitte die Bilder an“, antwortete er, nickte Officer Taylor über die Schulter hinweg zu. Sie reichte mir einen Hefter, in dem sich ein ganzer Satz Bilder befand. Ich öffnete ihn, blätterte ihn kurz durch.
„Ein weiterer Mord“, murmelte ich.
„Gleiche Umstände, wieder eine Straßenhure, verdammt, sogar in der gleichen Gasse.“
Ich ließ meinen Blick über die Bilder gleiten, bemerkte den seltsam positionierten Kopf, das Blut an den von Hämatomen übersäten Beinen, die Wunde im Nacken. Nur, dass es sich dieses Mal um eine Brünette handelte, die ähnlich billig geschminkt in ähnlich billiger Kleidung dalag. Der Mörder bevorzugte die Verlierer der Gesellschaft, doch das war ein Problem der Menschen. Ich reichte Officer Taylor den Hefter zurück.
„Unschön, aber es ist Ihr Fall, leider nicht mein Zuständigkeitsbereich.“
Ich sah, dass Officer Taylor mich fast empört anstarrte, als ich das sagte. Für sie offensichtlich nicht nachvollziehbar, dass ich keine Anteilnahme zeigte. Nicht, dass es mir egal war, dass jemand in dieser Stadt junge Frauen bestialisch ermordete, doch mein Job konzentrierte sich nun einmal auf andere Bereiche. Meine Aufgabe war, die Koexistenz zu schützen, nicht menschliche Abgründe zu recherchieren. Das war eine Angelegenheit der Menschen.
„Ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht bald in Ihre Zuständigkeit fallen wird, O’Dell.“
Ich betrachtete ihn, spürte seine Besorgnis, seufzte und deutete den beiden Polizisten, mir zu folgen. Ich führte sie durch das Wohnzimmer vorbei an Trish, die unter der Decke kaum zu erkennen war. Sergeant Smith schien in Gedanken zu besorgt, sich in meinen Räumlichkeiten umzusehen. Officer Taylor hingegen machte keinen Hehl daraus, dass sie sich verwundert umblickte. Wenn ich ihren Blick richtig deutete, malte sie sich gerade das Bild eines gelangweilten Millionenerbens aus, der als Hobby ausgewählte Fälle für die Polizei bearbeitete.
„Kaffee?“, fragte ich, deutete auf die Stühle um den Küchentisch und Sergeant Smith setzte sich sofort mit einem tiefen Schnaufen. Officer Taylor hingegen blieb stehen, sah sich immer noch um.
„Setzen Sie sich, Taylor“, schnaubte der Sergeant, woraufhin sich die junge Frau langsam dem Tisch näherte. „Mit Zucker, bitte!“, fügte er an mich gerichtet hinzu. Langsam ließ sich Officer Taylor nieder, ihre Augen hafteten auf mir, als ich mit Rebeccas semiprofessionellen Kaffeevollautomaten zwei Tassen frischen Kaffee zauberte und servierte, das Zuckerdöschen demonstrativ direkt vor Sergeant Smiths grobe Hand stellte. „Diesmal war die Presse vor Ort“, begann er zu berichten. „Jemand muss ihnen gesteckt haben, dass der zweite Mord dem ersten bis ins letzte Detail gleicht.“
„Nicht ganz, diesmal ist es eine Brünette“, warf ich ein, doch Sergeant Smith winkte ab.
„Bereits vor Ort konnte ich hören, dass sie vom Werwolfmörder sprachen.“
Ich lachte, doch weder dem alten Mann noch der jungen Frau schien zum Lachen zumute. „Wer die Frauen auch immer umgebracht hat, wird sich geehrt fühlen und es wieder tun, dem Ruhm zu Ehren.“
„Ein zweifelhafter Ruhm“, entfuhr es Taylor und ich sah den scharfen Blick, den der Sergeant ihr zuwarf, woraufhin sie den Blick senkte. Sofort begriff ich, was hier lief, verstand ich ihre schweigsame Art. Er hatte ihr verboten, mit mir zu reden. Er hatte Angst. Er wollte sie schützen – vor mir! Eine junge, offensichtlich schöne Frau und ein Vampir. Wie er ihr das wohl erklärt hatte? Hatte er die Herzensbrecher-Geschichte ausgepackt? Der Frauenheld, der allem hinterherstellte, was nicht bei drei auf den Bäumen war? Der verwöhnte, arrogante Casanova?
„Ein zweifelhafter Ruhm passend zu einem zweifelhaften Hobby“, entgegnete ich, lehnte mich an die Küchenanrichte. „Bedauernswert, aber ich sehe immer noch keinen Zusammenhang zu meinem Aufgabenbereich.“
„Wie Sie sagten, wird er vielleicht wieder morden“, fuhr Sergeant Smith fort. „Es scheint, als habe er eine Verbindung zum Okkulten, als wollte er mit den Morden eine Nachricht hinterlassen, wenn Sie verstehen, was ich meine.“
Ich atmete tief ein, trat an den Tisch und nahm den Hefter erneut an mich. Ich blätterte durch die Bilder des zweiten Mordes, blätterte durch die Bilder des ersten Mordes, die meine Annahmen des Tatorts bestätigten. Keine vampirische Beteiligung, doch ich verstand, was Sergeant Smith meinte. Der Mörder wollte Aufmerksamkeit. Deshalb die gleiche Gasse, die brutale Vorgehensweise, aus der der Genickbruch wie eine Erlösung erschien, die gleiche Art, das Opfer in seiner eigenen Blutlache zu hinterlegen. Deshalb der angeknabberte Nacken. Er wollte Aufmerksamkeit, aber nicht in erster Linie menschliche Aufmerksamkeit. Der Werwolfmörder wollte unsere Aufmerksamkeit.
Ich nickte nachdenklich. „Ja, ich verstehe.“ Ich spürte die Spannung der beiden Menschen, hörte sie regelrecht im lauten Schnaufen des alten Mannes, erkannte sie in den Augen der jungen Frau. Ich war mir nicht sicher, was genau sie erwartete, was sie zu wissen glaubte. Was Sergeant Smith anging, so wusste ich genau, was er wollte, meine übersinnlichen Fähigkeiten, um den Mörder zu fassen. Ich ließ sie ihren Kaffee trinken, während ich mich auf die Bilder konzentrierte. „Ich werde Rücksprache halten“, sagte ich dann leise.
Ein zufriedener Seufzer ging über seine Lippen. Er leerte den Kaffee in einem Zug, erhob sich und nickte mir zu. „Kommen Sie Taylor!“, brummte er und ging langsam den Weg zurück, den ich sie in die Küche geführt hatte.
Die junge Frau hatte kaum an ihrem Kaffee genippt, sah dem alten Mann überrascht hinterher, warf mir einen kritischen Blick zu. „Das ist alles?“, entfuhr es ihr. „Rücksprache halten?“
„Taylor!“, rief er.
„Da draußen läuft ein Irrer herum, der Menschen annagt, und er hält Rücksprache?“
„Das ist erst einmal alles, was ich Ihnen bieten kann“, sagte ich leise und sah sie sanft an. Ihre Wut schäumte, kochte förmlich über. Ich versuchte, ihre Augen mit meinen gefangen zu nehmen, musste jedoch feststellen, dass mir dies nicht gelang. Wann war es einem Menschen zuletzt gelungen, diesem Blick zu entrinnen? Ich konnte mich nicht erinnern.
„Taylor!“, zischte der Sergeant.
„Sie haben sie mit eigenen Augen gesehen!“, fuhr sie fort. „Sie sollen für solche Fälle der Experte sein!“
„Officer Taylor!“ stieß der Sergeant nun so scharf aus, dass Trish im Wohnzimmer kurz spitz aufschrie.
„Nathaniel?“, rief sie dann besorgt.
Ich sah der jungen Frau, die vor mir innerlich tobte, besänftigend in die Augen, doch ich bekam sie nicht zu fassen. „Es tut mir leid!“, sagte ich, ging an ihr vorbei aus der Küche und trat ins Wohnzimmer, wo Trish auf dem Sofa saß, die Decke ihr auf den Schoß gefallen war, und sie mich mit weit aufgerissenen Augen anstarrte.
„Wir finden heraus“, murmelte der Sergeant abwesend, während er Trish, deren Blässe Eingeweihten eindeutig verriet, was zuvor geschehen war, anstarrte. Dann winkte er Officer Taylor und deutete ihr, ihm zu folgen. „Officer!“, sagte er dabei streng.
Nur widerwillig folgte sie ihm mit einem kurzen Blick auf Trish aus dem Haus. Als die Tür ins Schloss fiel, erwiderte ich Trishs verwunderten Blick. „Sie konnte sich dir widersetzen?“, fragte sie. Ich nickte stumm. „Dir?“, wiederholte sie ungläubig.
„Ich werde mit dem Kreis reden müssen“, sagte ich leise.
Im Kreis der Alten
Ich stand vor der großen ovalen Tafel, an denen die Mitglieder des Kreises in großen, thronartigen Sesseln saßen, mindestens drei Meter Abstand zueinander, und mich nachdenklich musterten. Ich selbst hielt Abstand zu der Tafel, denn ich wollte ihnen nicht zu nahekommen, riskieren, dass sich unsere Energien mischten. Es war eine Zusammenkunft der Ältesten, eine Zusammenkunft der mächtigsten Vampire, die immer eine gewisse Gefahr in sich barg. Niemand wusste, wie viel Macht die anderen tatsächlich besaßen, und niemand wollte es den anderen wissen lassen. Der Respekt, vielleicht auch die Angst voreinander hielt die Balance, machte es möglich, dass der Kreis funktionierte.
Mein Blick flog über die sieben Vampire, wovon nur wenige älter waren als ich, drei an der Zahl, um genau zu sein. Drei waren ungefähr im selben Zeitalter gewandelt worden wie ich und einer von ihnen war jünger. Pierre, der meinen Platz eingenommen hatte, als ich den Kreis verlassen hatte. Dass er den Mitgliedern des Kreises an Macht nicht ebenbürtig war, stand außer Frage, weshalb er meist außerhalb der taktierenden Spiele der Mitglieder fröhlich seiner Mitgliedschaft frönte. Niemand sah in ihm eine Bedrohung. Er war immer freundlich und gut gelaunt, musste seine Gefühle nicht hinter einer Maske verstecken, worum ihn die anderen meiner Einschätzung nach manchmal beneideten. Doch hatte dies auch seinen Preis, denn seine Stimme fand weniger Gewicht als die der anderen. Er konnte allerdings gut damit leben, genoss, dass er zumindest ein wenig Mitspracherecht besaß.
Ich bemühte mich, niemanden von ihnen zu lange anzusehen, doch als mein Blick auf Marianne lag, spürte ich wieder die Traurigkeit, die sich meiner immer bemächtigte, wenn ich sie sah, und ich war mir sicher, dass sie es wusste. Doch sie ließ sich nichts anmerken, musterte mich mit derselben Ausdruckslosigkeit wie die anderen Mitglieder des Kreises. Marianne, meine große Liebe als frisch gewandelter Vampir. Wie naive Kinder hatten wir unsere Liebe im Schutz der Nacht genossen, hatten wir gemeinsam gejagt, unsere neuen Mächte erforscht. Wenn einer der Mitglieder auch nur eine leise Vorstellung meiner Fähigkeiten hatte, dann war sie es. Doch mit Eintritt in den Kreis war uns diese Naivität genommen worden, war uns unsere Liebe genommen worden.
Ich streifte kurz Amaniels Blick, den ich nur zu gut kannte. Ich schätze, dass er einer der Ersten gewesen war. Nicht der erste Vampir, aber beinahe. Ich hatte eine Zeit in seiner Obhut verbracht und vermutete, dass er den ältesten Vampir getötet und seine Macht in sich aufgenommen hatte. Er hatte mich, ohne es zu wissen, gelehrt, wie man die Macht anderer Vampire im Augenblick ihres Todes in sich aufnahm. Ihm verdankte ich dadurch, dass meine Macht stetig wuchs, mit jedem Vampir, den ich eliminierte. Ich glaube nicht, dass er ahnte, dass ich ihn dabei beobachtet hatte, dass ich meine Aufgabe dazu nutzte, mächtiger und mächtiger zu werden. Nicht, um die Welt zu beherrschen, wie Sie jetzt vielleicht vermuten, sondern um irgendwann eine Gegenmacht zu dem Kreis darzustellen, ihre Macht, ihre Spiele im Zaum halten zu können, denn schon immer hatte ich befürchtet, hatte ich gespürt, dass diese Einigkeit auf wackeligem Boden stand.
„Keine Anzeichen vampirischer Beteiligung?“, hörte ich Amaniel fragen.
„Nicht bei den beiden ersten Morden“, antwortete ich. „Doch es ist offensichtlich, dass der Mensch, der diese Morde verübte, die Aufmerksamkeit eines Vampirs erringen will.“
„Du glaubst, dass er gewandelt werden will?“
Ich nickte. „Ja, in der Tat. Die Brutalität, mit der er vorgeht, soll beweisen, dass er würdig ist, dass er ein wahrer Jäger ist.“
„Also kein Sensitiver“, mischte sich Marianne ein.
„Dann wüsste er, dass dies nicht die Eigenschaften sind, die wir in einem zukünftigen Vampir zu finden wünschen.“ Amaniel winkte abwehrend mit der Hand, obgleich sein Gesicht ausdruckslos blieb.
„Das scheint ihm nicht bewusst. Woher er auch immer von unserer realen Existenz weiß, er weiß nichts über unsere Gepflogenheiten“, fuhr ich fort. „Er wird weiter morden, bis er die Aufmerksamkeit eines Vampirs erregt.“
„Dann sollten sich die Menschen bemühen, ihn schnell zur Strecke zu bringen“, entgegnete Amaniel und ich wusste, dass er nicht daran dachte, mich in diesen Fall zu involvieren.
„Sie wünschen sich meine Hilfe“, sprach ich mein mehr als offenkundiges Anliegen aus.
„Es ist kein Vampir beteiligt, die Morde sind Sache der Menschen.“
„Na ja!“ Pierre räusperte sich. „Indirekt sind Vampire beteiligt. Es könnte sinnvoll sein, diesen Menschen zu stoppen, bevor Vampire aktiv einsteigen.“
Pierre wich auf seinem Thron leicht zurück, als sich die Blicke der anderen Mitglieder auf ihn legten. Kaum merklich lehnte er sich zurück. Mein Blick schweifte von ihm zu Marianne. Ich sah sie eindringlich an, in der Hoffnung, sie würde meinen Wunsch verstehen und für mich sprechen, doch sie schwieg eisern.
„Nathaniel, lass uns einen Augenblick allein darüber beraten!“ Amaniels Blick verriet Spott und Hohn, als er dies sagte. Die Strafe dafür, dass ich gewagt hatte, den Kreis zu verlassen, dass ich gewagt hatte, so deutlich zu zeigen, dass ich den Entscheidungen des Kreises nicht zustimmte.
Ich erwiderte seinen Blick, dann ließ ich selbst ein spöttisches Grinsen über meine Lippen gehen, verneigte mich, ohne ihn aus den Augen zu lassen, und verließ den Saal. Ich kannte die Entscheidung bereits. Kopfschüttelnd schlenderte ich durch die Burg, den Stützpunkt des Kreises und starrte in die Nacht hinaus. Ich konnte Fledermäuse durch das Gemäuer fliegen hören, sah das ganze eifrige Leben, das des Nachts aus den Verstecken gekrochen kam, und beschloss, mein zweites Anliegen nicht zu äußern. Die Spannung im Saal war merklich gestiegen seit meinem letzten Besuch. Der dünne Boden unter der Stabilität des Kreises hatte deutliche Risse bekommen. Ich hatte die Gier nach Macht gespürt und wusste, dass meine Bitte, die junge Frau zu überprüfen, eine ungesunde Aufmerksamkeit auf sie legen würde. Ich würde sie selbst überprüfen müssen, möglichst ohne, dass der Kreis etwas davon mitbekam. Ich griff in meine Westentasche und fühlte nach dem kleinen Röhren, das ich darin trug, dann ging ich ohne Umschweife in die Bibliothek.
Eine ältere Dame saß wie immer am Ausgang der Bibliothek und las. Ginger muss um die fünfundsiebzig gewesen sein, als sie gewandelt worden war. Für alle Ewigkeit im Körper einer alten Dame gefangen. Manchmal tat sie mir leid. Doch heute hatte ich nicht die Möglichkeit, Mitleid zu empfinden, denn heute musste ich sie überlisten. Wir sprachen kurz, bis ich zwischen den Regalen verschwand und mit einem Buch zurückkehrte, dessen Inhalt mir eine glaubwürdige Erklärung lieferte. Während Ginger ihren Schreibtisch vorbereitete, die Daten aufzunehmen, nahm ich das Röhrchen aus der Westentasche, steckte es in den Mund und wandte mich ihr zu. Mit einem: „Du bist ein Schatz, Ginger, das muss einfach mal gesagt werden!“, nahm ich ihren Kopf in meine Hände, küsste sie und kippte ihr damit den gesamten Inhalt in den Mund. Sie schluckte in ihrer Überraschung wie jedes Mal und schon verschwand ich wieder zwischen den Regalen, stellte meine Pseudoausleihe wieder ins Regal und bewegte mich schnell zu dem Buch, das ich eigentlich begehrte. Ich ließ es in meinem Mantel verschwinden und verließ mit einem letzten Blick auf Ginger, die regungslos vor sich hinstarrte, die Bibliothek. Jeden Moment würde die Wirkung nachlassen und sie würde weiter in ihrem Buch lesen, ohne sich an meinen kurzen Besuch und seine Umstände zu erinnern. Ich wartete vor der Tür, bis ich ihre normalen Bewegungen vernahm, dann entfernte ich mich zügig aus diesen Gängen.
Es ist durchaus von Vorteil, wenn man mit einer Kräuterhexe zusammenlebt. Helen hatte eben einen solchen Garten in einem kleinen Gewächshaus angelegt und mir geholfen, mit Tränken, Tees und Räucherstäbchen aus eben jenen Kräutern und Giftpflanzen zu experimentieren. Wenn man so oft von den Machtspielen des Kreises enttäuscht wurde wie ich, wird man sehr erfinderisch. Oft hatte ich Vampire in meinem Haus festgehalten, bis das Urteil des Kreises gefallen war. Und eben jene Vampire hatten mir stets Erkenntnisse über die Wirkung der verschiedenen Giftpflanzen und Kräuter geliefert. So wusste ich, dass Stechapfel auf unseren Organismus keine tödliche Wirkung hatte, sondern lediglich zum kurzzeitigen Erstarren führte einhergehend mit temporärem Gedächtnisverlust. Jedoch einem Verlust, der als solcher nicht wahrgenommen wurde. Es war als bliebe man kurz stehen, während die Zeit weiterlief, ohne dass man bemerkte, dass man kurz außerhalb der Zeit existiert hatte. In dem Moment, in dem das Bewusstsein wieder einsetzte, war auch die Tinktur selbst im Körper unauffindbar. Ein unschlagbares Mittel, wenn man des Öfteren den Kreis umgehen musste, was bei mir durchaus vorkommen konnte.
Sie ließen sich Zeit, wohl mehr, um mir wieder einmal vor Augen zu führen, was ich weggeworfen hatte. Doch dieses Mal kam es mir sehr entgegen, dass sie mir so viel Zeit gönnten. Ich konnte das Buch ungesehen sichern, dass ich es nicht mit mir zurück in den Kreis nehmen musste und somit in Gefahr ging, entdeckt zu werden. Ich konnte ohne Hast in den Warteraum zurückkehren und mich scheinbar gelangweilt in eine wartende Position bringen, bevor ich schließlich wieder hereingebeten wurde.
„Der Kreis hat entschieden!“, begann Amaniel und ich verkniff mir, mit den Augen zu rollen. „Die Morde sind Sache der Menschen. Wir werden uns bis auf Weiteres nicht einmischen.“
Ich musterte Amaniel ebenso ausdruckslos, wie er mich ansah, ohne seinem Blick auszuweichen. „Bis auf Weiteres bedeutet, bis sich ein Vampir einmischt. Ihr wollt diesen Mörder und seine Opfer tatsächlich dazu benutzen, gesetzesfreie Vampire zu locken.“
„Hast du etwas gegen die Entscheidung des Kreises einzuwenden?“
Ich ließ ein Grinsen über meine Lippen gehen und verneigte mich. „Ich respektiere die Entscheidung des Kreises und warte auf den Dummen, der in die Falle tappt.“ Mit diesen Worten wandte ich mich um und verließ mit größter Respektlosigkeit grußlos den Saal.
Leise fluchend schritt ich durch die Gänge, schimpfte auf die Arroganz der Alten, obgleich ich nichts anderes erwartet hatte, bis mir jemand in den Weg trat. Ich war nicht überrascht, hatte seine Anwesenheit längst bemerkt, doch war er für mich kein Grund, meine wahren Ansichten zur Entscheidung des Kreises zu verbergen. Er wusste unlängst, wie ich über die Alten dachte.
„Es tut mir leid, Nathaniel“, sagte Pierre und sah mich freundlich lächelnd an. „Ich habe es versucht, aber du weißt, wie viel Gewicht sie in meine Äußerungen legen.“ Er blieb mehrere Meter von mir entfernt stehen, wagte nicht, sich mir zu nähern. Er fürchtete mich, ganz eindeutig.
„Ich weiß, Pierre“, erwiderte ich, sah ihn seelenruhig an.
Er wich meinem Blick aus, obgleich ich keine negativen Gefühle mir gegenüber wahrnehmen konnte. „Ich nehme eine Alibirolle im Kreis ein. Ich bin nach dir der Älteste. Sie brauchen mich lediglich, um die Sieben vollzumachen.“
Ich lächelte. „Immerhin hast du so Einblick in die Machtspiele der Mitglieder. Du bist immer informiert.“
Er lachte, doch dann wurde er auf einmal sehr ernst. „Du solltest vorsichtig sein, Nathaniel“, sagte er leise. „Sie fürchten dich.“
„Ich weiß, dass sie mich fürchten. Ich war Mitglied des Kreises. Sie fürchten sich alle gegenseitig.“
Pierre schüttelte den Kopf. „Sie fürchten dich weit mehr. Sie können dich nicht einschätzen, deine Macht. Du solltest deine Verachtung für sie nicht so offenkundig machen. Es könnte sie herausfordern.“
Ich musterte ihn eine Zeit lang. „Du meinst, ich könnte ihnen ein Dorn im Auge werden.“
Er zog die Augenbrauen hoch. „Das habe ich nicht gesagt.“ Doch ich wusste, dass es genau das war, das er mir hatte sagen wollen, dass er mich warnen wollte.
„Nein, hast du nicht.“
„Sei auf der Hut, Nathaniel!“, wiederholte er eindringlich und verlieh seiner Warnung Gewicht, indem er mich unbewegt anstarrte.
„Ich hoffe, du weißt, auf welche Seite du dich stellen wirst, wenn sie den Dorn herausziehen wollen, Pierre!“, flüsterte ich und setzte meinen Weg weiter fort. Er wich mir aus, doch er sah mir grinsend hinterher. Pierre, wahrscheinlich der Einzige unter diesen Vampiren, der einem Freund nahekam.
Kein Team
Ich erwachte, als die Sonne unterging, in meinem fensterlosen Gewölbe. Es hatte Vorteile, in einem Verließ zu schlafen, denn es reduzierte die Gefahr, im Schlaf angegriffen und dem Sonnenlicht ausgesetzt zu werden, ohne sich verteidigen zu können. Es gab mir die Möglichkeit, in einem großen, gemütlichen Bett zu schlafen, wie ein gewöhnlicher Sterblicher. Ich brauchte keinen Sarg, kein Bett mit sonnendichter Verriegelung. Ich konnte mich in mein Gemäuer zurückziehen, in das auch durch den Gang kein Tageslicht dringen konnte. Es gab nur zwei Möglichkeiten, mich der vernichtenden Sonne auszusetzen: das Haus wurde über mir abgerissen oder jemand zerrte mich den langen, dunklen, lampenlosen Kellergang entlang, die Treppen hinauf in das Erdgeschoss des Hauses. Die erste Möglichkeit schien eher unwahrscheinlich und die zweite würde der Angreifer sicher nicht überleben. Wir fallen nicht in eine Art Totenstarre, wenn wir tagsüber schlafen. Wir werden auch nicht bei Sonnenaufgang von einer plötzlich einsetzenden Ohnmacht überfallen. Wir können wählen, tagsüber nicht zu schlafen, müssen uns nur vor dem Tageslicht versteckt halten.
Es gab Tage, an denen ich nicht ruhte, an denen ich in meinen privaten Räumen recherchierte, experimentierte oder auch einfach nur las. Rebecca, Trish und Helen ließen sich dennoch selten in den Kellerräumen blicken. Diese Räume gehörten mir und sie respektierten meine Privatsphäre. Ich warf einen Blick auf den Monitor, der mir mit den Bildern der Kamera bestätigte, dass ich sicher ins Erdgeschoss zurückkehren konnte. Das Zeitschloss ließ sich mit dem eingerichteten Code öffnen, was mir den Einbruch der Nacht bestätigte. Wie gesagt, auch Vampire wissen den Nutzen moderner Technik zu schätzen. Ich fand Rebecca in der Küche, wo sie Abendessen für sich und die beiden anderen kochte. Sie drehte mir kurz den Kopf zu, als ich nah hinter ihr stehen blieb, und lächelte mich an. Der kurze Augenblick reichte, um die tiefen Schatten unter ihren Augen zu erkennen. Sie hatte die letzten Nächte ebenso wenig geschlafen wie ich.
„Guten Abend, Nathaniel“, sagte sie, während sie Kokosmilch in die Pfanne mit dem Hähnchencurry goss und dabei umrührte.
„Guten Abend, Becca“, erwiderte ich, tauchte meine Nase in ihr Haar und sog ihren Duft ein. Doch da war noch ein anderer Geruch, ein fremder Geruch, der sich mit ihrem vermischte. „Du warst die ganze Nacht bei ihm?“, fragte ich.
„Es wurde spät“, erzählte sie und ihr Lächeln sagte mir, dass es keine Rechtfertigung war. „Er bot mir das Bett in seinem Gästezimmer an.“
Ich hob beide Augenbrauen. „Im Gästezimmer!“, wiederholte ich überrascht.
„Du weißt, dass ich nichts überstürzen will, Nathaniel!“
„Ist er vertrauenswürdig?“, fragte ich.
„Bisher gibt es nichts, was mich daran zweifeln lässt.“
„Ein angesehener, aufstrebender Anwalt, wurde mir gesagt.“
Sie lachte leise. „Ein gutaussehender, aufstrebender Anwalt, vor allem.“
Ich grinste. Ihr Puls schlug etwas schneller bei dem Gedanken an diesen Mann und ich spürte, dass sie wahrhaftig verliebt war. „Du weißt, dass ich dich nicht zwinge, hier zu leben, Becca, nicht wahr? Du weißt, dass ich dich nicht aufhalten werde, wenn du gehen willst.“
„Nathaniel!“, stieß sie stimmlos aus, drehte sich zu mir herum und sah mich mit zusammengezogenen Augenbrauen und tiefer Falte auf der Stirn an. Ihre Hände legten sich auf meine Brust. „Was redest du denn da?“
„Ich will, dass du weißt, dass ich keine Besitzansprüche erhebe. Alles, was du mir gibst, sehe ich als großes Geschenk. Ich werde nie etwas von dir fordern.“
„Hör auf, Nathaniel!“
„Nein, Becca! Ich spüre, dass du diesen Mann magst, ich möchte nicht, dass ich dir im Weg stehe.“
„Ich habe ihn gerade erst kennen gelernt.“
„Und ihr werdet euch weiter kennen lernen. Was willst du ihm erzählen, weshalb du mit zwei weiteren Frauen und einem Mann zusammenlebst?“
Sie schüttelte den Kopf. „Das wird sich ergeben, ich werde ihm sagen, dass wir eine Familie sind.“
„Du solltest ihn nicht belügen, Becca. Sicher hat er Beziehungen, wird dich überprüfen oder besser uns, wenn ihm etwas seltsam vorkommt. Er wird herausfinden, dass wir unmöglich eine Familie sind. Wie soll er dir dann noch vertrauen?“
Sie schwieg, sah mich weiterhin mit schmerzverzerrtem Gesicht an, dann schüttelte sie den Kopf. „Ich verstehe“, flüsterte sie. „Heißt das, ich werde niemals eine Beziehung eingehen können, solange ich hier lebe?“
„Sicher kannst du das“, antwortete ich. „Du solltest dir dennoch früh genug Gedanken darüber machen, was eine Beziehung für die Zukunft bedeutet, was es für deine Art zu leben bedeutet.“
Sie seufzte, lehnte den Kopf an meine Schulter und kuschelte sich in meine Umarmung. „Ich will diese Art zu leben nicht aufgeben“, sagte sie fast stimmlos.
„Das musst du nicht, Becca, aber du solltest auf seine Fragen vorbereitet sein. Sie werden kommen und du solltest nicht naiv in die Situation gehen.“
Eine Zeit standen wir schweigend da, dann schreckte das Geräusch des kochenden Currys sie auf. Sie stellte den Herd niedriger, legte den Deckel auf und goss den Reis ab, bevor sie sich wieder zu mir herumdrehte und mich ansah. Sie kam auf mich zu, streckte die Hand aus und strich mir zärtlich über die Wange. „Du bist blass, Nathaniel“, sagte sie lächelnd. „Du hast noch nichts getrunken.“





























