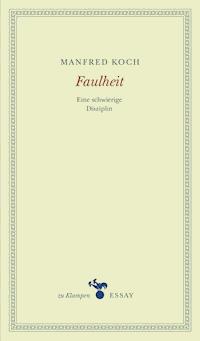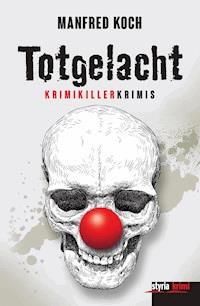Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
David Bauer ist verzweifelt: Freundin weg, Job verloren, Wohnung gekündigt. Vorübergehend kommt er im leerstehenden Haus eines Freundes unter, wo er hofft, zur Ruhe zu finden, als eine unbekannte Frau ihn am Telefon anfleht, sie vor ihrem gewalttätigen Mann zu schützen. Doch der Anruf wird abrupt unterbrochen. David möchte trotzdem helfen und stürzt dabei in ein Chaos aus traumatischen Kindheitserinnerungen, Schuldgefühlen, Gewaltvorstellungen und Rachegedanken. Seine Suche nach der Frau wird zu einem obsessiven Horrortrip, bei dem Wahn und Wirklichkeit miteinander verschmelzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Koch
Nette Leute mit Hunden
Roman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2019
Lektorat: Claudia Senghaas
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Z2sam / photocase.de
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-5958-0
Meditatio
Betrachte ich die Umgangsform des Hundes,
Komm ich zwangsläufig zu dem Schluss,
Dass der Mensch das höh’re Tier ist.
Betrachte ich die Umgangsform des Menschen,
Gesteh ich, Freund, ich werde ganz konfus.
Ezra Pound
Zitat
Das Missgeschick wird kommen und eine Weile bleiben.
Michael Cunningham
1
An meinem einundvierzigsten Geburtstag lud mich Robert ins Ristorante »Milano« zum Abendessen ein, und ich fand das einfach großartig von ihm, denn zu dieser Zeit war ich alles andere als ein unterhaltsamer Gesprächspartner, mit dem man ein paar angenehme, entspannte oder gar fröhliche Stunden verbringen konnte.
In den Monaten davor war einiges geschehen, das mein Leben gehörig durcheinandergebracht hatte. Zuerst hatte mich Laura verlassen und war mit einem Architekten, an dessen Seite sie sich ein interessanteres Leben versprach als mit mir, nach Berlin gezogen. Dann war Herr Thalheim, der Besitzer des Antiquariats, in dem ich jahrelang als Verkäufer gearbeitet hatte, völlig überraschend an einem Herzinfarkt gestorben, und weil keiner seiner drei Söhne das Geschäft übernehmen wollte, hatten sie »Das Buchgewölbe« kurzerhand geschlossen. Und zu allem Überfluss war mir zuletzt auch noch meine Wohnung gekündigt worden, und ohne Job hielt ich es für nahezu aussichtslos, eine halbwegs anständige Bleibe zu finden, die ich mir leisten konnte.
Für andere Leute wäre solch eine Situation möglicherweise überhaupt keine Katastrophe, manche sähen darin vermutlich sogar eine willkommene Chance, ihr Leben in völlig neue Bahnen zu lenken. Ich jedoch war nichts als ein Häufchen Elend, hatte nicht die leiseste Ahnung, wie es weitergehen sollte, beklagte mein Schicksal und gab aller Welt die Schuld an meiner ausweglosen Lage.
Seit Wochen lag ich meinem alten Freund Robert mit endlosen Tiraden über die Ungerechtigkeit, Dummheit und Herzlosigkeit, denen ich mich ausgeliefert fühlte, in den Ohren. Verzweiflung mündete in Wut, Wut in Ratlosigkeit, Ratlosigkeit wieder in Verzweiflung, eine monotone, zu nichts führende Spirale aus Anklagen und Selbstmitleid, die jeder andere Mensch wahrscheinlich spätestens bei der dritten Wiederholung unerträglich gefunden hätte. Aber Robert hörte sie sich immer wieder mit bewundernswerter Geduld an, und auch wenn er keinen Rat wusste, gab er mir doch wenigstens das Gefühl, verstanden zu werden.
»Dafür sind Freunde schließlich da«, sagte er jedes Mal, wenn mir mein Monolog irgendwann selber peinlich wurde und ich mich bei Robert verlegen dafür bedankte, dass er mir seine Zeit und seine Aufmerksamkeit schenkte. Und dann verspürte ich immer ein bisschen Erleichterung und einen Hauch von Zuversicht, alles könnte wieder gut werden. Doch dieses Gefühl hielt nie lange an, und schon nach kurzer Zeit versank ich wieder im Sumpf meiner trüben Gedanken. Das ging so dahin, quälend und ohne Aussicht darauf, jemals wieder aufzuhören – bis zu diesem Abend beim Italiener. Denn da tat Robert etwas, womit ich nie gerechnet hätte, und dessen Konsequenzen für mein weiteres Leben ich in ihrer ganzen Tragweite erst viel später erkennen sollte.
Als ich nach ein paar Bissen schon wieder lustlos in meiner Piccata milanese herumstocherte und gerade damit anfangen wollte, mich darüber zu beklagen, dass ich Laura offenbar nicht einmal mehr die Mühe wert war, mich an meinem Geburtstag anzurufen oder mir wenigstens eine Glückwunschkarte zu schicken, und dass ich bei den unverschämt hohen Mieten, welche die Leute schon für die mickrigsten Bruchbuden verlangten, mit meiner lächerlichen Abfindung und dem Arbeitslosengeld nie über die Runden kommen würde, und dass es heutzutage für jemanden über vierzig so gut wie keine Chance gäbe, einen vernünftigen Job zu bekommen, und dass ich mich am besten gleich umbringen sollte, um meinem Unglück ein Ende zu machen, kurz, als ich eben im Begriff war, das große Klagelied über mein Leben anzustimmen, das man mir verpfuscht hatte – genau in diesem Moment legte Robert seine Hand auf meinen Arm, griff mit der anderen in seine Jackentasche, legte einen Schlüssel aufs Tischtuch und schob ihn neben mein Weinglas.
»Dein Geburtstagsgeschenk, David. Ab sofort wird alles anders. Und jetzt freu dich gefälligst.«
Ich drehte den Schlüssel ratlos zwischen meinen Fingern.
»Danke, Robert … aber … ich versteh nicht …«
Hatte er womöglich eine billige Wohnung für mich gefunden, vielleicht sogar schon die erste Monatsmiete bezahlt? War das der Wohnungsschlüssel? Nein, viel zu schön, um wahr zu sein! Bloß keine falschen Hoffnungen, noch eine Enttäuschung konnte ich nicht brauchen. Und wieso sollte einer wie ich plötzlich wieder Glück haben?
Aber es kam noch besser.
»Was ist das?«
»Wonach schaut es denn aus?« Robert grinste.
»Ein Schlüssel. Ich bin ja nicht blöd.«
»Wieso fragst du dann?«
»Ich hab ja auch gemeint: Wofür ist der? Entschuldige, dass ich mich nicht vernünftig ausdrücke, aber offenbar bin ich sogar schon unfähig, eine verständliche Frage zu formulieren, verliere wohl den Verstand und bemerke nicht einmal, wie ich langsam aber sicher verrückt werde –«
»Stopp«, sagte Robert. »Stopp! Kein Wort mehr.« Und so, wie er mich dabei ansah, war mir sofort klar, dass ich jetzt Pause hatte und zur Abwechslung einmal er dran war mit Reden und ich mit Zuhören.
Er nahm mir den Schlüssel aus der Hand und hielt ihn mir demonstrativ unter die Nase. »Das hier«, er sprach betont langsam und überdeutlich, als würde er mit einem Schwerhörigen reden, »das hier, das ist der Schlüssel für mein Haus. Und das hier«, jetzt schrieb er mit einem Kugelschreiber etwas auf meine Papierserviette und legte den Schlüssel drauf, »das hier ist die Adresse. So, und dies hier, mein Freund«, nun hob er sein Weinglas und prostete mir zu, »dies hier wird für lange Zeit unser letztes Treffen gewesen sein. Ich werde nämlich für mindestens ein Jahr verschwinden, in acht Stunden sitze ich schon im Flugzeug.«
Und dann erzählte er irgendwas über unerträglichen Stress im Beruf, über Grenzen der Belastbarkeit, über Burn-out, über Auszeit, Nachdenken, Selbstfindung und den Sinn des Lebens, über Ruhe, Meditation und Seelenfrieden in der Abgeschiedenheit eines buddhistischen Klosters in Indien oder Thailand oder Tibet, was weiß ich, jedenfalls irgendwo am Ende der Welt, wo er unerreichbar sein würde, und zwar für ausnahmslos jeden, also auch für mich. Aber dafür könne ich bis zu seiner Rückkehr in seinem Haus wohnen, womit ich immerhin eine Sorge weniger hätte, vorerst wenigstens, und danach würden wir weitersehen. Doch wer weiß, vielleicht hätte ich dann ohnehin schon einen neuen Job und möglicherweise sogar eine neue Freundin. In der Nachbarschaft lebten nämlich eine Menge Frauen, die für mich sicher interessant sein könnten, junge Witwen, unglückliche Ehefrauen, hübsche Töchter, und über kurz oder lang würde ich meiner Laura keine einzige Träne mehr nachweinen. Du hast leicht reden, dachte ich, denn im Unterschied zu mir konnte Robert jede Frau um den Finger wickeln, und allein aus den wenigen Andeutungen, die er einmal darüber gemacht hatte, schloss ich, dass er dieses Talent auch weidlich ausnutzte.
»Jede Wette, David, die Welt wird für dich bald ganz anders ausschauen.« Er schenkte uns Wein nach, lächelte und hob sein Glas. »Viel Glück, mein Freund. So, und jetzt bist wieder du dran. Was sagst du dazu?«
Was sollte ich sagen? Was, außer wie dankbar ich ihm war? Das mit den Frauen war Unsinn, aber die Möglichkeit, ein Jahr mietfrei wohnen zu können, erschien mir tatsächlich wie ein erster heller Streifen am Horizont. Und auf einmal konnte ich nicht anders, als aufzustehen und Robert über den Tisch hinweg wortlos zu umarmen.
»Komm, David, lass das bitte«, sagte er sichtlich unangenehm berührt und drückte mich auf meinen Sessel zurück. »Dafür sind Freunde schließlich da. Und jetzt iss endlich deine Piccata auf, bevor sie ganz kalt wird.«
Glück gehabt, dachte ich, verdammt viel Glück. Glück im Unglück, wie man so schön sagt. Damals konnte ich ja noch nicht wissen, was ich heute weiß: Wenn man glaubt, dass alles gut ist, fängt der Wahnsinn erst richtig an.
2
Das Erste, was mir auffiel, als ich am Tag nach Roberts Abreise um die Mittagszeit sein Haus betrat, war der Geruch. Ich stellte meine Reisetasche im Flur ab, schloss die Augen, um mich besser konzentrieren zu können, und atmete vorsichtig ein. Kein Zweifel: Es roch nach Hund.
Nasses Fell, Hundesabber, Ausdünstungen, Scheiße – mit dieser Geruchsmischung in der Nase bin ich aufgewachsen, die hat sich in mein Gedächtnis hineingefressen, so wie sie sich in Teppiche, Vorhänge und Polstermöbel hineinfrisst, aus denen man sie auch nie wieder herauskriegt, egal, wie sehr man sich bemüht.
Und als ich dann auch noch die Hundeleine und den ledernen Beißkorb sah, die an Garderobenhaken neben der Haustür hingen, wusste ich, dass ich mich nicht getäuscht hatte.
Aber ich war doch ziemlich irritiert und fragte mich, wieso nie von einem Hund die Rede gewesen war – mit keinem einzigen Wort, nicht einmal in der leisesten Andeutung –, als Robert mir beim Italiener all die Dinge aufgezählt hatte, die ich bitte regelmäßig erledigen solle, angefangen beim Abtauen des Kühlschranks bis hin zum Staubsaugen, Fensterputzen und Rasenmähen. Den Rasen regelmäßig zu mähen, hatte er mir sogar mindestens drei Mal aufgetragen, als sei ein gemähter Rasen das Wichtigste auf der Welt. Aber nicht eine Silbe über einen Hund. Ein Hund war doch keine so bedeutungslose Nebensache, dass Robert einfach vergessen haben konnte, ihn zu erwähnen.
Oder hatte ich es überhört, war es verloren gegangen in dem Durcheinander aus Frustration und Vorfreude, das in meinem Kopf geherrscht hatte? Wie auch immer, jetzt war es zu spät, ich konnte Robert nicht mehr fragen, er hatte sich ja inzwischen hinter dicke Klostermauern zurückgezogen, irgendwo weit weg von hier. Es blieb mir also wohl nichts anderes übrig, als mich völlig unvorbereitet auf die Existenz eines vierbeinigen Mitbewohners einzustellen.
Jetzt wunderte ich mich allerdings, dass ich nicht sofort mit aufgeregtem Kläffen empfangen worden war. Schon die ganze Zeit hatte ich keinen einzigen Laut gehört, kein Bellen, kein Knurren, kein Winseln, absolut nichts. Und auch als ich fast auf Zehenspitzen durchs Haus schlich, eine Tür nach der anderen öffnete und mich in jedem Raum umblickte, konnte ich nirgends einen Hund entdecken, und da wusste ich dann erst recht nicht, was ich davon halten sollte.
Hatte Robert seinen Hund auf die Reise mitgenommen? Wohl kaum. Hatte er ihn für die Zeit seiner Abwesenheit anderen Leuten anvertraut, Nachbarn, Freunden, einem Tierheim? Möglich. Aber warum hingen dann die Hundeleine und der Beißkorb immer noch an ihren Haken?
Nun gut, früher oder später würde sich die Geschichte bestimmt aufklären. Hauptsache, dass es nun offenbar doch keinen Hund im Haus gab, um den ich mich hätte kümmern müssen. Ich atmete erleichtert auf. Denn was ich jetzt brauchte, waren vor allem Ruhe und Zeit zum Nachdenken. Robert hatte anscheinend auch das gewusst und mir deshalb die Verantwortung für seinen Hund vorsorglich erspart. Ein Grund mehr für mich, meinem Freund dankbar zu sein.
Das Haus würde mir wenig Arbeit machen, es war nicht groß. Vier Zimmer, Küche, Bad, Toilette. Ein Bungalow im Stil der Sechzigerjahre, mit Flachdach und einer kleinen, mit Natursteinplatten ausgelegten Terrasse. Rund ums Haus, nur unterbrochen durch einen breiten Kiesweg vom Gartentor zur Haustüre und weiter zu einer über und über mit Efeu bewachsenen Garage in der hintersten Ecke des Grundstücks, gab es eine Wiese mit niedrigen Sträuchern und einer grün gestrichenen Holzhütte, in der sich neben einem Haufen sinnlosem Gerümpel – wie zum Beispiel einem Klappfahrrad ohne Räder, ein paar rostigen Eisenrohren, einem blinden Spiegel, einem Korb voll fußballgroßen Zierkürbissen und, wohl am sinnlosesten, drei ausrangierten Barhockern, aus deren zerrissenen, weinroten Plastiksitzen die Schaumgummipolsterung quoll – auch nützliche Dinge befanden: ein alter Liegestuhl, mehrere Stapel Blumentöpfe aus ziegelfarbenem Ton, eine Heckenschere, ein Motorrasenmäher, ein Laubrechen, ein Spaten, eine Gießkanne aus Blech, ein zusammengerollter, schwarzer Wasserschlauch und ein Paar gelbe Gummistiefel, die mich sofort an die Stiefel erinnerten, in die ich als Kind immer schlüpfen musste, wenn mich mein Vater bei Regen mit unserem Hund hinausgeschickt hatte.
Das ganze Grundstück wurde von einer hohen Ligusterhecke eingesäumt, die offensichtlich schon seit Jahren nicht mehr geschnitten worden war, so dass man den Drahtzaun zwischen den wild wuchernden Zweigen kaum noch sehen konnte. Alles miteinander machte den Eindruck, als würde Robert bei der Pflege seines Eigentums doch ziemlich nachlässig sein, und deshalb beschloss ich spontan, es mit den vielen Dingen, die zu tun er mir aufgetragen hatte, auch nicht ganz so ernst zu nehmen. Sie waren gewiss nur als Beschäftigungstherapie für mich gedacht, um mich von meiner sinnlosen Grübelei über mein Unglück abzulenken.
Wie das Haus hatte auch die Einrichtung ihre beste Zeit schon länger hinter sich. In die Jahre gekommene, ein bisschen muffige Gemütlichkeit mit viel Nussfurnier, Raufasertapeten und Möbelsamt in Braun- und Ockertönen. Das erstaunte mich, denn ich hatte mir bei Robert etwas anderes erwartet. Anspruchsvoller, moderner, eleganter, meinetwegen auch protziger. Dieses alte, abgenutzte Zeug passte gar nicht zu ihm, fand ich, aber da hatte ich ihn wohl falsch eingeschätzt. Umso besser passte es zu mir. Denn genauso bescheiden, ja fast schäbig, war auch die möblierte Mietwohnung eingerichtet, in der ich bis jetzt gelebt hatte. Ich habe schon immer eine Vorliebe für gebrauchte Sachen gehabt, die einem ihre Geschichte erzählen, wenn man einen Sinn dafür besitzt. Was das betraf, würde ich mich in Roberts Haus also gar nicht lang eingewöhnen müssen. Das empfand ich als höchst angenehm, denn sonst ist es mir zeit meines Lebens immer schwergefallen, mich in einer neuen Umgebung nicht fremd oder sogar wie ausgesetzt zu fühlen. Und den Hundegeruch würde ich in ein paar Tagen ganz sicher auch nicht mehr wahrnehmen, dachte ich.
Es gab ein Wohnzimmer mit einer bodentiefen Fensterfront und einer Schiebetür, die direkt auf die Terrasse hinausführte, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank, einen kleinen Raum, der ursprünglich wohl als Kinderzimmer gedacht gewesen war, von Robert aber offenbar als Büro benutzt wurde, und noch ein kleines, sparsam mit einer Ausziehcouch, einem Garderobeschrank, einem Tisch und zwei Stühlen möbliertes Gästezimmer, das, so hatten wir vereinbart, ab jetzt mein Schlafzimmer sein würde.
Robert hatte für alles gesorgt. Die Couch war mit frischem Bettzeug bezogen, der Kühlschrank war gefüllt mit Fertigpizza, Schinken, Salami und Käse für mindestens eine Woche, und auf dem Wohnzimmertisch stand neben einer Vase mit Margeriten eine Flasche Rotwein als Willkommensgruß – lauter Freundschaftsbeweise, die mich zutiefst rührten. Mensch Robert, dachte ich, was du für mich tust, das werde ich dir nie vergessen!
Ich fühlte mich plötzlich so fröhlich und optimistisch wie schon lange nicht mehr. In den nächsten Tagen musste ich nur noch ein paar Mal mit dem Bus ins Stadtzentrum fahren, um meine restlichen Habseligkeiten aus der alten Wohnung zu holen, spätestens am Ende des Monats dem Vermieter den Wohnungsschlüssel zurückgeben, und danach konnte es losgehen mit meinem Versuch, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Glück gehabt, dachte ich wieder, es wurde aber auch langsam Zeit. Und dann schenkte ich mir ein Glas Wein ein und prostete meinem alten Freund in Gedanken zu.
Ich bin ja kein Experte, aber soweit ich es beurteilen konnte, war dieser Wein verdammt gut. Musste richtig viel Geld gekostet haben. Genauso wie die Cognacs, Whiskys und edlen Schnäpse, Flasche an Flasche dicht gedrängt in drei Reihen in der Bar, die wie ein Hausaltar fast die halbe Breite der rechten Wohnzimmerwand einnahm. An der Wand gegenüber der zweite Altar: ein großer Fernseher und eine Hi-Fi-Anlage mit riesigen Lautsprecherboxen. Das Teuerste, Modernste und Beste vom Besten, was es auf dem Unterhaltungselektronikmarkt Anfang der Neunzigerjahre zu kaufen gab – also zu der Zeit, in der sich all das abgespielt hat, worüber ich hier berichte.
Sündteure Getränke, sündteure Musikanlage, bloß nicht sparen, wenn es ums Genießen geht: was für ein Gegensatz zu dem abgenutzten Sofa, den durchgesessenen Fauteuils, dem falschen Perserteppich und der Stehlampe mit dem Elefantenhautschirm in der Zimmerecke. Es gab also doch etwas, worauf Robert Wert legte und das zu ihm passte. Ja, so kannte ich ihn. Wie beruhigend. Ich hatte ihn also doch nicht so ganz falsch eingeschätzt.
Ich stellte mir vor, wie er wohl oft dagesessen sein mochte, die Beine auf dem Tisch, ein Glas Whisky in der Hand, die Augen geschlossen und die Stereoanlage auf volle Lautstärke aufgedreht. Nur die Musik konnte ich mir nicht vorstellen. Seine Musik. Mit sechzehn, siebzehn hatte er die Stones gehört, manchmal Bob Dylan, doch das machten damals ja fast alle. Aber heute, ein Vierteljahrhundert später? Zog er sich die Schnulzen von Queen rein? Ließ er sich von Techno die Ohren volldröhnen, diesem nervtötenden Hämmern, das in letzter Zeit so oft aus der Nachbarwohnung durch die dünnen Wände zu mir gedrungen war? Liebte er Jazz oder war er gar Klassikfan geworden? Ich wusste es einfach nicht.
Ich ließ meinen Zeigefinger über die Stapel von Plattenalben und CDs gleiten und versuchte, ein paar Titel oder die Namen der Interpreten zu entziffern, die in winzigen Buchstaben auf den Schmalseiten der Cover gedruckt standen, aber eigentlich interessierte es mich nicht wirklich, wenn ich ehrlich war. Ja, irgendwann würde ich mir Roberts Musiksammlung schon noch ansehen, mir vielleicht sogar das eine oder andere anhören. Irgendwann, nur nicht jetzt. Denn jetzt war mir mein eigenes Leben wichtiger, mein eigener Klang, den ich zwischen den Misstönen der vergangenen Wochen einfach nicht mehr heraushören konnte, der mir verloren gegangen war, und den ich unbedingt wiederfinden musste. Ich hatte bloß absolut keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte.
Und wenn schon, dachte ich, ich habe ja jetzt Zeit, viel Zeit. Ein ganzes Jahr, um meine Probleme zu lösen. Ein ganzes Jahr, in dem sich vermutlich manches sogar einfach von selber erledigen würde. »Jede Wette, David, die Welt wird für dich bald ganz anders ausschauen«, hatte Robert gesagt, und sicher hatte er recht damit. Ich musste die Dinge nur an mich heranlassen, für sie offen sein. Denn so, wie mich die bösen Ereignisse überrascht hatten, genauso würden mich auch die guten überraschen. Also Geduld, und immer schön eins nach dem andern. Jetzt sollte ich hier erst einmal richtig ankommen, mich akklimatisieren, wie es so schön heißt, mich einleben. Die herrliche Stille in diesem Haus genießen. Und darauf vertrauen, dass alles andere geschehen würde, wenn die Zeit dafür reif wäre.
Ich nahm mir eine Flasche Whisky aus der Bar, ließ mich in einen Fauteuil fallen, legte meine Beine auf den Tisch, trank einen Schluck und atmete ein paar Mal tief durch. Der kalte, eiserne Ring, der schon so lang meinen Magen umklammert hielt, gab plötzlich nach. Ja, alles würde gut werden. Ich würde ihn wieder hören können, meinen abgewürgten, erstickten Klang. Oder noch besser: einen ganz neuen, ganz wunderbaren Klang. Wunderbar wie die Wärme, die langsam in mir aufstieg. So fühlt sich Zuversicht an, dachte ich. Aber wahrscheinlich lag es nur am Whisky, den ich aus der Flasche trank, weil ich kein Glas gefunden hatte.
Johnny Walker Blue Label.
Eine Stunde, zwei Stunden, drei … ich weiß nicht mehr, wie lang ich so dasaß und durchs Fenster hinaus in den Garten schaute. Ich erinnere mich nur noch an die Gedanken und Bilder, die leise heranfluteten, kamen und verebbten und wieder kamen, wie Wellen am Strand.
Laura. Der rätselhafte Ausdruck ihres Gesichts, als ich sie das erste Mal sehe: ein sanftes Lächeln und zugleich Augen voll Müdigkeit und Trauer. Sehnsucht, Hoffnung und Schicksalsergebenheit in einem. Ein Gesicht, das mich anrührt wie die Erinnerung an eine lang zurückliegende Zeit. Ein Gesicht, in dem ich mich wiederfinde und in das ich mich sofort verliebe.
Es ist ein eiskalter Novembernachmittag. Ich bin auf einem der Bücherflohmärkte, die ich schon seit Jahren regelmäßig besuche, um mich nach geeigneten Exemplaren für unser Antiquariat umzusehen. Meine Ausbeute ist spärlich, nach stundenlangem Wühlen in unzähligen Bücherkisten gerade einmal zwei Ausgaben der »Fackel« aus dem Jahr 1919. Ich bin enttäuscht, mich friert, es wird schon dunkel, die Leute packen ihre Bücher wieder ein – Schluss für heute, ab nach Hause, und das so schnell wie möglich.
In der Eile remple ich an einen kleinen Klapptisch, und ein Stapel Bücher klatscht auf den Boden. »Entschuldigung«, sage ich und gehe in die Hocke, um die Bücher aufzusammeln, »hoffentlich ist nichts beschädigt, wäre wirklich schade drum.« Das ist gelogen, denn ich erkenne auf den ersten Blick, dass die Bücher nichts wert sind. Fast ausnahmslos zerlesene Paperbacks, Groschenware. Was man Flohmarktverkäufern aber niemals sagen darf, sonst sind sie zutiefst beleidigt. Weshalb mich die Antwort auch ziemlich verblüfft. »Ach was, auch schon egal. Morgen hätte ich die Bücher ohnehin in den Müll geworfen. Was soll’s, das Zeug will ja doch keiner haben.«
Und als ich hochblicke, sehe ich in das Gesicht einer jungen Frau, die mich so hilflos und verlegen anlächelt, als ob nicht ich, sondern sie für das Missgeschick um Verzeihung bitten müsse. »Irrtum«, sage ich. »Ich will die Bücher. Und zwar alle.«
Und es ist verrückt, dass ich die Bücher kaufe, und noch verrückter, wie viel ich für sie bezahle, aber das ist mir gleichgültig. Denn was ich damit erreichen möchte, ist einzig und allein, dass mich diese Frau weiter anlächelt, ein bisschen fröhlicher vielleicht, obwohl mir gerade ihre Traurigkeit so gefällt, und dass ich mit ihr ins Gespräch komme, und dass sie »Ja« sagt, wenn ich sie auf einen Espresso einlade oder eine Tasse Tee in das kleine Kaffeehaus ganz in der Nähe. Und als sie dann tatsächlich »Ja« sagt, kann ich es kaum glauben.
Johnny Walker Blue Label.
So haben wir uns kennengelernt, erinnerst du dich, Laura? Oder versuchst du jetzt, alles möglichst schnell zu vergessen, weil du es für einen Fehler hältst? Heute, im Nachhinein.
Ach, Laura. Alles wirklich nichts als ein schrecklicher Fehler? Alles falsch von Anfang an? Alles nur eine unverzeihliche Dummheit? Alles nur zum Vergessen? Nicht für mich, Laura. Ich sehe dich immer noch.
Wie dein Lächeln plötzlich verschwindet, als ich dich frage, warum du die Bücher in den Müll werfen wolltest. Wie du deinen Kaffee völlig vergisst und nur noch redest und redest und redest, weil da endlich jemand ist, der dir zuhört und sich für das interessiert, was aus dir herausbricht, als wäre ein Damm gebrochen.
Wie du von deiner Ehe erzählst, deinem Mann, seinen unkontrollierten Wutausbrüchen, den Schlägen und Demütigungen, die du ihm jahrelang verziehen hast, immer wieder über dich ergehen lassen, immer wieder verziehen und immer wieder darüber geschwiegen, bis es dir einfach zu viel geworden ist und du dich am liebsten umgebracht hättest.
Wie du von deiner Scheidung erzählst, bei der dich dein Mann und sein Anwalt über den Tisch gezogen haben, so dass du jetzt gezwungen bist, alles, was dir geblieben ist, nachdem dein Ex eure kleine Wohnung fast leer geräumt hat, nach und nach zu verkaufen. Womit du dich aber auch endgültig von ihm befreien willst: Nur weg mit allem, was dich an deinen Mann erinnert, weg mit dem Schmuck, den er dir zur Hochzeit geschenkt hat, weg mit den paar restlichen Möbeln, und weg mit den paar Büchern, wenn es sein muss, in den Müll damit, weg mit allem, was gewesen ist, weg, weg, weg, Hauptsache, nie wieder Schläge, nie wieder Schmerzen, nie wieder Gewalt.
Und wie dein Lächeln auf einmal wieder zurückkehrt, zögernd und unsicher, aber dafür auch ein bisschen in deine Augen, als ich sage, wie gut ich dich verstünde, und dass eine Frau mit mir ganz sicher niemals so etwas erleben müsste wie du mit deinem Mann.
Johnny Walker Blue Label.
Was ist schiefgelaufen, wieso haben wir es nicht geschafft, Laura und ich? Kannst du mir das erklären, Robert? Aber komm mir jetzt bitte nicht zum hundertsten Mal damit, dass du mich für einen hoffnungslosen Träumer hältst. Einen, der glaubt, den edlen Ritter spielen zu müssen, den Beschützer wehrloser, misshandelter Frauen. Einen, der das mit Liebe verwechselt, was auf Dauer nie gut gehen kann. Und dass ich meine Einstellung endlich ändern soll, sonst würde ich schon noch sehen, was ich davon habe.
Gut gemeint, Robert, aber ausnahmsweise liegst du völlig falsch. Nach allem, was du über mich weißt, müsstest du nämlich auch wissen, wie zutiefst zuwider mir gewalttätige Männer sind, und dass sich das nie ändern wird. Aber »edler Ritter«? Lächerlich, absolut lächerlich. Tja, es kann eben doch niemand in einen anderen Menschen wirklich hineinschauen, selbst wenn er der beste Freund ist.
Johnny Walker Blue Label.
Lass uns reden, Laura. Lass uns nicht einfach so auseinandergehen. Nicht nach fast drei Jahren so tun, als hätten wir einander nichts mehr zu sagen. Okay, vielleicht bin ich ja wirklich so ein Langweiler, wie du immer behauptest. Und vielleicht bin tatsächlich ich daran schuld, dass dein Lächeln anders geworden ist, irgendwie routiniert, mechanisch und hart. Das hat sich ganz langsam eingeschlichen, und als ich es bemerkt habe, war es schon zu spät. Umgekehrt finde ich es auch nicht gerade toll, dass du dich kein bisschen für das interessiert hast, was ich liebe, nämlich für Bücher, nicht für neue, und für antiquarische schon überhaupt nicht. Und dass du nie wirklich zu mir gezogen bist, sondern ziemlich oft in deiner alten Wohnung geschlafen hast, nur weil du es von dort aus am nächsten Morgen nicht so weit zu deiner Arbeit gehabt hättest, wie du immer beteuert hast, das ist für mich auch so ein Wermutstropfen in unserer Beziehung. Aber das wissen wir beide eigentlich schon ziemlich lang, nicht wahr? Und trotzdem sind wir zusammengeblieben.
Irgendwas muss es da also doch noch geben, Laura. Irgendein Gefühl, das stärker ist als all die lächerlichen Kleinigkeiten, die uns trennen. Etwas Großes, Unerklärliches, wenn du es schon nicht Liebe nennen willst.
Nein? Glaubst du wirklich, dass es nur deine Angst vorm Alleinsein ist? Diese Angst sei das Einzige, was dich bis jetzt daran gehindert hat, mich zu verlassen, sagst du? So wie damals in deiner Ehe, in der du auch nur wegen dieser Angst jahrelang ausgeharrt hättest. Aber jetzt, mit diesem anderen Mann, sei eben endlich alles anders, und ich solle dir nicht böse sein, doch vorbei sei eben vorbei. Gut, wenigstens eine klare Antwort. Ich muss es wohl akzeptieren, auch wenn es verdammt weh tut.
Johnny Walker Blue Label.
Ich bin dir nicht böse, Laura. Na ja, ein bisschen vielleicht. Trotzdem wünsche ich dir viel Glück mit deinem neuen Wunderknaben. Wie du ihn kennengelernt hast, will ich gar nicht wissen. Nein, keine Fragen mehr. Doch, eine einzige noch: Warum, verflucht noch einmal, warum hast du nicht schon viel früher mit mir über deine Angst geredet? Wäre besser gewesen, weißt du. Ich glaube nämlich, dann hätten wir eine Chance gehabt, und es wäre vielleicht doch gut gegangen mit uns. Und irgendwann hätte auch ich dir von meiner Angst erzählen können.
Okay, hätte wahrscheinlich auch nichts gebracht. Angst plus Angst ist nicht Mut. Oder doch?
Ach, Laura.
Johnny Walker Blue Label.
Schiefgelaufen irgendwie.
Von wegen edler Ritter.
Ritter von der traurigen Gestalt. Bestenfalls.
Dulcinea …
Du hast keinen Schimmer, wovon die Rede ist, stimmt’s?
Johnny Walker Blue Label.
Ich wünsch dir ein schönes Leben, Laura. Mach’s gut. Und pass auf dich auf. Versprochen, ja?
Johnny Walker Blue Label.
Entschuldige, Robert, dass ich dir deinen teuren Whisky wegsaufe, während du dich in mönchischer Enthaltsamkeit übst. Falls dich etwas daran stören sollte, muss ich dich leider zitieren: Das hast du nun davon. Nein, ganz im Ernst, ich weiß deine Großzügigkeit echt zu schätzen. Mir geht es so gut wie schon lang nicht mehr. Und dir hoffentlich auch, mein Freund. Also auf deine und meine Zukunft!
Johnny Walker Blue Label.
Ich glaube, das mit Laura kriege ich wirklich hin, weißt du. Macht mir schon fast nichts mehr aus. Und das mit dem Antiquariat – also, ich hab da so eine Idee: Wenn du zurückkommst, kaufst du »Das Buchgewölbe« und machst mich zum Geschäftsführer. Genug Geld hast du ja offensichtlich, also was sagst du dazu? Dafür sind Freunde schließlich da, stimmt’s? Also, ich werde auf alle Fälle gleich einmal mit den drei Thalheim-Söhnen reden, die sind sicher heilfroh, wenn sie das Geschäft loswerden und dabei sogar noch was verdienen. Ich frage mich nur, warum mir das nicht gleich eingefallen ist. Aber gut, besser spät als gar nicht. Großartige Aussichten, was, Robert? Mensch, alter Freund und Bettelmönch, ich freu mich schon richtig drauf.
Johnny Walker Blue Label.
Wunderbar, dieses Licht der Abendsonne über der Ligusterhecke. Sanftes Rotgold. Smooth.
Der Tag geht, Johnny Walker kommt.
Johnny Walker kam, der Tag ging. Und ich wäre wohl noch lang so zufrieden dagesessen und hätte durchs Wohnzimmerfenster zugeschaut, wie die Sonne zuerst genau entlang der spitzen Dachsilhouette des Hauses auf der anderen Straßenseite und dann hinter der Hecke versank und alles in einen schwarzen Scherenschnitt verwandelte, während ein schmaler Streifen Himmel langsam whiskyfarben wurde, ja, wahrscheinlich wäre ich sogar eingeschlafen mit der fast leeren Flasche in der Hand – wenn nicht plötzlich der Hund zu bellen angefangen hätte.
Verdammter Köter! Seinetwegen stolperte ich über meine Reisetasche, die immer noch im Flur stand. Ich fiel der Länge nach hin und schlug hart mit dem Kopf auf dem Boden auf. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder auf die Beine kam, in meinem Schädel begann jemand auf mein Stirnbein zu hämmern, das Bellen draußen vor der Tür wurde immer lauter und wütender, und dann läutete auch noch irgendwo im Haus das Telefon. Ich fühlte mich von allen Seiten bedroht, wusste nicht mehr, was ich machen sollte, und stand bloß da wie angenagelt, bis mir irgendetwas befahl: Zuerst der Hund, also raus hier!
Und dann sah ich sie, den großen, wolfsgrauen Schäferhund, der sich hoch aufgerichtet am Gitter des Gartentors festkrallte und kläffte und kläffte, und den Jungen, der verzweifelt versuchte, den Hund an der Leine zurückzuzerren.
»Verschwindet«, schrie ich, »haut bloß ab!« Was natürlich völlig sinnlos war.
»Ich weiß auch nicht, was er hat«, rief der Junge. »Das macht er sonst nie!«
Ich trat ein paar Mal kräftig gegen das Gartentor, der Hund wich zurück, duckte sich und knurrte gefährlich, aber schon Sekunden später warf er sich wieder mit einem mächtigen Satz gegen das Drahtgitter und bellte wie der Teufel. Und im Haus schrillte immer noch das Telefon, in meinem Kopf hämmerte es, und ich spürte, wie sich mein Magen zusammenkrampfte.
Ich hasste dieses Vieh. »Aus, Tasso! Aber sofort, Tasso! Aus, Tasso! Und sitz, Tasso, sitz!«, brüllte ich, und der Hund gehorchte sofort, zog mit einem protestierenden Winseln den Schwanz ein und setzte sich.
Der Junge sah mich fassungslos an. Verschüchtert, fast ängstlich. Er tat mir leid, schließlich konnte er nichts dafür, dass er den Hund nicht bändigen konnte.
»Schäferhunde reagieren auf ihren Namen«, erklärte ich.
»Aber wieso wissen Sie, wie er heißt?«
»Einfach so«, sagte ich. »Ich hab den gleichen Hund gehabt, als ich in deinem Alter war, und der hat auch Tasso geheißen. Schätze, du bist zehn, richtig?«
»Elf«, sagte der Junge. »Nächste Woche werde ich zwölf.«
»Schon zwölf! Das ist ja toll. Und wie heißt du?«
»Sebastian. Meine Eltern sagen Bastian.«
»Bastian und Tasso also«, sagte ich.
»Ja«, sagte Bastian, und jetzt grinste er. »Und Ihr Hund hat wirklich Tasso geheißen? Echt?«
»Ja, echt. So ein Zufall, was?« Dass fast jeder zweite Schäferhund Tasso hieß, musste ich dem Jungen ja nicht verraten, er hielt seinen Hund sicher für etwas Besonderes, alle Kinder tun das, und die Illusion wollte ich ihm nicht kaputt machen. »Mein Tasso hat aber nur so ähnlich ausgesehen wie deiner. Und auf der rechten Vorderpfote hat er einen großen weißen Fleck gehabt.«
»Aha«, sagte der Junge.
Der Hund stand auf, zerrte wieder an der Leine und zwängte seine Schnauze durchs Gitter, um an mir zu schnüffeln. Ich trat einen Schritt zurück.
»Tasso tut nichts. Er will nur spielen. Wenn Sie möchten, können Sie ihn streicheln.«
»Danke. Kein Bedarf.« Ich trat noch einen Schritt zurück, als befürchtete ich, der Hund könnte mich durchs Gitter hindurch anspringen.
»Haben Sie Angst vor Hunden?«
»Nein. Nicht unbedingt. Ich mag sie bloß nicht.«
»Echt? Und wieso?«
»Ach, weißt du, das ist eine lange Geschichte.«
»Aha«, sagte der Junge. Dann sah er mich auf einmal neugierig an. »Entschuldigen Sie?«
»Ja?«
»Was haben Sie da?« Er zeigte auf meine Stirn.
»Warum? Was ist da?«
»Sie bluten, glaube ich.«
»Ach, das.« Dein Hund hat mich erschreckt und deshalb bin ich hingefallen, hätte ich beinahe gesagt. Vermutlich die beste Antwort, um sich vor einem Zwölfjährigen lächerlich zu machen. Also sagte ich lieber: »Ach, das ist nichts, ich hab mich nur aufgekratzt, weiß du.«
»Aha«, sagte der Junge wieder.
»Also dann, ihr zwei, schaut dass ihr nachhause kommt. Und sei so gut, Bastian, komm mit Tasso in Zukunft nicht mehr hierher. Ihr habt hier nichts zu suchen. Klar?«
»Ja«, sagte Bastian. »Alles klar.«
Das wäre geschafft, dachte ich. Doch als ich mich umwandte und zurück zum Haus ging, sprang der Hund schon wieder am Tor hoch und bellte wie verrückt und warf sich gegen das Gitter, als wollte er es niederreißen, um in den Garten zu gelangen, und der Junge konnte ihn nicht zurückhalten, und dass er Tasso bei seinem Namen rufen sollte, hatte er in der Aufregung wohl schon wieder vergessen. Aber ich wusste, irgendwann würde der Hund müde werden und aufgeben, und ich drehte mich zu den beiden nicht mehr um, sondern beeilte mich, ins Haus zu kommen, wo das Telefon immer noch läutete und läutete und läutete.
Wo genau stand das blöde Ding überhaupt? Bei dem Krach, den der Hund vorm Gartentor und der Hammer in meinem Schädel machten, hatte ich ziemliche Mühe herauszukriegen, aus welchem Raum das Läuten kam.
Es war Roberts Arbeitszimmer. Und auch da konnte ich das Telefon dann nicht gleich finden, weil es von einem Stapel alter Zeitschriften und ein paar Aktenordnern verdeckt wurde, die auf dem Schreibtisch lagen.
Das Telefon ging mir nun schon seit mindestens zehn Minuten mit seinem beharrlichen, penetranten, schrillen Läuten auf die Nerven, es schrie mich regelrecht an, und am liebsten hätte ich wieder »Aus!« gebrüllt oder »Schnauze, und zwar sofort!«, um es zum Schweigen zu bringen. Der Anruf konnte ja unmöglich für mich sein, und dass ich Nachrichten für Robert entgegennehmen sollte, hatten wir nicht vereinbart. Aber das Telefon würde wohl kaum irgendwann müde werden wie ein Hund, sondern ewig so weitermachen, wenn der Mensch am anderen Ende der Leitung nicht lockerließ.
Also hob ich schließlich doch den Hörer ab und machte damit den größten Fehler meines Lebens.
Das wusste ich natürlich noch nicht, als ich förmlich »Ja, hallo, hier bei Lehmann« sagte und darauf erst einmal nur etwas hörte, das mir wie ein leises Schluchzen vorkam, gefolgt von ein paar geflüsterten Worten, die ich aber bei all dem Lärm nicht verstehen konnte. Ich presste den Hörer an mein Ohr, hielt mir das andere mit der flachen Hand zu und wiederholte »Hallo, hier bei Lehmann« – und dann verstand ich das Flüstern, verstand die atemlos hervorgestoßenen Worte, die ich besser nie gehört hätte.
»Bitte, lauf schnell zu mir herüber … er hat mich geschlagen … er ist so brutal … o Gott … er wird mich umbringen … hilf mir … bitte, hilf mir … um Gottes willen –«
Und dann brach die Verbindung ab.
»Hallo?«
Nichts. Totenstille.
Ich starrte den Hörer an, legte auf, hob noch einmal ab. Nichts. Auflegen, abheben, auflegen, abheben. Sinnlos. Nur das Freizeichen war zu hören, und die Stille, die ich sonst so liebte, war auf einmal schrecklich.
Sogar der Hund bellte nicht mehr. Dafür begann jetzt das Hammerwerk hinter meiner Stirn auf Hochtouren zu arbeiten, was mir das Denken auch nicht eben leichter machte.
Was sollte ich tun? Wenn das kein schlechter und unüberbietbar geschmackloser Scherz gewesen war, und danach hatte es sich weiß Gott nicht angehört, dann war das ein verzweifelter Hilferuf gewesen, der Aufschrei einer Frau, die möglicherweise gerade in diesem Augenblick von ihrem Mann halb tot geprügelt wurde.
Laura! Du lieber Himmel, Laura? War sie wieder an einen Schläger geraten und wusste keinen anderen Ausweg mehr, als mich zu Hilfe zu rufen? Verfluchte Scheiße!
Irgendwas stieg siedend heiß in mir auf, Schweiß brach mir aus allen Poren, und ich begann zu zittern. Durchatmen, tief durchatmen.
Ich Idiot! Laura konnte es doch gar nicht gewesen sein. Sie war in Berlin und sie hatte keine Ahnung, dass ich in Roberts Haus wohnte. Wieso hätte sie mich also hier anrufen sollen?
Doch wer war es dann gewesen? Eins war klar: Der Anruf hatte nicht mir gegolten, sondern Robert. Irgendwo da draußen gab es eine Frau, die sich in letzter Not an Robert gewandt hatte und offenbar von seiner Abwesenheit nichts wusste. »Bitte, lauf schnell zu mir herüber«, hatte sie gesagt, also musste sie ganz in der Nähe sein, hier in irgendeinem der Häuser, möglicherweise sogar in dieser Straße. Mir wurde schlecht bei der Vorstellung, dass vielleicht soeben im Nachbarhaus ein Mann auf seine Frau einschlug, und niemand da war, der etwas dagegen unternahm. Wie denn auch? Keiner außer mir wusste davon, und ich konnte nichts tun.
Mir blieb nichts übrig, als das Telefon anzuglotzen und darauf zu hoffen, dass sich die Frau noch einmal melden würde. Bei ihr anrufen konnte ich nicht, das Telefon war ein alter, schwarzer Wählscheibenapparat, auf dem es natürlich weder Rufnummernanzeige noch Rückruftaste gab. Noch so ein Relikt aus den Sechzigerjahren in diesem Haus. Sogar schon in den handylosen Anfangneunzigern vorsintflutlich.
Und bei der Polizei anrufen? »Guten Abend, irgendwo hier in der Gegend wird gerade eine Frau von ihrem Mann misshandelt – Adresse unbekannt, Name unbekannt, Telefonnummer unbekannt – tut mir leid, aber helfen Sie ihr bitte, es ist dringend.« Es war zum Wahnsinnigwerden, aber nein, es gab nichts, absolut nichts, was ich tun konnte.
Das Hämmern in meinem Kopf hatte sich in ein leises, dumpfes Pochen verwandelt, doch als ich mir mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn wischte, spürte ich einen stechenden Schmerz über der rechten Augenbraue. Vorsichtig tastete ich über die Stelle. Sie fühlte sich klebrig an.
Ich ging ins Badezimmer, blickte in den Spiegel und erschrak. Von der Nasenwurzel bis zur Schläfe hatte sich eine Schwellung ausgebreitet, mittendrin war die Haut aufgeplatzt, und aus dem kleinen Cut war ein wenig Blut gequollen, das schon zu trocknen begann. Das war also das Resultat meines Sturzes. Kein schöner Anblick. Und in den nächsten Tagen würde er noch hässlicher sein: ein Bluterguss, zuerst blaugrün und dann gelb. Ich kannte das. Ich hatte es schon oft gesehen. Viel zu oft.
Mir wurde speiübel. Der Hund, der Hilferuf, die blutig geschlagene Stirn – das alles miteinander war einfach zu viel. Doch ich schaffte es nicht, es aus mir herauszuwürgen, da konnte ich mir den Finger so tief in den Hals stecken, wie ich wollte, ich wurde es nicht los.
Noch vor einer halben Stunde war es mir richtig gut gegangen. Aber Johnny Walker konnte mir jetzt auch nicht helfen, im Gegenteil, schon der Gedanke daran schnürte mir die Kehle zu. Vielleicht sollte ich schlafen, dachte ich. Abtauchen ins Vergessen. Ich schlich ins Gästezimmer und legte mich aufs Bett. Es schaukelte wie ein Schiff bei schwerem Seegang, wenn ich die Augen zumachte. Also blieb mir nichts anderes übrig, als in den dunklen Raum zu starren, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, und mir dann an der Zimmerdecke einen Punkt zu suchen, an dem ich mich festhalten konnte. Außerdem wäre Schlafen ohnehin keine gute Idee gewesen, denn ich musste ja unbedingt wach bleiben, um das Läuten nicht zu überhören, falls die Frau doch noch einmal anrufen würde.
Nach einiger Zeit wurde mir kalt, ich zog Schuhe und Hose aus und kroch unter die Bettdecke. Und dann konzentrierte ich mich wieder auf den Punkt über mir, obwohl mir die Augen brannten. Und ich horchte aufs Telefon, obwohl es nicht mehr läutete, leider oder Gott sei Dank, das wusste ich nicht. Ein paar Mal hörte ich das Schlagen von Autotüren, zwei, drei Mal bellten Hunde, aber weit weg und immer nur kurz, wenn ich ganz ruhig lag, gab auch die Platzwunde auf meiner Stirn Ruhe, und irgendwann schlief ich schließlich doch ein.
Aus der klaffenden Wunde rinnt Blut, es blutet und blutet und hört nicht auf, das Blut rinnt mir übers Gesicht, ich will es abwischen, aber das Gesicht ist gar nicht mein Gesicht, es ist Lauras Gesicht, es sind Lauras traurige Augen, es ist Lauras trauriges Lächeln, es ist Lauras Blut, das eine dunkelrote Spur von ihrer Stirn bis zu ihrem Kinn zieht, und wieder will ich das Blut abwischen, aber ich kann Lauras Gesicht nicht erreichen, wenn ich meine Hand danach ausstrecke, weicht es zurück und verschwindet hinter einem Schleier aus Nebel und Rauch, und dann taucht es auf einmal wieder auf, kommt näher und näher, und es ist das Gesicht meiner Mutter, und es ist das Blut meiner Mutter, das rinnt und rinnt und von ihrem Kinn auf den Boden tropft, und auch das Gesicht meiner Mutter weicht zurück, als ich es berühren will, wird immer weißer und blasser und löst sich in Nebel auf, nur das Blut auf dem Boden ist noch da, und Tasso ist da, seine weiße Pfote ist blutverschmiert, und er leckt das Blut vom Fell, und er leckt an den Bluttropfen auf dem Boden, und er fährt mir mit der Zunge übers Gesicht, und er leckt das Blut von meinem Gesicht, und das Blut vermischt sich mit dem Geifer, der in schleimigen Fäden von seinen Lefzen trieft, und mein Gesicht ist ganz nass, und der widerliche Geruch raubt mir den Atem, und ich ersticke, gleich ersticke ich, ersticke, ersticke, ersticke – und mit allerletzter Kraft stoße ich den Hund von mir weg.
Ich fuhr hoch, riss die Augen auf, rang nach Luft und blickte verwirrt ins Halbdunkel: Ein fremdes Bett, ein fremdes Zimmer im fahlen Licht der Morgendämmerung – es verging sicher eine Minute, bis ich mich endlich zurechtfand und wusste, wo ich war. Aber was war dieses Feuchte, Schleimige, Kalte auf meinem Gesicht und auf dem Kopfpolster? Und woher kam dieser ekelhafte, säuerliche, beißende Gestank?
Es war so unglaublich banal, so beschämend und zugleich so lächerlich! Was soll ich lang drum herum reden? Die Wahrheit ist, dass ich mich im Schlaf übergeben hatte und beinahe an meinem Erbrochenen erstickt wäre. Die ganze Flasche Johnny Walker Blue Label war mir zusammen mit den letzten halbverdauten Resten meiner Piccata milanese wieder hochgekommen und hatte unbarmherzig ihren Tribut gefordert.
Nur sie? Wirklich nur sie?
3
Nicht nur die Nachwirkungen meines Whiskyrausches hielten mich davon ab, aus dem Haus zu gehen, ich wollte auch in der Nähe des Telefons bleiben. Ich hatte mir vorgenommen, es dieses Mal richtig zu machen, wenn die Frau wieder anriefe. Ich würde versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen oder wenigstens ihren Namen zu erfahren.
Ich hoffte inständig auf ihren Anruf, meine Gedanken kreisten um nichts anderes mehr, und am meisten wünschte ich mir, sie würde mir sagen, alles sei in Ordnung und es gehe ihr gut, was gestern Abend geschehen sei, sei nur ein Missverständnis gewesen, bitte um Entschuldigung wegen der Belästigung und kein Grund zur Sorge. Allerdings bezweifelte ich, dass ich ihr das dann glauben würde. Denn ich wusste es besser, weiß Gott, auch wenn ich wollte, dass es anders wäre, wusste ich es besser.
Spätestens nach allem, was Laura mir darüber erzählt hatte, wusste ich, dass viele Frauen die Gewaltattacken ihrer Männer kleinreden. Aus Liebe, aus Abhängigkeit, aus irregeleitetem Verständnis und aus hundert anderen Gründen, nur um sich nicht eingestehen zu müssen, dass ihr Ehemann oder Partner ein Dreckskerl ist. Robert hatte bei einem unserer letzten Gespräche zwar gemeint, ich dürfe das nicht so einseitig sehen, denn gewalttätige Männer hätten meistens selber irgendwann Gewalt erleiden müssen. Trotzdem waren wir uns darin einig, dass es immer unweigerlich in eine Katastrophe mündet, wenn niemand eingreift und dem Wahnsinn ein Ende macht.
Das Schwindelgefühl und die Übelkeit, die mich ein paar Mal ziemlich vehement auf die Toilette trieben, ließen im Lauf des Vormittags nach, und um meinen Magen zu beruhigen, aß ich ohne großen Appetit ein paar Scheiben Toastbrot und ein bisschen von dem Schinken, den Robert für mich besorgt hatte – die Pizza rührte ich lieber nicht an – und ich machte mir eine große Kanne ungezuckerten Kamillentee, der mir helfen sollte, die bösen Geister von Johnny Walker endgültig zu vertreiben. Den vollgekotzten Polsterüberzug hatte ich bereits in die Waschmaschine gesteckt und das Gästezimmer ausgiebig gelüftet. Nur die Platzwunde und die Schwellung auf meiner Stirn würden wohl noch einige Zeit brauchen, um zu verschwinden.
Mein erster Tag in diesem Haus war nicht wirklich optimal verlaufen, dachte ich. Einmal davon abgesehen, dass ich mit Laura zu meinem eigenen Erstaunen schon beinah meinen Frieden gemacht hatte, und dass ich die Idee, Robert vorzuschlagen, das Antiquariat zu kaufen, immer noch für ausgezeichnet hielt. Aber alles andere? Am besten, Schwamm drüber und zurück an den Start! Ach ja, wenn das so einfach gewesen wäre.
Je länger das Telefon schwieg, desto größer wurde meine Unruhe. Was, wenn die Frau nur deshalb nicht anrief, weil sie nicht anrufen konnte? Hatte ihr Mann sie in ein Zimmer eingesperrt? Hatte er das Telefonkabel aus der Wand gerissen? Hatte er sie so brutal zusammengeschlagen, dass sie immer noch halb ohnmächtig oder starr vor Angst auf dem Boden lag? Oder – ich mochte es mir gar nicht vorstellen – war sie tot?
Ein Unfall, würde es heißen. Die Treppe hinuntergestürzt. Bedauernswert, wirklich bedauernswert. Aber da kann man nichts machen, so etwas kommt nun einmal vor. Der arme Mann. Muss ein ungeheurer Schock für ihn sein. Aufrichtiges Beileid. Waren so ein reizendes Paar die beiden. Gibt es eigentlich Kinder? Einen Sohn, aha. Gerade einmal zwölf. Schrecklich, in diesem Alter die Mutter zu verlieren. Aber, wie gesagt, was soll man machen? Man kann sich sein Schicksal eben nicht aussuchen.
Nein, dachte ich. Nein, nein, nein! Verflucht noch einmal, ruf doch endlich an! Ich dreh hier sonst noch durch!
Im nächsten Moment meldete sich meine Vernunft zu Wort, beziehungsweise das, was ich für nüchternes Denken hielt, nachdem es sich endlich von den letzten Resten Johnny Walker befreit hatte. »Du Idiot«, sagte die Vernunft, »was geht dich eigentlich diese Frau an? Diese Fremde, von der du überhaupt nichts weißt. Vielleicht ist sie bloß eine Verrückte, und du reimst dir da eine Geschichte zusammen, die nicht das Geringste mit der Realität zu tun hat. Also lass das gefälligst und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten.«
Aber waren meine eigenen Angelegenheiten tatsächlich schwerwiegender als das, was dieser Frau geschah? War es nicht doch wichtiger, ihr zu helfen, und wenn sich hinterher alles nur als ein Produkt reiner Einbildung, ihrer oder meiner, herausstellen sollte, umso besser? Darauf wusste sie keine Antwort, meine ach so nüchterne Vernunft, und sie hatte nichts Besseres zu sagen als »Ja, aber …«
Willkommen auf dem Kettenkarussell der Gedanken. Immer im Kreis herum. Immer schneller. Immer wieder von vorn. Wenn ich davon nicht schwindlig werden wollte, musste ich schleunigst abspringen. Und das tun, wofür mein Bauch plädierte.
Und dann war die Antwort ganz einfach, logisch und klar: Die Frau rief nicht an – also musste ich sie suchen.
Ich konnte nicht anders. Es war meine verdammte Pflicht, dieser Frau zu helfen.
Das hatte ich nun davon.
Nach den vielen Stunden, die ich im Haus in einem Gemisch aus Whiskydunst und Hundemief zugebracht hatte, tat mir die frische Luft gut. Hier draußen in der grünen Vorstadtidylle riecht ein Abend im Juni eben wirklich noch so, wie ein Frühsommerabend zu riechen hat, dachte ich. Und unter normalen Umständen hätte ich meinen ersten Spaziergang durch mein neues Viertel auch einfach nur genossen, aber jetzt stellte ich mir natürlich ständig die Frage, in welcher all der hübschen Villen sich wohl gerade die Tragödie dieser Frau abspielte.
Jeder Garten konnte der Vorhof ihrer Hölle sein, hinter jeder Fassade konnten Angst und Gewalt wohnen, jede heruntergelassene Jalousie konnte schreckliche Szenen verbergen. Und je länger ich die schmalen Straßen und Wege entlangging, desto verlogener fand ich alles, und der Duft von Blumen und frisch gemähtem Gras bekam auf einmal etwas Giftiges, der Gesang der Amseln in den Baumkronen etwas Alarmierendes, und der Frieden, der über dem Viertel lag, etwas Gefährliches.
Vermintes Gelände – von Hunden bewacht, dachte ich, als mich plötzlich zwei Frauen in weiten Jogginghosen, Sweatshirts und Tennisschuhen überholten und sich mir in den Weg stellten. Die eine hielt einen Rottweiler an der kurzen Leine, die andere einen Dalmatiner.
»Sagen Sie einmal, was tun Sie hier?« Die Rottweilerfrau musterte mich mit Polizistenblick. »Was haben Sie hier verloren? Wir beobachten Sie schon eine ganze Weile.«
»Genau«, fügte die Dalmatinerfrau hinzu. »Seit mindestens einer halben Stunde gehen wir bereits hinter Ihnen her.«
»Ist nämlich ziemlich eigenartig, wie Sie vor jedem Haus stehen bleiben und es betrachten. Suchen Sie irgendetwas Bestimmtes?«
»Oder haben Sie sich verlaufen? Sie sind ja offensichtlich fremd hier bei uns, oder? Wir haben Sie jedenfalls noch nie gesehen.«
»Also bitte, wer sind Sie und was wollen Sie hier?« Die Rottweilerfrau sah aus, als wollte sie im nächsten Augenblick ihren Hund auf mich loslassen.
Es ist wohl besser, wenn ich höflich antworte, dachte ich, obwohl mir im ersten Moment eher danach zumute gewesen war, mit irgendeiner unfreundlichen Bemerkung zu reagieren oder die Frauen ohne ein Wort stehen zu lassen und einfach weiterzugehen.
»Guten Abend erst einmal«, sagte ich und deutete dazu sogar eine knappe Verbeugung an, es konnte ja nicht schaden. »Mein Name ist David Bauer und ich bin tatsächlich neu hier. Ich wohne nämlich seit gestern im Haus von Robert Lehmann. Und jetzt wollte ich einmal ein bisschen die Gegend kennenlernen. Zufrieden? Oder wollen die Damen sonst noch was wissen?«
Die Frauen sahen einander fragend an.
»Robert Lehmann? Weißt du …?«
»Keine Ahnung … oder doch, ich glaube, das ist der mit dem Bungalow, du weißt schon.«
»Richtig«, sagte ich. »Der Bungalow in der Sackgasse. Birkenweg fünf. Nur ein paar Straßen weiter.«
»Kenne ich nicht«, sagte die Rottweilerfrau.
»Aber sicher kennst du den«, sagte die Dalmatinerfrau und lachte. »Robert. Der schöne Robby.«
»Ach so, der. Robby. Na ja.« Die Rottweilerfrau blickte mich an. »Ein Freund von Ihnen?«
»Mein bester«, sagte ich. »Seit unserer Schulzeit.«
»Tja«, sagte sie. »Wenn das so ist.«
»Genau«, sagte die andere. »Das wär’s dann, oder?«
Und dann zogen beide mit einem Ruck an den Leinen ihre Hunde hoch, die während der ganzen Zeit hechelnd zu ihren Füßen gesessen waren, und gingen einfach davon. Ohne weitere Fragen. Ohne Gruß. Als wäre ich auf einmal nicht mehr vorhanden. Was sie wissen wollten, wussten sie jetzt offenbar, und ein David Bauer interessierte sie wohl nicht.
Oder sie wollten möglichst schnell nachhause kommen, um ihren Ehemännern von diesem Mann zu erzählen, der ihnen höchst verdächtig vorgekommen ist, nämlich wie ein Einbrecher, beziehungsweise einer, der in ihrem Viertel die Häuser auskundschaftet – so ein unrasierter Typ mit einer Platzwunde auf der Stirn wie nach einer Schlägerei, schlampig gekleidet, und ziemlich unangenehm gerochen hat er auch – der dann aber behauptet hat, er würde seit Kurzem hier wohnen, aber wer weiß, ob das auch wirklich stimmt, und wie gut es doch ist, dass wir einen scharfen Hund im Hause haben, man kann nämlich nicht vorsichtig genug sein bei all dem Gesindel, das sich neuerdings hier herumtreibt.
Und auch ich sah zu, dass ich so schnell wie möglich heimkam. Noch eine Begegnung dieser Art wollte ich mir ersparen. Oder hätte ich den beiden Damen nachlaufen und sie fragen sollen, ob sie mir netterweise sagen könnten, in welchem Haus in der Nachbarschaft seit einiger Zeit eine Frau von ihrem Mann blutig geschlagen wird? Spätestens dann hätten sie vermutlich ihre Hunde auf mich gehetzt. Denn so etwas gibt es doch gar nicht, nein, nicht hier in dieser feinen Gegend mit all diesen hochanständigen Menschen, und wer etwas anderes behauptet, der soll sich zum Teufel scheren, eine Frechheit ist das nämlich, genau, eine Unverschämtheit sondergleichen, bitteschön!
Trotzdem eine verpasste Gelegenheit, dachte ich. Wenn ich es geschickt angestellt hätte, wer weiß, vielleicht hätte ich irgendetwas herausbekommen, einen Hinweis, eine Andeutung, eine Vermutung, ganz im Vertrauen natürlich, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Weil man will ja nichts gesagt haben, aber was man so hört, also möglicherweise, aber nein, eigentlich ganz unvorstellbar, sicher nur ein böses Gerücht, und das haben Sie jetzt nicht von uns, nur dass das klar ist, verstanden?
Und selbstverständlich hätte ich absolute Verschwiegenheit versprochen, meinetwegen sogar geschworen, Hauptsache, ich wäre einen Schritt weitergekommen bei meiner Suche. Aber ich Idiot hatte es wieder einmal vermasselt. Dafür wusste ich jetzt, dass Robert als der schöne Robby bekannt war, na großartig. Darüber konnte ich zwar lachen, doch es interessierte mich noch weniger als seine Musiksammlung. Er war also wirklich immer noch ein kleiner Möchtegern-Casanova, der schöne Robby