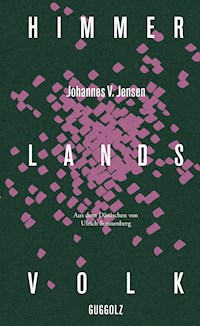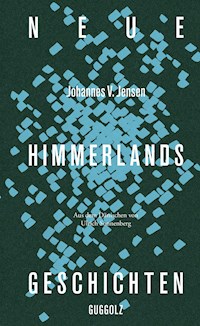
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Guggolz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Johannes V. Jensen (1873–1950) schloss mit seinem dritten Band Himmerlandsgeschichten 1910 die große Geschichts- und Geschichtenschreibung seiner Heimatregion ab. »Neue Himmerlandsgeschichten« versammelt 18 Erzählungen und Essays, in denen Johannes V. Jensen diesmal auch als Sammler der Geschichten in Erscheinung tritt. Wie ein Ethnologe reflektiert er über den Wandel der Zeit und die gesellschaftlichen Entwicklungen, sammelt Volkslieder und mythische Erzählungen. Die technische Moderne bricht ins ländliche Himmerland ein und drängt mit ihren Zerstörungen und auch Versprechungen die vertrauten Sagen und Traditionen. Die neue Eisenbahnlinie verändert nicht nur den Alltag, sondern auch den Blick auf die Welt außerhalb der unmittelbaren Umgebung. Das führt zu Emigrationswellen und zur Erweiterung der Welt um das verheißungsvolle Land jenseits des Ozeans, das nun erreichbar geworden ist. Die Risse in der Gesellschaft und in den einzelnen Menschen, die durch den Eintritt in die Moderne entstehen, kennt niemand so genau wie Jensen. Zweifel an der Erzählbarkeit äußern sich in essayistischen Formen, in eingeschobenen Erläuterungen und Reflexionen. Und doch zelebriert Jensen in grandiosen Geschichten über Figuren wie Jørgine, Schleifstein-Ajes oder den Pferdehändler Kresten die menschliche Würde der unverwüstlich eigenwilligen Himmerländer. Ulrich Sonnenberg spürt in seiner präzisen Übersetzung der Beschreibungskunst Jensens nach und verschafft den fast urtümlichen Erzählungen einen auch für unsere Ohren zeitlosen, aber doch betörenden Klang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes V. Jensen
NEUE HIMMERLANDSGESCHICHTEN
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Mit einem Nachwort vonHeinrich Detering
INHALT
NEUE HIMMERLANDSGESCHICHTEN
DER PFERDEHÄNDLER
KLEIN-SELGEN
BO’L
SCHLEIFSTEIN-AJES
HERR JESPER
DER EMIGRANT
GRAABØLLE
DER HEIDEBAUER
HIMMERLANDS BESCHREIBUNG
JENS JENSEN WEBER
DIE WASSERMÜHLE
DER HUND DES BAKHOFBAUERN
JØRGINE
DER SPILLMANN
DAS MÄDCHEN AUS HVORHVARP
RAVNA
ALS DER SCHUHMACHER INS FEGEFEUER KAM
FÜR MEINEN GROSSVATER
ANHANG
EDITORISCHE NOTIZ DES ÜBERSETZERS
ANMERKUNGEN
NACHWORT VON HEINRICH DETERING
BIOGRAFIEN
DER PFERDEHÄNDLER
Es ließ sich gar nicht vermeiden, dass den Leuten vom Bakhof hin und wieder ein Streich gespielt wurde, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab. Noch immer erinnerte man sich an den Silvesterabend, an dem die Burschen aus Graabølle die Fenster des Hofs mit Papier verklebt und die Bakhofbauern zweieinhalb Tage in dem Glauben geschlafen hatten, es sei noch immer Nacht; es war eine Geschichte, die zu gut war, als dass sie hätte vergessen werden können. Aber auch später hatten die Bewohner des Bakhofs manche Unbill zu ertragen, zum Beispiel als Kresten, der älteste Sohn, ein Pferd kaufen wollte und sich dabei nach Strich und Faden blamierte. Damals hatte er den Hof bereits übernommen.
Der alte Bakhofbauer hatte zur gebotenen Zeit sein Altenteil angetreten und der Jugend den Hof überlassen, Kresten trug nun die Verantwortung. Er war nicht mehr ganz jung, dieser Kresten, beinahe dreißig, aber schon immer war er für seine Umtriebigkeit bekannt. Und als er den Hof übernahm, überkam ihn ein regelrechtes Fieber, er wollte alles richtig machen und sich genauso verhalten wie andere junge Hofbesitzer. Nur gelang ihm leider durchaus nicht alles, ja, ihm passierte so manches Missgeschick, und er erlitt eine Reihe von Rückschlägen. Allerdings handelte es sich nur um Kleinigkeiten – zumindest hoffte er es. An die wirklich großen Dinge wagte er sich ohnehin nicht heran. Kresten war noch nicht verheiratet, denn das war für ihn die größte aller Fragen. Was auch immer er unternahm, er sah alles als eine Prüfung an, die darüber entschied, ob er jemals der reizvollen und gefährlichen Aufgabe gewachsen sein würde, eine Frau zu finden.
Kresten war ein Zweifler. Das war er schon immer gewesen, und das Leben hatte ihn in seinem Recht zu zweifeln bestärkt. Wie in der bitteren, tränenreichen Zeit beim Militär in Aalborg, als er wegen Schamhaftigkeit für untauglich erklärt worden war … sein Leben lang würde er sich darüber grämen, es hatte seinem Glauben an sich selbst einen harten Schlag versetzt. Und es hatte weitere derartige Vorfälle gegeben. Kresten war so stark, dass er einen Ochsen hätte tragen können, doch fehlte es ihm an Selbstvertrauen. Und das wusste er genau.
Daher nutzte er jede Gelegenheit, sich selbst zu beweisen, und seine unablässige Geschäftigkeit hatte weniger damit zu tun, durch irgendeine Tat Aufsehen zu erregen, vielmehr wollte er den anderen ebenbürtig sein und sich die gewöhnlichsten Fertigkeiten des alltäglichen Lebens aneignen. Erst wenn ihm etwas gelänge, womit er selbst zufrieden wäre – es müsste nicht einmal etwas Besonderes sein –, hielte er sich für reif genug, um um die Hand einer Frau anzuhalten.
Nachdem Kresten den Hof übernommen hatte, bemühte er sich als Erstes um ein sicheres Auftreten beim Handeln. Das war sehr wichtig, doch es fiel ihm schwer. Aber andere Leute waren schließlich auch gute Händler, also musste es sich lernen lassen.
Daher begann Kresten, ohne großes Aufsehen zu erregen, über die Märkte und anderen Orte zu schlendern, wo Menschen und Tiere zusammenkamen. Es galt, sich einen gewissen Ruf als Pferdehändler zu verschaffen. In der ersten Zeit kaufte und verkaufte er nicht, sondern stand nur daneben, wenn andere handelten, um zuzuhören und alles Wesentliche zu erfahren. Kresten war zu schüchtern, um Fragen zu stellen und von denen zu lernen, die klüger waren als er; er wagte nicht, seine Unsicherheit zu verraten, gleichzeitig spürte er aber auch, dass es ihn nicht befriedigen würde, etwas zu können, das er durch Fragen erlernt hatte. Sein Ehrgeiz bestand darin, wie alle anderen Burschen in seinem Alter seine eigenen, gleichsam angeborenen, natürlichen Fähigkeiten zu zeigen. Und das war keineswegs ein so geringes Ziel, wie viele glauben mögen.
Was anderen Bauern gemessenen Schrittes zuteilwurde, musste Kresten gleichsam im Sprung erreichen. Es war gewissermaßen eine Verzweiflungstat, als er es schließlich wagte, auf dem Markt von Hvalpsund ein Pferd zu kaufen. Es war ein recht gutes Geschäft, nur ahnte niemand, was es ihn gekostet hatte, so zu tun, als wäre alles völlig normal. Aber gekauft hatte er das Pferd.
Es war ein gut vier Jahre altes Tier, ein Exemplar von der Art, die das Auge erfreut, dem Besitzer zur Ehre gereicht und gleichzeitig in der Lage ist zu arbeiten. Es war von ganz anderer Qualität als die Mähren, die normalerweise auf dem Bakhof in die Krippen sabberten. Kresten wollte mit der Zeit gehen. In gewisser Weise hatte er Glück gehabt, den Handel trotz seiner eigenen Kleingläubigkeit abgeschlossen zu haben. Er war so vorsichtig gewesen, das Pferd einem Mann abzukaufen, der nicht aus der Gegend stammte und daher auch nicht auf die Idee kam, Krestens Äußerungen über Pferde im Allgemeinen anzuzweifeln. Und es war gut gegangen. Eigentlich kannte Kresten sich bestens aus, aber, wie gesagt, er war es nicht gewohnt, sich darauf zu verlassen, dass es tatsächlich richtig war. Es kam ihm wie ein Traum vor, dass es ihm gelungen war, den Mann mit kühler Kennermine gefragt zu haben, was das Pferd kosten solle, dass er, die Pfeife tief im Mundwinkel, lässig und aufmerksam dagestanden hatte, wie jemand, der sich von nichts auf der Welt täuschen lässt, während der Besitzer das Pferd vor seinen Augen auf und ab traben ließ. Eigenhändig hatte er das ungeheuer viele Geld gezahlt und wie ein geachteter Hofbesitzer und erfahrener Pferdehändler den Kauf begossen. Wäre irgendjemand aus seinem Bekanntenkreis dazugekommen, wäre es völlig unmöglich gewesen.
Aber nun war es tatsächlich geschehen, es war die glückselige Wahrheit, dass er hier am Straßenrand nach Hause ging und eines der schönsten Pferde des ganzen Marktes am Zügel hinter sich herzog! Mit einem Glücksgefühl in der Brust sah er sich alle Augenblicke nach dem braven Tier um. Es erschien ihm noch ein wenig fremd, aber das war so überraschend nicht, schließlich hatte er es gerade erst gekauft und kannte es noch nicht. Er musste sich keine Sorgen machen. Kresten wusste, dass man ihn mit dem Pferd nicht betrogen hatte, es wies keinen der Mängel auf, die er kannte, es war gesund, ein durch und durch gutes Pferd. Im Geiste sah er ein ähnliches Tier vor sich, das er noch kaufen wollte, er sah die beiden Pferde glänzend und edel Seite an Seite vor einem funkelnagelneuen gefederten Wagen, der in der Tat ebenfalls nicht ungekauft bleiben sollte. Doch das alles würde nach und nach geschehen, ohne größeres Aufsehen zu erregen. Die Leute im Dorf sollten es nicht merken, es sollte sich einfach so ergeben, zufällig, als wäre der neue Bakhofbauer schon immer, ja, eigentlich von Geburt an, mit der Zeit gegangen, als verhielte er sich genauso wie alle anderen Leute in Graabølle und Umgebung.
Abgesehen von der Furcht, nicht so wie die meisten anderen Menschen zu sein, hatte Kresten vor nichts mehr Angst, als bei einer Veränderung seines Verhaltens oder Änderungen auf dem Hof ertappt zu werden. Vermutlich hatte diese Furcht ein und dieselbe Ursache, nämlich die Angst, wie er sich verhalten sollte, wenn die Menschen ihn beobachteten. Denn dabei ging es ja gewissermaßen um sein Leben. Schließlich gab es keine andere Welt für Kresten als den engen Kreis, in dem er nun einmal lebte.
Aber im Augenblick war er glücklich. Der Anfang war gemacht. Hier lief er mit dem neuen Pferd, das war geschafft, und während Kresten weiterging, hatte er nur eine einzige Sorge: Er wollte so gleichgültig wie möglich erscheinen, sollte ihm einer seiner Nachbarn begegnen. Auf dem Heimweg fuhren mehrere Fuhrwerke mit Bekannten vorbei, die ebenfalls auf dem Markt gewesen waren, und allen zeigte Kresten sein ausdrucklosestes Gesicht, aus dem sich wahrlich nur schwer etwas ablesen ließ. In seinem Kopf kreiste indes der Gedanke, ob sie nun auch tatsächlich das vortreffliche Pferd gesehen und bewundert hatten, das er hinter sich herzog. Viele, die vorbeifuhren, sahen und bewunderten sein Pferd, allerdings ohne wirklich zu stutzen oder Kresten darauf anzusprechen, und genau das war ja das Schöne daran. Hätten sie eine Bemerkung gemacht, ihm etwas zugerufen, gelacht oder sich überhaupt für ihn interessiert, wäre alles verdorben gewesen. Wenn man weiß, dass Bauern sich nicht ohne Grund so verhalten, muss man sich nicht wundern, auf so erstaunlich wortkarge und mimosenhafte Bauern mit sieben Vorhängeschlössern vor dem Mund zu treffen. Wenn kein anderer auf sie Acht gibt, passen sie gegenseitig auf sich auf.
Für Kresten war es ein stolzer Tag. Auf dem Heimweg hatte er das Gefühl, mit dem Pferd auf der Landstraße an feindlichen Lagern vorbeizuschleichen, stets in der größten Gefahr, entdeckt zu werden. Aber schon bald würde er in Sicherheit sein, in der Ferne sah er bereits den Kirchturm von Graabølle und links davon den Bakhof …
Da holte ihn Anders Mikkelsen in seiner stattlichen Kutsche ein, vor die er die Knapstrupper gespannt hatte, und er bremste – Anders Mikkelsen, der berühmteste Pferdehändler und Scherzbold der Gegend, ließ die Knapstrupper halten und rief ihm zu:
»Hast du ein Pferd gekauft, Kresten?«
Kresten war höflich stehen geblieben, antwortete aber nicht, seine Gesichtszüge waren erstarrt. Keinesfalls sollte irgendjemand ihm etwas ansehen können.
»Das Pferd kenne ich gut«, rief Anders Mikkelsen und hickste unbekümmert. Er hatte auf dem Markt ein paar Tässchen Tee genossen. In beiden Augen glimmte ein kleiner roter Funke, und in den Mundwinkeln saßen bestimmt tausend Späße. »Ich hab das Pferd schon mal gesehen.«
Und Anders erwähnte den Mann, von dem Kresten das Pferd gekauft hatte. Es war offensichtlich, Anders kannte den Mann, es war kein leeres Gerede.
»Ein schönes Pferd, das man sich gern ansieht«, fügte er hinzu und ließ die Peitschenschnur in der Luft gemächlich vor- und zurückschwingen. Dann zog er an den Zügeln, und als die Knapstrupper sich in Bewegung setzten, beugte er sich vom Kutschbock und rief:
»Aber ich sage dir, es hat Feldspat!«
Da stand Kresten nun. Er sah Anders Mikkelsen nach, der wie ein Sieger auf der Landstraße weiterfuhr. Verflucht! Feldspat! Was um alles in der Welt war das für eine Krankheit? Kresten hatte nie davon gehört. Also hatte das Pferd doch keine gesunden Beine, und das ganze Spiel war verloren! Nicht nur, dass die Leute darüber reden würden, Anders Mikkelsen hatte ja nichts davon, wenn er den Mund hielt; noch schlimmer war, dass Kresten sich nun selbst wieder seiner eigenen elenden Begrenztheit bewusst wurde. Er war einfach zu schwer von Begriff, er hatte kein Selbstwertgefühl. Der Tag hatte seinen Glanz verloren. Er drehte sich nicht mehr nach dem Pferd um, es hatte keinen Sinn mehr, das Ganze war hoffnungslos.
In den ersten Tagen nach seiner Heimkehr mit dem neuen Pferd ging Kresten heimlich in den Stall und hob ein Bein nach dem anderen am Haarbüschel des Fesselgelenks, untersuchte und befühlte es und strich mit den Fingern über den Huf, aber es war ihm nicht möglich, auch nur den geringsten Fehler an Hufen und Beinen zu entdecken. Das Pferd war in seinen Augen gesund, und es war schlichtweg entmutigend, dass er den Fehler nicht finden konnte. Kresten schüttelte über sich selbst den Kopf und starrte einsam und verzweifelt vor sich hin. Es war traurig.
Nicht einmal die Meinung seines Vaters über das Pferd konnte Kresten zufriedenstellen, obwohl der alte Bakhofbauer sich zu seiner Zeit gut auf Pferde verstanden hatte. Der Alte hielt das Pferd für einen guten Kauf. Nicht dass es ihm gefiel, denn er hatte sein Leben lang einen Hang zu kleinen, verdrießlichen Mähren mit Haaren über den Ohren und Hufen wie Spucknäpfe gehabt. Aber dieses Missbehagen sprach er nicht aus, schließlich saß er auf dem Altenteil und wollte die Schnäpse nicht missen, die sein Sohn ihm bisweilen über den Tisch schob. Was den Wert des Pferdes betraf, stimmte er dem Kauf zu. Leider ließ Kresten, der zunehmend schwermütiger wurde, sich davon nicht trösten.
Schließlich traf er eine Entscheidung. Heimlich brach er zu einem vier Meilen entfernten Markt in einem vollkommen fremden Kirchspiel auf und verkaufte das Pferd dort. Er verlor dabei nicht gerade wenig, zumal er beim Verkauf einen Fehler nach dem anderen machte. Schließlich konnte er nicht für das Pferd garantieren, aber verkauft werden sollte es. Kresten kam ohne das Pferd nach Hause, nun war die Situation immerhin wie vor dem ersten Handel. Nicht sonderlich gut für sein Selbstwertgefühl, aber zumindest etwas eindeutiger. Nun konnte man von vorn beginnen. Jetzt war man doch erheblich klüger.
Einige Tage später traf Kresten Anders Mikkelsen und ein paar andere Pferdehändler am Wirtshaus und schloss sich sofort der Gesellschaft an – mehr als unbefangen in seinem Auftreten und so gut wie völlig betrunken. Und nachdem der Bakhofbauer auf sich aufmerksam gemacht hat, blinzelt er Anders Mikkelsen mit einem spitzbübischen Grinsen zu und vertraut ihm an:
»Ich habe das Pferd verkaufen können …«
Kresten benutzte nicht seine gewohnte Umgangssprache, sondern versuchte, wie jemand aus der Stadt zu klingen, er sprach jede Silbe peinlich genau aus, weil es sich seiner Ansicht nach unter Pferdehändlern so gehörte. Als Anders Mikkelsen dies hörte, stutzte er und schwieg verständnislos, was meinte der Mann vom Bakhof?
»Doch, ich habe es einem Kerl aus der Gegend von Holstebro aufgeschwatzt«, fuhr Kresten fort und versuchte noch immer, wie ein Städter zu sprechen. »Ja, das habe ich wirklich getan. Er hat es bekommen, mitsamt Feldspat und allem …«
Kresten schlug sich auf die Schenkel und lachte, bis seine Stimme sich in den höchsten Fistelregistern überschlug. Schließlich saßen hier Pferdehändler beieinander und wollten sich amüsieren. Und dieser Witz war einfach zu gut, den musste er noch einmal erzählen:
»Ich habe es mitsamt Feldspat und allem anderen verkauft … hol mich der Teufel …«
Kresten brüllt vor Lachen und kann vor Heiterkeit kaum aus den Augen schauen. Aber nanu, die anderen lachen überhaupt nicht mit … sie stehen um ihn herum und sehen ihn kühl an, und Anders Mikkelsen …
»Sag mal, hast du nich selbst Feldspat?«, unterbricht ihn Anders hart und auf gut Jütländisch. Er ist heute nüchtern und ärgert sich über Kresten, er traut seinen Ohren kaum.
»Du hast doch nich etwa das gute Pferd verkauft?«
Kresten sackt plötzlich zusammen, als hätte er einen Schlag in die Magengrube bekommen, seine Augen werden ganz klein.
»Du hast diesen Unfug doch nicht etwa geglaubt?«, erkundigte sich Anders Mikkelsen lächelnd, allerdings wurde es ein schiefes Lächeln, denn der arme Kerl tat ihm leid. »Glaubt sofort, was ich ihm weismache!«
Und Anders Mikkelsen schüttelte leise den Kopf, als würde er einen Kranken bemitleiden. Und Kresten litt tatsächlich, er gab ein röchelndes Geräusch von sich, brachte aber kein Wort heraus.
»Du Dummkopf«, sagte Anders und schüttelte erneut mitleidig den Kopf. »Geht her und verkauft das kräftige und gesunde Pferd! Ja, ich habe gesagt, es hätte Feldspat, aber das war doch ein Scherz, ich war besoffen. Feldspat, daraus sind die Feldsteine gemacht, das musst du doch wissen? Hast du wirklich geglaubt, mit dem Pferd sei irgendetwas nicht in Ordnung … ts, ts, ts …«
Anders Mikkelsen wandte sich betrübt von ihm ab. Und die Gruppe der Pferdehändler, die um ihn herumstand, öffnete und schloss sich hinter ihm wie ein Organismus, der einen Fremdkörper ausstößt.
Seit dieser Großtat nannte man Kresten natürlich nur noch den »Pferdehändler«, obwohl er ein Mann vom Bakhof war und blieb.
KLEIN-SELGEN
Eines frühen Morgens kam An’ Kjestin von der Post vom Regen durchnässt in die Küche zu Anders Nielsens Frau und stieß ihre verfrorene Nase wie ein großer kranker Vogel vor … dies war schon einmal passiert, und Anders Nielsens Frau goss, ohne viele Worte zu verlieren, warme Milch in eine Schale mit Grütze und stellte die Schale vor An’ Kjestin auf den Tisch.
Nur ließ An’ Kjestin von der Post sich an diesem Tag nicht trösten; sie fing bereitwillig an zu essen, brach dann aber sofort wieder in Tränen aus:
»Heute Morgen habe ich Klein-Selgen gesehen.«
»Wirklich?« Anders Nielsens Frau senkte ihre Stimme ein wenig.
»Ja. Er stand vor meinem Bett …«
An’ Kjestin hob mit ihrem langen dünnen Unterarm, der einem Brennholzscheit ähnelte, den Löffel hoch und riss die rotgeweinten Augen weit auf:
»Er war es … und er sollte doch in Melbjærg bei Kren Torp in Diensten sein. Der Herr sei mir gnädig!«
Anders Nielsens Frau nahm ruhig die Kaffeemühle vom Herd, setzte sie sich an die Hüfte und fing an zu mahlen, hier war größerer Trost nötig.
»War es wirklich Selgen? Bist du sicher?«
»Er sah ganz genauso aus«, beharrte An’ Kjestin und löffelte untröstlich weiter. »Und soweit ich es beurteilen kann, war er es selbst. Ich habe ihn genauso deutlich gesehen, wie ich dich jetzt sehe, Lone.«
Anders Nielsens Frau erschauderte unter An’ Kjestins Blick.
»Ich bin aufgewacht und hatte das Gefühl, sehr traurig zu sein, es war vor dem Morgengrauen, aber es war hell genug, um etwas zu erkennen, und da stand eine kleine Gestalt vor meinem Bett, es war Selgen. Ich konnte seine Zähne erkennen.«
»War er bleich?«, wollte Lone wissen.
»Nein. Er stand im Dunkeln. Und er hat nichts gesagt. Er lächelte … ich ahnte, was er wollte … Gott tröste mich und sei mir gnädig … er ist tot. Er ist hungrig gestorben …«
An’ Kjestin legte den Löffel beiseite, die großgewachsene Frau, die Ähnlichkeit mit einem Pfosten hatte, sackte zusammen … Lone ging zu ihr, um sie zu stützen.
»Wieso glaubst du das?«, fragte Lone, der nun ebenfalls die Tränen in den Augen standen.
An’ Kjestin von der Post richtete sich langsam auf. Sie rieb einen Finger fest unter der Nase und setzte ihr Reiben mit dem Inneren der Handfläche und dem Unterarm fort, bis sie beinahe den Ellenbogen erreichte, dann zog sie die Nase hoch, blinzelte mit den inzwischen trockenen Augen und erklärte:
»Na ja, so habe ich es empfunden. Er war so fröhlich. Er stand da und lachte, genau wie im Herbst, als es auf der Heide so viele Preiselbeeren gab und er mir erklärte, das sei doch gut, jetzt müsse ich ihm nicht so viel zu essen kaufen. Er könnte morgens, mittags und abends Preiselbeeren und Schwarzbeeren essen, sagte er, es schien ihm etwas ganz Besonderes zu sein. Er stopfte die Hände in die Taschen, lächelte und war so glücklich. So habe ich ihn heute Morgen gesehen, ich sah die breiten Vorderzähne, die er in letzter Zeit bekommen hat. Er stand da, als wollte er mir erzählen, jetzt hätte er genug, jetzt bekäme er, was er wollte. Und damit verschwand er.«
»Wirklich?«, stieß Lone wie unter Schmerzen aus.
»Ja«, sagte An’ Kjestin. »Er ist in Gottes Obhut. Aber jetzt muss ich die Post austragen.«
An’ Kjestin begann ihre vier Meilen lange Tour an diesem Tag nicht anders als an allen anderen Tagen des Jahres, gebückt, mit langen, energischen Schritten und einem s-förmigen Hals wie bei einem Reiher. Von der Briefsammelstelle ging sie mit ihrer Tasche, auf deren Lederklappen mit Schuhmachergarn der Name des Postortes gestickt war und die ein paar Briefe mit großen schiefen Anschriften und einige wenige Ausgaben von Ugens Nyheder enthielt, in die westliche Gegend. Es regnete, klatschnass lief sie los und kam mit triefendem Rock heim, die mit Eisen beschlagenen Holzschuhe vollgesogen mit herbstlicher Nässe. Und dann brach sie in der beginnenden Dunkelheit nach Melbjærg auf, anderthalb Meilen über die Heide.
Am nächsten Morgen fand sie sich wieder bei Lone ein, zitternd vor Kälte, erloschen, beinahe stumm. Sie aß, was Lone ihr vorsetzte, doch erst nach langem Fragen erfuhr Lone, was sich zugetragen hatte. Klein-Selgen hatte Kren Torps Hof vor zwei Tagen verlassen.
Es war also wahr, was An’ Kjestin gesehen hatte. Der Junge war verschwunden.
Wie lange ist das nun schon her. Das Haus, in dem An’ Kjestin von der Post gewohnt hat, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Stelle, an der es stand, wurde umgepflügt, und nur diejenigen, die sie kannten, erinnern sich, dass hier einmal jemand gewohnt hat. Das Haus war klein, so kleine Häuser werden heutzutage gar nicht mehr gebaut, nur ein Wohnzimmer mit einer Tür und einem winzigen Fenster, Lehmwände und ein Dach aus Heidekraut. Wie ein kleiner dunkler Hügel, wie ein einsamer Vorposten stand es draußen auf der Grenze zwischen Heide und Moor. Es gab keinen Baum in der Nähe, und es gehörte nicht einmal ein bisschen Land zu dem Haus. Selgen hatte nichts besessen, er war Tagelöhner gewesen, und doch war es ihm gelungen, die Hütte zu bauen, damit er und An’ Kjestin unter einem gemeinsamen Dach leben konnten. So begann man damals. Dann musste gespart werden, das heißt, es galt so lange Torf für andere zu stechen, Stroh zu dreschen und Steine zu schleppen, bis schließlich ein wenig Geld übrig war, um ein Stück gerodete Heide zu kaufen. Und während andere ausruhten, dauerte es seine Zeit, das Land umzupflügen und mit den Mühen eines Jahres zu fruchtbarem Boden zu machen. Unendlich weit in der Ferne winkte das Ziel: auf dem eigenen Grund und Boden eine Kuh und ein paar Schafe zu halten. So wurde man in früheren Zeiten Bauer, und so hätte Selgens Schicksal ausgesehen, wäre er nicht gestorben, bevor er richtig begonnen hatte. An’ Kjestin und der kleine Junge, der nach seinem Vater benannt war, blieben allein in dem leeren Haus zurück. Und als der Mann fort war, riss sie sich zusammen und erledigte die Arbeit auf dem Hof selbst, ohne Hoffnung auf Erfolg und nur, weil sie und Klein-Selgen nicht hungern sollten. Sie übernahm die Aufgabe der Landbriefträgerin, das hielt sie wenigstens auf den Beinen, wenn man so will. Sie hatte durchaus Freundinnen, die Frauen auf den umliegenden Höfen halfen An’ Kjestin von der Post, denn sie wussten, wie man ihr helfen konnte. Sie gaben ihr etwas zu essen, wenn sie mit ihrer Tasche zur Tür hereinkam. Sie bat nie um etwas, vertilgte aber gewaltige Mengen, wenn sie eingeladen wurde; zu Hause in ihrer Hütte gönnte sie sich nichts, damit Klein-Selgen nichts entbehren musste.
In den harten Wintertagen, als ein drei Tage wütender Schneesturm Straßen und Wege hatte unsichtbar werden lassen, gab es immer jemanden, der sich an An’ Kjestin von der Post erinnerte und sich mit einem Brot durch Sturm und Schneetreiben bis zu ihrer Hütte durchkämpfte. Mehr als einmal fand man Mutter und Sohn wie im Winterschlaf im Bett, mit erloschenem Kamin und ohne die geringste Spur von irgendetwas Essbaren im Haus.
Im Sommer kamen sie am besten zurecht, der Magen braucht nicht so viel, wenn es warm ist. Der Herbst aber war ihre große Zeit, dann erntete An’ Kjestin Kartoffeln für die Bauern, und Klein-Selgen versorgte sich fast ausschließlich auf der Heide, sobald sie reif waren erst mit Schwarzbeeren, dann mit Preiselbeeren. Ach ja, dann war er so glücklich, weil er es der Mutter ersparte, für Essen zu sorgen …
Schließlich war An’ Kjestin der Ansicht, er sei alt genug, um in Dienste zu gehen. Und nun war er verschwunden. Auf dem Hof wussten sie nur zu berichten, dass Klein-Selgen vor zwei Tagen seiner Wege gezogen war. Nicht dass sich irgendjemand beklagte, er war ein guter Junge, und sie waren gut zu ihm gewesen, aber sie hatten die ganze Zeit über gemerkt, dass der Kleine bitterlich an Heimweh litt. Er war nicht wie die anderen Hütejungen, die in den ersten Tagen den Kopf hängen lassen und dann mit anpacken; Klein-Selgen hatte sich nicht eingewöhnen können, als hätte er Angst vor dem Hof gehabt. Und dann hatte ihn der Mut verlassen. Wenn sie aßen, legte er den Löffel beiseite und war untröstlich; und je besser das Essen war und je mehr es davon gab, sah es beinahe so aus, als würde es ihn umso mehr erschrecken. Eines Morgens lag er nicht in seinem Bett, aber sie hatten angenommen, dass er wohl heim zu seiner Mutter gegangen sei, denn danach hatte sich der Junge doch so gesehnt.
An’ Kjestin von der Post stieß die Nase wie einen Schnabel vor und schnappte nach Luft, als sie diese Erklärung hörte. Sie verstand durchaus, warum Klein-Selgen sich in dem Reichtum des Hofes nicht hatte zurechtfinden können und warum ihm das Essen nicht hatte schmecken wollen – es lag daran, Gott sei’s geklagt, dass er an seine Mutter und ihr abgewetztes Brotmesser daheim in der Heidekrauthütte mit dem einen Fenster dachte.
Man fand ihn draußen auf der Heide, meilenweit entfernt, an einem Ort, über dem sie Vögel in der Luft kreisen sahen, dort lag er halb versunken in einer Pfütze. Er lag auf dem Rücken im struppigen Gras und war fast nicht zu erkennen, und doch sah es aus, als würde er lächeln. Eine grüne Fliege saß auf den breiten, noch nicht ganz ausgewachsenen Vorderzähnen.
An’ Kjestin von der Post ist vor vielen Jahren gestorben. Von dem kleinen einsamen Aussiedlerhaus an der Grenze zwischen Heide und Moor ist nicht die geringste Spur geblieben. Die Armen sterben aus. So kann man auch mit der Armut fertig werden. Aber die Genügsamkeit und die Dankbarkeit gegenüber der Hand, die Gottes Gaben verteilt, das trockene Brot, geraten mit ihnen in Vergessenheit.
BO’L
Es ist schon lange her und hört sich eigentlich nicht nach einer Geschichte an, die des Erzählens wert ist, aber damals war alles vorhanden, woraus die schönsten Geschichten entstehen.
Schilf-Sørens Bo’l (so sprachen sie Bodils Namen im Himmerland aus) sollte heiraten. Sie war erst neunzehn Jahre alt und hatte ihren künftigen Ehemann noch nie gesehen. Denn Schilf-Søren hatte in Amerika eine Kusine mit einem erwachsenen Sohn, ihn sollte Bo’l heiraten. Die Hochzeit war aus der Entfernung arrangiert worden, und außer Bo’l war die ganze Familie daran beteiligt gewesen, dennoch war sie von Herzen glücklich. Er hieß Chas Anderson und war dem Foto nach zu urteilen ein ausgesprochen attraktiver Mann. Vor dem fremden Namen musste niemand Angst haben, denn eigentlich hieß er Karl und war hier in Bo’ls Heimat geboren, obwohl es schon so lange her war, dass sie sich nicht mehr an ihn erinnern konnte. Er besaß einen Hof mit mehreren hundert Morgen Land in Nebraska, USA, ebenso viel Land, wie hierzulande zu einem Herrenhof gehört. Nun hatte sich die Familie auf beiden Seiten des Atlantiks darum bemüht, dem Hof eine Frau zu beschaffen, und die Glückliche war Bo’l. In ihren Mußestunden betrachtete sie das große glänzende Kabinettporträt mit dem fremden Namen und den Medaillen darunter, das einen vornehmen Herrn mit gescheitelten Haaren von der Seite zeigte, der einen Ausgehanzug mit weißem Kragen trug. Ein wenig glich er Onkel Jørgen, mit dem er ja auch verwandt war, und das war durchaus beruhigend; dennoch handelte es sich um eine wildfremde Person von vornehmem Stand, die von weit her kam, doch genau dieser Umstand war ja so interessant und großartig. – Oh, Hauptsache er war nicht ein so feiner Mann, dass man von Liebe und so etwas reden musste, um von ihm geschätzt zu werden … Oh, lieber Gott, um Himmels willen!
Bei derartigen Gedanken bekam Bo’l Schweißausbrüche, dann musste sie sofort irgendetwas tun; vor Verlegenheit hüpfte sie auf der Stelle oder schlug auf etwas ganz Beliebiges ein, sie lachte oder stieß ein Brüllen aus, denn sie war ja so jung, dass nur Unfug dabei herauskam, wenn sie sich fürchtete oder schämte. Sie fiel »Perle« um den Hals und stürzte sich mit ihrem ganzen Gewicht auf den altersschwachen kleinen Hund, der beinahe erdrückt wurde und sich in ein wütendes wildes Tier verwandeln musste, um sich zu befreien. Bo’l pflückte Blumen, wozu sie eigentlich schon zu alt war, sang ausgelassen im Kuhstall und spielte der Kuh so alberne Streiche, dass das alte Haustier in seiner Box verärgert den Kopf herumwarf. Wie damals, als sie noch ein kleines Mädchen war, formte Bo’l aus Brot- und Wurstscheiben heimlich »Ritter«, verstreute die Krümel und ließ die Fliegen und Mücken darauf aufmerksam werden. Dann wiederum trat sie wie eine verheiratete Frau mit einem straff über das Haar gezogenen Kopftuch, schlurfenden Holzschuhen und hausmütterlichen Anwandlungen auf – kurzum, Bo’l war verliebt.
Bo’l war das einzige weibliche Wesen in Schilf-Sørens Haus. Ihre Mutter war gestorben, und die Geschwister dienten auf fremden Höfen. Viel zu tun gab es in der kleinen, einsam gelegenen Büdnerei nicht, man konnte nur die Kuh und den Vater umsorgen, der tagein, tagaus seine Matten und Binsenschuhe flocht. Bo’l hatte reichlich Zeit, an ihre Hochzeit zu denken. In vier Monaten, noch vier Monate – die kurz und gleichzeitig aber auch lang waren –, wenn es doch nur schon so weit wäre, wie sollte sie es bloß so lange aushalten … lieber Himmel!
Zwei Dinge ängstigten Bo’l indes und ließen ihr Blut jedes Mal schneller fließen, wenn sie an ihre Hochzeit dachte. Zum einen wusste sie einfach nicht, was sie tun musste, um auf ihren Bräutigam, den Amerikaner, ansprechend und anziehend zu wirken. Wenn sie daran dachte, hatte Bo’l das Gefühl, so armselig und wertlos, so vollkommen frei von allen Vorzügen zu sein, dass ihr, was immer sie in den Händen hielt, herunterfiel und sie nur in winzigen Atemzügen Luft holte – so fühlte sich in ihrer Einsamkeit die eigene Bedeutungslosigkeit an. Oder sie brach ganz einfach in schallendes Gelächter über sich selbst aus, ha, ha – schließlich bot man den Leuten ja auch eine Speckseite an, eine sprachlose Göre, mit der man Löcher in den Kirchboden hätte schlagen können! Bo’l schnaubte geradezu bei dem Gedanken und atmete lang und tief ein, ganze Tonnen von Luft atmete sie ein und aus, während sie verletzt und erregt an ihre eigene Unwürdigkeit dachte. Tatsächlich war Bo’l zu ihrem heillosen Kummer ein kräftiges und wohlbeleibtes Mädchen, eine neunzehnjährige Fenja, der kein Mühlstein auf der Erde oder im Meer zu schwer war. Sie war eine Riesin mit dem Herzen einer Stute, schwergliedrig und mit einem Rücken wie ein Kran. In tiefster Scham wusste sie, dass sie mit den Füßen in einem Zwanzigliterscheffel stehen und eine Tonne Roggen auf den Schultern tragen konnte. Es gelang ihr fast, die Kuh hochzuheben – in aller Heimlichkeit hatte sie es einmal versucht, gleichsam um ihrem eigenen Unglück in die Augen zu schauen. Es musste ja niemand erfahren, aber vor sich selbst konnte sie es nicht verbergen, zumal es doch geradezu unanständig war, so stark zu sein. Aber nicht genug damit, dass sie diese furchtbare Kraft hatte, sie war auch regelrecht feist, ja, liebe Kinder, sie quoll geradezu über, und zwar jenseits des Erlaubten; es ließ sich nicht verbergen, und daher wäre sie vor Scham auch am liebsten gestorben. Wie konnte irgendein Mann sie nur mögen, wie sollte sie ihrem Bräutigam in die Augen sehen, da sie doch überzeugt war, von Kopf bis Fuß ein einziges Missverständnis zu sein?
Dies war eine der ernsthaften Sorgen Bo’ls. Der andere Kummer schien unbedeutender zu sein, aber er beschäftigte sie beinahe ebenso sehr. Es war wie eine fixe Idee. Bo’l quälte eine nagende Angst, dass sie sich am Hochzeitstag nicht richtig benehmen und am Altar nicht weinen würde, wie man es von einer Braut erwartete. Oh, sie würde bestimmt nicht weinen können! Sie wusste es, und doch war es nicht zu ertragen, wenn sie sich selbst diese Schande bereitete. Bo’l kamen auch sonst nicht so schnell die Tränen, aber wenn es darauf ankam, vergoss sie nicht einen Tropfen, das wusste sie aus Erfahrung. Was würden die Leute sagen? Und was musste Chas Anderson denken, wenn ihre Vorahnung richtig war und sie die Trauung trockenen Auges hinter sich brachte? Bo’l standen die Tränen in den Augen, wenn sie an das Furchtbare dachte; wenn es jedoch so weit war und der Tag kam, würde ihr dieser Gedanke auch nicht weiterhelfen. In diesen Monaten war sie die Nervosität in Person, und häufig sah Schilf-Søren kopfschüttelnd von seiner Arbeit auf und machte sich Gedanken über die Tochter, die so vollkommen selbstvergessen zu sein schien und abwechselnd rot und blass wurde.
Währenddessen vergingen die vier Monate. Zwei Tage vor der Hochzeit traf Chas Anderson ein. Er war einäugig. Dieser Makel hatte die Fotografie allerdings nicht verunstaltet, da er auf dem Foto die leere Augenhöhle abgewandt hatte. Weder glich er einem Bauern noch einem vornehmen Herrn, er war weder alt noch jung, er lachte nicht, war aber auch in keiner Weise betrübt. Er hatte Geld, war geizig und sprach weder Dänisch noch Englisch. Häufig öffnete er den Mund, aber nicht, um zu lächeln; man sollte sehen, dass er Gold in den Zähnen hatte, als hätte er jahrelang nichts anderes gegessen. Er kam mit dem Zug und trug einen fürstlichen Pelz mit dem Fell nach außen, sodass er aussah wie ein auf den Hinterbeinen laufender Bär. Da es April und schon recht warm war, unternahmen die Leute den vorsichtigen Versuch, über ihn zu lachen, um die aufsehenerregende Romanze, die sich unten im Schilfhaus anbahnte, zu einem raschen Ende zu bringen. Dieser Versuch jedoch misslang. Chas Anderson hatte dafür gesorgt, dass ihm ein Gerücht vorauseilte, und dieses Gerücht verbreitete sich schnell. Am Tag vor seiner Ankunft erhielt ein Mann im Sprengel eine Postkarte von ihm, auf der er sich kühl nach dem Preis von Moholm erkundigte … möglicherweise hätte er Interesse, es zu kaufen. Moholm – zweihunderttausend Kronen – tretet beiseite, liebe Leute! Es gab wenig zu lachen über Chas Andersons Besuch in der Gegend.
Er blieb nur knapp eine Woche, taute aber nicht auf. Die Leute aus dem Sprengel, die ihn als Jungen gekannt hatten, versuchten, sich ihm zu nähern, ja, sie buckelten geradezu vor ihm, geblendet von dem Licht, das von der Vermutung über seinen Reichtum ausging. Vorsichtig nannten sie ihn bei seinem alten Namen Karl, auf den er gehört hatte, als er noch bei Regen als Hirtenjunge im Moor umherzog. Chas Anderson hatte mit ihnen nichts zu bereden und wandte ihnen das leere Auge zu. Er besuchte niemanden außer seiner armen Verwandtschaft, zumindest ihre Standesvorurteile sollten sich dieses Mal nicht bestätigen …
Später, als Chas Anderson und Missis Anderson abgereist waren, sickerte durch, warum der heimgekehrte Amerikaner sich den Bewohnern des Sprengels gegenüber so kühl benommen hatte. Man hatte bei seinem Eintreffen tatsächlich ein Ehrentor vergessen! Ja, das war wirklich ein Fauxpas. Und es war recht bitter für den Sprengel – denn Chas Anderson hinterließ das Gerücht, dass die Armenkasse mit einer beträchtlichen Summe bedacht worden wäre, wenn …
Verflixt noch mal! Hätte man das gewusst. Offenbar war es nicht gelungen, ihn zu besänftigen, daher hatte auch niemand sein Geld gesehen. Vermutlich hatte Chas Anderson alles in allem keine fünf Kronen in der Woche ausgegeben, die er in der Gegend verbracht hatte. Man hatte ihm die Ehrenbezeugungen verweigert. Vermutlich würde er nie wiederkommen.
Damit behielten die Leute recht.
Aber Bo’l? Wie war sie mit ihrem Amerikaner zurechtgekommen, von dem Moment seiner Ankunft bis zu dem Tag, an dem sie sich unter seinem kalten Auge ein letztes Mal zu dem Schilfhaus am Rande des Moores umsah, bevor sie die Reise über das wilde Meer wagte? Sie hatte es einigermaßen glimpflich überstanden. Wie sie geahnt hatte, hatte Chas Andersen zu ihrem großen Entsetzen tatsächlich begonnen, von Liebe zu sprechen, und zwar mit einem ziemlich affektierten amerikanischen Akzent. Sie hatte das Gefühl, als würden Sturzseen aus unseliger Verlegenheit über sie hereinbrechen, glücklicherweise war ihre Zunge jedoch wie gelähmt, sodass sie es nicht noch schlimmer machen konnte, indem sie selbst versuchte, auf diese vornehme Art und Weise zu sprechen. Sie hoffte zu Gott, dass es ihr auch in Zukunft gelingen würde zu schweigen. Solange sie einfach schwieg, würde Chas Anderson möglicherweise nie ihren bedauerlichen Mangel an edlen Gefühlen bemerken.
Was Bo’ls unpassende Kraft betraf, so hatte sie ebenfalls Glück gehabt und sie verbergen können. Und solange Chas Anderson sie nicht erwischte, würde sie ihre Kraft auch für sich behalten.
Auch mit den Tränen vor dem Altar erging es Bo’l nicht halb so schlimm, wie sie es befürchtet hatte. Sie hatte bitterlich geweint, als sie als Braut vor dem Altar stand.
SCHLEIFSTEIN-AJES
Das Dorf, in dem Ajes lebte, war zum Teil umgeben von den alten Schweinedeichen aus dem Mittelalter, als der Boden noch von allen Dorfbewohnern gemeinsam bestellt wurde. Die Bauern konnten sich noch gut an den Frondienst erinnern, den sie damals auf dem nahe gelegenen Herrenhof zu leisten hatten. Doch nun war es ein lebendiges Dorf, das es zu Wohlstand gebracht hatte. Auf den gediegenen Höfen hatte die Aufklärung Einzug gehalten. Es gab ärmere Leute, aber keinem mangelte es an irgendetwas. Der Gemeinderat konnte sich rühmen, dass niemand auf Kosten der Gemeinde versorgt werden musste, lediglich eine Familie wurde mit Armenhilfe unterstützt. Schleifstein-Ajes’ Familie.
Er wohnte mit seiner Frau und einer Unmenge annähernd gleich großer Kinder in einer erbärmlichen Hütte, die von der Gemeinde zum Armenhaus erklärt worden war; es war eine alte Einliegerbehausung ohne dazugehörendes Land, die langsam verfiel. Ihre ehemaligen Bewohner waren verstorben. Die Hütte bestand aus einfachen Fachwerkwänden und war so alt, dass die Wohnstube keine Decke hatte, man hatte also das Dach buchstäblich direkt über dem Kopf. Aber über eine Wohnung, die man umsonst bewohnt, soll man nichts Schlechtes sagen. Für das tägliche Brot sorgte Schleifstein-Ajes selbst. Er war Scherenschleifer, reparierte und lötete für die Leute und war auch sonst recht geschickt.
Nun darf man Ajes keinesfalls für einen verwahrlosten Strolch halten, er war kein Obdachloser, der sich mit seiner Scherenschleifer-Karre als Vorwand für unlautere Geschäfte auf der Landstraße herumtrieb. Schleifstein-Ajes blieb in seinem Sprengel, in dem er geboren worden war und in dem er das Versorgungsrecht genoss; er war ein Bauer, obwohl zu der Hütte nicht einmal ein Garten gehörte. Ajes sprach die Sprache des Dorfes und trug wie die anderen Bauern Holzschuhe und Lederärmel. Dass er nicht angefangen hatte, Land zu bestellen, lag an seiner Kleinwüchsigkeit, die Leute trauten ihm die Kraft für gewöhnliche Tagelöhnerarbeiten nicht zu – und er hatte sie auch wirklich nicht. Als Kind hatte er Klein-Ajes geheißen, und so wurde er auch noch als Erwachsener genannt, bis man ihn so oft mit seinem Schleifstein gesehen hatte, dass er fortan Schleifstein-Ajes gerufen wurde.
Wenn es daheim nicht etwas mit Lötkolben, Drillbohrer oder Kitt zu tun gab, zog Ajes mit seiner Schleifausrüstung in der Gegend umher. Er transportierte seine Schleifwerkzeuge in einer Schubkarre, aber es handelte sich keineswegs um eine dieser mit dem Fuß angetriebenen Holzdrechslerscheiben, mit denen das ausländische Pack schliff. Ajas erschien mit einem ordentlichen Schleifstein, einem Wassertrog und einer Kurbel, die einer seiner Söhne drehen durfte. Ajes’ Schleifstein war von der geschwinden Sorte, die Funken sprühen ließ und weithin zu hören war – eine wohlbekannte Vorrichtung, der die Menschen vertrauensvoll ihre Stechmesser und anderen Schneidewerkzeuge überließen. Ajes war gefragt, wenn er umherzog, und immer kam er nach Hause mit einer Schubkarre voller Blechzeug und angeschlagener Töpfe, die repariert werden mussten. Die Familie kam einigermaßen zurecht, zumindest im Sommer.
Das Schleifen betrieb Ajes als ein Mysterium, und hatte er ein feineres Werkzeug zu schärfen, so wurde es von Anfang an geradezu feierlich behandelt. Zunächst bearbeitete er das Messer grob mit dem Schleifstein, dann bekam es den Feinschliff, der mit einem weicheren Stein und Spucke von Hand ausgeführt wurde. Schließlich wurde das Messer poliert, oh, die letzte Verhätschelung der Klinge, die Ajes mit einem Ölstein vornahm, einem mit dem geheimnisvollen Inhalt eines Apothekerfläschchens getränkten Kleinod, das er am Körper trug. Dann schnitt das Messer auch ein Haar gegen den Wind und war beinahe zu gut für den Gebrauch. Wenn Ajes sich dieser Kunst hingab, die den größten Teil des Tages dauern konnte, schwieg er hartnäckig, als dürfte nur der Himmel sein Zeuge sein; nicht einmal der Gutsherr konnte Ajes eine Silbe entlocken, solange die wichtige Arbeit dauerte. Ach, was verstanden sie schon von der feineren Schleiferei! Natürlich machte sich die Arbeit nicht so bezahlt wie das einfache grobe Schleifen eines Schlachtermessers, wenn Wasser und Feuer sich am Stahl vermischten, aber dazu war jeder Trottel in der Lage. Die Kunstschleiferei jedoch gönnte Ajes sich zu seinem eigenen, privaten Vergnügen.
Nur wenige ahnten, über welche Gaben der kleine Mann verfügte, denn niemand kannte Ajes wirklich. Ihn störte es nicht. Nur seine Frau wusste es. Sie war eine Zwergin. Sie und die Kinder wussten um die Größe des Mannes. Und obwohl Ajes und Lene beide nur halb ausgewachsen waren, vermehrten sie sich mit erstaunlichem Erfolg und waren auf dem guten Weg zu einem Dutzend Kinder – eine Reihe unmerklich variierender Versionen der Eltern, die allesamt mit einem ererbten Hunger gesegnet waren, der sich mit Brot kaum stillen ließ. Und alle waren sich mit der Mutter einig in ihrem kritiklosen Respekt und Gehorsam gegenüber Ajes. Hier hatte er sein Publikum, das er ernährte und das sein eigentlich vollkommen unbegreifliches Selbstbewusstsein nährte. Wen Gott klein werden lässt, den lässt er sich vermehren.
Als Entschädigung für mangelnde Macht und Größe hatte die Natur Schleifstein-Ajes das gewaltigste Selbstvertrauen im Sprengel gegeben. Er war zu klein geraten, entwickelte aber Darmwinde wie ein Riese. Die Familie, der gegenüber er sich als der große Erzeuger fühlte, verehrte ihn als Mittelpunkt und Ziel der Schöpfung. Es herrschte keine Not im Armenhaus, im Gegenteil, es lag in einem Nebel aus glücklicher Überheblichkeit und gegenseitiger entzückter Vergötterung.
Der eigentliche Umfang von Ajes’ Bedeutung wurde nie vermessen, denn seine ärmlichen Verhältnisse verwehrten ihm eine höhere Bestimmung. Doch im alltäglichen Leben lag die Familie auf dem Bauch vor diesem Genie, das sich bereits zu erkennen gab, wenn er sich herabließ, eine undichte Kaffeekanne zu löten. Die Großtat erforderte eine tempelhafte Stille in der Stube. Die Kinder blieben mit dem Finger im Mund stehen, wenn Ajes den sternesprühenden Lötkolben von der offenen Feuerstelle nahm und ihn wie ein Vogel seinen Schnabel in das Scheidewasser auf einer Blechplatte tauchte. Nicht ein Wort durfte fallen, während das Zinn lief und der Meister mit einem beinahe wilden Blick den Lötkolben auf die Kaffeekanne richtete. Lene ging während der Arbeiten auf und ab, mit beschwichtigenden Gesten und einem gerührten Seitenblick auf den Allmächtigen. War Ajes gnädig, ließ er ganz nebenbei und eher für sich eine Bemerkung über seine Arbeit fallen. Der Monolog des Kenners, denn sie verstanden ihn ja doch nicht; Lene nahm es jedoch als Signal, die Andacht zu stören und in laute, fröhliche Rufe der Bewunderung auszubrechen: Oh, lieber Gott, Ajes, dass du das alles in deinem Kopf behältst!
Lenes Wesen war einem Kakadu ähnlich, mit seinem feurigen Schrei, sie gestattete sich eine unablässige törichte Lebenslust. Bei tiefschürfenderen Äußerungen aus dem Innenleben ihres Mannes indes schwieg sie mit feuchten Augen, gänzlich verloren in ihrer Unterwürfigkeit, wenn Ajes beispielsweise von einem Stück Zeitung aufsah und zerstreut seine Gedanken über die Regierung und das Reich verkündete. Ajes interessierte sich sehr für Politik und war mehrere Stunden in seiner eigenen Welt, wenn eine alte Zeitung in seinen Besitz kam. Hier konnte Lene ihm überhaupt nicht folgen und begnügte sich damit, die Lippen zu bewegen, als würde sie etwas sagen. Vor Demut und Stolz auf ihren Mann bekam sie dann häufig einen geradezu somnambulen Ausdruck in die Augen. Wenn ihm derart gehuldigt wurde, musste Ajes lange und heftig blinzeln. Kurze Zeit später konnte sich aber auch ein Schatten über seine Züge legen, dann kniff er die Lippen fest zusammen, sodass seine Frau sich in tiefer Ehrfurcht seiner Gemütsverfassung fügte. Die heimliche höhere Berufung ging dann wie ein Engel durch die Stube.
Niemals kroch die Familie mehr im Staub vor Ajes’ Schöpfermacht als an den großen Tagen, an denen er Glas für billige Wandbilder oder Fenster zuschnitt. Wie ein feindlicher Überfall musste Lene zwischen den Kindern wüten, um ihm Ruhe zu verschaffen, sie knebelte den Säugling mit einem Schnuller, schlug eines der Kinder zu Boden und verwies ein anderes sogar aus der Stube. Nur Flüstern und Gehen auf den Zehenspitzen war gestattet, wenn Ajes den Demanten hervorholte und damit zauberte. Der Schaft bestand aus Buchsbaumholz mit einem eingelegten »Auge« aus Perlmutt, ein unschätzbares Stück. Ajes hielt ihn senkrecht zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, dann nahm er um sich herum nichts mehr wahr. Der Moment war heilig. Zunächst fuhr Ajes mit der Fingerspitze an einem Lineal entlang über das Glas, damit der Demant nicht durch Staub beschädigt wurde, danach schnitt er, leise, bis das Glas nachgab und unter dem harten Stift knirschte. Behutsam brach er die Platte ab und studierte den grünen, schnurgeraden Bruch, nickte allwissend und legte das Glas für einen weiteren Schnitt zurecht; der Geist, der ihn überkam, ließ ihn leise schnaufen. Geschah das Unglück, dass eines der Kinder versehentlich einen kaum hörbaren Ton von sich gab, unterbrach Ajes die Arbeit mit einem gequälten und verletzten Blick auf Lene, setzte sich und schlug die Hände vor die Stirn. Er litt so lange, bis Lene ihn nach der üblichen Bestrafung der gesamten Nachkommenschaft und unter vielem Beklagen und Schmeicheln wieder sanft stimmte.
Der heimische Gottesdienst verlieh Ajes eine in sich gekehrte Würde, wenn er unter Fremden war; er bewegte sich dann mit einer unbeschreiblichen Betonung seiner Haltung und einem schicksalsschwangeren Gesichtsausdruck, als würde der Lauf der Welt von seinen Eingeweiden abhängen. Es quatschte in seinen abgelaufenen Holzschuhen, wenn er über die Erde schritt, und die Falten des schlottrigen, geflickten Hosenbodens wackelten gewichtig mal zu der einen, mal zu der anderen Seite, wie ein taktfest wiederholter, dunkler Orakelspruch. Ajes drückt viel von seinem Wesen mit dem Hinterteil aus.
Ansonsten war er ein wortkarger Mann. Nur die Politik, seine eigentliche Herzensangelegenheit, konnte ihn bisweilen so erhitzen, dass ihm einzelne Warnungen, Grundsätze und dunkle Reden über die Lippen kamen und man sich vorstellen konnte, was in der bescheidenen Hülle steckte. Der Apotheker der Gegend ließ in Ajes’ Nähe einmal eine Bemerkung fallen, in der er die Hoffnung auf irgendetwas ausdrückte, das nichts mit Politik zu tun hatte. »Das geschieht gewiss nicht in diesem Kabinett«, entgegnete Ajes plötzlich. Irgendetwas hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Erstaunt wollte der Apotheker mehr hören, doch Ajes war bereits gegangen. Die Holzschuhe quatschten und die Falten des Hosenbodens wackelten wie eine Fügung von der einen zur anderen Seite. An diesem Tag meinte Lene aufgrund von Ajes’ feierlicher Miene und gewisser bedeutungsvoller Worte, die er sich abnötigen ließ, zu wissen, dass ihr Mann nun endlich begonnen hatte, den Großen und Mächtigen den Stuhl vor die Tür zu stellen. Ängstlich und glücklich zugleich spürte sie, dass die Zeit nah war.
Und es waren bewegte Zeiten. Die Bauern hatten damals gerade begonnen, sich als Opposition gegen die Regierung zu vereinen. Unabhängig davon gab es Widerstand gegen das Militärwesen, und um die Proteste voranzutreiben, hatten einige sogar eine halbes Dutzend Büchsen aus England bestellt, während andere sich mit der heimischen Bewaffnung begnügten. Dieser Teil unserer politischen Geschichte ist bekannt, und auch, welches Ende es nahm. In dem Kirchspiel, um das es hier geht, wurde die Revolte von zwei Gensdarmen ohne Blutvergießen beendet.
Ajes’ Seele blühte bei dem Aufstand und der allgemein aufgeheizten politischen Stimmung auf. Während viele und bedeutendere Leute ihren Unmut durch Worte ausdrückten, trug Ajes seinen Teil durch Taten bei. Er schliff sämtliche Stechmesser im Sprengel! Er lötete einen alten Säbel, dessen Griff auseinanderklaffte, und er klebte all die Krüge und Teetassen wieder zusammen, die auf stürmischen Wahlversammlungen zu Bruch gingen. Er arbeitete in diesen Tagen wie im Fieber. Lene fürchtete um seinen Verstand. Aber er hielt durch.
Dann kam die Wahl. Es war ein Ereignis, weil der Landkreis zum ersten Mal einen radikalen Folketing-Abgeordneten bekam, allerdings war die Spannung von vornherein eher gering gewesen, da sich außer diesem Kandidaten niemand sonst zur Wahl gestellt hatte. Die Bevölkerung der Gegend war offensichtlich so kriegerisch gesonnen, dass die Verteidiger der provisorischen Gesetze der Regierung gar nicht erst den Versuch unternommen hatten, einen Gegenkandidaten aufzustellen. Der Kandidat der Radikalen hatte die Wahl mit seiner Kandidatur gewonnen. Dieser Wahlkreis fiel auch später durch Einstimmigkeit bei allen politischen Entscheidungen. In der Kür des Kandidaten bestand für Ajes der bedeutungsvollste Moment. Auch er hatte gewählt, doch gleichsam zufällig, der Schleifstein hatte wie ein Rückzugsort hinter ihm gestanden. Denn Ajes wusste genau, dass er kein Stimmrecht hatte. Dass er umsonst in einem Gebäude der Gemeinde wohnen durfte, betrachtete er als eine Art vornehmer Anerkennung seiner Verdienste, ein nationales Geschenk, das allerdings nicht das Wahlrecht umfasste. Bei einer schriftlichen Abstimmung hätte Ajes als Märtyrer einer inhumanen Gesetzgebung nach Hause gehen müssen. So weit war es jedoch nicht gekommen.
Die Wahl war eine angenehme Formalität, bei der der Wahlleiter die Versammlung aufforderte, für den einzigen Kandidaten den Arm zu heben. Alle Arme reckten sich in die Höhe. Unter lautlosem Schweigen blickte der Wahlleiter über diesen Wald von Armen. Er entdeckte einen einzigen Anwesenden am Rande der Versammlung, der seinen Arm nicht gehoben hatte. Der Wahlleiter zögerte … in diesem Moment reckte der Mann, es handelte sich um Schleifstein-Ajes, seinen kleinen Arm schwer und entschieden in die Luft. Einen Augenblick später erklärte der Wahlleiter den Folketingsmann für gewählt, und Hurrarufe ließen die Luft erzittern. Während des Beifallssturms rollte Ajes mit seinem Schleifstein davon. Die meisten hatten ihn überhaupt nicht bemerkt, nur ein paar Hofbesitzer hatten sich kurz umgedreht und den Mann mit dem Schleifstein mit einer Mischung aus Heiterkeit und Mitleid betrachtet.
Als Ajes zu Lene und den Kindern nach Hause kam, erkundigte er sich, ob es Kaffee gäbe. Lene wagte nicht, ihn auszufragen, aber ein Leuchten ging über ihr Gesicht. Ja, es gab Kaffee. Und sie würde alles für ihn tun, denn sie spürte, dass er glücklich war; sie fing an, laute Vogelschreie auszustoßen. Feier und Radau in der Hütte! Schließlich konnte Ajes nicht mehr an sich halten, er drückte sich mit dem Hintern auf die Bank und stieß Rauchwolken aus:
»Ich hab ihn durchgebracht!«
»Wirklich?«, rief Lene und sank vor dankbarer Ergriffenheit in die Knie. »Ist das wahr?«
Ajes blinzelt ein paar Mal weise durch den Rauch und nickt unmerklich, dann klappt er den Pfeifendeckel auf und wieder zu, blickt vor sich hin und nickt noch einmal.