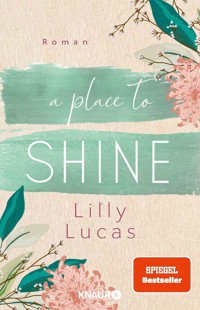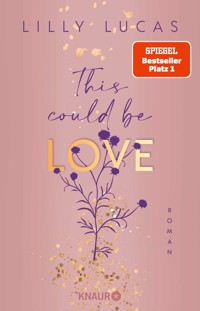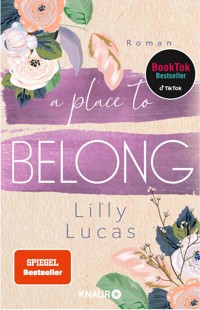Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Serie: Green Valley Love
- Sprache: Deutsch
Cozy, romantisch und herzerwärmend: In ihrem neuen Liebesroman »New Wishes« aus der Green-Valley-Reihe entführt uns Bestseller-Autorin Lilly Lucas wieder an den beliebten Schauplatz Green Valley, wo Rebecca Fitzgeralds Leben auf den Kopf gestellt wird. Winterzauber, Vorweihnachtszeit und jede Menge Herzklopfen in Green Valley Rebecca Fitzgerald hatte schon bessere Tage. Erst wird sie von ihrem Job in Colorado Springs beurlaubt, dann erfährt sie, dass ihr Vater sich die Hüfte gebrochen hat und ausgerechnet im Advent als Reverend ausfällt. Kurz entschlossen fährt sie in ihre Heimat Green Valley, um ihre Familie zu unterstützen. Zu Hause muss sie überrumpelt feststellen, dass ihre Eltern in ihrem Zimmer den Eishockeytrainer Leo Braxton einquartiert haben. Rebecca kann eigentlich weder mit Eishockey noch mit Sportlern etwas anfangen – selbst wenn sie so attraktiv wie Leo sind. Doch dann ist Leo zur Stelle, als Rebecca Hilfe braucht, und überrascht sie in mehrfacher Hinsicht … Gemeinsam mit Rebecca Fitzgerald nach Green Valley zu reisen, fühlt sich an wie nach Hause zu kommen. Die idyllische Kleinstadt in den Rocky Mountains lädt in der Weihnachtszeit zum Träumen ein. »New Wishes« ist perfekt für alle Fans von romantischen Liebesgeschichten und Winterromanen und für alle, die eine Liebesgeschichte zum Rundum-Wohlfühlen suchen. Die Green-Valley-Reihe Die New-Adult-Liebesromane der Green-Valley-Reihe sind in folgender Reihenfolge erschienen – sie sind aber auch unabhängig voneinander lesbar: - New Beginnings (Lena & Ryan) - New Promises (Izzy & Will) - New Dreams (Elara & Noah) - New Horizons (Annie & Cole) - New Chances (Leonie & Sam) - Find me in Green Valley (Kurzroman; Sarah & Grayson) - New Wishes (Rebecca & Leo)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lilly Lucas
New Wishes
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In Green Valley werden die größten Wünsche wahr
Rebecca Fitzgerald hatte schon bessere Tage. Erst wird sie von ihrem Job in Colorado Springs beurlaubt, dann erfährt sie, dass ihr Vater sich die Hüfte gebrochen hat und ausgerechnet im Advent als Reverend ausfällt. Kurzentschlossen fährt sie in ihre Heimat Green Valley, um ihre Familie zu unterstützen.
Zuhause muss sie überrumpelt feststellen, dass ihre Eltern in ihrem Zimmer den Eishockeytrainer Leo Braxton einquartiert haben. Rebecca kann eigentlich weder mit Eishockey noch mit Sportlern etwas anfangen – selbst wenn sie so attraktiv wie Leo sind. Doch dann ist Leo zur Stelle, als Rebecca Hilfe braucht, und überrascht sie in mehrfacher Hinsicht …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Fan Quotes
Widmung
Motto
Rebeccas Christmas Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Danke
Quellennachweise
Zu Hause ist dort, wo das Herz ist, und meins ist in Green Valley
@natzgi11
Green Valley ist das Gelächter von Freunden, der Geschmack von Pumpkin Pie, der Duft von klarer Bergluft und immer wieder: das Gefühl von zu Hause!
@jojo_20.00
Green Valley schenkt mir mit jedem Band ein Stück mehr Geborgenheit. Eine absolute Herzensreihe, die in jedes Regal gehört.
@my.bookish.paradise
Green Valley ist mein absoluter Safe Place! Du kannst sein, wer du willst ❤, und jederzeit zurückkommen!
@Rebecca.schreibt
Green Valley ist Heimat und Fernweh zugleich ❤
@annatinakie
Die schönste Zeit im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann bist du in Green Valley ❤.
@Nadine :)
Für mich bedeutet Green Valley vieles, aber in einem Satz zusammengefasst: Manche Orte halten dein Herz und lassen es nie wieder los. Green Valley ist so ein Ort. 🍁
@lilly_se_12
Green Valley fühlt sich an wie ein Gang über den Weihnachtsmarkt mit lieben Menschen: Draußen ist es kalt, und trotzdem liegen da so viel Wärme, Liebe, Gelächter und Geborgenheit in der Luft.
@mariesliteratur
Ich wusste nicht, dass ich auf der Suche nach einem Zuhause war, bis ich es in Green Valley gefunden habe ❤.
@regina_meissner_author
Sich an einen Ort zu träumen, ist einfach. Ihn nie wirklich aufsuchen zu können, schmerzhaft. Aber Green Valley ist genau dieses Gefühlschaos wert.
@buecherschmuck
Charaktere, in die man sich verliebt, Geschichten fürs Herz und eine Atmosphäre, die einen in ihren Bann zieht und nicht mehr loslässt. Ganz große Liebe für diese Reihe ❤
@sara_bib.li.o.phile_
Green Valley ist für mich ein Ort zum Träumen, zum Ankommen, zum Bleiben. Ich würde am liebsten selbst dort leben.
@Readandfit
Für A & L
Ihr seid mein größtes Geschenk.
»Last Christmas left me lonely
So this year I’m sending new wishes to Santa
And I’m wishing for nothing but you.«
Trace Bradley, My Greatest Wish
Rebeccas Christmas Playlist
Frank Sinatra – Have Yourself a Merry Little Christmas
Michael Bublé – It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas
Coldplay – Christmas Lights
Sara Bareilles, Ingrid Michaelson – Winter Song
Bing Crosby – I’ll Be Home For Christmas
Nat King Cole – Joy to the World
Joni Mitchell – River
John Williams – Somewhere in My Memory
Andy Williams – The First Noël
Ella Fitzgerald, Louis Jordan & His Tympany Five – Baby, It’s Cold Outside
Frank Sinatra – Hark! The Herald’s Angels Sing
Michael Bublé – Let It Snow!
Sigrid – Home to You (This Christmas)
John Williams – Carol of the Bells
Brenda Lee – Rockin’ Around the Christmas Tree
Gene Autry – Here Comes Santa Claus
1.
It’s beginning to look a lot like Christmas«, trällerteMichael Bublé im Radio, als ich das Büro unseres Personalleiters betrat. Wenn es nach seinem Gesichtsausdruck ging, sah es allerdings eher a lot like trouble aus.Mit ungewohnt ernster Miene saß Brian hinter seinem Schreibtisch. Sein dunkles Haar war zerzaust, als wäre er unzählige Male mit den Händen hindurchgefahren, und ich entdeckte Furchen auf seiner Stirn, die noch nicht da gewesen waren, als er mich kürzlich gefragt hatte, ob ich mit ihm essen gehen würde. Es wäre mein erstes Date gewesen, seit ich vor drei Monaten nach Colorado Springs gezogen war, um die Stelle im Community Center der St. John’s Church anzutreten. Obwohl Brian nur ein paar Jahre älter war als ich und noch dazu ein netter und gut aussehender Kerl, hatte ich abgelehnt. Don’t shit where you eat, wie man so schön sagte. Ich hatte meine Entscheidung ab und an bereut, vor allem, wenn ich ihm im Fahrstuhl oder auf dem Flur begegnet war und er sein umwerfendes Lächeln ausgepackt hatte. Heute hatte er es offenbar zu Hause gelassen. Sein Mund war nur ein schmaler Strich, sein Kiefer angespannt.
»Ich komm am besten gleich zum Punkt«, begann er, nachdem ich vor seinem Schreibtisch Platz genommen hatte. Mir fiel auf, dass er das Radio leiser gestellt hatte. Und seine Stimme ziemlich förmlich klang. »Bei uns ist eine Beschwerde eingegangen, Rebecca.«
»Eine Beschwerde? Worüber?«
»Über dich.«
Ich blinzelte. »Was?«
»Benedict Willis hat heute Morgen hier angerufen.«
Seinem Blick entnahm ich, dass er davon ausging, mir würde dieser Name etwas sagen, aber in meinem Kopf klingelte nichts.
»Der Bürgermeister von Colorado Springs?«, half er mir auf die Sprünge. »Kandidat für das Gouverneursamt?«
»Äh …«
»Offenbar hattest du Kontakt zu seiner Tochter. Victoria.«
Verwirrt huschten meine Augen umher. Victoria? Ich kramte in meinem Gedächtnis. Victoria … Willis … Victoria … Vicky … Es machte klick.
»Tori«, brach es aus mir heraus. Das Bild eines Teenagers blitzte vor meinen Augen auf. Rote Haare, Sommersprossen, schüchternes Lächeln. »Sie war bei mir in der Beratungsstunde«, erinnerte ich mich. »Vor ein paar Wochen.«
»Weißt du noch, worum es ging?«
Ich zögerte, weil mich seine Frage irritierte. Er wusste, dass die Gespräche zwischen mir und den Jugendlichen vertraulich waren. »Das darf ich dir nicht sagen, Brian.«
»Stimmt es, dass du Victoria zum … äh … Frauenarzt begleitet hast?«
Ich stutzte. »Woher …?«
»Ihr Vater hat das Rezept gefunden.«
»Okay.« Ich runzelte die Stirn. »Und wo ist jetzt das Problem?«
»Das Problem? Du besorgst einem minderjährigen Mädchen die Antibabypille, ohne vorher mit seinen Eltern zu sprechen? Was hast du dir dabei gedacht, Rebecca?«
Es dauerte mindestens zwei Sekunden, bis mein Verstand verarbeitet hatte, was er soeben gehört hatte. Und zwei weitere, bis ich zu einer Antwort imstande war.
»Das Mädchen ist sechzehn Jahre alt, und ich hab ihr die Pille nicht besorgt«, stellte ich klar und hasste das Zittern, das meine Worte begleitete. »Alles, was ich getan habe, ist, Tori zu ihrem Termin zu begleiten, weil sie nicht allein dort hinwollte. Und offenbar auch nicht mit ihren Eltern darüber sprechen konnte.«
»Und du bist nicht auf die Idee gekommen, das abzuklären?«
»Abzuklären? Tori hat sich im Vertrauen an mich gewendet«, entgegnete ich. »Noch dazu verstehe ich das Problem nicht. Sie braucht die Einwilligung ihrer Eltern nicht, wenn sie sich die Pille verschreiben lassen will. In achtzehn Staaten ist sie inzwischen sogar rezeptfrei erhältlich.«
»Das mag ja sein, aber wir sprechen hier von Benedict Willis. Wenn du seinen Wahlkampf verfolgen würdest, wüsstest du, dass er dem rechten Flügel der republikanischen Partei angehört. Ich muss dir hoffentlich nicht erklären, was das bedeutet.«
»Dass er ein Rassist und Frauenfeind ist?«, murmelte ich.
»Dass er sehrkonservativ ist«, bemerkte Brian mit Nachdruck.
»Das ändert weder etwas an der Gesetzeslage noch an meiner Schweigepflicht.«
Brian betrachtete mich sorgenvoll. »Er fordert deine Entlassung, Rebecca.«
Ich riss die Augen auf. »Bitte was?!«
»Er ist der Meinung, du wärst eine«, er malte Anführungszeichen in die Luft, »Gefahr für die Werte dieses Community Centers.«
Ein irrwitziges Lachen brandete in meiner Kehle. »Weil ich mit seiner Tochter beim Frauenarzt war?«
»Er meint es ernst, Rebecca.«
So langsam fragte ich mich, was Brian sich davon erhoffte, ständig meinen Namen ans Satzende zu packen.
»Du hast ihm hoffentlich gesagt, dass das kompletter Bullshit ist.«
»Natürlich nicht.«
Ich starrte ihn an. »Du bist seiner Meinung?«
»Nein«, erwiderte er entschieden. »Aber Benedict Willis ist der Grund dafür, dass dieses Community Center überhaupt steht. Er hat den halben Laden finanziert. Und er ist ein geschätztes Gemeindemitglied der St. John’s Church. So jemanden macht man sich nicht zum Feind.«
»Das nennt man Schwanz einziehen.«
»Nein, das nennt man Fürsorgepflicht«, entgegnete er scharf. »Ich hab die letzte halbe Stunde versucht, deinen Job zu retten, Rebecca.«
»Ich hab nichts falsch gemacht!«
»Es war nicht klug von dir, keine Rücksprache zu halten. Du bist noch in der Probezeit.«
»Hat dich nicht davon abgehalten, mich um ein Date zu bitten«, bemerkte ich spitz.
Brian zuckte zusammen, hatte sich aber schnell wieder gesammelt.
»Ich muss dich leider beurlauben.«
»Beurlauben? Ist das dein Ernst?«
»Es wird eine offizielle Untersuchung des Falls geben. Das ist Vorschrift.«
Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. »Eine Untersuchung«, wiederholte ich. »Weil ich mit einer jungen Frau beim Frauenarzt war.« Ich runzelte die Stirn. »Hörst du dir eigentlich selbst zu?«
»Rebecca«, seufzte er. »Ich mache hier nur meinen Job.«
»Ja, und ich hab meinen gemacht!« Ruckartig erhob ich mich. Geräuschvoll schabte der Stuhl über den Holzboden.
»Bitte setz dich wieder.«
»Kommt sonst ein Typ vom Sicherheitsdienst und begleitet mich zu meinem Schreibtisch, damit ich meine Sachen packen kann?«, spottete ich.
»Ich hoffe nicht, dass das nötig sein wird.«
Ich schluckte und nahm wieder Platz. So ruhig wie möglich fragte ich: »Und wie lange wird das dauern? Ich meine, wie lange bin ich beurlaubt?«
»Bis zu deiner Anhörung.«
»Anhörung?!«
»Das ist die offizielle Bezeichnung«, erwiderte er halb entschuldigend, halb rechtfertigend.
»Und wann wird diese Anhörung stattfinden?«
»Ich versuche, einen Termin für nächste Woche anzusetzen. Aber ich muss den Personalrat ins Boot holen, den Vorstand informieren … und gerade ist ziemlich viel los, wie du weißt.«
»Und was mache ich so lange?«
Ein wenig ratlos sah er mich an. »Vielleicht betrachtest du es einfach als … vorgezogenen Weihnachtsurlaub?«
Ich bedachte ihn mit einem argwöhnischen Blick.
»Du hattest doch noch keinen Tag Urlaub, seit du hier angefangen hast. Vielleicht tut es dir gut, mal … durchzuschnaufen.«
Beinahe hätte ich aufgelacht. »Ist sicher super erholsam. Weihnachtseinkäufe machen, Baum schmücken, Tatsächlich Liebe gucken, Plätzchen backen … ach ja, und um meinen Job bangen.«
»Ich wünschte, die Situation wäre anders.«
»Und ich wünschte, du hättest mehr Rückgrat.«
Meine Worte trafen ihn härter als eine Beleidigung, und für den Bruchteil einer Sekunde empfand ich Bedauern. Brian war nicht der Bösewicht in dieser Geschichte. Das war Benedict Willis. Aber machte Brian sich nicht zu seinem Handlanger, indem er mich beurlaubte?
»Ich muss dich leider um die Herausgabe deiner Zugangskarte bitten.« Seine Augen huschten zu der weißen Plastikkarte, die an einem Schlüsselband um meinen Hals hing. Sie verschaffte mir zu allen Zeiten Zugang zum Community Center und zu meinem Büro.
»Ich hab Hausverbot?«
»Nein, kein Hausverbot. Aber solange du beurlaubt bist, darfst du das Community Center nur zu den regulären Öffnungszeiten und über den Haupteingang betreten. Das ist leider …«
»Vorschrift«, vollendete ich seinen Satz mit einem bitteren Unterton. Ich zerrte mir das Schlüsselband über den Kopf und warf es ihm auf den Schreibtisch. Nur knapp verfehlte es seine Kaffeetasse mit den Rentieren drauf.
»Danke. Ich ruf dich dann an, sobald der Termin feststeht. Deine aktuelle Handynummer haben wir ja, oder?«
Ich nickte knapp und begriff, dass mein Arbeitstag gerade zu Ende gegangen war. Die gesamte Arbeitswoche. Und wenn ich Pech hatte, meine Zeit in Colorado Springs. Zum ersten Mal gesellte sich Panik zu meiner Wut. Mein erster Job, und ich versemmelte es nach nicht mal drei Monaten?! In der Probezeit?! Du hast nichts falsch gemacht, sagte ich mir. Du. Hast. Nichts. Falsch. Gemacht. Und trotzdem würde ich dieses Büro in wenigen Minuten mit einer Beurlaubung im Gepäck verlassen. Aber ich würde es so würdevoll wie nur möglich tun, nahm ich mir vor, straffte die Schultern und erhob mich. Ich spürte Brians Blick auf mir, als ich den Stuhl gerade rückte, mich umdrehte und ging. Bevor ich die Tür erreicht hatte, sagte er noch etwas: »Ich würde übrigens immer noch gerne mit dir essen gehen.«
Trotz allem. Er sprach es nicht aus, aber es schwang unüberhörbar mit.Ungläubig starrte ich ihn an. Ehe noch etwas meinen Mund verließ, das aus der Beurlaubung eine fristlose Kündigung machte, verließ ich das Büro. Ich schnappte gerade noch auf, wie Andy Williams »It’s the Most Wonderful Time of the Year« im Radio trällerte. Und ein, ich stimmte ihm so gar nicht mehr zu.
Als ich das Community Center eine Viertelstunde später verließ, war meine Wut kein bisschen verpufft. Im Gegenteil. Mit jedem Schritt, den ich mich von dem rotbraunen Sandsteingebäude entfernte, wurde sie stärker. Noch dazu haderte ich mit mir, ob ich mich ausreichend zur Wehr gesetzt hatte. Jetzt, mit etwas Abstand, fielen mir so viele Argumente ein, die ich noch hätte anbringen können. Begründungen, die ich hätte fordern müssen. Und Fragen, die ich hätte stellen sollen. Was passierte zum Beispiel mit meinem Lohn während dieser Beurlaubung? Wurde er weiterbezahlt, oder musste ich mit Einbußen rechnen? Beim bloßen Gedanken daran brach mir der Schweiß aus. Mein Gehalt als Hilfspastorin eines Community Centers war ohnehin schon mickrig und reichte gerade so aus, um meine Einzimmerwohnung am Stadtrand und alltägliche Einkäufe zu bezahlen. Eine Lohnkürzung würde mich ernsthaft in Bedrängnis bringen, vermutlich sogar dazu zwingen, meine Eltern um Unterstützung zu bitten. Mein Herz wurde bleischwer, als ich an Mom und Dad dachte. Sie waren so stolz gewesen, als ich die Zusage für Colorado Springs bekommen hatte. Lautes Hupen und Geschrei rissen mich aus meinen Gedanken. Neben mir auf der Straße schimpfte ein Taxifahrer aus dem Fenster seines Autos heraus, weil der Fahrer eines anderen Wagens seine Vorfahrt missachtet hatte. Der sah das offenbar anders und zeigte ihm den Vogel. Hinter ihnen staute sich der Verkehr. Ungeduldiges Hupen ertönte, schwoll an. Auch nach drei Monaten hatte ich mich nicht daran gewöhnt, wie anders das Leben in einer Großstadt war. Wie laut und hektisch. Mit seinen fünfhunderttausend Einwohnern war Colorado Springs zwar nicht gerade New York City, aber das Leben hier war das krasse Gegenteil von meiner Heimatstadt Green Valley, ein Tausend-Seelen-Ort inmitten der Rocky Mountains, den ich schmerzlich vermisste, seit ich ihn verlassen hatte. All die Dinge, über die ich mich früher mokiert hatte – dass jeder jeden kannte, man keine Privatsphäre hatte und in der Gerüchteküche 24/7 Licht brannte –, fehlten mir hier. Ich freute mich jetzt schon darauf, über die Weihnachtsfeiertage nach Hause zu fahren. Auf all die Menschen, mit denen ich aufgewachsen war. Die vertrauten Gesichter. Auf die hübsch geschmückten Schaufenster in der Main Street, den großen Weihnachtsbaum vor der Kirche, auf einen Pumpkin Pie bei Molly McAbott, einen Schokomilkshake aus Moe’s Diner und einen Abend mit Freunden im Olly’s. Die Aussicht auf all das erzeugte eine wohlige Wärme in meinem Bauch und verdrängte die dunklen Gedanken in den hintersten Winkel meines Bewusstseins. Wenn Postkarten, Kaffeetassen und Wandtattoos behaupteten, zu Hause wäre kein Ort, sondern ein Gefühl, konnte ich nur entgegenhalten: Green Valley war beides.
Weil ich mich plötzlich unfassbar nach einer vertrauten Stimme sehnte, wählte ich die Nummer meines älteren Bruders. Noah lebte in Houston und arbeitete als Raumfahrtingenieur für die NASA. Wir standen uns nahe und telefonierten regelmäßig miteinander. Zu meiner Überraschung ging er sofort ans Handy.
»Hab’s schon gehört«, meldete er sich leicht gestresst.
Das Smartphone am Ohr, blieb ich abrupt stehen und prallte fast mit einem Weihnachtsmann zusammen, der Flyer vor einem Schuhgeschäft verteilte. »Woher …?«
»Mom hat gerade angerufen.«
»Mom weiß es auch schon?«, platzte es geschockt aus mir heraus.
Kurz beschäftigte mich die Frage, ob es zulässig war, die Eltern einer Mitarbeiterin zu kontaktieren, wenn man sie beurlaubte.
»Äh … ja«, erwiderte Noah mit einem Hauch Irritation. »Sie ist ja mit ihm im Krankenhaus.«
»Krankenhaus?«
Ich hatte es bereits ausgesprochen, als mir bewusst wurde, dass wir offenbar von völlig unterschiedlichen Dingen sprachen.
»Dad ist auf einer Eisplatte ausgerutscht. Heute Morgen.« Nun hatte sich Misstrauen in seine Stimme geschlichen. »Ich dachte, deswegen rufst du an.«
»Geht es ihm gut?«, überging ich seine Bemerkung und registrierte das Zittern in meiner Stimme.
»Er hat sich die Hüfte gebrochen und wird gerade operiert.«
»Oh nein!«
»Ja«, seufzte Noah. »Mom klang total fertig am Telefon.«
»Ich check sofort die Busverbindungen«, murmelte ich, nahm das Smartphone vom Ohr und stellte meinen Bruder auf Lautsprecher. »Wenn ich mich beeile, schaff ich vielleicht den …«
»Du willst nach Hause fahren?«, unterbrach er mich.
Ich stutzte. »Du nicht?«
»Na ja, Dad hat sich was gebrochen. Das ist Mist, aber … er wird ja wieder. Außerdem … Ich krieg so kurzfristig keinen Urlaub. Du?«
»Ich … ähm … also … Deswegen hab ich eigentlich angerufen.«
Im Hintergrund hörte ich eine Frau sprechen. Sie stellte meinem Bruder eine Frage, die mindestens sieben Wörter beinhaltete, die ich nicht kannte.
»Sofort, Bee.« Noah wandte sich wieder an mich. »Sorry, ich muss dich abwürgen. Hab gleich ein echt wichtiges Meeting. Ich ruf dich heute nach der Arbeit an, dann überlegen wir in Ruhe, was wir tun können, okay? Wann hast du Feierabend?«
»Ich … bin gegen sechs zu Hause«, erwiderte ich leise und mit einem Anflug von schlechtem Gewissen. Es war zwar keine Lüge, aber auch nicht die Wahrheit.
»Gut, dann bis später. Und mach dir nicht zu viele Sorgen. Dad ist zäh.«
»Ja«, flüsterte ich, aber mein Bruder hatte bereits aufgelegt.
Ich stierte noch ein paar Sekunden aufs Display meines Smartphones. Die Uhranzeige. Wie konnte es so früh sein, wo schon so viel passiert war? Ich scrollte durch mein Telefonverzeichnis und wählte Moms Nummer. Als sie nach zehnmaligem Läuten nicht rangegangen war, gab ich es auf. Und checkte die Busverbindungen nach Green Valley.
2.
Fünf Stunden später stieg ich aus dem Mountain Express. Unter meinen Winterboots knirschte der frisch gefallene Schnee. Ich ließ den Nacken kreisen und streckte die Arme von mir. Die Sonne strahlte mir ins Gesicht, und die Luft roch nach Kälte, Kaminrauch und Tannennadeln. Nach zu Hause. Eine wohlige Wärme machte sich in mir breit, und ich fühlte mich schlagartig entschädigt für die lange Busfahrt. Für den Stau hinter Denver, der uns eine halbe Stunde gekostet hatte. Für die miese Coverversion von »White Christmas«, die im Radio gelaufen war. Für den Kerl neben mir, der pausenlos Sprachnachrichten von seiner Freundin abgehört hatte.
Der Busfahrer öffnete die Klappen zum Laderaum und übergab mir meinen Koffer. Ich bedankte mich, wünschte ihm noch einen schönen Tag und schlüpfte in meine Handschuhe. Es war kälter hier oben in den Rockys. Schneekristalle glitzerten in den Bäumen am Straßenrand, und das Eis auf dem Gehweg war trotz Streusalz nur stellenweise aufgetaut. Kein Wunder, dass Dad ausgerutscht war.
Meinen Koffer im Schlepptau, machte ich mich auf den Weg zu unserem Haus. Es befand sich unweit der Bushaltestelle, direkt neben der Kirche St. Mary’s, deren Glocken just in diesem Moment zur vollen Stunde läuteten. Es war ein Klang, den ich fest mit zu Hause verband, der mich mein ganzes bisheriges Leben begleitet hatte. Ein Gefühl von Ruhe überkam mich, als ich auf unser Haus zusteuerte. Es war, als würde sich mein Herz mit jedem Schritt ein bisschen mehr von dem Ballast befreien, mit dem ich in den Bus gestiegen war. Als würde es sich daran erinnern, dass es diesen Ort in meinem Leben gab, an dem sich nichts änderte. Bei dem ich immer die Gewissheit hatte, zu bekommen, was ich erwartete.
Ich zog meinen Koffer über den schmalen Weg aus Natursteinplatten, der zur Veranda führte. Im Gegensatz zu den meisten Häusern hier standen in unserem Vorgarten keine bunt blinkenden Rentiere oder Schneemänner. In unseren Büschen hingen keine LED-Tannenzapfen, und auf dem Dach war kein Plastik-Santa mit seinem Schlitten gelandet. Unser Haus war traditionell und zurückhaltend geschmückt. Um das Verandageländer schlängelte sich eine Tannengirlande mit roten Schleifen, und an der Haustür war ein Kranz angebracht. Rechts davon standen ein Tannenbäumchen und ein Windlicht aus getünchtem Holz. Merry Christmas prangte auf der naturfarbenen Fußmatte, und in den Fenstern hingen die Strohsterne, die Noah und ich als Kinder gebastelt hatten.
Ich fischte meinen Schlüssel aus dem Rucksack und sperrte auf. Vertraute Gerüche schlugen mir entgegen. Ich schälte mich aus Schal, Mütze und Handschuhen und hängte meine Jacke an die Garderobe. Mein Blick blieb an ein paar neuen Timberlands kleben. Die mussten Jacob gehören. Kurz war ich erstaunt, dass mein kleiner Bruder sich so teure Boots leisten konnte. Dass Mom und Dad es zugelassen hatten. Abgesehen davon, dass Geld bei uns immer knapp gewesen war, hatten sie uns beigebracht, nicht zu viel auf Äußerlichkeiten zu geben. Allerdings war Jacob ein Teenager, und für die zählte bekanntermaßen nichts anderes.
»Hallo?«, rief ich in die Stille des Hauses hinein, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass niemand daheim war. Meine jüngeren Geschwister Jacob und Ruthie waren in der Schule, und den Wagen meiner Eltern hatte ich nicht in der Einfahrt entdeckt. Vermutlich war Mom noch bei Dad im Krankenhaus. Die Nachrichten, die ich ihr aus dem Bus geschrieben hatte, hatte sie bisher jedenfalls nicht gelesen.
Ich sah mich um und ließ mein Zuhause auf mich wirken. Das durchgesessene Stoffsofa, die vielen Kissen, das riesige Bücherregal, die selbst gemalten Kinderbilder. Unser Wohnzimmer war schon immer eher gemütlich als geschmackvoll gewesen. Ein bisschen chaotisch, ein bisschen durcheinandergewürfelt, aber unglaublich heimelig. Ich trat an den Kamin heran und betrachtete lächelnd die Weihnachtsstrümpfe mit unseren Namen. Thomas, Barbara, Noah, Rebecca, Jacob und Ruthie. Auf dem Sims darüber standen gerahmte Familienfotos. Ein Hochzeitsbild meiner Eltern, Schnappschüsse von Einschulungen, Ausflügen und Urlauben. Das aktuellste Foto stammte aus dem Vorjahr und zeigte uns beim traditionellen Thanksgiving-Essen. Mir fiel auf, dass ich mein braunes Haar damals etwas kürzer getragen hatte. Inzwischen reichte es mir bis weit über die Schultern, was weniger eine bewusste Entscheidung als vielmehr der Tatsache geschuldet war, dass Zeit und Geld seitdem knapp gewesen waren.
Ich stellte meinen Koffer im Flur ab und ging in die Küche. Was ich dort vorfand, ließ sich nur als heilloses Durcheinander beschreiben. Die Arbeitsplatte war voller Mehl, Eierschalen und Schokoladenstreusel. Unter einem Nudelholz lag ein ausgerollter Teig, der am Rand bereits bröckelte, und ein paar Töpfe und Schüsseln waren unordentlich ineinandergestapelt. Der Küchentisch war übersät mit Blechen. Offenbar hatte meine Mutter Plätzchen backen wollen, als der Unfall passiert war. Ich versuchte es noch einmal auf ihrem Handy. Während ich dem Freizeichen lauschte, zupfte ich mir ein Stück Teig ab und schob es mir in den Mund. Sugar Cookies, seufzte ich verzückt in mich hinein. Ich ließ es noch ein paarmal läuten, dann legte ich auf und begann, die Küche aufzuräumen. Nachdem ich den Teig in Folie gewickelt und im Kühlschrank verstaut hatte, stapelte ich das Geschirr in die Spülmaschine und wischte über die Arbeitsplatten, wobei mir Eigelb auf die Jeans tropfte.
»Mist!«, murmelte ich.
Aber nach der langen Busfahrt hatte ich sowieso vorgehabt, zu duschen und mich umzuziehen. Ich öffnete meinen Koffer und lief mit meinem Kosmetikbeutel in der Hand in unser Badezimmer. Auch hier herrschte ein wenig Unordnung. Handtücher und Pyjamahosen hingen über den Rand der Badewanne, und aus dem halb offenen Wäschekorb spitzte der Ärmel eines Pullovers. Ich zog mich aus, stieg in die Dusche und wusch mir die Strapazen dieses verrückten Tages vom Körper. Während das heiße Wasser auf meinen Kopf und meine Schultern niederprasselte, musste ich daran denken, wo ich um diese Zeit eigentlich wäre. Dass in diesem Moment Jugendliche mit Problemen und Sorgen meine Sprechstunde im Community Center aufsuchten und ein leeres Büro vorfanden. Jugendliche wie Tori Willis. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie viel Ärger sie zu Hause bekommen hatte, nachdem ihr Vater das Rezept gefunden hatte. Am liebsten hätte ich mich bei ihr gemeldet, ihr gesagt, dass alles gut werden würde. Und das wird es, sprach ich mir selbst Mut zu. Ich stellte das Wasser ab, verließ die Duschkabine und wickelte mir ein Handtuch um den Körper. Als ich mich auf den Weg in mein Zimmer machte, fiel mir ein, dass ich meinen Koffer am Eingang abgestellt hatte. Ich drehte um und trug den Trolley die Treppe hinauf. Er war nicht schwer, weil ich nur das Nötigste eingepackt hatte. Ein Teil meiner Klamotten befand sich ohnehin noch hier zu Hause. Mein Kleiderschrank in Colorado Springs war viel zu klein, ein größerer hätte allerdings auch nicht in die Wohnung gepasst. Ich öffnete meine Zimmertür und ließ einen gellenden Schrei los. Vor mir stand ein Kerl. Ein riesiger Kerl. Er trug nichts außer schwarzen Boxerbriefs, und seinem verschwitzten Gesicht nach hatte er sich gerade mächtig angestrengt.
»Was machst du hier?!«
Perplex starrte ich ihn an, denn die Frage war nicht nur aus meinem Mund geschossen.
»Ich wohne hier!«
Wieder hatten wir exakt dasselbe gesagt – was lustig gewesen wäre. Unter anderen Umständen.
»Wer zur Hölle bist du?«, blaffte ich ihn an, während er »du bist Jacobs Schwester« sagte.
Das »Ja«, das meinen Mund verließ, klang zutiefst misstrauisch. Dabei beruhigte es mich durchaus, dass der Kerl meinen Bruder kannte. Auch wenn er ein bisschen zu alt war, um mit ihm befreundet zu sein. Ich schätzte ihn auf Mitte zwanzig, ein, zwei Jahre älter als ich. Er hatte blaue oder graue Augen, und sein dunkelblondes Haar hing ihm verschwitzt in die Stirn. Offenbar hatte er gerade Sport getrieben. Vielleicht kannten Jacob und er sich vom Eishockey?, dachte ich, als mein Blick über seine nackte Brust schweifte. Das wäre immerhin eine Erklärung für diesen lächerlich perfekten Körper gewesen. Die definierten Arme, die breiten Schultern, das Sixpack, die muskulösen …
»Dann war das früher dein Zimmer«, beendete er mein Starren.
Ertappt sah ich auf, betete dafür, nicht knallrot anzulaufen. Vielleicht registrierte ich deswegen erst mit Verzögerung, dass er die Vergangenheitsform verwendet hatte.
»Es ist mein Zimmer.« Als müsste ich meine Aussage unterstreichen, wies ich mit dem Zeigefinger auf mich.
»Tja, dann haben wir wohl ein kleines Problem.«
Zum ersten Mal fiel mir auf, dass er einen feinen kanadischen Akzent hatte. Mit einem Maximum an Gelassenheit fischte er ein Shirt vom Boden und zog es sich über den Kopf. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich es bedauern oder bejubeln sollte, dass dieser beeindruckende Oberkörper unter einer Lage Stoff verschwand. Aber das Funktionsshirt war so eng anliegend, dass es ohnehin kaum einen Unterschied machte.
»Wir haben gar kein Problem. Das ist mein Zimmer, und ich weiß immer noch nicht, was du hier zu …«
»Dein … äh … Handtuch.«
Offenbar hatte ich so wild vor mich hin gestikuliert, dass sich mein Handtuch gelockert hatte. Im letzten Moment verhinderte ich, dass es mir vom Körper rutschte und diese Situation in die Top 3 der peinlichsten Momente meines Lebens beförderte. Ungefähr zeitgleich hörte ich die Haustür ins Schloss fallen. Mom! Wie von der Tarantel gestochen, schoss ich aus dem Zimmer und stapfte die Treppe hinunter. Allerdings traf ich nicht auf meine Mutter, sondern Jacob, der gerade seinen Schulrucksack in die nächstbeste Ecke pfefferte und sich auf den Weg in die Küche machte. Aber so weit kam er nicht. Wie vom Donner gerührt blieb er stehen. »Was machst du denn hier?«, sagte er anstelle einer Begrüßung und schenkte mir einen schiefen Blick.
»Danke, gut. Ich freu mich auch, dich zu sehen«, erwiderte ich süßlich, bevor meine Miene zu vorwurfsvoll wechselte. »Da ist ein halb nackter Kerl in meinem Zimmer, der …«
Ich brach ab, als Jacobs Blick von etwas abgelenkt wurde.
»Hey Coach!«, sagte er fast ehrfürchtig und hob die Hand.
Coach?!
Ich sah über meine Schulter. Auf etwa der Hälfte der Treppe stand der Kerl aus meinem Zimmer. Inzwischen trug er eine dunkle Jogginghose.
»Hey Jake.«
Jake?!
Die Augen meines Bruders kehrten zu mir zurück. »Warum hast du nichts an?«, zischte er. »Das ist super peinlich.«
Ein ungläubiges Lachen kam über meine Lippen. »In meinem Zimmer steht dein halb nackter Coach, und ich bin peinlich?!«
Jacob runzelte die Stirn. »Er wohnt hier. Im Gegensatz zu dir.«
Ich riss die Augen auf. »Bitte was?!«
Dem Gesichtsausdruck meines Bruders entnahm ich, dass er das völlig ernst gemeint hatte.
»Ich wohne hier«, kam es bestätigend aus Richtung der Treppe.
Ich blinzelte ihn an.
»Haben Mom und Dad dir nichts gesagt?«, fragte mein Bruder und klang zum ersten Mal nicht wie ein bockiger Teenager, sondern wie ein verwunderter.
Ahnungslos zuckte ich mit den Schultern. »Wovon?«
Jacob setzte zu einer Antwort an, aber im selben Moment ging die Haustür erneut auf.
»Rebecca!?«
Meine Mutter starrte mich an wie ein Gespenst. Ihre Augen huschten zur Treppe, und ihre Gesichtszüge entglitten ihr. »Leo.«
Coach. Leo. Das wurde ja immer besser.
»Hey Mrs. Fitzgerald«, sagte der Kerl in einem höflichen Ton.
Sie lächelte angestrengt, bevor ihre Aufmerksamkeit wieder mir galt. »Was machst du hier, Rebecca?«
»Wieso fragt jeder, was ich hier mache?«
»Warum bist du nicht in Colorado Springs?«
»Noah hat mich angerufen und erzählt, dass Dad im Krankenhaus liegt. Da hab ich den nächsten Bus genommen. Ich hab dir geschrieben und ein paarmal angerufen.«
Ein entschuldigender Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Ich hab seit heute Morgen nicht mehr auf mein Handy geschaut. Es war einfach so viel los.« Erst jetzt wurde mir bewusst, wie aufgerieben sie aussah. »Ich weiß gar nicht, wo es ist. Wahrscheinlich noch im Auto.«
»Kommst du direkt aus dem Krankenhaus?«
Sie nickte.
»Wie geht es Dad?«, fragten Jacob und ich gleichzeitig.
»Er hat die Operation gut überstanden, war noch ein bisschen wirr, als ich gegangen bin. Aber das ist normal, sagt die Ärztin.«
»Kann ich ihn besuchen?«, fragte ich.
»Ja, natürlich. Da freut er sich.« Sie runzelte die Stirn. »Aber jetzt sag doch mal, warum bist du hier? Müsstest du nicht arbeiten?«
»Äh …« Ich hatte meiner Mutter in Ruhe erzählen wollen, was vorgefallen war, hatte mir während der Busfahrt sogar Sätze zurechtgelegt. In meiner Vorstellung war ich allerdings weder halb nackt gewesen noch in Gegenwart von Jacob und diesem Coach. »Ich hab Urlaub genommen.«
Mom stutzte. »Ich dachte, das geht nicht in der Probezeit.«
Kurz geriet ich ins Schwitzen, denn genau deswegen hatte ich über Thanksgiving nicht nach Hause kommen können.
»Eigentlich geht es auch nicht, aber es ist ja ein«, ich zögerte, »familiärer Notfall.«
Ich hasste es, meine Mom anzulügen, aber gerade sah ich keine andere Möglichkeit. Nicht solange da dieser fremde Kerl auf unserer Treppe stand und jedes Wort mit anhörte. Als könnte er Gedanken lesen, räusperte er sich und zupfte an seinem Shirt: »Ich würde dann mal duschen gehen.«
»Oh ja, natürlich«, sagte meine Mutter in einem fast entschuldigenden Ton und lächelte ihn an.
Die Selbstverständlichkeit, mit der er die letzten Stufen nahm und auf unser Badezimmer zusteuerte, rief mir wieder in Erinnerung, dass ich ihr ganz dringend ein bis sechs Fragen stellen musste. Er hatte die Hand bereits an der Türklinke, als mir noch etwas anderes einfiel.
»Stopp!«
Ich schob mich an ihm vorbei, sammelte hastig meine Klamotten vom Fußboden auf und beförderte sie in den Wäschekorb. Als ich mich umdrehte, lehnte er im Türrahmen. Wieder fiel mir auf, wie groß er war. Mindestens 1,90 Meter, schätzte ich. Und seine Augen waren eindeutig grau, nicht blau. Dass es mir jetzt so deutlich auffiel, lag vermutlich an seinem Shirt, das dieselbe Farbe hatte.
»Du … hast da was vergessen.«
Ich folgte seinem Zeigefinger zu meinem Slip, der den Weg in den Wäschekorb offenbar nicht ganz geschafft hatte. Röte stieg mir in die Wangen, auch wenn ich mich dagegen wehrte. Rasch wandte ich ihm den Rücken zu und beförderte das Höschen endgültig zur Schmutzwäsche. Nur mit einem Blick – einem sehr frostigen – gab ich ihm zu verstehen, dass er zur Seite treten sollte, und zu meiner Überraschung tat er das auch sofort. Trotzdem kam ich ihm nah genug, um die Mischung aus Schweiß und Waschmittel wahrzunehmen, die ihn umgab. Unser Waschmittel. Seit meiner Kindheit benutzte Mom dieselbe Marke. War das ein Zufall?
»Also, was ist hier los?«, fragte ich, als Leo im Bad verschwunden war und das Wasser durch die Leitungen rauschte. »Was macht sein Coach«, ich deutete auf Jacob, »in meinem Zimmer? Warum duscht er bei uns?«
Mom räusperte sich. »Tja, also …« Eine unheilvolle Pause entstand. »Leo wohnt bei uns.«
»Er wohnt bei uns«, wiederholte ich langsam. »Und warum? Ich meine, hatte er einen Wasserrohrbruch? Eine kaputte Heizung? Hat ihn seine Freundin vor die Tür gesetzt?«
Meine Eltern hatten ein Helfersyndrom, das wusste jeder. Sobald jemand in eine Notlage geriet, waren sie zur Stelle. Ganz Green Valley liebte sie dafür. Ich eigentlich auch. Außer es führte dazu, dass ich halb nackten Kanadiern in meinem Zimmer begegnete.
»Nichts davon«, erwiderte Mom.
Abwartend sah ich sie an.
»Coach Braxton wohnt richtig bei uns«, antwortete mein Bruder an ihrer Stelle.
Meine Augen huschten von ihm zu meiner Mutter, die ungewohnt verlegen dreinblickte. »Wie, richtig?«
»Er hat dein Zimmer gemietet«, sagte sie.
Ich lachte ein bisschen zu hell, aber weder Mom noch Jacob lachten mit.
»Das ist ein Witz, oder?«
Meine Mutter seufzte schwer. »Wie wär’s, wenn du dir erst mal was anziehst und ich uns einen Kaffee mache. Dann reden wir in Ruhe, okay?«
3.
Ihr habt mein Zimmer an ihn vermietet?!« Ich spuckte die Worte fast aus.
»Wir hatten zwei leer stehende Räume, nachdem Noah und du ausgezogen seid.« Mom wärmte ihre Hände an der Kaffeetasse. Dabei war es alles andere als kalt in unserer Küche.
»Ihr habt Noahs Zimmer auch vermietet?!«
»Nein«, erwiderte sie schnell. »Wir haben es zu einem Gästezimmer umfunktioniert. Damit ihr dort schlafen könnt, wenn ihr uns besucht.«
»Beide?!«
Noah und ich standen uns nah, aber die Zeiten, in denen wir uns ein Zimmer geteilt hatten, waren nun wirklich vorbei.
»Sind wir doch mal ehrlich.« Sie sah mich direkt an. »Wie oft kommt es noch vor, dass ihr gleichzeitig da seid? Eigentlich nur an Weihnachten, und Noah hat ja immer auch die Möglichkeit, bei Molly zu übernachten.«
Mein Bruder war mit Elara, der Enkelin von Molly McAbott zusammen. Molly führte ein Blumengeschäft in Green Valley und war berühmt für ihren Pumpkin Pie. Sie lebte allein in einem riesigen Haus, weshalb mein Bruder und seine Freundin meistens bei ihr übernachteten, wenn sie zu Besuch waren. Insofern war Moms Argumentation durchaus schlüssig. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie etwas zurückhielt.
»Sorry, aber ich versteh das nicht. Seit wann stört ihr euch an leer stehenden Räumen? Wenn ihr den Platz nicht braucht, hättet ihr doch alles so lassen können, wie es war? Warum holt ihr euch einen Wildfremden ins Haus?«
»Leo ist kein Wildfremder. Er ist Jacobs Eishockeycoach.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass Mrs. Moreau hier übernachtet hat, als ich Gitarrenunterricht bei ihr hatte.«
Mom sagte in einem neckenden Tonfall: »Das wäre auch ein äußerst kurzer Aufenthalt für sie gewesen, oder?« Ihre Miene wurde wieder ernst. »Leo hat im September sehr kurzfristig die Trainerstelle bekommen und ein Zimmer gesucht, also hielten wir es für eine gute Idee, ihm deins anzubieten. Zumal«, sie zögerte, »uns auch die Mieteinnahmen gelegen kamen.«
Jetzt wurde ich hellhörig. »Habt ihr Probleme?«
Seufzend atmete sie aus. »Die letzten Jahre waren nicht leicht für deinen Dad und mich«, räumte sie ein. »Mit zwei Kindern auf dem College und Jacobs Eishockeytraining. Und dann sind noch ständig Reparaturen am Haus angefallen. Die undichte Stelle im Dach, das kaputte Fenster … Wir mussten den Gürtel enger schnallen.«
»Warum habt ihr nichts gesagt? Noah und ich hätten uns mehr einbringen können. Wir hätten uns Nebenjobs suchen können.«
»Wir wollten, dass ihr euch voll und ganz auf euer Studium konzentrieren könnt.«
Betrübt senkte ich den Blick. »Mir war nicht bewusst, dass ihr wegen uns so sparen musstet.«
»Hey«, sagte Mom sanft und legte ihre Hand auf meinen Unterarm. »Dein Dad und ich würden es genauso wieder machen. Noah hat jetzt diese tolle Stelle bei der NASA bekommen, und du hast deinen ersten Job und stehst auf eigenen Beinen. Wir sind unglaublich stolz auf euch!«
In meinem Magen zog sich etwas zusammen.
»Ja, also, wegen meines Jobs«, begann ich schweren Herzens und suchte nach den richtigen Worten. »Ich …«
»Mom!«, brüllte Jacob von irgendwo im Haus. »Hast du meine Schienbeinschützer gesehen?«
»Die liegen auf deinem Sofa!«, rief sie und schenkte ihre Aufmerksamkeit wieder mir.
»Heute Morgen wurde ich …«
»Da sind sie nicht!«, kam es von Jacob.
»Sieh noch mal nach!«, brüllte meine Mutter.
»Hab ich schon!«
Mom seufzte genervt. »Ich bin gleich wieder da.«
»Ja«, hauchte ich mit einer Mischung aus Erleichterung und Sorge.
Meine Mutter verschwand aus der Küche und ließ mich mit vielen Fragen und einem schlechten Gewissen zurück. Es betrübte mich, dass ich nichts von der angespannten Finanzlage mitbekommen hatte. Dass meine Eltern es zurückgehalten hatten, um Noah und mir ein sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Nachdenklich rührte ich in meinem Kaffee und hörte, wie im Flur die Badezimmertür geöffnet und wieder zugezogen wurde. Nackte Füße klatschten auf den Holzboden, und ich störte mich an der Vorstellung, dass ein wildfremder Kerl barfuß in unserem Haus lief.
»Dieser Junge!« Kopfschüttelnd kehrte meine Mutter in die Küche zurück. »Natürlich lagen sie auf seinem Sofa. Aber man findet sie eben nicht, wenn man zu bequem ist, seine Klamotten aufzuräumen.«
Sie setzte sich wieder zu mir an den Esstisch.
»Wieso trainiert Jacob eigentlich nicht mehr bei Mr. Waxman?«
»Mr. Waxman ist letzten Monat siebzig geworden. Er hat schon eine Weile nach einem Nachfolger gesucht, und dann hat Bright Gordon plötzlich Leo aus dem Hut gezaubert.«
»Bright Gordon? Dem die Autohäuser in Vail gehören?«