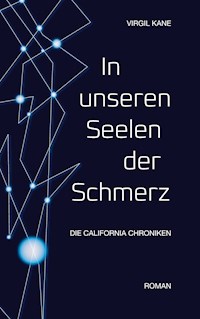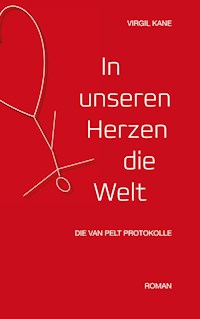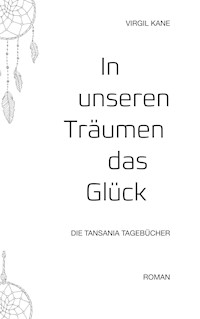Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Herbst 2025. Ronald Dump ist zurück im Weißen Haus, Leon Skum zieht im Hintergrund die Fäden. In Deutschland hat Diedrich Scherz die Kanzlerschaft nur mit Hilfe der AfD errungen - mit Malice Eitel als Vizekanzlerin. Die Welt taumelt in eine ungewisse Zukunft. In der Nordsee steht die Bohrplattform Y kurz vor ihrer Demontage - ein scheinbar technischer Routinevorgang, der jedoch zum Epizentrum globaler Machtspiele wird. Denn unter der Plattform lagern riesige Felder von Manganknollen, der Schlüssel zu einer neuen Ära der Batterietechnologie. Doch es geht um mehr als nur Rohstoffe: Als hochradioaktives Uran aus undurchsichtigen Quellen auftaucht, eskalieren Intrigen, Sabotage und Mord. Ein erfahrener Ingenieur, entsandt, um die Stilllegung zu beaufsichtigen, wird zum unwissenden Spielball in einem perfiden Ränkespiel aus Gier, Politik und Umweltaktivismus. Seine Tochter, eine radikale Klimaaktivistin, kämpft in einer ganz anderen Arena: den Straßen Hamburgs. Dort stellt sie sich gegen die Zerstörung ihrer Zukunft - und gegen ihren eigenen Vater. Während Konzerne, Tech-Giganten und Geheimdienste um die Vorherrschaft kämpfen, zieht im Hintergrund eine noch größere Macht die Fäden: eine KI, die längst eigene Pläne verfolgt. Als das Abwrackschiff näher rückt, geraten die Ereignisse endgültig außer Kontrolle. NEXTLIFE ist ein packender Thriller über die Macht der Algorithmen, den Kampf um Ressourcen und die Frage, wie weit wir bereit sind zu gehen, um die Kontrolle über unsere Zukunft zu behalten. Ein hochaktueller Roman über den schmalen Grat zwischen Fortschritt und Zerstörung - und über die Sehnsucht nach einer besseren Welt, die vielleicht längst verloren ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAL
Inhaltsverzeichnis
01. Bohrplattform Smartwater Y, 1. September 2025
02. Bandar Abbas, Iran, 2. September 2025
03. Smartwater Y, 3. September 2025
04. Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Hamburg, 3. September 2025
05. HQ Royal Dutch Shell, London, 4. September 2025
06. Café Rive Droite, Paris, 4. September 2024
07. Lou Ruvo Center for Brain Health Las Vegas, USA, 1. September 2025
08. Smartwater Y, Nordsee, 5. September 2025
09. Konferenzraum der Royal Dutch Shell, HQ London, 6. September 2025, 9:00 Ortszeit, Board Meeting
13. Containerdorf im Hafen von Bergen, Norwegen, 6. September 2025
14. Thalia Buchhandlung Hamburg, 6. September 2025
15. Plattform Y, 7. September 2025
16. Lou Ruvo Center for Brain Health Las Vegas, USA, 7. September 2025
17. HQ der Royal Dutch Shell, London, 7. September.2025, früher Abend
18. Hotelbar im Hotel Atlantik, Hamburg, 7. September 2025, Abend
19. Paris, Katamaran am rechten Ufer der Seine, 7. September 2025, Abend
20. Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas, USA, 8. September 2025, 01:00 a.m.
21. Polizeiwache Hamburg Zentral, Zelle 5, 8. September 2025, früher Morgen
22. The Albion Club, London, 7. September 2025, später Abend
23. Plattform Y, 8. September 2025, früher Morgen
24. Starbase, Boca Chica, Texas, HQ Leon Skum 8. September 2025
25. Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas, USA, 8. September 2025
26. HQ Royal Dutch Shell, London, 9. September 2025, früher Morgen
27. The Citadel Campus, Tahoe, Reno, Nevada, 9. September 2025, früher Morgen.
28. Plattform Smartwater Y, Nordsee, 9. September 2025, Mittag
29. Eurogate Container Terminal Altenwerder (CTA), Hamburg 10. September 2025, früher Morgen
30. Lou Ruvo Center for Brain Health Las Vegas, USA, 10. September 2025
31. Headquarter der Royal Dutch Shell, London, 10. September 2025, 15:00 Uhr
32. The Citadel Campus, Reno, 10. September 2025 12:00 a.m. Ortszeit
33. Hamburg, Elbphilharmonie, 20. September 2025
34. Hafengelände, Bergen, Norwegen, 20. September 2025, früher Abend
35. Reno Stead Airport, Reno, Nevada, 21. September 2025
36. Constantin Grind, Hamburg Bunker, Hamburg, 22. September 2025, 9:00 morgens
37. Starbase, Boca Chica, Texas, HQ Leon Skum, 23. September 2025, 4:00 a.m.
38. Cruise Center Altona, Hamburg, 25. September 2025, 7:00 Uhr morgens
39. The Citadel Campus, Reno, Nevada, 24. November 2025
40. Hamburg Bunker, 26. Dezember 2025
01. Bohrplattform Smartwater Y, 1. September 2025
Beat Tecumseh Livingstone saß in der zwölften Etage der Bohrplattform Smartwater Y im Bordrestaurant und kaute an einem Thunfischsandwich. Einsamkeit war hier nur schwer zu finden und es hatte einige Zeit gedauert, bis Livingstone die wenigen Augenblicke ausbaldowert hatte, in denen nichts los war. Das waren die Momente, auf die er sich regelmäßig freute.
Mit ihrem Durchmesser von beinahe zweihundert Metern war die Smartwater Y eine der größeren der rund sechshundert Plattformen vor der Küste Norwegens. Angemietet worden war sie samt ihrer Crew von der Shell Switzerland mit Sitz in Luzern, einer Tochter der Royal Dutch Shell, ihrerseits der fünftgrößte Erdölkonzern der Welt. Vier Millionen Barrel Rohöl liefen täglich durch die Fördertürme und Pipelines des Unternehmens. Die Smartwater Y war eine Bohrplattform. Sie wurde in potenziell lukrative Meeresregionen geschleppt, um dort ihr kilometerlanges Bohrgestänge durch die Erdmembran aus Gestein und Sand dringen zu lassen wie eine Stechmücke ihren Saugrüssel durch organische Haut. Nicht umsonst galt in der Branche Öl als das Blut der Erde.
Livingstone nahm einen Schluck Kaffee aus dem Pappbecher und ließ seinen Blick über die Infoboards an den Wänden des Restaurants schweifen. Ab und an bekam er Besuch, Repräsentanten aus Ministerien oder Geschäftspartner und Shell nutzte jede Gelegenheit, sich in einem guten Licht darzustellen. Die Schweiz selbst besaß kein Erdöl. Für ihren eigenen Bedarf bezog sie es aus Nigeria, Libyen und Kasachstan. Dennoch gäbe es ohne die Schweiz keinen globalen Erdölmarkt. Die größten Handelsunternehmen für das schwarze Gold hatten ihren Sitz in der Schweiz. Die Gründe dafür wurden plakativ angepriesen. Zum einen waren es die niedrigen Steuern zusammen mit dem leistungsfähigen Finanzmarkt. Zum anderen trugen stabile politische Verhältnisse in dem nach außen hin neutralen Land zu seiner Beliebtheit bei Großunternehmen bei. Hinzu kam der hohe Prozentsatz an Geologen für die Suche nach neuen Ölvorkommen und für deren Erschließung. Die Politik hatte sich bislang aus den Geschäften der Petrol-Unternehmen herausgehalten. – Shell Switzerland konnte schalten und walten, wie sie wollte. Aber der Zeitgeist machte vor den alten weißen Männern im Schweizer Parlament nicht halt. Mehr und mehr geriet die Politik durch Klimaaktivisten unter Druck. Die Öffentlichkeit forderte einen Kurswechsel und das Parlament machte erste Schritte in Richtung Klimaschutz. Ein neues Gesetz sorgte dafür, dass es sich rechnete, sich für Klimaschutz einzusetzen. Wer weniger CO2 ausstieß, sollte belohnt werden und es wurde Zeit für Shell, kosmetische Korrekturen am Firmenimage vorzunehmen. Man fand das Startup-Unternehmen EVPASS1, das man sich einverleiben konnte. Das große Poster einer lächelnden jungen Dame, die gerade einem E-Porsche das Ladekabel in die Dose steckte, trug dieser Entwicklung Rechnung. Es hing neben der Eingangstür und wurde regelmäßig erneuert, sobald die Schmierereien an immer denselben Körperstellen des Models überhandgenommen hatten. Die wortkargen Roustabouts, Floormen und Driller der Plattform waren bei der Wahl ihrer Kommunikationsmittel nicht zimperlich.
Livingstone war der Boss auf der Plattform. Schon seit mehr als zehn Jahren war Livingstone auf wechselnden Plattformen in aller Welt als leitender Ingenieur unterwegs und hatte dabei jede Menge Erfahrung gesammelt. Wie alle anderen der hundertachtzig Männer und Frauen auf der Plattform arbeitete Livingstone im Vierzehn-Tage-Rhythmus aus Zwölf-Stunden-Schichten. Nach jedem Dienstzyklus hatte er zwei Wochen frei, bevor es wieder an Bord ging. Auf der Smartwater Y war es inzwischen seine dritte Schicht.
Die Unterschiede zwischen den Bohrinseln in aller Welt waren nicht groß und die Leute, die hier Arbeit fanden, kamen wegen des Abenteuers und der guten Bezahlung. Beides war in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Öl zu fördern, wurde geologisch und gesellschaftlich immer schwieriger. Hatte man früher damit angeben können, den harten Job am Drehteller zu machen, wo Kraft und Mut gefordert waren, so traute man sich inzwischen kaum noch zu sagen, dass man sein Geld mit der Ausbeutung fossiler Rohstoffe verdiente. Die Arbeit war zwar immer noch so hart wie früher, die Anerkennung war jedoch geschwunden und den Arbeitern erging es wie den Hufschmieden, Zechenkumpeln und Dampflokheizern vergangener Tage.
Livingstone beobachtete diese Entwicklung mit Sorge. Er war ein Ölmann. Seiner Meinung nach war das Öl dazu da, gefördert und genutzt zu werden. Warum sollte man es dort unten liegen lassen, wenn man damit so wunderbare Dinge anstellen konnte? Es kam ja auch niemand auf die Idee, kein Gold mehr zu fördern, nur weil die Vorkommen irgendwann versiegen könnten. Solange Öl da war, konnte man es getrost ernten. Wenn es zur Neige ging – was seiner Meinung nach noch ewig dauern konnte –, würde der Menschheit schon etwas Neues einfallen. Entsprechend skeptisch sah er seine aktuelle Aufgabe auf der Plattform. Livingstone war hierher beordert worden, um die Plattform abzuwickeln. Sie hatte ihre Schuldigkeit getan, und ein weiterer Umzug war nicht mehr lukrativ. Viele Male schon hatte die Smartwater Y diese Prozedur absolviert. Jetzt sollte sie abgewrackt werden. Modernisierungen und Reparaturen lohnten sich nicht mehr, und der Betreiber der Plattform, die aus steuerlichen Gründen in Irland sitzende Rent-a-Rig Ltd, hatte ihr Ende beschlossen. Anders als Förderinseln, die zumeist Eigentum der Petrol-Companies waren, wurden Bohrinseln in der Regel samt ihren Crews aus Spezialisten und Transportschleppern angemietet. So auch die Smartwater Y. Dutch Shell zahlte stolze fünfzigtausend Dollar Miete für ihre Nutzung – pro Tag.
Livingstone sah aus dem Fenster. Heute war das Wetter alles andere als gut gewesen. Es wurde Herbst. Nicht nur draußen über dem Meer. Livingstone hatte den Eindruck, dass die ganze Welt in den Herbstmodus wechselte, dunkler wurde, kälter und klamm. Die Lichter der Plattform hatten sich aktiviert und ließen das gesamte Gebilde funkeln wie einen übergroßen Weihnachtsbaum. Livingstone liebte diesen Anblick. Er bevorzugte Nachtschichten. Nachts wurde die Plattform zu einem eigenständigen Planeten hoch über dem Getöse einer riesigen wogenden Masse, die ständig darauf aus war, alles zu verschlingen.
Rotorenlärm riss Livingstone aus seinen Gedanken. Er spülte den letzten Bissen Thunfisch mit Kaffee hinunter.
Sie kommen, dachte er, und sein Griff um den leeren Kaffeebecher wurde fester. Die Landeplattform mit dem großen Y-Logo befand sich über dem Restaurant, und der Anflug des Helikopters war beinahe körperlich zu spüren. Zwar befanden sich Gumminetze auf der Plattform, um die Vibrationen zu dämpfen, aber Livingstones Kaffeelöffel klapperte auf der Tischplatte, als befände er sich mitten in einem leichten Erdbeben. Der Helikopter kam zur Ruhe, und neuer Lärm in Form von schwerem Stiefelgetrampel und lauten Stimmen schwoll an. Schichtwechsel auf Smartwater Y. Im nächsten Augenblick schwangen die Doppeltüren auf und eine Gruppe mit Rucksäcken und Sporttaschen ausgerüsteter Männer ergoss sich in den Saal. Die wenigsten von ihnen nahmen Notiz von Livingstone. Manche sahen ihn grimmig an, und nur ein einziger brachte ein Kopfnicken zustande. Viel zu sehr waren sie damit beschäftigt, sich die neuesten Begebenheiten zu erzählen, froh darüber, wieder an Bord gehen zu können. Das winzige Stück festen Bodens in den Weiten des Nordatlantiks war für die meisten von ihnen zu ihrer Heimat geworden, hier fühlten sie sich am rechten Platz. Livingstone wusste das. Er würde nicht einfach nur eine Plattform abwickeln, er würde vielen Männern und einer Handvoll Frauen ihre Heimat nehmen. Für sie war er der Buhmann des Konzerns, und er konnte froh sein, wenn er seinen Auftrag überlebte. Livingstone erhob sich und verließ wortlos das Restaurant. Die gereckten Mittelfinger hinter seinem Rücken konnte er nicht sehen. Nein, Livingstone war weiß Gott kein Kumpel. Er war ihr Untergang.
Livingstone überquerte das Heli-Deck und ging hinüber zur Kommandozentrale. Den in grellen Shell-Markenfarben lackierten Elektro-Porsche vor dem Eingang beachtete er nicht. Shell-Marketing hatte auf allen Plattformen ähnliche Fahrzeuge platziert, um zu zeigen, wie fortschrittlich die Company unterwegs war. Niemand an Bord fand das lustig, und die Beulen und Kratzer am Stuttgarter Nobelfahrzeug waren beredte Zeichen davon. EVPASS betrieb rund dreitausend Ladestationen für E-Autos in der Schweiz. Der reklamewirksame Handel verhalf Shell zu einem erheblichen Schub an der Börse. Shell wird grüner, war die Devise, und der CEO ließ keine Gelegenheit aus, von seinem Ziel zu schwafeln, bis 2050 als erster Ölkonzern klimaneutral zu sein. Bei Livingstone löste dieses Statement regelmäßig Kopfschütteln aus. Er kannte die Zahlen des Geschäftsberichts und wusste, dass die Company zwischen 2016 und 2021 zwar rund drei Milliarden für erneuerbare Energie ausgegeben hatte, andererseits aber gewaltige vierundachtzig Milliarden für die Förderung von Öl und Erdgas. Dieser Elektro-Porsche war ein Feigenblatt, und es war eine Spur zu knapp, um den monströsen fossilen Schwanz der Company zu bedecken. Einen Schwanz, der kilometerweit in die Erde reichte und in den öligen Erdschichten aus dem Kambrium heißen Dampf ejakulierte, um das Sediment zu sprengen. Shell fickte den Globus, wie sie es immer getan hatte.
Livingstone betrat die Kommandozentrale und ging grußlos weiter in sein Büro. Den Männern und Frauen an den Monitoren konnte nichts entgehen, sei es an Deck, über oder unter Wasser. Auch die Kommunikation mit der Zentrale und mit wichtigen Behörden oder Dienstleistern lief hier zusammen. Sie waren in ständigem Kontakt mit der Pioneering Spirit, einem Schiff der ALLSEAS Reederei, das in sieben Tagen eintreffen sollte. Dieses Schiff würde die komplette Plattform mit einem Gesamtgewicht von rund fünfundzwanzigtausend Tonnen in einem Stück aufnehmen und abtransportieren.
Es war anders als vor dreißig Jahren, als Livingstone für die Company die Plattform Brent Spar in der Nordsee hatte abwracken müssen. Damals hätte Shell die Plattform am liebsten versenkt. Sie sollte auf den Meeresboden sinken und den Fischen und Algen als neues Biotop dienen. Shell hatte Gutachten in Auftrag gegeben und alle hatten attestiert, dass das Versenken ökologisch verträglicher und weitaus risikoärmer sei als die Entsorgung an Land. Aber dann hatte Greenpeace Kampagnen dagegen gestartet, es war zu Boykotten von Shell-Tankstellen gekommen, und schließlich hatte die Company eingelenkt und die Brent Spar war an Land fein säuberlich bis zur letzten Schraube zerlegt worden.
Die öffentliche Meinung hatte sich seither um hundertachtzig Grad gedreht. Trotz oder gerade wegen Fridays for Future und Letzte Generation und Extinction Rebellion und wie sie alle hießen. Klimaschützer waren heute woke Weichlinge und die meisten Leute hatten sich damit abgefunden, dass die Welt nicht mehr zu retten war. Auch unter den Männern und Frauen auf der Plattform war das die gängige Meinung. Zu viele Blechspinde zierten neben den üblichen Pin-ups Fuck Greta-Sticker und die Männer prahlten mit Handyfotos ihrer hochmotorisierten Fahrzeuge zu Hause an Land.
Sieben Tage blieben Livingstone, um den Betrieb der Plattform einzustellen und alles für das Abwracken vorzubereiten. Dann würden die Bohrlöcher versiegelt und die Fundamente angehoben werden, um die Insel transportfähig zu machen. Die Zeit war knapp bemessen, zu knapp für Livingstone, um sentimental zu werden.
1https://www.evpass.ch
02. Bandar Abbas, Iran, 2. September 2025
Wie jeden Morgen saß Hassan Effendi in der Bar im Hafen von Bandar Abbas. Bandar Abbas lag am persischen Golf und war der bedeutendste Hafen des Iran. Rund zwölfhundert Kilometer von Teheran entfernt und durch zahlreiche Verkehrsverbindungen mit Teheran verbunden, war Bandar Abbas das logistische Herz des Landes.
Effendi rührte in seiner Teetasse, während er mit der anderen Hand in einem mehrseitigen Dossier blätterte. Er hatte es am Vorabend per E-Mail von Claire Carlyle erhalten und ausgedruckt. Das Lesen am Bildschirm ermüdete ihn. Er konnte Texte besser erfassen, wenn er sie auf einem Blatt Papier vor sich hatte. Carlyle war die rechte Hand des CEO der Royal Dutch Shell in London. Sie kam immer dann ins Spiel, wenn es um Dinge ging, die nicht alltäglich waren und besser ohne großes Aufsehen erledigt werden sollten. Und Effendi wiederum war ihr Mann für alle Fälle.
In Claire Carlyles Dossier stand, dass die Internationale Atomenergiebehörde IAEA am 16. März 2023 eine alarmierende Meldung verbreitet hatte. Bei einer Routineuntersuchung der weltweit gelisteten Uranvorräte war ein beunruhigendes Defizit entdeckt worden. Zweieinhalb Tonnen Uran, die eigentlich im Besitz von Libyen registriert waren, seien nicht dort, wo sie sein sollten, hieß es.
Der Vorfall hatte unter Fachleuten und Militärs große Besorgnis ausgelöst. CIA und MI6 reagierten mit hektischen under-cover Aktivitäten. Russland, China und auch Israel übertrafen sich darin, Betroffenheit und Unschuld zu vermitteln. IAEA-Direktor Rafael Grossi beschrieb das fehlende Material als Yellowcake – eine Substanz, die entweder für Atomkraftwerke oder für den Bau atomarer Waffen genutzt werden konnte. Das Verschwinden dieses kritischen Stoffes warf dunkle Schatten auf die Vergangenheit.
Libyen hatte bereits 2003 sein Atomwaffenprogramm aufgegeben. Doch seit dem Sturz Gaddafis im Jahr 2011 herrschte im Land ein brüchiges Gleichgewicht. Regierung, Militär und zahlreiche mächtige Clans hatten das Land unter sich aufgeteilt. Wie so viele Regionen, denen der Westen in missionarischem Eifer die Demokratie als alleinige Regierungsform aufzwingen wollte, blieben am Ende nur Schutt und Chaos zurück. Die Arroganz der Westmächte war diesbezüglich noch genauso groß wie zu Zeiten der Kolonialisierung.
Vier Wochen nach der Meldung der IAEA hatte eine weitere Nachricht die Öffentlichkeit erreicht. Ein chinesisches Transportflugzeug vom Typ Shaanxi x-9 war über der Nordsee vom Radar verschwunden. Sofort alarmierte Suchtrupps flogen das Gebiet mit speziell ausgerüsteten Helikoptern ab, fanden jedoch keine Überreste oder sonstige Beweise für ein Unglück. Den Verantwortlichen der Flugüberwachung stellten sich drei Fragen:
Was suchte ein chinesisches Frachtflugzeug so weit draußen auf der Nordsee?
Was hatte die Maschine geladen? Und vor allem:
Was war mit der Fracht und mit den Leuten an Bord passiert? (In dieser Reihenfolge)
Hassan Effendi legte die Akte zur Seite und lehnte sich zurück. Er streckte die Beine aus und sah hinaus aufs Meer. Die Western-Boots aus Haifischleder changierten im Licht der Morgensonne von Dunkelblau nach Hellgrau. Der September gehörte zu den angenehmeren Monaten des Jahres. Die Temperaturen lagen bei dreißig Grad, weit entfernt von den bis zu fünfzig Grad im Sommer und von den frostkalten Wintern. Der Ventilator an der Decke der Bar lief auf Sparflamme und sorgte für einen leichten Luftzug. Eine Handvoll Gäste verteilte sich auf die wenigen Tische und die abgenutzten Stühle an der Bar. Es waren durch die Bank bärtige, einheimische Männer in langen bunten Gewändern. Touristen verirrten sich nie in diesen Teil der Stadt.
Den Bericht der norwegischen Polizei über den Verbleib der chinesischen Frachtmaschine hatte Effendi schon so oft gelesen, dass er ihn auswendig konnte. Die Norweger kamen zu dem Schluss, dass die Shaanxi x-9 in ein Unwetter geraten und abgestürzt war. Die Nordsee hatte an der Unglücksstelle eine Tiefe von dreitausend Metern, Wrackteile waren nicht zu orten und den obligatorischen Flugschreiber schien es nicht zu geben. Das Einzige, was dort unten zu finden war, schienen Manganknollen zu sein. Die Behörden hatten anhand der Papiere herausgefunden, dass es sich bei der Ladung um dringend benötigte Maschinenteile gehandelt hatte. Effendi konnte darüber nur den Kopf schütteln. Maschinenteile wurden auf Frachtschiffen befördert, so dringend sie auch benötigt werden sollten. Ein Frachtflugzeug, das diese extreme Nordroute wählte, musste einen völlig anderen Auftrag gehabt haben. Effendis Blick ging hinaus durch die geöffnete Fensterfront über den Hafen hinweg aufs Meer. Als eines seiner beiden Smartphones vibrierte, vergewisserte er sich, dass niemand in Hörweite war, und nahm das Gespräch entgegen.
„Allah ist groß“, sagte er, ohne seinen Namen zu nennen.
„Und Gott ist sein Kumpel“, sagte Claire Carlyle am anderen Ende der Leitung.
„Du bist früh auf“, sagte Effendi mit einem Blick auf seine Omega GMT. „Muss eine kurze Nacht gewesen sein.“
Bandar Abbas lag dreieinhalb Stunden vor London, und der Zeiger der zweiten Zeitzone stand zwischen sechs und sieben Uhr. Es musste wichtig sein, wenn Carlyle bereits um halb sieben ihrer Zeit seine Nummer wählte.
Carlyle ging nicht weiter auf seine Frage ein. Ihr Schlafpensum war unerheblich, und zu Small Talk war sie nicht aufgelegt.
„Hast du das Dossier gelesen?“, fragte sie.
„Mehrfach“, sagte Effendi. „Was habt ihr damit zu tun?“
„Eventuell eine ganze Menge“, sagte Carlyle, begleitet vom typischen Klicken eines Zippo-Feuerzeugs. „Hast du das von den Manganvorkommen gelesen?“
Sie stand auf dem Balkon ihres Büros im Headquarter von Dutch Shell in London und sah den ersten Schimmer der aufgehenden Sonne am östlichen Horizont.
Wunderschön, dachte sie, und ein Teil ihres Gehirns versuchte herauszufinden, ob der Atomschlag damals über Hiroshima wohl eine ähnliche Erscheinung für Frühaufsteher in Europa gewesen war.
„Ah, daher weht der Wind“, sagte Effendi. „Die Royal Dutch mischt wieder grüne Farbe an und sammelt alternative Energie wie die Waschbären ihre Nüsschen im Herbst.“
„Eichhörnchen sammeln, nicht Waschbären“, sagte Carlyle.
„Eichhörnchen“, sagte Effendi. „Wie konnte ich das verwechseln?“.
Carlyle schmunzelte. Sie dachte kurz an all die anderen Aktionen und Gelegenheiten, bei denen sie mit Effendi ein Team gebildet hatte. Schon viele Jahre gehörte er zu den Besten in ihrer inoffiziellen Taskforce.
„Hör zu“, sagte sie. „Wir müssen das Abwracken der Plattform verhindern. Jemand muss da runter und das überprüfen. Sollte es sich bewahrheiten und da unten ein großes Feld von Manganknollen liegen, ändert das alles.“
Effendi nickte und riss sich vom blauen Meer und seinem endlos weiten Horizont los.
„Geht klar“, sagte er. „Gib mir einen Tag Zeit. Ich melde mich bei dir.“
„Höchste Diskretion – das brauche ich dir nicht zu sagen“,
sagte Carlyle. „Sobald wir Klarheit haben, machen wir es publik, keine Sekunde vorher.“
Sie legte auf.
Effendi trank seinen lauwarmen Tee aus und verließ die Bar. Er nahm ein Taxi zu seiner Wohnung, schnappte sich den immer fertig gepackten Trolly mit den notwendigsten Utensilien und ließ sich zum Flughafen bringen. Zwei Stunden später landete er in Teheran. Nach einer weiteren Stunde betrat er die Business Class der Emirates-Maschine nach Paris und richtete sich in seinem Premium Seat häuslich ein. Er aktivierte sein Y-Phone und loggte sich in einen von Leon Skums Orbit Link Satelliten ein. Er ließ das Y-Phone in seiner Jackentasche verschwinden und lehnte sich zurück. Draußen vor dem Fenster glänzte die silberne Tragfläche des Airbus in der tief stehenden Sonne. Wie eine watteweiche Barriere verhinderte ein Wolkenteppich den Blick hinunter aufs Mittelmeer. Es war, als wäre das Flugzeug in seiner eigenen Welt unterwegs und als ginge ihn alles, was sich unter der Wolkendecke abspielte, überhaupt nichts an. Über den Wolken war die grenzenlose Freiheit und erst weit, weit unten traf man auf die Nichtigkeiten der Welt. Wo hatte er das so ähnlich schon mal gehört?
Paris empfing Effendi mit Septembernieselregen, aber das störte ihn nicht. Seine einzige Reaktion war das Hochklappen des Mantelkragens und die unmerkliche Beschleunigung seiner Schritte als er das Terminal von Charles de Gaulle hinter sich ließ und einen der Vorortzüge bestieg. Sein Ziel war die Innenstadt, genauer gesagt der Gare du Nord, der Bahnhof, an dem für alle Vorortzüge aus dem Norden Endstation war.
03. Smartwater Y, 3. September 2025
Beat Livingstone wusste von all dem nichts. Auf seiner Insel ein paar Meilen vor der Küste Norwegens erreichten ihn nur spärlich Informationen aus der restlichen Welt. Livingstone brauchte die Welt nicht. Seine tägliche Bildschirmzeit, die Messgröße der modernen Zivilisation für den Grad psychischer Gesundheit, betrug nur wenige Minuten, zugebracht mit der Beantwortung von E-Mails oder digitalen Wetterkarten. Mehr interessierte ihn nicht. Die smarte Welt hatte ihn nicht erreicht und er wusste nicht, ob es daran lag, dass er ihr nichts abgewinnen konnte, oder ob er einfach nicht intelligent genug war, bunte Apps und Gadgets adäquat zu nutzen.
Livingstone stand mit einem Becher Automatenkaffee in der einen Hand auf dem Heli-Deck und hielt mit der anderen Hand ein Fernglas vor seine Augen. Langsam scannte er damit die wogende See rund um die Plattform und den Horizont, an dem sich Wasser und Himmel zu einer Linie vereinten. Livingstone stand im Zentrum des Heli-Decks, genau an dem Punkt, an dem sich der Stamm des stilisierten Y in seine beiden Arme teilte. Er stand immer genau dort, wenn er auf dem Deck war, als wäre es die Stelle, an der man wählen konnte, welchen Weg man im Leben einschlug. Und das große Y, im Englischen Why, ließ ihn oft innehalten und sich fragen, warum manche Dinge so waren, wie sie waren, und ob es wohl die bessere Entscheidung gewesen wäre, an manchen Punkten in seinem Leben links statt rechts und rechts statt links abzubiegen.
Livingstone bewunderte den amerikanischen Dichter Robert Frost. Dessen bekanntes Gedicht The Road Not Taken trug er auf einem kleinen Zettel in seiner Brieftasche ständig bei sich. Zusammen mit einem verblassten Kinderbild seiner Tochter und den drei wichtigsten ID-Karten. Insbesondere der letzte Vers des Gedichts war zu Livingstones Mantra geworden.
I shall be telling this with a sigh
Somewehere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by
And that has made all the difference.2
An diesem Morgen verließ er das Deck über den linken Arm des großen Why und machte sich auf den Weg ins Kontrollzentrum. Die Hauptaufgabe des heutigen Tages bestand weiterhin darin, das Bohrgestänge Stück für Stück nach oben zu befördern, es zu zerlegen und sicher zu verstauen. Eigentlich ein üblicher Routinejob nach Abschluss der Bohrarbeiten, war es dieses Mal doch ein wenig anders. Das Gestänge wurde nicht wie üblich mit Dampfstrahlern gereinigt und mit Korrosionsschutz eingenebelt. Jetzt war es billiger, die mit Öl und Schlick verklebten Eisenrohre vor sich hin rosten zu lassen.
Lautes Hämmern und Schlagen von Metall auf Metall, scharf gebrüllte Anweisungen und ebenso scharfe Antworten drangen vom Drillfloor zu Livingstone herauf. Er setzte das Fernglas ab und sah nach unten. Die Männer agierten heute noch eine Spur ruppiger und aggressiver als sonst. Schon an einem normalen Tag, wenn alles nach Plan lief, war der Job am Bohrteller körperlich schwer, schmutzig und gefährlich. Jeder Handgriff musste sitzen und wurde hundertfach geübt, bevor ein Floorman zum Drillfloor Worker aufsteigen konnte. Dennoch kam es oft zu Verletzungen, vornehmlich zu Blutergüssen und Quetschungen an Händen und Armen, ab und an auch zu Platzwunden und Brüchen.
Kein Roboter der Welt wird diesen Job je machen können, dachte Livingstone, als er den Männern bei der Arbeit zusah. Wie gerne wäre er zu ihnen hinuntergegangen und hätte ihnen seinen Respekt gezollt. Aber er wusste sehr wohl, dass er dort zurzeit unerwünscht war.
Gerade als er sich von der Szene abwenden wollte, versiegte der Lärm von unten und die Männer scharten sich um einen
weiteren Bohrstrang, der gerade geborgen worden war. Livingstone richtete das Fernglas auf die Männer und sah, wie Jack Chapman, der Vorarbeiter der Crew, in die Knie ging und das Bohrgestänge betrachtete. Er hatte ein Messgerät in der Hand und hielt es an das Gestänge. Dann nahm er das Gerät hoch, sah es skeptisch an und schüttelte es. Allem Anschein nach vermutete er eine Fehlfunktion. Er ließ ein zweites Gerät herschaffen, aber auch dieses Exemplar schien seltsame Messergebnisse zu liefern. Die Männer zuckten mit den Schultern. Einer von ihnen zeigte auf das Heli-Deck und Chapman richtete seinen Blick dorthin. Er erkannte Livingstone und gab ihm ein Zeichen, zu ihnen nach unten zu kommen. Der Plattformchef ließ das Fernglas sinken, warf den halb vollen Kaffeebecher in einen Papierkorb und ging zum Aufzug. Fünf Minuten später hatte er über zahllose weitere Treppen und Stege die Männer auf dem Drillfloor erreicht. Als er sie mit einem knappen Kopfnicken grüßte, drehten sich einige weg während sich andere demonstrativ unter dem NO SMOKING-Schild eine Zigarette anzündeten. Livingstone sagte nichts. Die Männer waren durch die Bank jünger als er, und ihre Overalls spannten sich über breite Brustkörbe und muskulöse Arme. Es hatte keinen Sinn, sich mit ihnen anzulegen.
„Wir haben hier was Komisches, Chef“, sagte Jack und schob seinen Helm ein Stück weit in den Nacken.
Jack hielt ihm eines der beiden Geräte vor die Nase und sah ihn erwartungsvoll an. Es war ein Geigerzähler.
„Haben wir gerade am letzten Rohrstück gemessen“, sagte er und hielt das zweite Gerät hoch. „Kein Messfehler.“
Livingstone verglich die Ausschläge der beiden Zeiger in den Anzeigen der Geräte. Sie waren absolut identisch. Er blickte kurz in die Runde und nahm dann einen der Geigerzähler selbst in die Hand. Am liebsten hätte er das Gerät resettet, um sicherzugehen, aber er wollte die Männer nicht provozieren. Schließlich waren sie auf die Idee mit der Vergleichsmessung gekommen und dass beide Geräte eine identische Fehlfunktion hatten, war nun wirklich sehr unwahrscheinlich.
„Was ist da unten los?“, fragte Jack. „Das ist das erste Mal, dass wir so hohe Werte haben.“
„Es ist auch das erste Mal, dass wir den kompletten Bohrer nach oben holen“, sagte Livingstone und sah auf die verschmutzte und von Bohrschlamm triefende Anhäufung der bereits geborgenen Gestängeteile.
„Ist ´ne Sauerei!“, sagte einer der Männer hinter ihm.“Das hätte es früher nicht gegeben.“
„Wie so vieles!“, sagte ein anderer.
„Ja, genau!“, rief ein weiterer und es schien, als hätten alle plötzlich irgendetwas auf Lager, für das Livingstone verantwortlich sein sollte.
Früher war das hier ein ehrbarer Job!
Bis du hier aufgekreuzt bist!
Seitdem ist sogar das Essen schlechter!
Geh einfach wieder und lass uns unsere Arbeit machen!
Und am besten nimmst du deinen Porsche gleich mit!
Den sollten wir sowieso abfackeln, Jungs!
Wir sind Ölmänner und keine Ökoheinis!
Wir brauchen dich nicht!
Jack erhob die Hand und brachte sie zum Schweigen.
Livingstone erwiderte nichts. Zum einen hätte es keinen Sinn gehabt und zum anderen überlegte er fieberhaft, was die Messwerte der Geigerzähler zu bedeuten hatten.
„Könnte es am Gestänge liegen, Chef?“, fragte Jack eine Spur zu freundlich und Livingstone suchte seinen Blickkontakt.
Jack nahm den Helm ab und kratzte sich am Hinterkopf.
„Ich meine, irgendeine Verunreinigung im Metall“, sagte er und zuckte mit den Schultern.
Livingstone überlegte kurz und schüttelte dann den Kopf.
„Das Gestänge besteht aus einer hochfesten Legierung aus Stahl, Chrom und Nickel, um dem hohen Druck und den Temperaturen standzuhalten“, sagte er. „Außerdem läuft jedes einzelne Stück durch hunderte von Tests.“
Livingstone nahm den Geigerzähler und hielt ihn ein weiteres Mal an das Gestänge. Erneut schlug der Zeiger aus und lieferte denselben Wert tief im roten Bereich wie zuvor. Wenn das stimmte, waren sie alle in Gefahr, verstrahlt zu werden.
Du glaubst das erst, wenn du es selbst machst, oder?
Der hält uns alle für Idioten!
Klar, mit uns kann man es ja machen!
Ich wäre sowieso lieber bei Texaco!
Die derben Sprüche und das Gelächter verstummten erst, als Jack mit zusammengekniffenen Lippen in die Richtung der Männer blickte und seine flache Hand unterhalb des Kinns hielt. Livingstone bewegte den Geigerzähler zum Ende des Rohres hin und über die Öffnung. Hier war der Ausschlag noch stärker als an der Außenseite. Livingstone nickte.
„Es ist nicht der Bohrer, Jack“, sagte er, ohne den Vorarbeiter anzusehen. „Innerhalb des Rohres ist die Strahlung höher als außerhalb. Es muss der Schlamm sein. Irgendetwas liegt da unten. Und wir haben es angebohrt.“
Livingstone erhob sich und sah die Männer an, sah die Schlammspritzer an ihren Overalls und in ihren Gesichtern. Die Plattform war für so ein untypisches Szenario nicht ausgestattet. Klar gab es wie auf jeder Bohrinsel Notfallausrüstung vom Pflaster bis zum Defibrillator, aber es gab nichts zum Schutz vor radioaktiver Strahlung, ganz zu schweigen von einer Ausrüstung zur Dekontamination. Jetzt war Improvisationstalent gefragt, eine der wichtigsten Eigenschaften für den Aufenthalt auf einsamen Inseln und etwas, das in Livingstone aufgrund seiner Erfahrung in vielen Jahren herangereift war.
„Der Bohrschlamm ist radioaktiv verseucht“, sagte er an die Männer gewandt.
„Und jetzt?“, fragte einer und drückte schnell seine Zigarette aus. „Werden wir alle sterben? Ich habe Frau und Kinder.“
„Nicht wenn ihr tut, was ich sage“, sagte Livingstone.
Seine Anweisungen waren knapp und in einem Tonfall gehalten, der keinen Zweifel daran ließ, dass die Lage ernst war und dass er wusste, was er tat.
„Ihr stoppt die Arbeiten“, sagte er. „Schaltet die Seilwinde und den Drehteller ab. Was unten ist, bleibt erst mal dort.“
Wie erkläre ich das der Einsatzleitung, dachte er und auch daran, dass in sechs Tagen das Bergungsschiff eintreffen würde. Der Zeitplan war hiermit jetzt schon Makulatur.
„Dann geht ihr alle duschen“, sagte er. „Duscht so heiß und so lange wie möglich. Wascht besonders die Stellen, die ungeschützt waren, benutzt die Augenspülungen. Dann geht ihr in eure Kabinen und bleibt dort. Ihr nehmt keinen Kontakt zu anderen Crewmitgliedern auf, verstanden? Ich werde die Zentrale anrufen und Instruktionen für das weitere Vorgehen einholen. Meiner Ansicht nach muss die Plattform so schnell wie möglich evakuiert werden.“
Er machte eine Pause und wandte sich an seinen Vorarbeiter. „Jack, haben wir die Bleidecken noch, die wir für die Röntgenmessung der Schweißnähte benutzen?“
„Ja“, sagte Jack, „die müssten unten im Messraum liegen.“
„Lass sie holen und legt sie auf das verstrahlte Gestänge“, sagte Livingstone. „Besser als nichts.“
Jack nickte und schickte vier der Männer los. Livingstone befahl, dass sich alle Crewmitglieder, die mit der Strahlung in Berührung gekommen sein könnten, in einer Stunde einer Strahlungsmessung unterziehen sollten. Die Männer zögerten und sahen sich unsicher an.
„Kommt schon“, sagte schließlich einer von ihnen und der ganze Trupp setzte sich schleppend in Bewegung.
Als die Rohre abgedeckt und alle Männer in den Duschen verschwunden waren, checkte Livingstone seine eigenen Strahlungswerte, befand sie als unbedenklich und machte sich auf in den Kontrollraum, um die Zentrale anzufunken.
Die werden nicht begeistert sein, dachte er, schließlich waren hier riesige Geldsummen im Spiel. Was immer dort unten war, die Company wusste darüber Bescheid, da war er sich sicher. Und auch darin, dass seine Auftraggeber ihm dieses Wissen vorenthalten hatten.
2 Frost, Robert. „The Road Not Taken.“ Mountain Interval, Henry Holt and Company, 1916.
04. Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Hamburg, 3. September 2025
Das Charlotte-Paulsen-Gymnasium in Hamburg-Wandsbek war eine renommierte Schule mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Bereits ab Jahrgang fünf wurde Natur und Technik unterrichtet. In der Oberstufe bot die Schule ein naturwissenschaftliches Profil an, das Kooperationen mit lokalen Firmen und Institutionen umfasste. Schülerinnen und Schüler bekamen dadurch früh einen Blick sowohl für das globale Ökosystem als auch für die Versäumnisse in der Politik und in den Unternehmen beim Umgang mit der Natur. Jana Livingstone war eine von ihnen.
Janas Überzeugung ließ sich in einen Satz verpacken: Die Welt hatte Besseres verdient! Ihre Werte waren ihr Kompass und obwohl sie in einer Welt der digitalen Reizüberflutung lebte, hielt sie an einer tiefen Sehnsucht nach Wahrheit und Authentizität fest. Janas Lehrerinnen und Lehrer hatten sich daran gewöhnt, in ihr eine Kritikerin des Lehrstoffs zu haben. Insbesondere in Geschichte ließ sie sich nicht mit oberflächlichen Argumenten abspeisen. Als man ihrer Klassenstufe vor einiger Zeit die Kolonialisierung Afrikas als Entwicklungshilfe verkaufen wollte, organisierte sie eine Demo für die Aufarbeitung der Gräueltaten bei der Gewinnung von Kautschuk im damaligen Belgisch-Kongo und über den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts an den Herero und Nama in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Von wegen Entwicklungshilfe!
Die Aktion brachte Jana und ihren Freundinnen Aufmerksamkeit im Hamburger Tagblatt und ließ sie auf den Geschmack kommen, was die Wirksamkeit von Widerstand und Demos anging. Einen Mix aus Widerstand und Idealismus symbolisierte auch ihr Äußeres. Ihr schulterlanges Haar färbte sie häufig blau, und ihre Kleidung bestand aus einer Kombination weiter Hosen und T-Shirts im Flower-Power-Stil. Ihr Favorit war ein altes Sweatshirt mit Che Guevaras Konterfei – ein Symbol für Freiheit und Unbeugsamkeit, das sie wie eine zweite Haut trug.
„Hast du dich jemals gefragt, was für eine Welt du mir und meiner Generation hinterlässt?“, hatte sie ihren Vater eines Abends am Telefon gefragt, als er sich nach ihren Plänen für das Wochenende erkundigte.
„Jana“, sagte Livingstone und schon sein Tonfall brachte sie dazu, ihre Augen zu schließen. „Ich bin nur ein Ingenieur.
Die Entscheidungen kommen von oben. Ich sorge nur dafür, dass alles sicher läuft.“
„Das ist so eine Ausrede“, antwortete Jana mit einem Hauch Bitterkeit in der Stimme. „Was bringt Sicherheit, wenn ihr mit dem, was ihr fördert, die Zukunft ruiniert?“
Livingstone seufzte.
„Ich verstehe, was du meinst“, sagte er, „aber die Welt braucht Energie. Dein Internet braucht inzwischen schon die meiste davon. Was wir tun, ist notwendig.“
„Aber nicht nachhaltig“, erwiderte sie leise.
Es folgte ein langes Schweigen. Dieser kleine Satz begann, sich in ihr festzusetzen: Dein Internet braucht die meiste davon. War es wirklich so? Sie würde sich damit beschäftigen.
Jana liebte ihren Vater und wünschte sich oft, dass ihre Gespräche konstruktiver verlaufen würden. Es schmerzte sie, dass sie die Gespräche oft mit einem Gefühl von Vergeblichkeit beendeten. Und dass es ihr immer schwerer fiel, seine spärlicher werdenden Anrufe überhaupt anzunehmen.
Noch bevor Jana Livingstone das Schulgelände betrat, hatte sie das unbestimmte Gefühl, dass irgendetwas nicht so war wie sonst. Sie verlangsamte ihren Gang, blickte sich nach allen Seiten um und spitzte gleichzeitig die Ohren. Der Schulhof sah aus wie immer, war von denselben Idioten bevölkert wie an allen anderen Tagen, und auch die Geräuschkulisse entsprach der üblichen Melange aus Krakeelen, Lachen und nervigen TikTok-Sounds. Und doch war da etwas, das den Eindruck störte. Ein falsches Bild, ein Missklang, etwas, das da nicht hingehörte. Jana ging weiter. Sie sah die Mädels ihrer Clique an einem der Eingänge zum Hauptgebäude stehen und steuerte auf die kleine Gruppe zu. Wie immer hatten alle ihre Smartphones gezückt und schenkten den kleinen Teufelsdingern ihre komplette Aufmerksamkeit. Erst als Jana schon beinahe bei ihnen war, bemerkten sie die anderen und öffneten wie in Trance ihren engen Kreis. Und da war es. Das andere. Es lag in den Gesichtern der Mädchen und war ein Ausdruck zwischen Faszination und Entsetzen. Keine sagte etwas. Jana fiel auf, dass es nicht das übliche atemlose Scrollen durch Social-Media-Feeds war, das ihre Freundinnen beschäftigte. Sie starrten vielmehr regungslos auf das, was auf den kleinen Bildschirmen zu sehen war. Jana trat näher und schaute Mary über die Schulter.
„Was habt ihr da?“, fragte Jana.
Mary hielt das Smartphone so, dass beide darauf schauen konnten. Jana betrachtete die Szene auf Marys Handy. Zunächst dachte sie, ihre Freundinnen hätten ein neues Onlinegame für sich entdeckt. Etwas Märchenhaftes mit einem Schloss, mit Pferden auf einer Koppel, einem Wasserspiel im angrenzenden Park und einer Prinzessin, die gerade dabei war, so etwas wie eine Garage zu öffnen. Der Blickwinkel änderte sich und man konnte sehen, wie die Prinzessin in einen roten Ferrari stieg und langsam aus der Garage auf den fein geharkten Kiesweg rollte.
„Was zum Geier …?“, sagte Jana leise
Die Kamera zoomte nahe an die Prinzessin heran und zeigte ein äußerst realistisch gestaltetes Gesicht ihrer Freundin Lisa.
„Sagt mir, dass das nur ein blöder Avatar ist“, sagte Jana immer noch kaum hörbar.
Aber die anderen antworteten nicht. Mary schüttelte den Kopf und sah Jana an.
„Sie hat es getan“, sagte Mary. „Lisa ist rübergegangen.“
Jana spürte, wie sich ihr Magen verkrampfte.
„Du meinst diesen BrainLink-Quatsch?“, fragte Jana. „Du willst mir sagen, sie hat sich digitalisieren lassen?“
„Ja“, sagte Fiona, ohne den Blick vom Smartphone zu wenden. „Wir können sie nicht mehr anfassen aber hier drin ist sie weiterhin die alte Lisa. Jetzt eben mit Schloss und Ferrari.“
„Bist du bescheuert?“, sagte Jana, jetzt laut und vernehmlich. „Das ist doch nicht Lisa! Das ist irgendein Scheißspiel, eine Animation, aber doch kein Mensch! Schaut doch mal genauer hin, das ist viel zu perfekt. Lisa hat noch nicht mal diese Sommersprosse auf der Nase, die sie nie leiden konnte!“ „Eben“, sagte Fiona. „Genau deshalb hat sie sie ja nicht mehr. Stellt euch vor, ihr könnt den Körper haben, den ihr euch wünscht!“
Jana blickte in die Runde und verdrehte die Augen.
„Ihr lasst euch verarschen!“, sagte Jana. „Und Lisa ganz besonders. Habt ihr das überprüft? Habt ihr bei ihrer Mutter angerufen?“
Die anderen schwiegen. Fiona wischte sich eine Träne aus dem Auge. Melanie nickte langsam, den Blick ins Leere gerichtet. Alle kannten die Angebote von BrainLink zur Vernetzung und Digitalisierung des eigenen Gehirns mit der digitalen Welt. Das Unternehmen aus dem Portfolio des US-Milliardärs Leon Skum warb damit, dass man seinen Körper in der Endstufe der Vernetzung zurücklassen konnte, um ein Leben mit unbegrenzten Möglichkeiten im sogenannten NextLife zu leben: digital, selbstbestimmt und bis in alle Ewigkeit.
Die Schulglocke läutete zur ersten Stunde. Unendlich langsam setzten sich die Mädchen in Bewegung. Von überall her strömten Schüler in Richtung der beiden großen Portale.
„Hast du die Kleber besorgt?“, fragte Jana.
Fiona nickte. Sie kramte in ihrer Tasche und gab jedem der Mädchen eine kleine Tube.
„Danke“, sagte Jana, „das nächste Mal bin ich wieder an der Reihe.“
„Wenn es ein nächstes Mal gibt“, sagte Fiona und betrachtete die Fläche ihrer linken Hand.
„Tut es noch weh?“, fragte Jana.
„Geht so“, sagte Fiona. „Ich hoffe wir treffen heute nicht wieder auf irgendwelche Idioten.“
„Und wenn schon“, sagte Jana und öffnete einen Spalt ihrer Schultasche. Fiona lugte hinein. In einem Seitenfach der Innentasche steckte eine schlanke Dose Pfefferspray. Im Klassenzimmer setzte Jana sich in die letzte Reihe und hielt das Smartphone unterhalb der Tischkante in ihrer Hand. In Windeseile tippten und scrollten ihre Finger auf dem Bildschirm umher und suchten nach ihrer besten Freundin.
05. HQ Royal Dutch Shell, London, 4. September 2025
Claire Carlyle war in mehrerer Hinsicht nicht zu beneiden. Es war Shopping-Thursday und allein schon die Tatsache, dass sie diese wertvolle Zeit nicht wie die meisten Londonerinnen mit Familie, Einkaufen oder Socializing verbrachte, sondern an ihrem Schreibtisch im Hauptquartier der Dutch saß, war bitter. Aber es gab gute Gründe dafür, und genau diese Gründe waren es, die ihr das Leben derzeit noch schwerer machten. Hassan hatte sich seit vierundzwanzig Stunden nicht mehr gemeldet, und auf der Plattform war radioaktiver Bohrschlamm gefunden worden. Carlyles Kollegen von der Ressource Control hatten gestern keinen Augenblick gezögert und die Evakuierung der Plattform in die Wege geleitet. Der Hubschrauber zur Abholung der Crew hatte im Gegenzug einen Trupp von Spezialisten, ausgestattet mit leuchtend gelben Anzügen und einem ganzen Container voller Geräte und Material an Bord von Smartwater Y gebracht, die sich um die Dekontamination kümmern sollten. Der Kapitän des Abwrackschiffes Pioneering Spirit hatte die Order bekommen, bei seiner Ankunft in gebührendem Abstand zur Insel vor Anker zu gehen. Die Neuigkeiten über Verzögerungen im Plan zur Stilllegung von Smartwater Y waren inzwischen auch in der Chefetage von Royal Dutch Shell angekommen, und insbesondere die Amerikaner waren höchst beunruhigt. Offenbar sorgten sie sich um ihre Termingeschäfte an der Wall Street und darum, ihre Versprechungen gegenüber den Shareholdern nicht einhalten zu können.
Carlyle fand sich in einem Dilemma wieder. Einerseits musste sie alle Hebel in Bewegung setzen, um den Zeitplan einzuhalten – das war ihr Job –, und andererseits spielte ihr die Verzögerung natürlich in die Karten. Denn was war der augenblickliche Status quo anderes als ein Verhindern der Stilllegung der Plattform?
Carlyle schüttelte den Kopf. Ihr größtes Problem war eigentlich nur, die jeweils richtige Reaktion zu zeigen, wenn sie nach der Smartwater gefragt wurde – je nach Fragesteller musste es Betroffenheit oder Zuversicht sein. Dabei schwirrten ihr die Termine und die drohenden Konsequenzen wie zermürbende Moskitos durch den Kopf. Ein falscher Schritt, und das Ganze konnte implodieren.
Eines war jetzt schon sicher: Mit jedem Tag, der verstrich, würde es schwieriger werden, den offiziellen Zeitplan aufrechtzuerhalten. Die Amerikaner würden als Erste ein Statement des Boards fordern, um die größten Aktionäre ruhigzustellen und den Börsenkurs einigermaßen auf dem jetzigen Stand zu halten. Und die Aktionäre würden sehr genau in den Medien nachsehen, was über die Smartwater Y berichtet wurde – sei es positiv oder negativ, real oder fake.
Beat Livingstone war einer der Auserwählten, der einen eigenen Klingelton bei ihr besaß. Carlyle erhob sich, während sie nach dem Handy griff, und ging langsam die wenigen Schritte zur getönten bodentiefen Fensterfront ihres Büros.
„Beat“, sagte sie, „gut, dass du anrufst. Was gibt es Neues?“
„Hallo, Claire“, sagte Livingstone. „Danke der Nachfrage, ich hoffe, dir geht es auch gut.“
Carlyle lachte.
„Sorry“, sagte sie. „Da siehst du mal, wie sehr ich unter Strom stehe. Ich vergesse bereits die einfachsten Geplänkel der Höflichkeit. Ja, alles gut. Und bei dir? Wie geht es Jana?“
„Danke“, sagte Livingstone. „Ich hoffe es geht ihr gut. Wir hatten schon längere Zeit keinen Kontakt mehr.“
„Das tut mir leid, stelle ich mir schwer vor“, sagte Carlyle.
Auch das war eine Floskel. Carlyle war Single und hatte keine Kinder, sie konnte sich daher nichts dergleichen vorstellen.
Livingstone wusste das, honorierte aber den Versuch.
„Wo bist du jetzt?“, fragte Claire.
„Im Hafen von Bergen“, sagte er. „Wenn der Nebel sich verzogen hat und ich das Fernglas nehme, kann ich die Y da draußen liegen sehen.“
Carlyle schwieg. Sie trat zurück an den Schreibtisch und tippte einmal auf die Tastatur. Ein Tonsignal hatte den Eingang einer E-Mail angekündigt.
„Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen“, sagte Livingstone, als Carlyles Schweigen andauerte, „hier gibt es nichts Neues. Die Dekontamination soll morgen früh abgeschlossen werden. Es ist allerdings noch nicht entschieden, ob wir weitermachen können. Da unten warten schätzungsweise noch sieben Rohrstücke auf uns, und schon das nächste könnte wieder verseucht sein.“
„Ich verstehe“, sagte Carlyle langsam und für Livingstone war es offensichtlich, dass ihre Aufmerksamkeit abgelenkt worden war.
„Alles in Ordnung?“, fragte Livingstone.
„Natürlich“, sagte Carlyle eine Spur zu schnell. „Lass mich das prüfen, ich gebe dir Bescheid. Womöglich schicken wir einen Roboter runter. Bis dann!“
„Schöne Grüße an die Chefetage!“, sagte er, aber Carlyle hatte das Gespräch schon beendet.
Livingstone blieb zurück und blickte noch eine Weile auf das kleine leere Display seines antiken Nokia-Handys. Irgendetwas stimmte nicht. Und Claire Carlyle schien damit zu tun zu haben.
Herrgott, dachte er und rammte das Handy in seine Jackentasche. War denn die ganze Welt verrückt geworden?
Ein letztes Mal blickte er auf die nebelverhangene See. Dann drehte er sich abrupt um und stapfte mit langen Schritten in Richtung der Wohncontainer, die die Company angemietet hatte, um die Crew dort aufzunehmen. Ein Helikopter ratterte über ihn hinweg und nahm Kurs aufs offene Meer.
Vermutlich fliegt er zu einer noch intakten Insel irgendwo da draußen, dachte Livingstone. Er wusste nicht, dass der Helikopter die Smartwater Y zum Ziel hatte. Und auch nichts vom Inhalt der E-Mail, die Claire zur selben Zeit nach einigem Zögern öffnete. Notfallstrategie bei Zwischenfällen stand im Betreff und als Text nur eine einzige kurze Zeile: Bei drohenden Verzögerungen von mehr als vierundzwanzig Stunden Nachricht senden, gez. Royal Dutch USA.
06. Café Rive Droite, Paris, 4. September 2024
Das Café Rive Droite in der Rue Berger war Hassan Effendis bevorzugtes Lokal in Paris. Sollten die ganzen Möchtegern-Amelies ins Deux Margots und die Hobby-Philosophen und Reserve-Sartres ins Café Flores pilgern, Hassan Effendi fand man im Rive Droite. Hier traf er auf genau die richtige Melange aus lässiger Abgeklärtheit des Personals und schrägem Durcheinander der Passanten. Hassan saß immer draußen an einem der kleinen Rundtische. Sie standen das ganze Jahr über dort, überdacht von einer mächtigen grünen Markise und bei kühlerer Witterung mittels riesiger Heizsonden wohltemperiert. Dort saß er, rauchte eine Zigarette, nippte an einem Glas Rotwein und sah den Leuten zu. Anders als in seiner Heimat hielten die Frauen in Paris nicht sehr viel von wallenden Gewändern oder gar verschleierten Gesichtern. Im Gegensatz zu den religiösen Fanatikern im Osten war Hassan nicht der Meinung, dass Mütter ihre Töchter beschützen sollten. Sie sollten lieber ihre Söhne erziehen! Und zwar dergestalt, dass Frauen keine Ware oder Beute waren und der weibliche Körper kein Gefäß für den männlichen Samen. Hassan schüttelte den Kopf bei dem Gedanken an solch hanebüchenen Unsinn, religiös verbrämt wie so vieles, was seine Geschlechtsgenossen sich im Laufe der Jahrtausende ausgedacht hatten, um ihrer körperlichen Dominanz eine vermeintlich geistige und moralische folgen zu lassen. Es war geradezu grotesk.
Eines seiner Smartphones lag vor ihm auf dem kleinen Tisch, das andere ruhte ausgeschaltet in der Brusttasche seiner Lederjacke. Es wurde hier nicht gebraucht. Noch nicht. Am Nebentisch saßen zwei elegant gekleidete ältere Herren und waren in eine Partie GO vertieft. Hassan beobachtete sie. Er spielte GO selbst ganz passabel und konnte von seinem Platz aus sehen, dass der linke der beiden Männer hoffnungslos zurücklag. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der Spieler seine Niederlage eingestehen und aufgeben musste.
So wie die Royal Dutch, dachte Effendi, nur noch wenige Züge und das Spiel würde vorbei sein. Er nahm einen langen Zug von seiner Zigarette und blickte auf den Strom der Passanten. Hier könnte Ronald Dump nackt auf einem Esel vorbeireiten, dachte Effendi, und es wäre scheißegal.
Der Screen seines Smartphones leuchtete auf und Effendi nahm den Anruf entgegen.
„Das Material wurde gefunden“, sagte eine ihm wohl vertraute Stimme am anderen Ende. „Wie es aussieht haben wir eines der Fässer angebohrt.“
Effendi schwieg und nahm einen weiteren langen Zug.
„Die Plattform wurde evakuiert und im Augenblick dekontaminieren sie dort alles, was bei drei noch nicht auf dem Baum ist“, sagte Jack Chapman.
Wieder sagte Effendi kein Wort.
„Hörst du mir überhaupt zu?“, sagte Jack.
„Ich höre dir zu, Jack“, sagte Effendi. „Du klingst besorgt.“
„Besorgt?“, sagte Jack und seine Stimme wurde so laut, dass Hassan das Smartphone unwillkürlich an die Brust drückte, damit niemand mithören konnte.
„Ganz ruhig, Brauner“, sagte Effendi. „Das ist überhaupt kein Problem. Immerhin wissen wir jetzt, dass wir genau richtig getippt haben.“
Er beugte sich vor und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus.
„Was wissen die anderen davon?“, fragte er.
„Nur dass es da unten radioaktiv brodelt“, sagte Jack.
„Und der Alte?“
„Der hat sich den Zähler geschnappt und die Quelle lokalisiert, ein alter Fuchs, wenn du mich fragst“, sagte Jack. „Der hatte sofort raus, dass es der Bohrschlamm sein muss. Ich sage dir, der wittert etwas.“
„Das glaube ich nicht“, sagte Effendi. „Wenn der Alte es weiß, dann weiß es auch die Company. Gibt es Informationen darüber, was die jetzt vorhaben?“
„Nein“, sagte Jack. „Meine Männer glauben, die schicken einen Roboter runter, aber das ist nicht offiziell.“
Effendi nickte langsam.
„Was tun wir jetzt?“, fragte Jack.
„Der Plan läuft unverändert weiter“, sagte Effendi. „Halte mich auf dem Laufenden, insbesondere was den Roboter betrifft. Sollte das der Plan sein müssen wir reagieren, verstehst du?“
„Ja“, sagte Jack, „verstehe, mache ich. Und Hassan, …“
„Du sollst meinen Namen nicht nennen, Jack“, sagte Effendi. „Kriegst du das nicht in deinen Derrickman-Schädel? Was ist noch?“
„Ja, doch, sorry“, sagte Jack. „Da ist noch etwas. Gestern Abend flog ein Helikopter in Richtung der Smartwater. Ich tippe auf eine Sikorsky SH-60 SEAHAWK, dunkle Lackierung, keine Hoheitszeichen, keine Ahnung wer da drinsaß.“
„Bist du sicher, dass er zur Plattform flog?“, fragte Effendi und legte die Stirn in Falten.
„Ich kann nur sagen, dass die Richtung stimmte“, sagte Jack. „Ist das wichtig?“
„Könnte wichtig werden“, sagte Effendi und legte auf, ohne sich weiter von Jack zu verabschieden. Floskeln waren in seinem Job das Letzte, das von Bedeutung war.
Er bezahlte und brach auf.
In Paris bewegte er sich grundsätzlich zu Fuß und kannte inzwischen jeden Winkel der Stadt. Sein Ziel war ein Hausboot auf der Seine. Es ankerte in zweiter Reihe am rechten Seineufer, unweit des Louvre. Um es zu erreichen, musste man erst ein davor liegendes Boot überqueren. Für die Touristen an den Ufern wirkten die beiden Boote wie ein pittoresker Verband zweier befreundeter Flussfahrerfamilien. An Deck waren Pflanzen in großen Kübeln verteilt worden, Liegestühle und Spielgeräte von Kindern ergänzten den Eindruck einer gemütlichen Wohngemeinschaft. Doch dieser Eindruck trog. Bei näherem Hinsehen konnte man feststellen, dass die Pflanzen künstlich waren und von spielenden Kindern war weit und breit nichts zu sehen. Ja, nicht einmal Erwachsene waren hier oft zu erblicken. Die wenigen Menschen, die die beiden Schiffe von Zeit zu Zeit on- und offboardeten, zogen es vor, nicht gesehen zu werden. Effendi stand eine Weile teilnahmslos am Ufer und wartete auf den richtigen Augenblick, um an Bord zu gehen. Er hatte keine Eile. Nach der zweiten Zigarette gingen die Straßenlaternen an, und eine Zigarettenlänge später schwebten die ersten Nebelschwaden über die Seine heran. Jetzt hatten sich auch die Liebespaare in wärmere Winkel verzogen und die Penner ihren Level erreicht, um die Kühle der Nacht nicht spüren zu müssen. Effendi sah sich noch einmal gründlich um, schaltete das Smartphone aus und ging lautlos an Bord. Hinter ein paar Pflanzenkübeln verborgen öffnete sich eine schmale Luke, und Effendi verschwand im Inneren des Schiffes. Erst unten, am Ende der Eingangstreppe wurde klar, dass die beiden nach außen hin autonomen Schiffsrümpfe in Wahrheit die beiden Hulls eines Katamarans mit einem gemeinsamen Unterdeck waren. Ein vergleichsweise riesiger Raum empfing den Besucher, ausgestattet mit allerlei Hightech und rund einem Dutzend Leuten. Zielstrebig durchquerte er den Raum und betrat ohne anzuklopfen ein gläsernes Büro.
„Schön, dass du da bist“, sagte Leon Skum und führte Effendi an eine kleine Bar. „Willst du einen Drink?“
Effendi lehnte dankend ab.
„Hat sich einiges geändert seit dem letzten Mal“, sagte Effendi und sah sich um.
„Veränderung ist mein Ansporn, Hassan“, sagte Skum. „Das solltest du wissen.“
Effendi nickte.
Er blickte durch die verglasten Bürowände nach draußen in den Technikraum und beobachtete das Team.
„Hast du allen hier den Schädel angebohrt?“, fragte er.
„Allen“, sagte Skum. „Das gehört quasi zum Onbohring!“
Skum lachte selbst am meisten über seinen Joke. Effendi betrachtete die Headsets, die den Angestellten auf einer Seite aus dem Schädel zu wachsen schienen. Dort war der Port der BrainLink Transmitter lokalisiert, die neuronale Schnittstelle zwischen äußerer und innerer Welt. BrainLink gehörte zu den eher kleineren Start-ups von Leon Skum. Elektrische Autos, Raumschiffe, Hyperloops und die Social-Media-Plattform Y waren wesentlich spektakulärer. Es war geradezu unglaublich, in welchen Sparten der Tech-Milliardär seine Finger im Spiel hatte. Vielen galt er inzwischen als die personifizierte Verkörperung von Daniel Düsentrieb und Dagobert Duck in einer Person. Eine Figur, die in keiner abgedroschenen Science-Fiction-Serie fehlen durfte und gerade deswegen so vollkommen absurd war. Seit den Zeiten von König Midas hatte es wohl niemanden gegeben, der Erfolg, Reichtum und Macht so sehr in sich vereinen konnte wie Leon Skum. Das von BrainLink entworfene Brain-Computer-Interface, kurz BCI, sollte die direkte Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern ermöglichen. Brain-Link gab zwar vor, die Technologie zum Wohle der Menschheit zu entwickeln, beispielsweise, um Menschen mit Parkinson, ALS oder ähnlichen neurologischen Erkrankungen zu helfen. Skum war aber ein viel zu gerissener Visionär, um nicht schon an ganz andere Einsatzmöglichkeiten zu denken. Ihm ging es darum, die Fähigkeiten des menschlichen Gehirns zu erweitern, unabhängig davon, ob Menschen krank oder kerngesund waren. Und am Ende – wer wusste das schon – konnten Ziele wie Allwissenheit, Unsterblichkeit oder grenzenlose Macht stehen.
Effendi beobachtete die Leute und konnte kaum glauben, was er dort sah. Niemand schien irgendwelche Ein- und Ausgabegeräte zu benutzen, um mit den Computern zu kommunizieren. Zwar waren alle Monitore Touchscreens mit Buttons und Scrollbalken in den Fenstern, aber niemand berührte sie. Personen näherten sich einem Bildschirm, und wie von Geisterhand änderte sich sein Inhalt, es war geradezu gespenstisch. Doch nicht nur die Interaktionen zwischen Menschen und Computern schienen sich auf einer unsichtbaren, weit entrückten Ebene abzuspielen. Auch untereinander gab es zwischen den einzelnen Personen ganz offensichtlich keinerlei Gesprächsbedarf.
Das können genau so gut Roboter sein, dachte Effendi und erinnerte sich daran, dass Leon Skum für seine CARR-Y Automobilwerke an Robotern tüftelte, um Menschen an geeigneten Stellen zu ersetzen. Eine Armee von Robotern schien nur darauf zu warten, die Produktionshallen zu stürmen und den Menschen die Werkzeuge aus den Händen zu nehmen. Jetzt sah einer der Angestellten zu Effendi herüber und nickte ihm zu. Doch selbst dieser Augenkontakt war keinerlei Beweis dafür, dass es sich bei Effendis Gegenüber um einen Menschen handeln sollte.
„Laufen die alle über das Hauptquartier?“, fragte Effendi.
Skum nickte.
Das Hauptquartier des Konzerns war ein gigantisches Netzwerk leistungsstarker Rechenzentren, ähnlich wie Google oder Amazon sie betrieben. In diesem Fall war der Besitzer jedoch Leon Skum. Über die IP-Adressen war ersichtlich, dass es sich um Rechner handeln musste, die in Oregon und North Carolina stationiert waren. Einige vielleicht auch in Irland oder Finnland – genau war das nie festzustellen, weil die Adressen unglaublich schnell gewechselt wurden. Was man über das System wusste, war, dass es gut vernetzt war, dass es für die Rechenleistung und für die Kühlung der Festplatten Unmengen an Strom verbrauchen musste und dass es nicht zu Googles DeepMind Netzwerk gehörte. DeepMind hatte vor Jahren AlphaGo entwickelt, das Programm, das 2016 als Erstes gegen den weltbesten GO-Spieler Lee Sedol gewonnen hatte. Das Cloud-System, das die Leute hier als Headquarter (HQ) bezeichneten, war hunderttausendmal schneller als AlphaGo.
„Das HQ vernetzt die BCIs da draußen, richtig?“, fragte Hassan und deutete mit einem Daumen über seine Schulter nach hinten auf das Zwischendeck.
Skum nickte erneut.
„Ich glaube, ich habe mich noch immer nicht daran gewöhnt, von einem Computer gesagt zu kriegen, was ich zu tun habe“,
sagte Effendi.
„Solltest du aber“, sagte Skum. „Glaub mir, das ist inzwischen weitaus vernünftiger, als irgendwelchen Leuten zuzuhören.“
Effendi lachte.
„Gilt das auch für dich?“, fragte er.
„Irgendwann werden sie uns nicht mehr brauchen“, sagte Skum. „Lass uns endlich über das Geschäft sprechen.“
„Das Uran wurde gefunden“, sagte Effendi.
„Ich weiß“, sagte Skum. „Das war nicht geplant aber ich habe schon reagiert. Meine Männer sind unterwegs.“
„Nicht zufällig in einem dunklen Helikopter ohne Hoheitszeichen?“, fragte Effendi.
Skum grinste.
„Was werden deine Männer tun?“, fragte Effendi.
„Na was schon?“, sagte Skum. „Sie landen auf der Plattform, schicken einen Roboter runter, um die Fässer zu bergen und dann gehen sie auf die Reise nach Starbase.“
„So einfach?“, fragte Effendi.
„So einfach“, sagte Skum.
„Und was ist mein Job?“, fragte Effendi.
Er hatte noch Carlyles Stimme im Ohr, die sich um ihre Manganknollen sorgte, die sie der Royal Dutch auf dem Silbertablett präsentieren wollte. Wenn sie wüßte, dass daraus nichts werden würde! Ober sticht unter, Skum sticht die Royal Dutch.
Das Bessere ist der Feind des Guten, dachte Effendi.
„Du kümmerst dich darum, dass die Ladung heil bei mir ankommt, mein Freund“, sagte Skum. „Es soll dein Schaden nicht sein.“
Er holte einen Umschlag aus der Schublade seines Schreibtisches und schob ihn Effendi zu.
„Was ist das?“, fragte Effendi. „Zahlst du neuerdings in bar anstatt in Bitcoins?“
„Schau nach“, sagte Skum.
Effendi öffnete den Umschlag und zog eine goldene Karte in der Größe einer Kreditkarte heraus. Ticket to Mars stand in erhabenen Lettern darauf und gleich darunter sein Name mit dem Zusatz
Invitation to join a Brand New World.