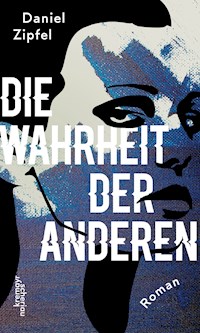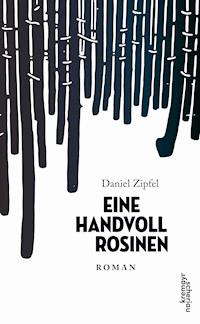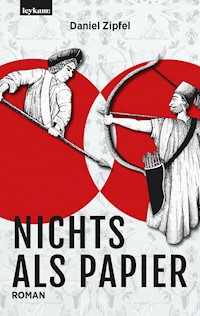
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gibt es die menschliche Güte? Ein Roman über die von Rechtspopulisten vereinnahmte Zeit der Wiener Türkenbelagerung, auf der Suche nach Vernunft und Frieden. 1683. Wien steht kurz vor der Belagerung durch die Osmanen, tatarische Reiter verbreiten Angst und Schrecken. Während der Kaiser mit seinem Hofstaat bereits die Stadt verlässt, reist der deutsche Rechtsgelehrte Samuel von Pufendorf nach Wien, um seinen verschwundenen Bruder Esaias zu suchen. Schon nach kurzer Zeit wird er der Spionage bezichtigt und muss gemeinsam mit dem zwielichtigen Geschichtenerzähler und Sänger Gustl wieder aus der belagerten Stadt fliehen. Inmitten eines immer unübersichtlicher und grausamer werdenden Krieges will er den Beweis für die menschliche Güte erbringen, auch wenn er selbst zunehmend zwischen die Fronten gerät. Ein Roman, der zeigt, wie aktuell die Vergangenheit ist, und dass die Fronten angesichts zahlreicher Interessen niemals so klar sind, wie sie zu sein scheinen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Nichts als Papier
1683. Wien steht kurz vor der Belagerung durch die Osmanen, tatarische Reiter verbreiten Angst und Schrecken. Während der Kaiser mit seinem Hofstaat die Stadt bereits verlassen hat, reist der deutsche Rechtsgelehrte Samuel von Pufendorf nach Wien, um seinen verschwundenen Bruder Esaias zu suchen. Doch schon nach kurzer Zeit wird er der Spionage bezichtigt und muss gemeinsam mit dem zwielichtigen Geschichtenerzähler und Sänger Gustl aus der Stadt fliehen. Inmitten eines immer unübersichtlicher und grausamer werdenden Krieges will er den Beweis für die menschliche Güte erbringen, auch wenn er selbst zunehmend zwischen die Fronten gerät.
Ein hochaktueller Roman über die heute von Rechtspopulisten vereinnahmte Zeit der Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683, der zeigt, dass die Fronten niemals so klar sind, wie sie zu sein scheinen.
„Ich habe dieses Buch weggefressen und konnte nicht einsehen, dass es zu Ende ging. Ich bin begeistert!“ FERIDUN ZAIMOGLU
„Dieser Roman bringt das große Kunststück fertig, sowohl Geschichtsbuch wie politische Parabel zu sein. Mit sprachlicher Eleganz, detailreich und packend erzählt er von Konflikten, die so alt sind wie die Gesellschaft selbst.“ ÇIĞDEM AKYOL
.
Über Daniel Zipfel
Daniel Zipfel,. 1983 in Freiburg geboren, lebt in Wien und arbeitet als Autor und Jurist in der Asylrechtsberatung. Sein Roman „Eine Handvoll Rosinen“ (Kremayr & Scheriau 2015) wurde vom österreichischen Bundeskanzleramt als „besonders gelungenes Debüt“ ausgezeichnet und erhielt die Buchprämie der Stadt Wien, ebenso sein zweiter Roman „Die Wahrheit der anderen“ (Kremayr & Scheriau 2020).
Newsletter des Leykam Verlags
In unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Veranstaltungen, unsere Autor*innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:
https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
Daniel Zipfel
NICHTSALS PAPIER
Roman
Für Laurenz, für Elisa
Im Sommer des Jahres 1683 wurde die kaiserliche Residenzstadt Wien durch die Osmanen belagert. Tatarische Reiter verwüsteten die umliegenden Landstriche. Die Verteidiger Wiens leisteten wochenlang erbitterten Widerstand, bis ein deutsch-polnisches Entsatzheer die Stadt befreite. Oberbefehlshaber Jan III. Sobieski, König von Polen, wurde zum Helden der Schlacht.
Inhalt
Erstes Buch
Wien
Stockholm
Gießhübl
Zu den blauen Flaschen
Rother Turm
Hofburg
Zweites Buch
Langenzersdorf
Minoritenplatz
Schlossergassel
Wipplingerstraße
Neugebäude
Freyung
Rauer Stein
Drittes Buch
Korneuburg
Passau
Perchtoldsdorf
Himmel
Wald
Viertes Buch
Wasser
Regensburg
Erde
Luft
Fünftes Buch
Feuer
Hollabrunn
Tulln
Kahlenberg
Licht
Erstes Buch
Über die Reise des großen GelehrtenSamuel von Pufendorf nach Wien /Warum die Unternehmung zu einemungünstigen Zeitpunkt erfolget /Und vom sonderlichen Gebaren desBänkelsängers Gustl
Wien
Der Gustl und der Tod seien Freunde, sagte man. Der Gustl sei in die Pestgrube gefallen und aus der Pestgrube wieder herausgekommen. Der Tod, so sagte man in Wien, sei für den Gustl zu schade, denn einer wie der Gustl, mit all dem Branntwein, den Trinkgeldern und den undurchsichtigen Geschäften, der habe es verdient, bis in alle Ewigkeit im finsteren Tal des Lebens zu wandeln.
Und so wandelte er pfeifend durch die Gassen, während alle schon schliefen, seinen Dudelsack unter den Arm geklemmt, rieb dreimal das Kruzifix um seinen Hals, denn die Gassen waren nicht so leer, wie sie zu sein schienen, das wusste er besser als alle anderen. Er bewegte seine Lippen stumm zum Ave Maria, hob seine Hand an den spitzen Hut, erwiderte den Gruß des Männleins mit der Hahnenfeder, das an einer Laterne lehnte. Dort, wo die Gassen sich ins Dunkle verengten, hörte er Ratten vorbeihuschen und den abscheulichen Basilisken, hörte ihn in den nächsten Brunnen gleiten, und hinter sich hörte er das Schlurfen nasser Füße, die aus der Donau kamen. Er bräuchte sich nur umzudrehen, um dem Nöck ins schuppige Gesicht zu schauen, aber das wäre ein schwerer Fehler gewesen, weil den Wassermann sah man nur einmal, und im nächsten Moment hatte er einen schon in die Donau gezogen.
So ging er weiter, der Gustl, ging festen Schrittes, denn er wusste, sie würden ihm nichts antun, denn er war einer von ihnen, eine Gestalt, die es nur im Dunklen gab.
Erst als er bei dem erleuchteten Palais angelangt war, machte er ein Kreuzzeichen und drehte sich um, damit er die Nachtgestalten nicht mit über die Schwelle nahm, damit sie nicht heimlich an ihm vorbeischlichen. Aber als er sich umwandte, war die Gasse leer, und er spürte einen leichten Stich im Herzen, einen Hauch von Enttäuschung, dass sie nicht da waren.
„Der Herr Kolschitzky?“ Mit diesen Worten empfing ihn ein Diener in schwarzer Livree, hielt ihm eine Kerze entgegen.
„Der Herr Gustl. Den Gustl wolltet’s haben, nicht den Kolschitzky. Also ist der Gustl gekommen.“
„Natürlich. Ihr seid spät. Die Trauergäste sind schon da.“
Der Diener ließ den Gustl eintreten, verschloss das schwere Tor mit den Kupferbeschlägen hinter ihm, ging mit langen Schritten durch die Eingangshalle voraus.
Die Fliesen waren aus Marmor, die hohen Spiegel verhüllt mit schwarzer Seide. Durch die offenen Fenster brachte ein Luftzug den morastigen Geruch der Donau herein. Die Öllämpchen an den Wänden flackerten.
Eine Flügeltür wurde aufgestoßen, entließ einen Schwall Stimmen, bevor sie jäh wieder zuschlug. Ein Priester kam dem Gustl entgegen, eine kleine Ledertasche an die Brust gedrückt, und würdigte ihn keines Blickes.
Als der Gustl in den Raum trat, erhob sich ein Klatschen und Kreischen. Das gleißende Licht eines Kristalllusters blendete ihn, er musste einmal, zweimal blinzeln und als er die Augen öffnete, wurde ihm schon ein Glas in die Hand gedrückt, nicht Branntwein oder Bier, sondern Champagner. Der Widerschein Hunderter Kerzen schimmerte in den Goldornamenten, den Farben der Ölgemälde. Nur die zahlreichen Spiegel an den Wänden, in den Nischen, an der Decke waren ebenso mit schwarzer Seide verhüllt wie die Spiegel im Flur. In all dem Licht, in Wolken aus Puder und Parfum, Zimt und Lavendel standen Grafen und Gräfinnen, torkelte die vornehmste Wiener Bürgerschaft in Perücken, die ihnen über die Schultern fielen, in teuren Westen und weiten Roben, alle sturzbetrunken.
Nur die Bediensteten trugen Schwarz, drängten sich durch die Gäste, die zwischen den weiß gedeckten Tischen wankten, füllten Gläser nach, reichten Silbertabletts mit Häppchen und kontrollierten auf dem Weg in die Küche, ob die Seidentücher über den Spiegeln nicht verrutscht waren.
„Der Gustl soll auf den Tisch! Auf den Tisch!“ Der Ruf wurde von der Menge aufgenommen, zehnfach, hundertfach, Männerkehlen und Frauenkehlen skandierten: „Auf den Tisch! Den Tisch!“
„Amen, amen!“, brüllte ihnen der Gustl aus vollem Hals entgegen. „Der Gustl hört euch, ihr armen Seelen!“
Er kippte den Champagner hinunter, warf das Glas über die jauchzenden Köpfe hinweg, stieg auf einen der Tische, hob seinen Rock und zeigte sein Hinterteil.
Dann blies er mit vollen Backen in das Holzröhrchen des Dudelsacks. Die Menge sang, tanzte, drehte sich zur jaulenden Musik, und von hier oben, aus den Augenwinkeln, während er im Takt stampfte, konnte der Gustl auch den Leichnam des Gastgebers sehen, des alten Generals von Sporck, eingewickelt in ein weißes Tuch. Sie hatten ihn auf den Samtkissen eines Kanapees aufgebahrt, über ihm das größte seiner geliebten Gemälde, die Schlacht des glorreichen Jahres 1664, wo fast zwanzig Jahre zuvor türkische Reiter von den Fluten der Raab weggerissen wurden, über ihnen die christlichen Dragoner mit blitzenden Säbeln.
Noch auf dem Totenbett solle der ehrwürdige General seine Regimenter befehligt und die Einnahme der Raab-Brücke angeordnet haben, während der Leibarzt seine Zehen nach Würmern untersuchte und eine Dienerin ihm den Nachttopf ausleerte. Um die elfte Stunde solle er seinen Geist ausgehaucht haben, nachdem ihm die Gottesmutter Maria in glänzendem Harnisch erschienen war.
Der Gustl blies stärker in die Sackpfeife, neben seinem Tisch bildeten Männer und Frauen lachend einen Kreis. Ein junger Adeliger mit hochroten Wangen trat in die Mitte, drehte einige Pirouetten, bevor er unter dem Jubel der anderen die Arme hochwarf, zusammenbrach und am Boden liegen blieb.
Die Menge verstummte. Der Gustl setzte die Sackpfeife ab, zog ein Tuch aus seiner Tasche, wischte sich den Schweiß von der Stirn und nahm einem Diener die Weinflasche vom Tablett.
Langsam erhoben sich die Stimmen wieder, begannen einen lamentierenden Totengesang, der hinaufstieg zum Stuck der Decke, zu den Dragonern und Heiden auf den Ölgemälden.
Im nächsten Moment lösten sich kichernd einige Damen aus dem Kreis, küssten den Liegenden auf die Wangen und auf die Stirn. Im allgemeinen Jubel stand der junge Mann auf, verbeugte sich in alle Richtungen und tänzelte zurück in den Kreis. Der Gustl nahm das Mundstück erneut zwischen die Lippen und blies in den Dudelsack. Er trat im Takt, einmal, zweimal, gleich würde sich der Tanz wiederholen, diesmal würde eine Frau hervortreten in die Mitte und all die alten Grafen würden losstürzen, sich aus dem Weg schubsen, um die Liegende zu erwecken, noch bevor der Totengesang zu Ende wäre.
Dreimal, viermal stampfte der Gustl auf. Die Menge unter ihm wogte hin und her, als er auf einmal den Kristallluster und die Engel am Deckengewölbe sah und dann erst merkte, wie das Tischtuch unter seinen Füßen rutschte, der Tisch auf einer Seite nachgab und er fiel. Die Tanzenden schrien auf und stoben davon, während er auf den Boden krachte, dabei Gläser und Stühle mitriss. Am Boden blieb er liegen und verhedderte sich im Tischtuch. Sein Hut war ihm vom Kopf geflogen, der Dudelsack lag irgendwo.
Die Menge hielt inne, irritiert über das Aussetzen der Musik, über die Störung im Ablauf. Mit geweiteten Augen starrten sie den Gustl an, der sich fluchend aufrappelte, aber kurz darauf huben sie wieder an zu singen, drehten sich weg und kreischten nach mehr Champagner, nach Wein, nach Bier, brauchten den Gustl schon gar nicht mehr, hatten ihn längst vergessen.
Schimpfend stieg er aus dem Tischtuch, schnappte sich eine Weinflasche und stellte sich an die Wand, unter einen Dragoner, der einen Heiden in die Knie zwang. Er rieb sich die schmerzenden Beine und nahm einen Schluck.
„Das ist Eurer, oder?“ Ein großer Mann mit Goldringen an den Fingern hielt ihm den Spitzhut hin. Der Gustl verbeugte sich, nahm seinen Hut.
„Seid Ihr Georg Franz Kolschitzky?“ Der Mann hatte einen fremdländischen Akzent, den der Gustl nicht gleich zuordnen konnte. Er nahm noch einen Schluck Wein.
„Der Kolschitzky bin ich, solang es hell ist. In der Nacht bin ich der Gustl.“
Der Mann lächelte, lehnte auf seinem Spazierstock. Sein Kostüm war nach französischer Mode geschnitten, das bekam kein Schneider in ganz Wien so sauber hin.
„Ein gottloses Treiben“, stellte er fest.
Der Gustl schob seinen Hut in die Stirn. „Ihr meint die Tanzleich? Ist schon die dritte diese Woche, werter Herr. Die Menschen haben eine Freud dran, wenn wer stirbt. Gott müsst Ihr woanders suchen. Nicht in Wien.“
„Gott ist zumeist nicht zu finden.“ Der Fremde lächelte noch immer. „Ihr wurdet mir empfohlen. Es heißt, Ihr kennt viele Leute. Ihr sprecht viele Sprachen.“
„Mehr Sprachen, als es Leut gibt, edler Herr, und mehr Leut kenn ich, als es Namen gibt. Mit wem hab ich das Vergnügen? Seid Ihr Sachse?“
Der Fremde senkte den Kopf zu einer unmerklichen Verbeugung. „Ich bin Gesandter des schwedischen Hofes. Wie ich ebenfalls hörte, habt Ihr eine Herberge? Ich suche eine Unterkunft.“
Der Gustl musterte den Mann, die große Nase, die satten Wangen, die kleinen Augen unter der Perücke, die sich nicht bewegten.
Er trank einen Schluck Wein, rülpste. „Mit Verlaub, Eure schwedische Exzellenz, meine Herberge wird den Ansprüchen eines Gesandten nicht genügen.“
„Sorgt Euch nicht um meine Ansprüche. Ich muss Besucher empfangen, die niemand hört und niemand sieht. Die im Dunklen bleiben.“
Der Gustl machte einen Schritt nach vorne, aber der Schwede setzte ihm seinen Spazierstock an die Brust.
„Besucher, für die ich jemanden gut brauchen könnte, der bereits bei den Heiden Dolmetscher war. In Stambul, ist dem nicht so?“
Der Gustl zögerte, kniff die Augen zusammen. „Das ist lang her.“
Der Fremde nickte. „Ich bezahle gut.“
Der Gustl schob den Hut nach hinten, kratzte sich am Kopf, klopfte auf die Sackpfeife.
„Sehr gut bezahle ich“, sagte der Fremde.
Hinter ihnen hatten die Tanzenden sich untergehakt, drehten sich Arm in Arm.
„Ist gut“, sagte der Gustl und nahm einen Schluck aus der Flasche, sagte es in dem Moment, als ein heftiger Windstoß durch die offenen Fenster fuhr, heftiger als zuvor. Der Luster schwankte und die Kerzen erloschen.
Die Grafen hielten ihre Perücken fest, die Gräfinnen ihre Röcke, während die Bediensteten eilig, fast panisch, durch ihre Reihen drängten, die Betrunkenen auf die Seite schoben und hektisch die Fenster verriegelten, aber es war zu spät.
Als die ersten Kerzen wieder leuchteten, sah man es im spärlichen Licht, und ein Raunen ging durch die Gästeschar. Der Wind hatte die schwarzen Seidentücher von den Spiegeln gerissen, alle blickten in ihre eigenen Gesichter, wiederum um ein Vielfaches gespiegelt von den Spiegeln an der Decke, an den Wänden zwischen den Schlachtgemälden, zehnfach, hundertfach, bis in die ewige Verdammnis.
Stockholm
Der große Rechtsgelehrte Samuel von Pufendorf hatte den Würfel nur widerwillig entgegengenommen.
„Elfenbein“, hatte sein Bruder Esaias gemeint, als er ihm den Würfel hingehalten hatte und er in den dicken Fingern mit den Goldringen fast verschwunden war. „Elfenbein, aber nicht von den Elefanten aus Guinea, gleichwohl Ihr, mein lieber Bruder, auch einen solchen gewiss noch nie gesehen habt. Nein, dieses Elfenbein ist aus den Stoßzähnen biblischer Bestien gewonnen. Grausame haarige Kreaturen, die seit Jahrtausenden im gottvergessenen Eis der tatarischen See gefangen sind.“
„Gott vergisst kein Eis“, hatte Pufendorf erwidert, „vor allem wenn sich darin haarige Bestien befinden.“
„Mein lieber Bruder, Ihr habt keine Ahnung, was Gott alles vergisst.“
Schon in der Nacht hatte es über Stockholm aufgehört zu schneien, und nun lag die Stadt mit ihren Giebeldächern und Kirchturmspitzen unter einer Schneedecke begraben. In den Häusern hängten die Menschen Äpfel, Oblaten und Zucker an ihre kleinen Tannenbäume. Die Kirchgeher bewegten sich durch den Schnee zur Frühmesse, über die zugefrorenen Kanäle, während die Glocken den Weihnachtsmorgen des Jahres 1682 einläuteten.
Unter den Brücken hindurch kreisten Kinder auf dem Eis, überholten einander jauchzend, bis sie dorthin gerieten, wo das Eis dünn war, wo immer mal wieder eines mit kurzem Schrei einbrach und versank.
Im großen Lesesaal der Universität von Stockholm war davon nichts zu hören. Durch die hohen Fenster traf das fahle Sonnenlicht auf den Holzboden der Bibliothek, auf die Goldeinbände in den Regalen. Samuel von Pufendorf lehnte missmutig an der Brüstung der Galerie, blickte in den Saal und drehte den Würfel seines Bruders in der Hand. Unten wurde Esaias von Professoren und Studenten umringt. Neben dem großen Globus standen sie. Der Geruch ihrer durchnässten Perücken verbreitete sich bis hinauf zu Pufendorf.
Er rümpfte die Nase, ließ den Würfel in der Seitentasche seines Mantels versinken und verwünschte die Idee, Esaias hierhergebracht zu haben.
Wie sie sich gebärdeten, dachte Pufendorf, buckelten, an den Lippen seines Bruders hingen, selbst die Kollegen der juridischen Fakultät, selbst der alte Canutus Hahn.
Esaias hatte seine Hände auf den prallen Bauch gelegt, sonnte sich in der Gunst all dieser Speichellecker und referierte mit großer Geste über die Wüsten von Afrika, über die türkischen Paläste und über die Salons von Paris. Esaias, der Diplomat, die ganze Welt hatte er gesehen, von Stambul bis Kopenhagen.
Ein Nasenstüber, dachte Pufendorf, das würde dem eingebildeten Laffen gehören!
„Unsere Alten erreichen die fünfzig Jahre“, hörte er da seinen Bruder in den Saal rufen, „nur die Hälfte aller Kindlein sterben bis zum fünfzehnten Jahr. Wie glücklich kann Schweden sich schätzen, und weshalb? Wegen der Vernunft, Messieurs! Die Vernunft, die über allem steht! Denn was braucht es die alten Geschichten von Moral, ja sogar von Religion, wenn es um das Wohle des Landes geht?“
Die Zuhörer zupften an ihren Krägen, rückten die Perücken zurecht.
„Die moderne Welt“, setzte Esaias fort, „fragt nicht mehr nach der Moral.“
Pufendorf seufzte.
Alberti, dem die Hautfalten herunterhingen wie einem Elefanten aus Guinea, holte tief Luft. „Ich erlaube mir zu begegnen, dass man es mit der Vernunft in der Weltpolitik gleichwohl nicht übertreiben dürfe, zumal prima facie –“ Er hielt inne, ruderte mit den Armen, suchte offenbar den verlorenen Gedanken und sagte schließlich: „Weil Hobbes.“
Dann begannen sie über Hobbes zu debattieren, wie immer.
Samuel von Pufendorf hob die Augen zur Decke und folgte den Staubkörnern, die hinunterfielen auf die Werke der griechischen und römischen Philosophen, wo sie im Zwielicht verschwanden. Er versuchte, sich abzulenken, dachte an die Abhandlung über das Strafprozessrecht des teutschen Kaisers, an die neue Prüfungsordnung, an den unbeantworteten Brief des Wiener Hofbibliothekars.
„Wenn es ums Saufen und Rauben geht“, hallte unten Esaias’ Stimme weiter durch den Lesesaal, „dann mögen große Geister wie mein eigener Bruder noch so viel von der göttlichen Würde des Menschen sprechen, von Moral und Gerechtigkeit.“ Er schlug mit der flachen Hand auf den Globus. „Da draußen, Messieurs, gibt es nur Wölfe! Wer anderes behauptet, der ist ein armes Pfaffenkind!“ Er fügte noch etwas hinzu, aber es ging im Applaus der Zuhörer unter. Alberti drehte den Kopf und schielte zu Pufendorf hinauf. Canutus Hahn war im Stehen eingeschlafen.
Samuel von Pufendorf raffte seinen Mantel zusammen und stieg die Wendeltreppe der Galerie hinunter. „Ich muss meinen geliebten Bruder leider dem werten Kollegium entreißen, sonst versäumen wir die Frühmesse.“
Einer von Albertis Schülern eilte herbei, reichte Esaias Mantel und Dreispitz. Ein anderer Student hielt ihm Gehstock und Degen hin. Esaias drückte jedem seiner Zuhörer die Hände.
Alberti breitete seine Arme aus, umarmte ihn mit ungelenken Bewegungen. „Verehrter Gesandter, möchtet Ihr nicht in ein paar Monaten wiederkommen? Ich reise zu Ostern nach Kopenhagen und berichte darüber in einer mehrtägigen Vorlesung. Ein verständiger Gast wie Ihr wärt eine Bereicherung.“
Pufendorf drehte sich um, stapfte hinaus und wartete vor der Saaltür. Schließlich kam sein Bruder, zog sich die Handschuhe über. Die goldenen Fäden in seinem Ärmelaufschlag blitzten. Wortlos ging Pufendorf in Richtung des Ausgangs. In einigem Abstand hörte er Esaias’ Schritte, hörte ihn fröhlich pfeifen.
Auf der Nordbrücke, die zurück in die Stadt führte, blieb Pufendorf erstmals stehen, wartete im kalten Wind, der aus dem Osten kam, vom Meer. Er blickte auf die vertäuten Fischerboote, die vom Eis umschlossen waren. Schließlich hatte sein Bruder ihn erreicht.
„Wieso seid Ihr stehen geblieben?“ Esaias zog seinen Mantel enger.
„Nichts habt Ihr gelesen“, fuhr ihn Pufendorf an, „ein Esel seid Ihr, der keine einzige meiner lectiones kennt! Wie kommt Ihr dazu, meine Lehre über die Güte menschlicher Natur in Zweifel zu ziehen? Noch dazu vor diesen Schnapphähnen, vor Alberti, der mich einen ahnungslosen Moralisten nennt. Ein Nasenstüber würde Euch gehören, Esaias, hört Ihr?“
Der Angesprochene stützte sich auf seinen Gehstock, lächelte auf den kleinen Bruder hinab. „Der Herr Vater hat auch immer von Engeln, Heiligen und Gerechtigkeit gesprochen, wie es sich für einen Pastor geziemt. Passt nur auf, dass Ihr ihm nicht zu ähnlich werdet, Samuel.“
„Unfug“, schimpfte Pufendorf.
„Ihr habt nun bald fünfzig Lebensjahre, die schwarze Galle im Körper nimmt überhand, viel Zeit bleibt uns beiden nicht.“ Er klopfte den Schnee vom Brückengeländer. „Der alte Mensch neigt zu wunderlichen Gedanken, zur Melancholie. Göttliche Gnade, menschliches Recht, immer hat es eine Leier gegeben, um das Menschengetier in den Schlaf zu wiegen, damit es nicht hört, was draußen umhergeht, in der Nacht, in ihm selbst. Aber heute, mein Bruder, heute leben wir im Zeitalter kalter, klarer Vernunft.“
Unter der Brücke krachte das Eis. Pufendorf schwieg, betrachtete die Zinnen der Königsburg am anderen Ufer, die neuen, spitz zulaufenden Kirchtürme. Überall ragten Holzgerüste empor, die ganze Stadt eine einzige Baustelle.
„Das ist dummer Unfug!“, wiederholte er schließlich und machte sich daran weiterzugehen. Der Schnee wehte ihm ins Gesicht. „Der Mensch ist das Ebenbild Gottes und seine Güte ist naturgegeben. Gottgegeben. Punktum.“
„Wer so alt ist wie wir“, hörte er Esaias’ Stimme von hinten, „sollte keinen Schimären mehr nachjagen. Nichts anderes als Wölfe sind wir, die gelernt haben, Kreide zu fressen. Armselige, keulenschwingende Bestien.“
Pufendorf ging ein paar Schritte. Es hatte ihm nicht gutgetan stehen zu bleiben. Die Kälte hatte sich seiner Glieder bemächtigt. Vorsichtig, fast zittrig setzte er auf den verschneiten Steinen einen Fuß vor den anderen.
„Und der Würfel?“, hörte er seinen Bruder rufen. „Gebt doch zu, dass Euch der Würfel gefällt!“
Mit fünfunddreißig Jahren hatte Catharina von Pufendorf bereits zwei Doktoren der Jurisprudenz geheiratet, sich in Heidelberg wegen eines Hauskaufs verschuldet, ihren ersten Mann begraben und war dem zweiten in ein Land gefolgt, wo es den ganzen Winter über dunkel blieb. Sie war nicht gewillt, ungebührliche Fragen ihrer Töchter bei Tisch zu dulden.
„Stimmt das mit der Seeschlange, werter Onkel?“
Catharina deutete Emerentia, still zu sein.
„Stimmt es, dass der Tatarenkönig die Seeschlange selbst erwürgt hat? Habt Ihr alles davon gegessen oder nur den Schwanz?“
Catharina schlug auf den Tisch. Ihre Töchter senkten den Kopf über die Limonikrapfen. Dann brach es erneut aus Emerentia heraus. „Stimmt es also?“
Esaias drehte an seinen Ringen. Sein rosiges Gesicht leuchtete. „Die Tataren behaupten das zwar, aber Seeschlangen muss man nicht immer erwürgen, man findet sie auch in kleineren Formen. Im Mittelmeer etwa. Jene, die ich gegessen habe, ist mit einer Kanone erlegt worden. Vermutlich.“
Esaias biss in seinen Krapfen, legte ihn zurück auf den Teller, klopfte die Brösel auf das weiße Tischtuch. Emerentia und Magdalene rutschten auf ihren Sesseln herum, folgten jeder Bewegung ihres Onkels. Pufendorf hatte die Arme verschränkt. Sein Krapfen lag unangetastet auf dem Teller.
Am Kachelofen knisterten Harz und Tannennadeln in einer Schale mit Räucherwerk. Aus dem Untergeschoss, wo sich neben Catharinas Reiseromanen die Koffer von Esaias stapelten, duftete es nach Zimt und Speck.
„Still sitzen“, herrschte Pufendorf seine Töchter an, „beim Weihnachtsmahl spricht man nicht über heidnische Seeschlangen und ähnlichen Humbug.“
Esaias griff nach einem Lebkuchen aus der Silberschüssel. „Lasst die beiden doch, lieber Bruder, und lasst mich alten Mann von meinen Reisen erzählen, lasst mich ein Stück von der weiten Welt in Euer Heim bringen. Sagt doch, werter Bruder, was habt Ihr letzten Herbst auf Eurer Reise nach Lund gegessen?“
Die Mädchen kicherten und verstummten erst, als Catharina ihnen den Löffel über den Hinterkopf zog.
„Fisch“, entgegnete Pufendorf.
Catharina richtete ihr Besteck gerade. „Der verehrte Samuel hat einen Brief vom Wiener Hof erhalten.“
Esaias hob die Augenbrauen. „Das wusste ich gar nicht. In Wien kenne ich zahlreiche Personen von erstem Rang. Der Brief ist doch nicht etwa von seiner Exzellenz, dem alten Kanzler Hocher? Offenbar korrespondiert er in seinen Mußestunden mit ganz Europa, verschickt überallhin seine Käfer. War dem Brief ein Käfer beigefügt?“
Catharina reckte das Kinn in die Höhe. „Kein Käfer. Der Brief stammt von einem Doktor Nessel, Mitglied des kaiserlichen Rates.“
„Nessel?“ Esaias runzelte die Stirn. „Nie gehört.“
Catharina räusperte sich. „Doktor Nessel ist Hofbibliothekar.“
„Ach.“ Esaias biss in seinen Lebkuchen. „Ich hätte es mir denken können. Hat er ein Buch geschickt?“
„Ja“, murmelte Pufendorf. „Meines.“
Esaias kaute bedächtig.
„Mit überaus verständigen Kommentaren“, fügte Pufendorf hinzu.
„Ohne Zweifel ist es entzückend, das eigene Buch noch einmal zu lesen.“
Pufendorf schnitt seinen Limonikrapfen entzwei. „Doktor Nessel schreibt, er habe Gelegenheit gehabt, Menschen in paradiesischer Armut zu beobachten. Menschen, die nichts anderem folgen als ihrem natürlichen Empfinden von Recht, das ihnen der Allmächtige ins Herz gelegt hat.“
„Und wo sollte dieser Ort sein, wo man solche Gemeinschaften findet?“
„Im Gebiet der Erzdiözese Moson.“
„In Peru?“
„Nein.“
„Im afrikanischen Dschungel?“
„Bei Wieselburg.“
„Aha.“ Esaias verzog das Gesicht. „Wo ist das?“
„An der Grenze zu Ungarn.“
„Das hat euch der Bibliothekar geschrieben?“
„Hofbibliothekar.“ Pufendorf wischte das Messer an der Serviette ab, richtete es am Tellerrand aus, den silbernen Griff im rechten Winkel zur Tischkante. „Die Fürsten Esterházy und Batthyány haben am Rande einer kaiserlichen Audienz von der Erzdiözese Moson berichtet. Keinerlei Ordnung solle es dort geben, nur Pest, Wölfe, Schlangen und Hexen. Außerdem kämen immer wieder die Türken herüber, streiften durch die Sümpfe. Die Menschen selbst hausten in einfachen Schilfhütten, seien dem Kreatürlichen näher als dem Menschlichen.“
Pufendorf nahm ebenfalls einen Lebkuchen, schob damit die Krapfenstücke auf dem Teller zusammen. „Ein Naturzustand!“
Esaias blickte auf Pufendorfs Teller. „Was meint Ihr damit?“
„Das sind Menschen jenseits von Recht und Ordnung“, ereiferte sich Pufendorf. „Den Naturvölkern in Afrika und Amerika gleich, drei Tagesreisen von Wien entfernt. Menschen, die nur ihrer eigenen Güte folgen.“
„Einem Katholiken sollte man nichts glauben.“
„Sagt mir, werter Bruder“, erwiderte Pufendorf wieder ruhig, „nur einmal angenommen, man würde eine Forschungsreise in Erwägung ziehen. Wie sind die Straßen nach Wien?“
Esaias blickte ihn entgeistert an. „Weit.“
„Das ist mir bewusst.“
„Ich kenne die Distanzen zwischen den europäischen Hauptstädten. Jene zwischen Stockholm und Wien beträgt tausendzweihundert Meilen.“
„Die Lerchen!“, rief Catharina. Die Haushälterin war aus dem Untergeschoss heraufgekommen, stellte eine Platte mit den speckumwickelten Vögeln auf den Tisch. Esaias nahm einen davon auf seinen Teller. Der Speckmantel triefte auf den Lebkuchen, auf den angebissenen Krapfen. „Ihr gebt doch nicht wirklich etwas auf die Schilderungen dieses Büchermenschen. Naturvölker, Urzustand, all das wird man dort unten wohl kaum finden. Pest und Türken vielleicht schon eher.“
„Wenn man die Menschen sehen, studieren könnte“, sagte Pufendorf, „ihre Güte im Zustand der Gesetzlosigkeit. Der Nutzen für die naturrechtliche Lehre wäre unermesslich.“
Pufendorf spürte die Wärme des Ofens, seine Wangen glühten. Er trank einen Schluck aus dem Weinglas, mied Catharinas Blick.
Esaias schob ein Stück Speck in den Mund, den Lebkuchen hinterher.
„Ich reise zu Pfingsten wieder nach Wien“, sagte er schließlich, „vielleicht auch später. Das hängt von gewissen Umständen ab.“
Pufendorf horchte auf.
„Ich könnte euch mitnehmen.“ Esaias grinste, wischte sich über den Mund, kratzte sich am Kinn. Im nächsten Moment schüttelte er den Kopf. „Nein, vergesst es. Bitte vergesst es. Schreibt Bücher in Stockholm, lasst Euch nicht auf eine Welt ein, die weit weg ist!“
Pufendorf zupfte seinen Kragen zurecht. „Wann reist Ihr nach Wien? Zu Pfingsten? Zu Pfingsten muss ich eine Vorlesung über Seneca halten.“
„Na bitte!“, rief Esaias, drehte sich zu den Mädchen. „Wollt Ihr von den Pfauen Stambuls hören? Es sind die schönsten des ganzen Orients.“
Pufendorf erhob sich, ging einige Schritte zum Fenster. Er spürte seinen Rücken. Hier drang die Kälte von außen durch das dünne Glas, der Ofen strahlte nur schwach herüber. Das Schneetreiben hatte fast aufgehört, aber man sah kaum den Kanal. Er könnte einen Reisebericht in Frankfurt drucken lassen, eine Abschrift für den König, eine für das Institut. Da könnte Alberti zu Ostern ruhig nach Kopenhagen fahren, eine Reise nach Wien würde ihn in den Schatten stellen. Im Herbst könnte er einen Vortrag halten, könnte vor dem Kollegium stehen und all den Krokodilen erläutern, dass er die Naturmenschen gesehen, dass er ihr Gerechtigkeitsempfinden studiert hatte. Dass es eine menschliche Güte gab, wie es das Naturrecht annimmt.
Er bildete sich ein, die Stimmen von Kindern zu hören, die noch in der Dunkelheit auf dem Eis liefen, glaubte am Ufer des Kanals eine Gestalt zu erkennen, die bis zur Hüfte im Wasser stand.
„Ein Wassermann?“ Auf einmal war Catharina neben ihm, legte ihre Hand auf seinen Oberarm. Er hörte die Mädchen lachen, hörte Esaias singen, ein Lied vom Frühling, von Elefanten und fliegenden Fischen.
Catharina sah Pufendorf mit ernstem Ausdruck an. Ihre Augen forschten in seinem Gesicht. Er spürte den Druck ihrer Hand, blickte erneut aus dem Fenster, suchte die Gestalt am Kanal, glaubte, Schreie zu vernehmen, aber Esaias’ Lachen übertönte alles.
Catharina lächelte ihn an, räusperte sich. „Vergesst die Hirngespinste. Im Alter ist das Reisen zu anstrengend.“
Pufendorf schwieg.
„Kommt weg vom Fenster“, fügte sie sanft hinzu, „kommt zum Ofen herüber, wo es wärmer ist. Euch wird immer so schnell kalt.“
Gießhübl
Das Pferdegesicht des Kaisers war zu hässlich. Immer wieder musste der Hofmaler mit der Brotrinde radieren, das Papier war bereits voller Krümel, war schwarz von den verwischten Linien des Bleistifts. Noch dazu fuhr ihm immer wieder der Wind durch die Blätter. Die vorstehende Unterlippe, die schmale Kopfform, die geschwollenen Augenlider, all das musste sauberer, geradliniger werden, damit es zum Gesicht eines Herrschers wurde, eines Imperators, zum Gesicht Kaiser Leopolds I.
Zu Füßen des Hofmalers lagen bereits die Überreste von neun Bleistiften und vier Brotrinden im Gras. Leopold fehlte einfach die grazile Strenge seines Vaters, der ihm die Herrschaft über ein zerbröckelndes Reich vermacht hatte, ihm fehlte das glamouröse Charisma seiner großen Gegenspieler, eines Ludwig XIV. von Frankreich oder eines türkischen Sultans Mehmet IV. Vielmehr kaschierte die Kaiserwürde ein hoffnungsloses Gesicht, genauso ineinandergeschoben wie das Reich, das gleichzeitig römisch, teutsch und heilig sein wollte und ebenso wie die Züge seines Herrschers den eigenen Ansprüchen nicht genügen konnte.
„Das Licht ist diffizil.“
Der Hofmaler blickte hoch.
„Das Licht ist diffizil“, sagte der Kaiser. „Es kommt von oben. Die Uhrzeit, versteht Er, vielleicht hat Er die falsche Uhrzeit gewählt. Außerdem stören die Bäume das Licht. Das Licht ist empfindsam, entflieht der Stunde wie ein junges Reh. Das muss Er wissen. Jeder Künstler weiß um die Empfindsamkeit des Lichts.“
Der Hofmaler schob seinen Hut aus der Stirn. „Natürlich, Eure Majestät.“
Leopold nickte. „Ich habe es Ihm schon dreimal gesagt.“
Der Hofmaler setzte den Bleistift erneut an, an einer anderen Stelle, malte die Schultern, die Köpfe der Adeligen, die auf der Waldlichtung um den Kaiser herumstanden, die Mitglieder des Hofstaats, die Marschälle und Prinzen, alle in ledernen Jagdgewändern, den Dreispitz auf dem Kopf, reglos, weil der Kaiser es so angeordnet hatte, um das Licht nicht zu stören. Hinter dem Rücken des Hofmalers, unter den hohen Bäumen, winselten die Hunde, die seit Stunden an der Leine gehalten wurden.
„Vielleicht doch anders“, sagte der Kaiser, klopfte Kiefernnadeln von den weißen und goldenen Spitzen seines Seidenkostüms, reckte den Arm und lehnte sich gegen einen Baum. „Vielleicht doch so, meint Er nicht? Vielleicht beginnen wir noch einmal?“
„Nein, Majestät“, beeilte sich der Hofmaler zu sagen, „es ist schon zu wenig Licht.“
Leopold verzog das Gesicht. „Es sei. Starhemberg, wovon habt Ihr zuvor geredet?“
Eine Gestalt vom anderen Ende des Bildes machte einen Schritt nach vorne.
„Nicht! Bleibt dort drüben! Ihr bringt die Aufstellung durcheinander!“
Graf Starhemberg hielt inne, zog sich zurück, den Kopf zu Boden gesenkt.
„Eure Majestät, ich hatte von der ungarischen Grenze gesprochen. Vom Angriff der Türken auf die Festung Raab. Nach neuesten Berichten sind es zweihunderttausend Mann, Majestät.“
„Was kümmert diese Angelegenheit Euch als Wiener Stadtkommandanten? Der Sultan will Raab, das wissen wir. Soll er haben, holen wir zurück. Sonst noch etwas?“
„Nein, Majestät.“
Eine Hand fasste den Grafen am Oberarm, zog ihn aus dem Bild. Gräfin Josepha Irene von Starhemberg war die einzige Frau in der Jagdgesellschaft, aber ihre Stiefel waren aus besserem Leder als die des Grafen. Sie flüsterte ihm etwas ins Ohr, stieß ihn wieder nach vorne.
„Die Stadt muss auf eine Belagerung vorbereitet werden, Majestät.“
„Welche Stadt?“
„Wien, Majestät.“
„Wien?“ Der Kaiser drehte den Kopf zu Starhemberg. „Eine Belagerung? Durch die Türken?“
Der Graf blickte zu Boden, rang mit den Händen, setzte an, etwas zu sagen, schloss den Mund wieder.
„Nun?“, fragte der Kaiser.