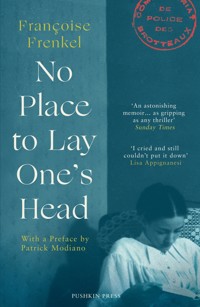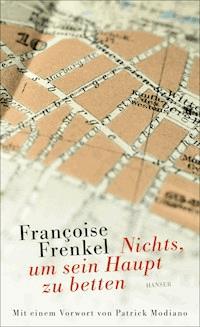
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Voller Leidenschaft für die Literatur eröffnet die polnische Jüdin Francoise Frenkel nach dem Studium in Paris 1921 die erste französische Buchhandlung in Berlin. 1939 flieht sie vor dem Nationalsozialismus, über Paris quer durch Frankreich bis in den „freien“ Süden nach Nizza. Als es 1942 auch hier zu Razzien kommt, findet sie Schutz bei dem Ehepaar Marius. Zwei in ihrer Unerschütterlichkeit unvergessliche Menschen, mit deren Hilfe ihr 1943 die Flucht in die Schweiz gelingt. Jetzt erscheint dieses „in Tempo und Intensität wie ein Roman“ (Le Monde) geschriebene Zeugnis, das als historischer und literarischer Fund gefeiert wird, mit einem Vorwort von Patrick Modiano erstmals auf Deutsch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Voller Idealismus und Leidenschaft für ihren Beruf eröffnet die polnische Jüdin Françoise Frenkel nach dem Studium in Paris 1921 »La Maison du Livre«, die erste französische Buchhandlung in Berlin. Als die Nationalsozialisten den Verkauf französischer Bücher und Zeitschriften verbieten und die Situation immer bedrohlicher wird, muss sie das Geschäft 1939 nach achtzehn Jahren schließen. Mit einem Empfehlungsschreiben der französischen Botschaft flieht sie zuerst nach Paris, dann über Avignon bis in den »freien« Süden nach Nizza. Während der dortigen Razzien im August 1942 findet sie unverhofft Schutz im Friseursalon des Ehepaars Marius. Mit der rückhaltlosen Hilfe dieser beiden Menschen gelangt sie in den folgenden Monaten von Versteck zu Versteck und schließlich bis zur Schweizer Grenze, wo ihr im Juni 1943 beim dritten Versuch die Flucht gelingt. Noch unter dem Eindruck des Schocks beginnt Frenkel in Freiheit mit der Niederschrift von Nichts, um sein Haupt zu betten. Ein literarisches Zeugnis von unschätzbarem historischem Wert und eine Hommage an jene, die ihr Leben riskierten, um andere zu retten.
Hanser E-Book
Françoise Frenkel
Nichts, um sein Haupt zu betten
Mit einem Vorwortvon Patrick Modiano
Dossier von Frédéric Maria
Aus dem Französischenvon Elisabeth Edl
Carl Hanser Verlag
Die dieser Ausgabe zugrundeliegende französische Neuausgabeder Originalausgabe von 1945 erschien 2015 unter dem Titel Rien où poser sa tête bei Gallimard in Paris.
ISBN 978-3-446-25412-1
© Éditions Gallimard Paris 2015 für das »Vorwort«von Patrick Modiano und das »Dossier« von Frédéric Maria
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2016
Umschlag und Foto:
Peter-Andreas Hassiepen, München
Satz: Satz für Satz, Wangen im Allgäu
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de .
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
Inhalt
Vorwort von Patrick Modiano
Vorbemerkung
I. Im Dienste des französischen Geistes in DeutschlandBerufung – Paris – Berlin – Umschwung – Boykott – Pogrom – Aufbruch – An der Grenze – Ankunft in Paris – Erinnerungen
II. ParisAugust 1939 – Stimmung – Radio und Presse – Der Sitzkrieg – Paris am Vorabend der Besetzung
III. AvignonJuni 1940
IV. VichyExodus – Besetzung – Stimmung – Auf dem Postamt – Der Bahnhof – Massenaufbruch – Reisen und Zwischenfälle
V. AvignonAugust–November 1940 – Die Rhone – Der Mistral – Monsieur Devitrolles
VI. NizzaDezember 1940 – Typen und Gestalten – Monsieur Thérive, Koch und Politiker – Diskussionen beim Radiohören – Presse und Propaganda – Unstetes Leben – Öffentliche Meinung – Das Wüten des Mittelmeers – Das Hotel La Roseraie – Schlangestehen – Schlawiner – Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung – Schwarzmarkt – Tausch-handel – Die Arche Noah – Formalitäten – »Die neue Ordnung« in Frankreich – Verhängnisvolle Tage – Die Marius’ – Der Schwur des Südfranzosen – Ungewissheiten – Wechsel-fälle des Lebens
VII. Irgendwo in den BergenDas Schloss – Auf der Straße
VIII. Rückkehr nach NizzaSeptember–Dezember 1942 – Marion – Madame Lucienne – Alternative – Die beiden Strickerinnen
IX. GrenobleDezember 1942 – Die Entscheidung – Auf in die Schweiz? – Rachel, die Verwirrte – Julot, der Schleuser – »Los, los!« – Grauen
X. An der GrenzeVerhaftung – Gespräche mit Gendarmen – Im Knast
XI. AnnecyEnde Dezember 1942–Januar 1943 – Im Gefängnis – Das Leben in der Haftanstalt – Verschiedene Gestalten – Ein blondes, rosiges Kind
XII. Saint-JulienFahrt zum Schwurgericht – Der Mörder aus Bremen – Ein Nachmittag in der Zelle – Vor Gericht – Betrügerische Schleuser – Die vier »Dienstleistenden«, Musketiere von 1939 – Die verschwundenen Diamanten – Das Rote Meer und der Stacheldraht – Freispruch
XIII. Annecy»Nach Gurs!« – Der Schwur des Savoyarden – Güte, dein ist der Sieg! – Begegnungen und Neuigkeiten – Ein schöner Scherz – Der Abbé – Im Kloster – Friede, Erholung, Vergessen
XIV. An der GrenzeApril 1943 – Zweiter Fluchtversuch – Der neapolitanische Soldat – Rückkehr nach Annecy – Savoyen 1942–1943
XV. Auf in die SchweizJuni 1943 – Der Zöllner und seine Familie – Unterwegs – Heimweh – Ein mähender Bauer – Die widerspenstige Gittertür – Der Sprung in die Schweiz – Ein freundlicher Soldat – Gerettet! – Ein leeres Bündel und ein sehr müdes Herz
Zeittafel
Dossier
Dank
Zur deutschen Ausgabe
Endnoten
Vorwort
Das Exemplar von Nichts, um sein Haupt zu betten (Rien où poser sa tête), das, wie ich erfahren habe, vor kurzem in Nizza auf einem Trödelmarkt der Emmaus-Bruderschaft gefunden wurde, hat bei mir ein seltsames Gefühl hervorgerufen. Vielleicht weil es in der Schweiz gedruckt worden war, im September 1945, für den Verlag Jeheber in Genf. Dieser Verlag, den es nicht mehr gibt, hatte 1942 L’aventure vient de la mer veröffentlicht, die französische Übersetzung eines Romans von Daphne du Maurier, der im Jahr davor in London erschienen war, einer jener englischen oder amerikanischen Romane, die von der Nazi-Zensur verboten wurden und die man unterm Ladentisch verkaufte und sogar auf dem Schwarzmarkt im Paris der Besatzungszeit.
Man weiß nicht, was aus Françoise Frenkel nach dem Erscheinen von Nichts, um sein Haupt zu betten geworden ist. Am Ende ihres Buches erzählt sie uns, wie sie von der Haute-Savoie aus 1943 illegal die Schweizer Grenze überschritten hat. Dem Hinweis zufolge, der unter der Vorbemerkung steht, hat sie Nichts, um sein Haupt zu betten in der Schweiz geschrieben, »am Ufer des Vierwaldstädter Sees, 1943–1944«. Manchmal gibt es merkwürdige Zufälle; nur ein paar Monate früher, im November 1942, da entdecke ich in einem Brief von Maurice Sachs, abgeschickt aus einem Haus im Departement Orne, wo er Zuflucht gefunden hatte, plötzlich in einem Satz den Titel des Buches von Françoise Frenkel: »Offenbar ist das ein bisschen meine Linie, wenn nicht gar mein Schicksal, nichts haben, um mein Haupt zu betten.«
Wie hat das Leben von Françoise Frenkel nach dem Krieg ausgesehen? Bis zum heutigen Tag habe ich nur wenige Dinge in Erfahrung bringen können: Sie erwähnt in ihrem Buch die französische Buchhandlung, die sie Anfang der zwanziger Jahre in Berlin gegründet hatte – die einzige französische Buchhandlung in der Stadt – und die sie offenbar bis 1939 leitete. Im Juli jenes Jahres verlässt sie überstürzt Berlin und geht nach Paris. Doch aus einer Untersuchung von Corine Defrance, »La Maison du Livre français à Berlin (1923–1933)«, erfahren wir, dass sie diese Buchhandlung gemeinsam mit ihrem Mann führte, einem gewissen Simon Raichenstein, über den sie in ihrem Buch kein einziges Wort verliert. Dieser Phantomehemann soll Berlin Ende 1933 verlassen haben und mit einem Nansen-Pass nach Frankreich gegangen sein. Einen Personalausweis sollen die französischen Behörden ihm verweigert haben, dagegen schickten sie ihm wohl einen Ausweisungsbescheid. Doch er ist in Frankreich geblieben. Von Drancy aus kam er mit dem Transport vom 24. Juli 1942 nach Auschwitz. Er war in Russland geboren, in Mogilew, und soll im 14. Arrondissement gewohnt haben.
Françoise Frenkels Spur findet man im Staatsarchiv Genf, in der Liste jener Personen, die während des Zweiten Weltkriegs an der Genfer Grenze registriert wurden, das heißt, die Erlaubnis bekamen, nach ihrem Grenzübertritt in der Schweiz zu bleiben. Diese Liste verrät uns ihren richtigen Namen und Vornamen: Raichenstein-Frenkel, Frymeta, Idesa; ihr Geburtsdatum: 14. 7. 1889, und ihr Herkunftsland: Polen.
Eine letzte Spur von Françoise Frenkel, fünfzehn Jahre später: ein Antrag auf Entschädigung mit ihrem Namen, aus dem Jahr 1958. Es geht um einen Überseekoffer, den sie im Mai 1940 im Lagerhaus »Colisée« in der Rue du Colisée Nr. 45 in Paris eingelagert hatte und der am 14. November 1942 als »jüdischer Besitz« beschlagnahmt wurde. Sie bekam 1960 eine Entschädigung von 3500 Mark zugesprochen, wegen der Enteignung ihres Koffers.
Was enthielt er? Einen Mantel aus Nutriapelz. Einen Mantel mit einem Kragen aus Opossum. Zwei Wollkleider. Einen schwarzen Regenmantel. Einen Morgenrock von Grünfeld. Einen Regenschirm. Einen Sonnenschirm. Zwei Paar Schuhe. Eine Handtasche. Ein Heizkissen. Eine tragbare Erika-Schreibmaschine. Eine tragbare Universal-Schreibmaschine. Handschuhe, Strümpfe, Taschentücher …
Muss man wirklich mehr wissen? Ich glaube nicht. Was die Besonderheit von Nichts, um sein Haupt zu betten ausmacht, ist, dass man die Autorin nicht genau identifizieren kann. Dieses Zeugnis über das Leben einer verfolgten Frau im Süden Frankreichs und in der Haute-Savoie während der Besatzungszeit ist umso beeindruckender, als es das Zeugnis einer Anonyma zu sein scheint, so, wie das auch lange Zeit Eine Frau in Berlin gewesen ist, ebenfalls in der Schweiz veröffentlicht, in den fünfziger Jahren.
Denken wir zurück an die ersten literarischen Werke, die wir mit etwa vierzehn Jahren gelesen haben, so wussten wir damals nichts über ihre Autoren, ob es sich um Shakespeare handelte oder um Stendhal. Aber diese naive und direkte Lektüre prägte uns für immer, als wäre jedes Buch eine Art Meteorit. In unserer Zeit erscheint der Schriftsteller auf Fernsehbildschirmen und auf Buchmessen, er tritt unaufhörlich zwischen seine Werke und seine Leser und wird zu einem Handlungsreisenden. Wir sehnen uns zurück nach der Zeit unserer Kindheit, als wir Der Schatz der Sierra Madre lasen, veröffentlicht unter einem falschen Namen: B. Traven, von einem Mann, dessen Identität nicht einmal seinen Verlagen bekannt war.
Ich möchte das Gesicht von Françoise Frenkel lieber nicht kennen, noch die Wechselfälle ihres Lebens nach dem Krieg oder ihr Sterbedatum. So bleibt ihr Buch für mich auf immer der Brief einer Unbekannten, postlagernd, seit einer Ewigkeit vergessen und jetzt zugestellt, scheinbar irrtümlich, vielleicht aber war er doch für einen bestimmt. Dieses seltsame Gefühl, das ich beim Lesen von Nichts, um sein Haupt zu betten empfand, lag auch daran, dass ich die Stimme einer Person hörte, deren Gesicht im Halbdunkel nicht wahrzunehmen ist und die einem eine Episode aus ihrem Leben erzählt. Und das hat mich an die Nachtzüge meiner Jugend erinnert, keine Schlafwagen, sondern Abteile mit Sitzplätzen, wo eine sehr große Nähe entstand zwischen den Reisenden und wo einem jemand, unterm Nachtlicht, irgendwann sein Herz ausschüttete oder sogar Geständnisse machte, wie in der Verschwiegenheit eines Beichtstuhls. Was dieser plötzlichen Nähe Kraft verlieh, war die Annahme, dass man sich wahrscheinlich niemals wiedersehen würde. Kurze Begegnungen. Man bewahrt an sie eine Erinnerung in der Schwebe, die Erinnerung an eine Person, die keine Zeit hatte, einem alles zu sagen. So geht es mir auch mit dem Buch von Françoise Frenkel, geschrieben vor siebzig Jahren, jedoch im Wirrwarr der Gegenwart und unter dem Eindruck des Schocks.
Ich habe schließlich die Adresse der Buchhandlung, die Françoise Frenkel führte, ausfindig gemacht: Passauer Straße 39; Telefon: Bavaria 20–20, zwischen Schöneberg und Charlottenburg. Ich stelle mir die beiden in dieser Buchhandlung vor, sie und ihren Mann, der nicht vorkommt in ihrem Buch. Als sie es schrieb, wusste sie wahrscheinlich nichts von seinem Schicksal. Simon Raichenstein besaß einen Nansen-Pass, denn er gehörte zu den aus Russland stammenden Emigranten. Es gab von ihnen über hunderttausend Anfang der zwanziger Jahre in Berlin. Sie hatten sich im Bezirk Charlottenburg angesiedelt, das deshalb auch »Charlottengrad« genannt wurde. Viele dieser Weißrussen sprachen Französisch, und ich vermute, sie waren die wichtigsten Kunden von Herrn und Frau Raichenstein. Vladimir Nabokov, der in diesem Bezirk wohnte, hat wahrscheinlich eines Abends den Fuß über die Schwelle der Buchhandlung gesetzt. Unnötig, in Archiven zu stöbern und nach Fotos zu suchen. Ich glaube, es genügt, Nabokovs »Berliner« Erzählungen und Romane zu lesen – die er in russischer Sprache schrieb und die der bewegendste Teil seines Werkes sind –, um Françoise Frenkels Spur in Berlin wiederzufinden. Man kann sie sich vorstellen in den dämmerigen Straßen und spärlich beleuchteten Wohnungen, die Nabokov beschreibt. Beim Blättern in Die Gabe, dem letzten Roman, den Nabokov auf Russisch schrieb und der ein Abschied ist von seiner Muttersprache, findet man die Beschreibung einer Buchhandlung, die wohl der von Françoise Frenkel und dem rätselhaften Simon Raichenstein glich. »Er überquerte den Wittenbergplatz, auf dem, wie in einem Farbfilm, rund um eine antike, zu einem Untergrundbahnhof führende Treppe Rosen im Winde zitterten, und lenkte seine Schritte zu der Buchhandlung … Es brannte noch Licht – sie versorgten die nächtlichen Taxifahrer mit Büchern –, und durch das matte gelbe Glas sah er die Silhouette von Mischa Beresowskij …«
Auf den letzten fünfzig Seiten ihres Buchs erzählt Françoise Frenkel von einem ersten, jedoch scheiternden Versuch, die Schweizer Grenze zu überschreiten. Sie wird auf die Zollstation gebracht, dort sitzen »zwei in Tränen aufgelöste junge Mädchen« und »ein wie betäubter Junge«. Am übernächsten Tag wird sie im Autobus, zusammen mit anderen verhafteten Flüchtlingen, ins Gefängnis Annecy überstellt.
Diese Seiten gehen mir nahe, weil ich lange Jahre in der Region Haute-Savoie verbracht habe. Annecy, Thônes, das Plateau des Glières, Megève, Le Grand-Bornand … Die Erinnerung an den Krieg und den Maquis war noch lebendig in jener Zeit meiner Kindheit und Jugend. Fingerabdrücke. Handschellen. Sie wird vor eine Art Gericht gestellt. Zum Glück wird sie nur zu einer »Mindeststrafe auf Bewährung« verurteilt und »für frei erklärt«. Am nächsten Tag folgt die Haftentlassung. Nach dem Verlassen des Gefängnisses geht sie in der Sonne durch die Straßen von Annecy. Der Weg, dem sie aufs Geratewohl folgt, ist mir vertraut. Sie hört das Murmeln eines Springbrunnens, den ich ebenfalls hörte, während der frühen Nachmittage, erfüllt von Stille und großer Hitze, am See, am Ende der Promenade du Pâquier.
Bei ihrem dritten Versuch, illegal die Schweizer Grenze zu überschreiten, wird sie es schaffen. Am Busbahnhof Annecy habe ich oft einen Bus genommen, der mich nach Genf brachte. Mir war aufgefallen, dass er durch den Zoll fuhr, ohne je kontrolliert zu werden. Und dennoch spürte ich beim Näherkommen der Grenze, unweit von Saint-Julien-en-Genevois, einen leichten Stich im Herzen. Vielleicht schwebte noch die Erinnerung an eine Gefahr in der Luft.
Patrick Modiano
Nichts, um sein Haupt zu betten
Hinweis zur französischen Neuausgabe: Die französische Neuausgabe von Nichts, um sein Haupt zu betten entspricht der Originalausgabe von 1945. Es wurde keine Kürzung oder Umgestaltung des Textes vorgenommen. Nur einige Tippfehler und sprachliche Ungenauigkeiten wurden dem Leser zuliebe korrigiert. Alle Fußnoten stammen von der Autorin.
Vorbemerkung
Es ist Pflicht der Überlebenden, Zeugnis abzulegen, damit die Toten nicht vergessen, noch Hilfsbereitschaft und Aufopferung Unbekannter missachtet werden.
Mögen diese Seiten ein ehrenvolles Gedenken an jene wecken, die für immer verstummt sind, unterwegs vor Erschöpfung gestorben oder ermordet.
Ich widme dieses Buch denMENSCHEN GUTEN WILLENS, die hochherzig, mit unermüdlicher Tapferkeit, ihren Willen der Gewalt entgegengestellt und Widerstand geleistet haben bis ans Ende.
Lieber Leser, schenke ihnen die dankbare Zuneigung, die jede großmütige Tat verdient!
Ich gedenke ebenso meiner Schweizer Freunde, die mir die Hand gereicht haben in dem Augenblick, da ich unterzugehen drohte, und des hellen Lächelns meiner Freundin Lie, die mir geholfen hat weiterzuleben.
F. F.
In der Schweiz, am Ufer
des Vierwaldstädter Sees,
1943–1944.
I
Im Dienste des französischen Geistes in Deutschland
Ich weiß nicht, auf welches Alter meine Berufung zur Buchhändlerin tatsächlich zurückgeht. Als ich ganz klein war, konnte ich Stunden damit verbringen, in einem Bilderbuch oder einem großen illustrierten Band zu blättern.
Die liebsten Geschenke waren mir Bücher, die sich auf Etageren an den Wänden meines Kleinmädchenzimmers stapelten.
Zu meinem sechzehnten Geburtstag erlaubten meine Eltern mir, eine Bibliothek ganz nach meinem Geschmack in Auftrag zu geben. Ich ließ, nach meinem Entwurf, einen Schrank bauen, der zum Erstaunen des Tischlers vier verglaste Seiten haben sollte. Dieses Möbelstück meiner Träume stellte ich in die Mitte meines Zimmers.
Um mir die Freude nicht zu verderben, ließ meine Mutter mich gewähren, und ich konnte meine Klassiker in ihren schönen Verlagseinbänden betrachten und auch die modernen und die Gegenwartsautoren, für die ich selbst liebevoll Einbände nach meiner Phantasie wählte.
Balzac zeigte sich in rotes Leder gebunden, Sienkiewicz in gelben Saffian, Tolstoi in Pergament, Die Bauern von Reymont waren in den Stoff eines alten bäuerlichen Schultertuchs gekleidet.
Später bekam der Schrank einen Platz an der Wand, die bespannt war mit einer schönen hellen Cretonne, und diese Veränderung minderte in nichts mein Entzücken.
Viel Zeit verging seither …
Das Leben hatte mich für lange Studien- und Arbeitsjahre nach Paris verschlagen.
Jeden freien Augenblick verbrachte ich auf den Quais, vor den alten feuchten Kästen der Bouquinisten. Dort stöberte ich manchmal ein Buch aus dem 18. Jahrhundert auf, das mich damals besonders anzog. Manchmal glaubte ich, ein Dokument, einen seltenen Band, einen alten Brief in Händen zu halten; eine stets neue, wenn auch flüchtige Freude!
Erinnerungen!
Die Rue des Saints-Pères mit ihren staubigen und dunklen Läden, Orte voll angehäufter Schätze, eine Welt herrlichen Stöberns! Zauberhafte Zeiten meiner Jugend!
Und das lange Verweilen an der Ecke Rue des Écoles und Boulevard Saint-Michel, in der großen Buchhandlung, die sich hinaus aufs Trottoir ergoss. Das diagonale Lesen in Bänden mit unaufgeschnittenen Seiten, mitten im Straßenlärm: Gehupe der Autos, Geschwätz und Gelächter von Studenten und jungen Mädchen, Musik, Refrains der gerade beliebten Chansons …
Dieses Getöse lenkte die Leser nicht im geringsten ab, es war Teil unseres Studentenlebens. Wäre diese Bewegung verschwunden und wären diese Stimmen verstummt, man hätte an der Straßenecke ganz einfach nicht weiterlesen können: eine merkwürdige Bedrückung hätte uns alle erfasst …
Doch zum Glück war damals nichts dergleichen zu befürchten. Sicher, der Krieg hatte die allgemeine Fröhlichkeit ein wenig gedämpft, doch Paris lebte sein pulsierendes, sorgloses Leben. Die Jugend im Quartier Latin vibrierte, das Chanson an den Straßenecken erschallte immer noch, und der Bücherliebhaber setzte seine heimliche Lektüre an den Tischen fort, überladen mit Schätzen, welche die Verlage und Buchhändler allen so großzügig zur Verfügung stellten, mit freundlichem Wohlwollen, vollkommener Uneigennützigkeit.
Am Ende des Ersten Weltkriegs kehrte ich zurück in meine Heimatstadt. Nach den ersten Freudenbekundungen darüber, meine Angehörigen heil und unversehrt wiedergefunden zu haben, rannte ich in mein Jungmädchenzimmer.
Wie vom Donner gerührt blieb ich stehen! Die Wände waren kahl: die geblümte Cretonne war geschickt abgelöst und entfernt worden. Nur Zeitungen klebten noch auf dem Gips. Meine schöne Bibliothek mit den vier Glaswänden, ein Wunderwerk meiner jungen Phantasie, war leer und schien sich ihres Ruins zu schämen.
Auch das Klavier war aus dem Salon verschwunden.
Die Besatzer von 1914–1918 hatten alles mitgenommen.
Aber meine Angehörigen waren am Leben und gesund. In ihrer Mitte verbrachte ich glückliche Ferien und fuhr voller Energie und Tatendrang zurück nach Frankreich.
Neben den Vorlesungen an der Sorbonne arbeitete ich eifrig in der Bibliothèque Nationale, ebenso in der Bibliothèque Sainte-Geneviève, meinem Lieblingsort.
Nach meiner Rückkehr aus Polen absolvierte ich nachmittags ein Praktikum bei einem Buchhändler in der Rue Gay-Lussac.
Auf diese Weise lernte ich die Bücher-»Kunden« kennen. Ich versuchte ihre Wünsche zu durchschauen, ihren Geschmack, ihre Vorstellungen und Neigungen zu begreifen, die Gründe ihrer Bewunderung für ein bestimmtes Werk, ihrer Begeisterung, Freude oder Unzufriedenheit zu erraten.
Nach der Art, wie jemand einen Band in Händen hielt, beinah zärtlich, wie er behutsam darin blätterte, die Seiten ehrfürchtig las oder nur hastig, achtlos umschlug und das Buch anschließend wieder auf den Tisch legte, manchmal so nachlässig, dass die Ecken, dieser so empfindliche Teil, umgeknickt waren, gelang es mir mit der Zeit, einen Charakter, eine Seelen- und Geistesverfassung zu durchschauen. Ich legte das Buch, das ich für geeignet hielt, eher unauffällig in die Nähe des Lesers, denn er sollte sich nicht von einer Empfehlung beeinflusst fühlen. Entsprach es seinen Vorstellungen, war ich überglücklich.
Ich begann Sympathie für die Kundschaft zu empfinden. In Gedanken begleitete ich manche Besucher ein Stück ihres Weges und malte mir dabei ihre Beziehung zu dem mitgenommenen Buch aus; dann wartete ich ungeduldig auf ihre Rückkehr, um etwas zu erfahren über ihre Reaktionen.
Doch es geschah auch … dass ich Hass empfand für einen Vandalen. Denn es gab Leute, die ein Buch quälten, es so sehr mit heftiger Kritik, mit Vorwürfen überschütteten, bis sie seinen Inhalt auf perfide Weise entstellten!
Ich muss zu meiner großen Verlegenheit gestehen, dass vor allem Frauen es an Umsicht fehlen ließen.
So hatte ich die notwendige Ergänzung zum Buch gefunden: den Leser.
Im allgemeinen herrschte zwischen dem einen und dem anderen vollkommene Harmonie in dem kleinen Laden der Rue Gay-Lussac.
In jedem freien Augenblick ging ich in die Ausstellungsräume der Verlage, wo ich wieder auf alte Bekannte traf und auf Neuigkeiten, Dinge, die für Überraschung sorgten und für Freude.
Als die Stunde gekommen war, mich für einen Beruf zu entscheiden, zögerte ich nicht: ich folgte meiner Berufung zur Buchhändlerin.
Das war im Dezember 1920 … Ich wollte wie üblich meinen Angehörigen einen kurzen Besuch abstatten. Unterwegs machte ich Station in Posen, in Warschau, dann, nach den Ferien bei meiner Familie, fuhr ich nach Krakau.
In meinem Gepäck hatte ich die ersten beiden Bände der Thibault von Roger Martin du Gard, die Croix de bois von Dorgelès, Civilisation von Duhamel, lauter Bücher, die mir geeignet schienen, Freunde und Buchhändler, die ich zu treffen beabsichtigte, mit meiner Bewunderung für die reiche Blüte der französischen Nachkriegsliteratur anzustecken.
Meine Absicht war es, eine Buchhandlung in Polen zu eröffnen. Ich fuhr also nacheinander in diese Städte. Überall hatten die Buchhändler eine stattliche Auswahl französischer Bücher. Mein Unterfangen erschien mir überflüssig.
Ich beschloss, auf der Rückfahrt kurz in Berlin haltzumachen, Freunde zu sehen und dann den Abendzug zu nehmen, um frühmorgens wieder in Paris zu sein.
Wir flanierten durch die Hauptstraßen Berlins, und ich blieb, wie ich es gerne tat, vor den Schaufenstern der großen Buchhandlungen stehen. Wir waren Unter den Linden hinabgegangen, die Friedrichstraße und die Leipziger Straße, als ich plötzlich rief:
»Aber ihr habt gar keine französischen Bücher!«
»Schon möglich«, lautete die lakonische und gleichgültige Antwort.
Wir machten unseren Spaziergang in umgekehrter Richtung noch einmal, und diesmal betrat ich die Buchhandlungen. Überall versicherte man mir, dass es praktisch keine Nachfrage nach französischen Büchern gebe: »Wir haben nur ein paar Bände Klassiker.«
Von Zeitungen und Zeitschriften keine Spur. Die Verkäufer in den Kiosken antworteten unwirsch auf meine Fragen.
Mit diesem Eindruck fuhr ich zurück nach Paris.
Professor Henri Lichtenberger, dem ich von den Ergebnissen meiner Reise berichtete, sagte einfach nur:
»Nun, warum eröffnen Sie dann nicht eine Buchhandlung in Berlin?«
Ein Verleger rief:
»Berlin? Das ist ein Mittelpunkt! Versuchen Sie doch Ihr Glück!«
Mein guter Professor und Freund P. erklärte:
»Eine Buchhandlung in Berlin … das ist fast eine Mission.«
Ich hatte nicht so hochfliegende Pläne: ich suchte eine Beschäftigung, und Buchhändlerin war die einzige, die für mich zählte. Die Aussicht, in Berlin zu arbeiten, das ich flüchtig im Winternebel gesehen hatte, triste und moros, war jedoch nicht ohne Reiz für mich.
In dieser Stimmung machte ich mich eine Weile später auf in die Hauptstadt Deutschlands.
Mein erster Weg führte mich auf das Französische Generalkonsulat, wo ich meinen Plan mit dem ganzen Schwung meiner Überzeugungskraft darlegte und die moralische Unterstützung, über die ich bereits verfügte, geltend machte.
Der Generalkonsul hob die Arme zum Himmel:
»Aber, Madame, Sie scheinen mir das politische Klima im gegenwärtigen Deutschland nicht zu kennen! Ihnen sind die alltäglichen Realitäten nicht klar! Wenn Sie wüssten, wie schwer es mir schon fällt, ein paar hier lebende Französischlehrer auf ihren Posten zu halten. Unsere Zeitungen werden nur in ganz wenigen Kiosken verkauft. Die Franzosen kommen bis hierher ins Konsulat, um sie zu lesen, und Sie wollen gleich eine ganze Buchhandlung eröffnen! Man wird Ihnen den Laden zertrümmern!«
Später habe ich erfahren, dass in Breslau, nach der Volksabstimmung in Oberschlesien, das Konsulat von einem deutschen Mob verwüstet worden war.
In der Französischen Botschaft konnte ich nur einen jungen Attaché sprechen; er zeigte sich kaum ermutigender. Doch nachdem ich acht Tage lang recherchiert und überlegt hatte, stand mein Entschluss fest: Es gab keine französischen Bücher, Berlin war eine Kapitale, eine Universitätsstadt, man spürte hier bereits den Puls des wiedererwachenden Lebens schlagen. Eine französische Buchhandlung musste, im richtigen Augenblick, Erfolg haben.
Deutschland war mir nicht unbekannt. Als junges Mädchen hatte ich hier meine Deutschkenntnisse verbessert und bei Professor Xaver Scharwenka mein Musikstudium fortgesetzt.
Später war ich ein zweites Mal in Deutschland gewesen und hatte ein Semester lang Vorlesungen an der Frauenuniversität Leipzig gehört.
Die großen Meister des Denkens, der Poesie und der Musik in Deutschland waren mir nicht fremd. Und auf ihrem Einfluss beruhte die ganze Hoffnung auf den Erfolg meiner Buchhandlung in der Hauptstadt.
Natürlich musste ich unzählige Formalitäten in dieser bürokratischen Behördenstadt erledigen. Der erste Berliner Beamte, auf den ich traf, erwies sich als entschiedener Gegner des Verkaufs von ausschließlich französischen Büchern. Wir einigten uns auf die Bezeichnung »Zentrum für fremdsprachige Bücher«. Auch dieser deutsche Gesprächspartner war der Ansicht, dass der Zeitpunkt für die Realisierung meines Plans nicht gerade günstig schien.
Und so nahm trotz aller offiziellen Einwände mein Versuch, eine französische Buchhandlung in Berlin zu gründen, seinen Anfang. Sie hatte ihren Sitz zunächst im Zwischengeschoss eines Privathauses, in einem ruhigen Viertel, abseits vom Stadtzentrum.
Pakete trudelten langsam aus Paris ein, brachten mir die schönen Bände mit den für französische Verlage so typischen bunten Einbänden; die Bücher füllten die Regale, kletterten bis hinauf zur Decke, lagen verstreut auf dem Fußboden.
Kaum hatte ich mich fertig eingerichtet, kam auch schon die Kundschaft. Es handelte sich, offen gesagt, zuerst um Kundinnen, Ausländerinnen zum größten Teil, Polinnen, Russinnen, Tschechinnen, Türkinnen, Norwegerinnen, Schwedinnen und viele Österreicherinnen. Der Besuch eines Franzosen oder einer Französin hingegen war ein Ereignis. Die Kolonie war klein. Viele ihrer Mitglieder hatten die Stadt am Vorabend des Krieges verlassen und waren nicht wiedergekommen.
Die Festtage für diese schönen Kundinnen waren die Tage, an denen Modezeitschriften und -hefte eintrafen, auf die sie sich mit Freudengeschrei stürzten, entzückt vom Anblick der Modelle, die sie so lange hatten entbehren müssen. Schriften über Kunst fanden ebenfalls ihre eifrigen Bewunderinnen.
Die mobile Bibliothek stieß auf großes Interesse. Bald schon mussten sich die Leser in eine Liste eintragen und warten, bis sie an der Reihe waren, denn die Bücher verschwanden im Handumdrehen.
Wegen der rasanten Zunahme meiner Kundschaft erwog ich nach ein paar Monaten eine Vergrößerung, und die Buchhandlung zog ins mondäne Viertel der Hauptstadt.
1921! In dieser brodelnden Zeit wurden die internationalen Beziehungen und auch der intellektuelle Austausch wiederaufgenommen. Allmählich erschien die deutsche Elite, anfangs sehr vorsichtig, an dieser neuen Zufluchtsstätte des französischen Buches. Dann kamen die Deutschen immer zahlreicher: Philologen, Professoren, Studenten und die Vertreter jener Aristokratie, deren Bildung stark beeinflusst war von der französischen Kultur, Menschen, die man damals schon als »die alte Generation« bezeichnete.
Ein seltsam gemischtes Publikum. Bekannte Künstler, Stars, Frauen aus der feinen Gesellschaft beugen sich über die Modezeitschriften, sprechen leise, um den Philosophen nicht zu stören, der in einen Pascal vertieft ist. Neben einem Glasschrank blättert ein Dichter ehrfurchtsvoll in einer schönen Verlaine-Ausgabe, ein Gelehrter mit Brille studiert den Katalog einer wissenschaftlichen Verlagsbuchhandlung, ein Gymnasiallehrer hat vor sich vier Grammatiken gestapelt und vergleicht mit großem Ernst die Kapitel über die Veränderlichkeit des Partizips, wenn diesem ein Infinitiv folgt.
Zu meiner Verwunderung konnte ich nun feststellen, wie sehr die französische Sprache die Deutschen interessierte und welch profunde Kenntnis ihrer Meisterwerke einige von ihnen besaßen. Ein Gymnasiallehrer machte mich eines Tages in einer Montaigne-Ausgabe, die er gerade in der Hand hatte, auf eine Lücke von etwa zehn wichtigen Zeilen aufmerksam. Er hatte recht, die Ausgabe war nicht in extenso. Ein Philologe konnte, auf der Grundlage einiger Zitate eines französischen Dichters, ohne Zögern den Namen des Autors nennen. Ein anderer konnte Maximen von La Rochefoucauld, von Chamfort und Pensées von Pascal auswendig deklamieren.
Dieses Buchhändlerleben brachte mich mit sympathischen Originalen in Kontakt. Ein deutscher Kunde, ein sehr guter Grammatiker, der sich nach einem Einkauf verabschiedete, hörte meine Angestellte sagen: »Au plaisir, Monsieur!« Er machte auf dem Absatz kehrt und bat, man möge ihm diese Redewendung erklären. Er wollte wissen, ob es sich nur um eine kommerzielle Höflichkeitsfloskel handelte, ob man sie auch in Gesellschaft verwenden konnte, bei welcher Gelegenheit etc.
Er schrieb sich den Ausdruck in ein Notizbuch und versäumte es fortan nie, ein »Au plaisir« anzubringen, begleitet von einem komplizenhaften Lächeln.
Als Vorboten der Diplomatie erschienen zuerst die Beamten der Konsulate und Botschaften; sie gehörten bald zur Stammkundschaft. Dann kamen die Attachés und schließlich, als letzte, die Herren Diplomaten und vor allem ihre Frauen.
Was Seine Exzellenz, den Botschafter Frankreichs, betraf, so hatte ich seinen Besuch schon bei der Eröffnung der Buchhandlung in jenem westlichen Bezirk von Berlin erhalten.
Er dankte mir für meine Initiative, suchte sich mehrere Bücher aus und sagte, auf jene der französischen Sprache so eigene Art, die Bestimmtheit und liebenswürdige Höflichkeit zu vereinen weiß, dass Romain Rolland und Victor Margueritte, der eine ein Deserteur der französischen Sache, der andere ein Pornograph, nichts verloren hätten in einer Buchhandlung, die etwas auf sich hielte. Dagegen empfahl Seine Exzellenz mir die Werke von René Bazin, von Barrès und Henri Bordeaux.
Nachdem er gegangen war, fühlte ich mich stolz und traurig zugleich. Trotz all meines guten Willens wusste ich, diesen Ratschlägen würde ich einfach nicht folgen können.
Die Botschafterin eines fremden Landes, so intelligent wie hübsch, hatte eine Leidenschaft fürs Schmökern. Sie verbrachte Stunden mit Herumstöbern und entdeckte immer irgendeinen Band nach ihrem Geschmack. Eines Tages, als sie nicht davor zurückgeschreckt war, sich beim Wühlen in staubigen antiquarischen Büchern, die in einem Raum hinter der Buchhandlung angehäuft waren, ihre schönen, gepflegten Hände schmutzig zu machen, sagte sie hellauf begeistert zu mir:
»Wäre ich keine Diplomatengattin, mein Traum wäre es, Buchhändlerin zu sein.«
Von diesem Tag an war unsere Kameradschaft besiegelt. Ich stellte Nachforschungen für sie an bei Bouquinisten in Paris, sie schickte mir Kunden und benachrichtigte mich, wenn wichtige Franzosen und Stars nach Berlin kommen sollten.
Denn wir organisierten Vorträge und Empfänge für berühmte Autoren auf der Durchreise in Deutschland.
Claude Anet, Henri Barbusse, Julien Benda, Madame Colette, Dekobra, Duhamel, André Gide, Henri Lichtenberger, André Maurois, Philippe Soupault, Roger Martin du Gard kamen zu Besuch in die Buchhandlung.
Manche ergriffen auch das Wort. Bei diesen Causerien ging es um literarische Themen, um künstlerische, um Erinnerungen und Eindrücke; sie zogen Professoren an, Studenten, Franzosen und auch ein mondänes Publikum. Nach den Vorträgen wurden französische Platten gehört: Chansons, Gedichte, Szenen aus Theaterstücken.
Unter Mithilfe von Franzosen guten Willens gaben wir auch »Theateraufführungen«, Akte von Marivaux, von Labiche, auch Dr. Knock von Jules Romains, manchmal sogar Sketche zu aktuellen Themen, von uns selbst geschrieben. Bei manchen Aufführungen hatten wir bis zu fünfhundert Schüler aus deutschen Schulen zu Besuch.
Das unter Franzosen organisierte Fest zum Faschingsdienstag wurde bei der Kundschaft ebenfalls ein großes Ereignis.
In seinem Buch Dix ans après hat Jules Chancel von einem dieser Feste erzählt, von der Stimmung und dem Erfolg.
Ich hatte in meinen Bemühungen als Buchhändlerin aufgeschlossene Hilfe gefunden bei Professor Hesnard, Presseattaché, Autor eines ausgezeichneten Buches über Baudelaire. Er half mir diskret mit seinen Ratschlägen.
Der Kulturattaché, der um 1931 nach Berlin kam, war mir ebenfalls eine unendlich wertvolle Unterstützung, und ich kann gar nicht genug betonen, wie viel ich seiner Gelehrtheit und seiner Hilfsbereitschaft verdanke.
Im September 1931 tauchte Aristide Briand auf, in Begleitung eines Beamten, der ihm als Cicerone diente. Nachdem er mir seine Anerkennung ausgesprochen hatte, fragte er, ob ich mein Geschäft im Geiste der deutsch-französischen Annäherung begründet hätte.
»Ich wünsche mir diese Annäherung sehnlichst, wie auch die aller Völker der Welt«, erwiderte ich, »doch als ich mich in Berlin niederließ, habe ich mich nur auf den Standpunkt des Geistes gestellt. Die Politik führt zu Ungerechtigkeit, Verblendung und Maßlosigkeit. Nach einer heftigen Diskussion zwischen zwei Kunden verschiedener Staatsangehörigkeit habe ich stets darauf geachtet, dass in der Buchhandlung nicht mehr über Politik gesprochen wird«, fügte ich hinzu.
Als Beobachterin der Ereignisse, die sich um mich herum abspielten, hatte ich bei der Ausübung meines Metiers die verschiedensten Feststellungen gemacht, gesehen, wie Konflikte sich anbahnten, und gespürt, wie Bedrohungen heraufzogen. Gewiss, ich hätte gern offen mit diesem großen Staatsmann gesprochen, dessen Bestrebungen Vertrauen verdienten. Doch er war in Begleitung.
Das Misstrauen, das mir die Politik einflößte, gewann die Oberhand. Ich bereue nicht, dass ich Briand keine einzige Frage gestellt und auch nicht über meine Befürchtungen gesprochen habe. Sein Idealismus wurde nur wenig später hoffnungslos enttäuscht!
Ich hatte die Büchse der Pandora nicht geöffnet, in der ganz tief unten in zehntausendjährigem Schlaf die Hoffnung ruht auf eine mögliche Verständigung zwischen den Völkern.
Briands Besuch verlieh meiner Buchhandlung neues Ansehen und brachte ihr noch mehr Kundschaft. So erlebte ich Jahre voller Sympathie, Frieden und Wohlstand.
Ab 1935 begannen die ernsthaften Schwierigkeiten.
Zunächst die Devisenfrage.
Um meine Bestellungen französischer Bücher zu bezahlen, brauchte ich jedes Mal eine neue Clearing-Genehmigung. Ich musste Beweise liefern für die Notwendigkeit der Einfuhren. Ich besorgte mir also die verschiedenartigsten Empfehlungen. Schulen gaben mir Bestellscheine, Gymnasiallehrer ebenso. Die Universitäten nahmen den offiziellen Weg.
Einzelkunden füllten Blätter aus, die ich anschließend der Sonderdienststelle zur Beurteilung einzuführender Bücher vorlegte. Um die Bestände zu ergänzen, nahm ich die Unterstützung der Französischen Botschaft in Anspruch. Die Arbeit wurde mühsam.
Manchmal erschien die Polizei. Unter dem Vorwand, dass ein Autor auf dem Index stand, kontrollierten die Inspektoren alles, beschlagnahmten einzelne Bände. So nahmen sie etwa die Bücher von Barbusse mit, später die von André Gide und schließlich eine große Anzahl anderer Bände, unter ihnen das Werk von Romain Rolland (der schon vom französischen Botschafter auf den Index gesetzt worden war).
Um diese Lücken in meinen Regalen zu füllen, und durch eine Ironie der Umstände, kam ausgerechnet in dieser Zeit ein Franzose, Berlin-Korrespondent einer südfranzösischen Zeitung, in die Buchhandlung und brachte mir sein Werk mit dem Titel: En face de Hitler. Es war … Ferdonnet, der traurige Berühmtheit erlangen sollte als Sprecher bei Radio Stuttgart. Er bat mich in selbstgefälligem Ton, ein Exemplar seines Werkes ins Schaufenster zu legen. Ich antwortete ihm, gemäß den Weisungen der Verleger würde ich keine politischen Bücher ausstellen. Er erwiderte:
»Sie wissen wohl, dass es mir ein leichtes wäre zu insistieren …«
Dann im Befehlston:
»Ich zähle jedenfalls auf Sie, was den Verkauf angeht!«
Polizisten erschienen regelmäßig und beschlagnahmten verschiedene französische Zeitungen, die auf ihrer Liste standen. In der Folge fanden sich meine Kunden pünktlich bei Ladenöffnung ein, um dem Besuch der Inspektoren zuvorzukommen. Freilich wurde die Anzahl der erlaubten französischen Blätter immer kleiner.
Einige Wochen lang war nur Le Temps zugelassen. Ich beeilte mich sogleich, eine ausreichende Anzahl zu bestellen; die Kundschaft lechzte nach Nachrichten aus dem Ausland. Acht Tage lang konnten die Leser darüber verfügen. Doch eines schönen Morgens teilte mir ein Inspektor mit, dass Le Temps nun ebenfalls auf der schwarzen Liste stehe. Er nahm den gesamten Bestand mit, zur großen Enttäuschung meiner Kunden.
Zeitungen verstecken? sie beiseitelegen? »Verbreitung verbotener Blätter«, das hätte mich ins Konzentrationslager gebracht.
Von nun an gelangten keine französischen Tageszeitungen mehr nach Deutschland. Sie verschwanden endgültig.
Alle diese Einschränkungen galten ohne Ausnahme.
Doch mit Verkündung der Nürnberger Rassengesetze (beim Parteikongress, im September 1935) wurde auch meine persönliche Lage sehr heikel.
Die Nazi-Partei wusste, dass meine Buchhandlung gewissermaßen unter dem Schutz der französischen Verlage stand. Die deutschen Behörden, getreu ihrer Politik, die öffentliche Meinung einzulullen, zögerten, einen Skandal zu provozieren. Einerseits duldeten sie meine Tätigkeit im Dienste des französischen Buches; andererseits warfen sie mir meine Herkunft vor.
In meiner Post fanden sich Vorladungen, Aufforderungen, Anordnungen, diesem oder jenem Treffen beizuwohnen, an dieser oder jener Veranstaltung oder Versammlung teilzunehmen. Die Buchhändlervereinigungen befahlen mir, meine Lagerbestände zu kontrollieren und der Sonderprüfstelle all jene Bücher auszuhändigen, die dem Geist des Regimes widersprächen. Allen diesen Formularen waren Fragebögen beigefügt, meine Rassenzugehörigkeit betreffend und die meiner Großeltern und Urgroßeltern mütterlicherseits und väterlicherseits.
Mein Sekretär zeigte mir diese deprimierenden Papiere nach einer Weile nicht mehr; er stieg auf sein Motorrad, fuhr von einer Behörde zur nächsten und erteilte ihnen die verlangten Auskünfte. Er betonte meinen Status als Ausländerin, um die Schwierigkeiten vorläufig aus dem Weg zu räumen und mir so die Zeit zu geben, die ich brauchte, um die Auflösung meines Geschäfts vorzubereiten.
Immer öfter kam es zu Zwischenfällen. Ich erinnere mich an eine Brüskierung, die ich ein paar Tage vor Weihnachten hinnehmen musste. Viele Pakete mit Geschenkbüchern waren von zwei Postboten gebracht worden. Die Tische waren beladen mit schönen Ausgaben für Erwachsene, bunten Bilderbüchern für Kinder. Zeitschriften, zusammengestellt mit jenem vollkommenen Geschmack, den man nur in Frankreich und nirgendwo sonst auf der Welt findet, wurden gerade unter den bewundernden Ausrufen der Kundschaft ausgepackt.
Es herrschte das für die Jahreszeit so typische Fieber!
Plötzlich flog die Ladentür krachend auf und die Nazi-Blockwartin unseres Hauses stürmte herein. Eine Frau mit Gorgonenhaupt, in jeder Hand hielt sie zwei leere Konservenbüchsen.
»Verstehen Sie Deutsch?«, schrie sie.
»Ja, sicher«, sagte ich eher verwundert.
»Gehören Ihnen diese vier Metallbüchsen?«
»Das weiß ich nicht, ich werde meine Putzfrau fragen; warum denn?«