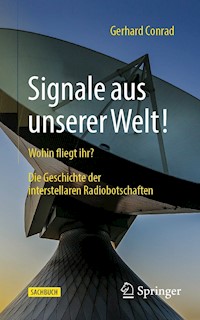20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mann, der mit Hamas und Hisbollah verhandelt hat Der Nahost-Konflikt hat erneut tiefe Gräben aufgerissen und drängende Fragen aufgeworfen. Wie konnte passieren, was am 7. Oktober in Israel geschah? Haben die Geheimdienste die nahende Katastrophe nicht erkennen können, auf welchen Ebenen sind sie oder auch Entscheidungsträger gescheitert? Wie kommt es, dass Nachrichtendienste in einer ihrer Kernaufgaben, der strategischen Warnung, immer wieder scheitern? Es ist schwieriger denn je, in Zeiten von Fake News und hybrider Kriegsführung belastbare Informationen zu beschaffen, sie zu einem Lagebild für Entscheidungsträger zu integrieren, dieses zu beurteilen und verwertbare Hinweise zur weiteren Entwicklung zu geben. Das weiß kaum jemand besser als Gerhard Conrad. Der Islamwissenschaftler, der auch Chef des Leitungsstabes des BND sowie bis zu seiner Pensionierung Leiter des Intelligence Analysis Center (EU INTCEN) in Brüssel war, hat in diesen Funktionen vielfältige Einblicke gewonnen. Und er hat zuvor auch, unter anderem im persönlichen Auftrag von zwei UN-Generalsekretären, in humanitären Angelegenheiten diskret »face to face« zwischen Hamas, Hisbollah, Israel, Ägypten, Katar, Türkei und dem Iran vermittelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nichtwissen ist tödlich
GERHARD CONRAD studierte Völkerrecht sowie Politologie und promovierte in Islamwissenschaften, bevor er seinen Dienst im militärischen Nachrichtenwesen der Bundeswehr und später beim BND begann. Seit 1990 Analyst, später Agent mit dem Schwerpunkt Nahost, von 2009 bis 2012 Leiter des präsidialen Leitungsstabes, danach Vertreter des Dienstes in London und von 2016 bis 2019 Direktor im Europäischen Auswärtigen Dienst (EU-INTCEN) in Brüssel.
Der 7. Oktober 2023 wird für immer in die Geschichte des Nahen Ostens eingeschrieben sein: Mit einem beispiellosen Angriff überraschte die Hamas Israel, tötete binnen 48 Stunden weit über tausend Menschen und verschleppte Hunderte Geiseln nach Gaza. Haben die Geheimdienste die nahende Katastrophe nicht erkennen können, auf welchen Ebenen haben sie oder die politischen Entscheidungsträger versagt?In Zeiten von Fake News und hybrider Kriegsführung ist es schwieriger denn je, belastbare Informationen zu beschaffen und die Entscheidungsträger gut zu briefen, damit sie angemessen reagieren können.Das weiß kaum jemand besser als der Geheimdienstexperte Dr. Gerhard Conrad. Der Islamwissenschaftler, der auch Chef des Leitungsstabes des BND sowie Leiter des Intelligence Analysis Center (EU INTCEN) in Brüssel war, hat in humanitären Angelegenheiten diskret »face to face« zwischen Hamas, Hizballah, Israel, Ägypten, Qatar, Türkei und Iran vermittelt.In diesem Buch zeichnet er minutiös nach, durch welche Methoden Geheimdienste versuchen, ein Bild der Lage zu gewinnen, welche Informationen sie Militär und Politik zur Verfügung stellen – und welche Entscheidungen daraus abgeleitet werden können.Conrad zeigt, wie dringend notwendig Informationsbeschaffung durch Nachrichtendienste in diesen Zeiten ist. Nichtwissen kann tödliche Folgen haben.
Gerhard Conrad
Nichtwissen ist tödlich
Der Nahe Osten und die Rolle der Geheimdienste
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Econ ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbHISBN: 978-3-430-21126-0© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Alle Rechte vorbehalten, insbesondere und ausdrücklich die Nutzungunserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG.Lektorat: Ulrich WankAutorenfoto: © privatE-Book-Konvertierung powered by Pepyrus
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Einleitung
1. Aus dem Nichts?
2. Faktor Mensch
3.
Intelligence failure
auf allen Ebenen?
4. Jihad-Ideologie – ein strategisches Risiko?
5. Hamas – ein unverstandenes Risiko
6. Menschliche Schilde – Mission impossible
7. Geisellagen: ein operativer Albtraum
8.
Information Warfare,
Lawfare
und
Psywar
9. »Das Kalifat ist die Lösung«
10. Iran und die »Achse des Widerstands«
11. Nahost: Wo steht die Region?
12. Sicherheitspolitische Zeitenwende
13.
Intelligence matters
Widmung und Dank
Lesehinweise
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Einleitung
Widmung
»Where we failed, we will need to investigate and improve; where we made mistakes, we will learn and change; where fractures were opened, however big they are, we will insist on fixing and repent. The Israeli people have no other country, the State of Israel doesn’t have another IDF, and the IDF doesn’t have another Intelligence Directorate.«
(Generalmajor Shlomi Binder bei Dienstantritt als Leiter des Militärischen Geheimdienstes am 22.08.24)
Einleitung
Déjà-vu: Ein langer Leidensweg beginnt
Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang freundlich. »Lieber Herr Conrad, sollten wir nicht einmal über Gaza reden?« Ich hatte so einen Anruf schon erwartet. Während meiner aktiven Zeit beim Bundesnachrichtendienst oder zuletzt in der Europäischen Union wäre er wahrscheinlich »von ganz oben« gekommen, doch jetzt war es ein guter Bekannter und mittlerweile recht prominenter Exponent der deutschen Medienlandschaft. »Ja«, sagte ich. »Ich glaube schon. Da gibt es einiges, worüber wir sprechen könnten.« Im Laufe des Tages hatte ich die Nachrichten erst mit wachsender Beunruhigung, dann mit Bestürzung, schließlich mit völliger Fassungslosigkeit zur Kenntnis genommen. In Berlin war ein ruhiger Herbsttag angebrochen, in dessen Verlauf sich in Israel eine Katastrophe den Weg bahnte, die die Welt erschüttern sollte. Wir vereinbarten uns auf den nächsten Tag, um wenigstens die Chance für ein erstes Verständnis der unglaublichen Ereignisse zu gewinnen. Die volle Dimension der Geschehnisse vom 7. Oktober 2023 habe ich aber erst in den darauffolgenden Tagen erfasst. Auch Regierungen, Streitkräfte und Geheimdienste bemühten sich um ein Lagebild. Alle wollten an diesem und den darauffolgenden Tagen wissen, was sich da ereignete, – zum Teil sind sie bis heute damit beschäftigt. Die Nachrichtenlage der ersten Stunden war dünn und unübersichtlich. Bruchstückhaft tauchten in den Medien Bilder zerstörter israelischer Panzer und Befestigungsanlagen an der Grenze zu Gaza auf. Aus dem Gazastreifen wurden offenbar Tausende Raketen auf Ziele in Israel abgeschossen.
Die Bilder der ausgebrannten und zerstörten Sperranlagen entlang des Gazastreifens weckten bei mir lebhafte Erinnerungen. Im Sommer 2009 waren dort Maschinengewehre auf unser Fahrzeug gerichtet, als ich das streng bewachte und hochgerüstete Bollwerk am Kontrollpunkt Eretz passierte. Ich hatte damals das Gefühl, in einen Käfig hineinzufahren. Als Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes war ich seinerzeit freigestellt worden, um mich im Auftrag der israelischen Regierung in Gaza mit den Vertretern der Hamas zu treffen und als von beiden Seiten mandatierter Vermittler über die Freilassung des von der Terrororganisation im Juni 2006 entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit zu verhandeln. Die Bundesregierung kam damit einer Bitte Israels nach, und da ich in den Jahren zuvor an zwei erfolgreichen Verhandlungen mit der libanesischen Hizballah über den Austausch von libanesischen Häftlingen gegen israelische Gefallene, Vermisste und Geiseln entscheidend mitgewirkt hatte, galt ich als »Experte«. Man hatte mir in den Medien seinerzeit sogar den Spitznamen »Mister Hizballah« verliehen. Bis Shalit im Oktober 2011 endlich wieder in Freiheit war, vergingen noch einmal über zwei Jahre, in denen ich zwischen Berlin, Tel Aviv und Gaza pendelte.
Die Kulisse, die mir in den Fernsehbildern am 7. Oktober wieder begegnete, war mir seitdem recht vertraut, doch nunmehr bestürzend verändert. Über den Ruinen der Befestigungsanlagen, verdüsterte schwarzer Rauch von einem brennenden Fahrzeug den Himmel. Obwohl die Bilder dramatisch waren, boten sie doch wenig konkrete Information über das Gesamtgeschehen. Nur so viel zeichnete sich ab: Etwas Grauenhaftes spielte sich in Israel ab – noch war es diffus, aber die präzedenzlose Dimension war bereits erkennbar. Die Hamas verbreitete Videoclips und verlautbarte, dass sie einen Großangriff unter der Bezeichnung »al-Aqsa-Flut« begonnen habe. Es sollte eine »Flutwelle« an Terroristen sein, die massenhaft Rache für die »Entweihung der heiligen Al-Aqsa-Moschee« in Jerusalem durch die »Ungläubigen« und deren »Verbrechen am palästinensischen Volk« nehmen sollten. In den nächsten Stunden wuchs das Entsetzen. Die Terrororganisation stellte mehr und mehr Zeugnisse ins World Wide Web, auf denen zu sehen war, wie vermummte Kämpfer israelische Soldaten und Zivilisten töteten, schwer misshandelten oder als Geiseln nach Gaza verschleppten. Die israelische Armee schien offenbar weitgehend hilflos. Ich fragte mich, warum offenbar keine Kampfhubschrauber oder Kampfflugzeuge, die nur wenige Flugminuten von Gaza entfernt stationiert sein mussten, oder Bodentruppen in die Kämpfe eingriffen. Theoretisch hätte es für sie ein Leichtes gewesen sein müssen, mit geballter Feuerkraft das Vordringen der Hamas-Terroristen zu verlangsamen oder sogar zu unterbinden. Aus dem, was ich aus nationalen und internationalen Nachrichten erfahren konnte, ergab sich dann allmählich das Bild einer außergewöhnlich gut vorbereiteten, breit angelegten, komplexen Operation der Hamas über die gesamte Länge der Sperranlagen zu Gaza. Der Angriff war wie aus einem taktischen Lehrbuch für das Gefecht mit verbundenen Waffen abgelaufen: Man hält den Gegner durch massives Raketenfeuer nieder, damit er sich in seinen Befestigungen und Schutzräumen in Sicherheit bringt. Dadurch ist sowohl seine Aufmerksamkeit, ebenso wie seine Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt. In diesem Moment lassen sich die – ganz offenbar vorab erkundeten – Schwachstellen der Befestigungsanlage durchbrechen. Das war der Hamas gelungen. Darauf folgte ein interessanter taktischer Schachzug. Einmal auf israelisches Gebiet gelangt, verteilten sich die Kommandos nach einem offenbar vorab ausgearbeiteten Operationsplan in verschiedene Richtungen und stießen bis zu zehn Kilometer weit ins Landesinnere vor, um zahlreiche – überwiegend »weiche«, also nicht militärische – Ziele anzugreifen: kleinere Siedlungen, Kibbuzim und ein Rave-Event (das Supernova-Konzert). Aber auch der befestigte Ort Sderot wurde Ziel einer blutigen Attacke, in deren Verlauf die örtliche Polizeistation gestürmt und insgesamt über 30 Menschen umgebracht wurden. Binnen kurzer Zeit war klar, dass es das Operationsziel war, eine möglichst große Zahl an Geiseln zu nehmen und – sprichwörtlich wahllos – ein Maximum an Menschen zu töten. Dass bei der Operation auch viele Hamas-Kämpfer ums Leben kommen würden, nahm die Terrororganisation in Kauf, dank ihres ausgeprägten Märtyrerkultes war das möglich. Am Ende des Tages hatte die Hamas einen präzedenzlosen militärischen Erfolg errungen, die israelischen Streit- und Sicherheitskräfte zutiefst gedemütigt und das Sicherheitsgefühl der Menschen in Israel grundlegend erschüttert.
An den Folgetagen trat das ganze Grauen der Ereignisse zutage. In den Medien verfolgte ich, was über die Zahlen der getöteten und entführten Israelis bekannt wurde. Die Hamas hatte mehr als 240 Menschen – Männer, Frauen, Kinder, Greise, Soldatinnen und Soldaten – nach Gaza verschleppt und etwa 1.200 Menschen zum Teil auf bestialische Weise ermordet. Zuerst hatte ich in der Operation eine – wenn auch in Umfang und militärischer Durchsetzungskraft präzedenzlose – Entführungsaktion gesehen. Erst langsam sollte ich begreifen, dass wir es mit einem groß angelegten Terrorangriff zu tun hatten, dessen Ziel es gewesen war, systematisch ein Höchstmaß an Tod und Verwüstung in Israel anzurichten und dies aller Welt vor Augen zu führen. Im Hinblick auf die Geiselnahmen erlebte ich ein veritables Déjà-vu, da mir die Härte, Komplexität und Dauer der damit verbundenen Verhandlungen aus meinen zahlreichen Treffen mit der Hamas nur allzu präsent waren. Ich habe diesen langwierigen, nervenaufreibenden und häufig schmerzlichen Prozess meiner Bemühungen als Vermittler in meinem Buch »Keine Lizenz zum Töten« (Econ 2022) bereits beschrieben, nachdem ich genug Abstand und Zeit gewonnen hatte, um meine Erfahrungen – im Rahmen des Zuträglichen – aus dieser Epoche zusammenzufassen. In den Tagen nach dem 7. Oktober hatte ich dann das Gefühl, dass mich die Vergangenheit einholte. Manchmal gab es dafür konkrete Gründe: Der aktuelle Führer der Hamas in Gaza, Yahya Sinwar – Mastermind des Angriffs vom 7. Oktober – war im Oktober 2011 zusammen mit weiteren 1.026 Häftlingen in dem auch mit meiner Hilfe vermittelten Austausch gegen Gilad Shalit freigekommen. Ich bin dem Mann nie persönlich begegnet, er war in einem israelischen Gefängnis in Beerscheba inhaftiert, doch er war mir insofern ein Begriff, als dass er Anführer des »Komitees der palästinensischen Häftlinge« war und in dieser Funktion die Verhandlungen immer wieder ins Stocken brachte. Sinwar hatte öffentlich darauf hingearbeitet, dass auch Häftlinge freigelassen werden sollten, die von der israelischen Regierung eigentlich kategorisch von einem Austausch ausgeschlossen worden waren. Viele von ihnen hatten schwerste Straftaten begangen und zahlreiche israelische Staatsbürger ermordet. Sinwar selbst war bereits 1988 zu vier lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden und galt schon damals als Todfeind Israels. Nach seiner Freilassung tauchte er in seinem heimatlichen Milieu in Gaza unter, um dort als Sicherheitschef von Hamas seine Karriere fortzusetzen, bevor er im Februar 2017 die Führung von Hamas als Nachfolger von Ismail Haniyeh antreten konnte. Nun war er als Urheber eines noch nie dagewesenen Terrorangriffs zu weltweiter Prominenz aufgestiegen. Hätte das irgendjemand voraussehen können?
Ebenso stand die Frage im Raum, wie sich Israel angesichts dieser präzedenzlosen Herausforderungen verhalten und welche Folgen die Tragödie für den gesamten Nahen Osten, und somit letztendlich auch für Europa und Deutschland, haben würde? Wie erwartet und angekündigt fiel die israelische Reaktion massiv aus. Seit dem späteren Vormittag des 7. Oktober flogen die israelischen Luftstreitkräfte kontinuierliche Angriffe auf Ziele im Gazastreifen, am 8. Oktober wurde der Kriegszustand ausgerufen, umfangreiche Reserven mobilisiert und Landstreitkräfte im Grenzraum zusammengezogen. Am 9. Oktober wurde der Gazastreifen von der israelischen Armee abgeriegelt, die Strom-, Wasser- und Lebensmittelversorgung unterbrochen. Die USA verlegten den Flugzeugträger Gerald R. Ford ins östliche Mittelmeer. Eine deutliche Warnung an die libanesische Hizballah und den Iran, von einem Angriff auf Israel abzusehen. Die Sorge vor einem hochdynamischen, nicht mehr einzuhegenden Flächenbrand in Nahost war von Anfang an sehr groß. In der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober rückte das israelische Militär in den Gazastreifen ein, um Geiseln zu befreien, Infrastruktur der Hamas zu zerstören und ihre Mitglieder zur Rechenschaft zu ziehen. Das öffentlich erklärte Kriegsziel war die Vernichtung der Terrororganisation. Die mit einem solchen Auftrag verbundene Herausforderung für die Streitkräfte ist allerdings gigantisch. Der gesamte Gazastreifen – etwa vierzig Kilometer lang und zehn bis fünfzehn Kilometer tief – ist mit mehr als zwei Millionen dort lebender Menschen außerordentlich dicht besiedelt. Zu allem Übel hat die Hamas Gaza in den vergangenen beiden Jahrzehnten extensiv untertunnelt. In dieses Netz aus Tunneln und Kavernen hatten sich die Terroristen mit ihren Geiseln zurückgezogen. Hier waren zuvor wohl auch die Vorbereitungen für den Angriff des 7. Oktober getroffen worden. In diesem Zusammenhang sollten wir uns vergegenwärtigen, dass Gaza von israelischer Seite intensiv überwacht wird. Die Überwachung ist annähernd flächendeckend: Telefongespräche werden abgehört, E-Mails gelesen, Drohnen kreisen über Gaza, und aus dem Weltraum sind Sensoren modernster Aufklärungssatelliten auf das Gebiet gerichtet. Doch auch Spitzentechnik vermag nur sehr unzureichend, in die Tunnelsysteme der Hamas hineinzuschauen – oder zu hören. Das könnten nur menschliche Quellen. Doch die muss man – in einem zutiefst feindseligen Umfeld – erst einmal finden, werben, führen und beschützen. Eine sehr riskante Aufgabe für jeden Nachrichtendienst. Schon während der Gefangenschaft Shalits hatten Armee und Geheimdienste mehrfach erwogen, die Geisel mit einem Kommandounternehmen zu befreien. Keines der Projekte konnte umgesetzt werden, offenbar aufgrund eines krassen Missverhältnisses zwischen Informationsarmut und Risiko. Seit 2011 hatte die Hamas das Tunnelsystem in strategischer Vorbereitung auf eine mögliche israelische Bodenoffensive unter dem gesamten Gazastreifen zu einer Art »Alpenfestung« ausgebaut. Ähnlich wie die Hizballah, bemühte sich die Hamas um Abschreckung durch maximale Resilienz, die allerdings zulasten der ungeschützten Zivilbevölkerung geht. Das ist im Kalkül der Hamas vorgesehen: Nur durch dramatische Opfer kann der internationale Druck auf Israel im information warfare optimal gesteigert werden. Vor diesem Hintergrund bemühten sich die USA, Ägypten und Qatar bereits seit Oktober 2023 um indirekte Verhandlungswege für einen Austausch der Geiseln. Worauf würde man sich angesichts der hohen Zahl an Geiseln nun einrichten müssen? Allein um Shalit wurde ja mehr als fünf Jahre lang in verschiedenen Formaten verhandelt.
Der Nahe Osten mitsamt seinen Irrungen und Wirrungen, seinen kulturellen und zivilisatorischen Besonderheiten und historischen Bedingtheiten, ist mir seit den späten Siebzigerjahren zunehmend vertraut geworden. Als Student der Orientalistik hatte ich einige Einblicke in Tradition, Anspruch und Realitäten nehmen können. Bereits seit 1979 befasste ich mich mit den damaligen Erscheinungsformen des Islamismus, auch einmal auf der Grundlage einschlägiger Originalquellen mit den Positionen des klassischen islamischen Rechts, der Shari’a, zum Umgang mit Nichtmuslimen in Krieg und Frieden. Als Reserveoffizier und Lagestabsoffizier im Bundesministerium der Verteidigung konnte ich in den Achtziger- und Neunzigerjahren die Entwicklungen immer wieder in zahlreichen Wehrübungen, 1989 auch an der Botschaft Damaskus, unter militär- und sicherheitspolitischen Aspekten verfolgen. Seit 1990 nahm mich die Region dann über knapp 30 Dienstjahre hinweg beim BND sowohl in der Lageanalyse als auch vor Ort in Anspruch. Von 1998 bis 2002 war ich Resident des BND in Damaskus und Beirut. Zwischen 2002 und 2011 in verschiedenen Formaten diskreter Vermittler zwischen Hizballah, Hamas und Israel in humanitären Angelegenheiten. Auch in meiner letzten aktiven Position als Direktor des EU-Intelligence Analysis Center (EU-INTCEN), einem Analyseverbund der europäischen Nachrichtendienste, hatte ich von 2016 bis 2019 mit der aktuellen Lage in der Region und der damals besonders akuten Bedrohung Europas durch den islamistischen Extremismus und Terrorismus zu tun. Kein Wunder also, dass mich die Ereignisse nach dem 7. Oktober 2023 erneut in ihren Bann zogen. Die Zahl der Medienanfragen, die mich erreichten, wuchs mit dem Fortgang des Geschehens in Nahost. Auch ohne aktuelles nachrichtendienstliches »Herrschaftswissen« bot sich mir eine Chance, nicht zuletzt ausgestattet mit dem über Jahre der akademischen Forschung und Lehrtätigkeit hinweg erworbenen Rüstzeug von Islamwissenschaft und Intelligence Studies, in der Öffentlichkeit immer wieder einmal den gröbsten Missverständnissen und Fehlperzeptionen entgegenzutreten, zu einem besseren sachlichen Verständnis des Geschehens und seiner Hintergründe beizutragen und auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Information und Desinformation hinzuweisen. Dies erscheint mir umso wichtiger, als die Eskalation der Gewalt eine mörderische Dynamik entwickelt, die sich in ihrer polarisierenden und destabilisierenden Wirkung auch in den westlichen Gesellschaften zunehmend stärker manifestiert. Die Sentenz des großen griechischen Tragöden Aischylos (starb 456 v. u. Z.), dass das erste Opfer im Krieg stets die Wahrheit sei, hat im Informations- und Desinformationszeitalter noch einmal in dramatischer Weise an Bedeutung gewonnen. Wer den öffentlichen Informationsraum manipuliert, gar beherrscht, beeinflusst Perzeptionen und Entscheidungsprozesse. Information warfare kann über Verlauf und Ausgang kinetischer Kriege entscheiden. Das zeigen die Konflikte um die Ukraine und Israel. Darum ist es essenziell, auch diese Dimension des Krieges zu verstehen und sich im eigenen Urteil nicht zum Spielball von Interessen degradieren zu lassen.
Bereits am 9. Oktober 2023 begann die libanesische Hizballah damit, den Norden Israels mit Raketen und Drohnen anzugreifen, allerdings in einem zunächst eher moderaten Umfang. Israel reagierte jedoch angesichts der schrecklichen Erfahrungen mit Gaza kurzfristig erst einmal mit der Evakuierung von über 60.000 Menschen aus den Dörfern in der unmittelbaren Gefahrenzone, um auf jeden Fall weitere zivile Opfer und die damit einhergehende Eskalationsdynamik zu vermeiden. Dies umso mehr, als es auch für die Nordgrenze strategische Gefahrenhinweise gab, dass Elitetruppen der Hizballah, die sogenannten Radwan-Forces, ähnliche Eventualfallplanungen für einen massiven Grenzdurchbruch wie aus dem Gazastreifen heraus mit verheerenden Konsequenzen für die Menschen dort angestellt hatten. Entsprechende operativ nutzbare Tunnelanlagen hat die IDF in verdeckten Einsätzen bereits während der Sommermonate und mehr noch nach ihrem Eindringen in den Südlibanon entdeckt. Hinweise auf eine imminente Gefahr schien es zwar nicht gegeben zu haben, aber wer hätte nach Gaza noch auf die eigene Lagefeststellung und Lagebeurteilung bauen wollen?
Die Hizballah jedoch verfuhr im Südlibanon bemerkenswerterweise in ähnlicher, spiegelbildlicher Weise, wohl im Hinblick auf eine mögliche israelische Großoffensive der Landstreitkräfte, die man in Beirut in den ersten Tagen wohl nicht ausschließen wollte. Dessen ungeachtet wollte man aber als Teil der von Iran gegen Israel und die USA geführten »Achse des Widerstands« so etwas wie eine »zweite Front« errichten, um die Hamas durch die Bindung israelischer Kräfte im Norden zumindest indirekt militärisch zu unterstützen. Der kontinuierliche Aufbau militärischer Potenziale der Hizballah durch den Iran wird seit Jahren von Israel aufmerksam verfolgt. Mit verdeckten Operationen oder unkommentierten Luftschlägen versucht die israelische Regierung, die rückwärtigen, in den Iran führenden Verbindungslinien der Hizballah in Syrien und dem Irak zu unterbrechen und so den Nachschub von Flugkörpern, Waffen und Munition zu reduzieren. Dazu ist zeitgerechte nachrichtendienstliche und exakte militärisch-taktische Aufklärung entscheidend. Diese Form der Auseinandersetzung nahm angesichts der wachsenden militärischen Bedrohung nach dem 7. Oktober 2023 deutlich an Fahrt und Intensität auf. Nachdem Israel am 1. April 2024 mehrere hochrangige Kommandeure der iranischen Revolutionsgarde (Pasdaran) durch einen gezielten Luftschlag in Damaskus getötet hatte, sah sich Teheran zu einer direkten Vergeltung herausgefordert. Am 13. April 2024 griff der Iran mit Hunderten von ballistischen und Lenkflugkörpern, darunter offenbar auch solche aus russischer und nordkoreanischer Produktion, Ziele in ganz Israel an. Nur durch eine international koordinierte – maßgeblich von den USA unterstützte – hochklassige Luftverteidigung konnten weitreichende Schäden vermieden werden, die unvermeidlich einen schweren israelischen Gegenschlag mit unabsehbaren Folgen nach sich gezogen hätte. Das war nur möglich, weil es im Vorfeld des Angriffs eine internationale Kooperation bei der nachrichtendienstlichen und technischen Aufklärung (JISR – Joint Intelligence Surveillance and Reconnaissance) durch israelische, amerikanische, britische und andere Kräfte gegeben hatte. Doch auch wenn kein allzu großer Schaden entstanden war, handelte es sich bei der Attacke doch um einen beispiellosen Präzedenzfall. Bislang hatte man sich nämlich in der Auseinandersetzung auf verbale Attacken, Terroranschläge, Entführungen und Ähnliches beschränkt. Eine direkte militärische Konfrontation war stets vermieden worden. Das hat sich mit dem massiven Luftangriff vom April 2024 geändert. Ein unkontrollierte Eskalation ist hier wahrscheinlich nur deshalb ausgeblieben, weil Israel die Attacke weitgehend unbeschadet überstanden hat und im Vorfeld offenbar allseitige indirekte »präventive Diplomatie« seitens der USA betrieben worden war. Dies sollte sich im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung dramatisch ändern. Seit dem Sommer hatte sich jedoch der Schlagabtausch zwischen Hizballah und Israel zunehmend verschärft. Tägliche Raketensalven von 40 bis 60 Projektilen auf den Norden Israels waren keine Seltenheit mehr; umgekehrt schlug die israelische Luftwaffe zunehmend massiv und gezielt gegen erkannte Depots und Abschussrampen bis weit in den Norden der Bekaa-Ebene und nach Syrien hinein ebenso zurück wie gegen einzelne relevante militärische Kommandeure der Hizballah. Der innenpolitische Druck auf die Regierung Netanyahu, die Sicherheit im Norden des Landes wieder herzustellen, nötigenfalls mit einer umfassenden militärischen Aktion, wuchs kontinuierlich, zumal sich auf diplomatischem Weg über eine US-amerikanische Vermittlung keine konkreten Ergebnisse hatten erzielen lassen. Im Herbst 2024 überstürzten sich die Ereignisse: Am 16. und 17. September wurden mit einer beispiellosen, über Jahre konspirativ vorbereiteten Sabotageaktion über 3.000 elektronische Pager und mehrere Hundert Walkie-Talkies in den Händen von Partei-Kadern offenbar durch zentral gesteuerte Funksignale zur Explosion gebracht und nahezu ebenso viele Hizballah-Funktionäre verletzt oder getötet. Am 20. September folgte ein von den israelischen Luftstreitkräften geflogener »Enthauptungsschlag« gegen die gesamte Führung der im Grenzraum zu Israel eingesetzten Elitetruppe der Radwan-Forces bei ihrer Krisensitzung in Beirut, um am 27. September mit einem massiven Luftangriff auf die in 50 Metern Tiefe unter dem Beiruter Stadtteil Dahieh gelegenen Führungsbunker fortgesetzt zu werden. Generalsekretär Hasan Nasrallah und zahlreiche der nach den Verlusten der vergangenen Wochen noch verbliebenen Führungspersönlichkeiten kamen hierbei ums Leben. Der Konflikt ist mit dem massiven, wenngleich militärisch erneut weitgehend folgenlosen iranischen Raketenangriff auf Israel am 1. Oktober und dem am selben Tag auf breiter Front begonnenen Einsatz israelischer Bodentruppen in Südlibanon in eine neue Phase getreten. Mit weiteren Luftschlägen gegen Ziele in Libanon und Syrien setzt Israel seine Kampagne zur Zerstörung militärischer und logistischer Potentiale von Hizballah und der iranischen Pasdaran fort; eine mögliche Abfolge von Vergeltungsschlägen zwischen Israel und Iran wird das Risiko einer unkontrollierten militärischen Eskalation an allen Fronten erhöhen. Grundlegende Entscheidungen aller Beteiligten über Art, Umfang und Zielrichtung ihres Vorgehens werden zu treffen sein.
Auch im Roten Meer führt der Krieg, der zwischen der Hamas und Israel begonnen hat, seit dem 19. Oktober 2023 zu offenen Kampfhandlungen. Vom Jemen aus greift die Huthi-Miliz Schiffe auf der internationalen Handelsroute an. Die Huthis sind wegen ihrer Zugehörigkeit zur weiteren schiitischen Konfessionsgemeinschaft und ihrer in den vergangenen Jahren immer stärker gewordenen politischen sowie militärischen Ausrichtung ein zusätzlicher Stellvertreter des Iran an einem geopolitisch heiklen choke point der Region geworden. Wie die libanesische Hizballah gehören sie inzwischen zur sogenannten »Achse des Widerstands«. Dank des Iran besitzt die Miliz ein Arsenal relativ moderner Waffen – darunter Mittelstreckenraketen und luft- wie seegestützte Antischiffsraketen –, mit denen sie Ziele in Israel zu erreichen versucht, in erster Linie aber internationale Handelsschiffe während ihrer Passage durch das Bab al-Mandeb, den maritimen Eingang zum Roten Meer, angreift und beschädigt. Die Angriffe haben das erklärte Ziel, die Handelswege nach Israel zu blockieren. Die damit einhergehende erhebliche Störung des Welthandels wird von den Huthis billigend in Kauf genommen. Die Versorgungslage und die Wirtschaftsinteressen der westlichen Staatengemeinschaft werden davon spürbar in Mitleidenschaft gezogen. Darum wurde eine informelle, internationale Koalition zum Schutz der Schiffspassage gegründet, an der neben Frankreich, Großbritannien und den USA auch die Bundesrepublik zeitweise mit einer Fregatte im Roten Meer teilnimmt. Unsere Marine hat sich damit in einen Einsatzraum begeben, in dem allein schon aus Überlebensinteresse hohe Anforderungen an eigene wie im maritimen Verbund integrierte Intelligence, Surveillance and Reconaissance (JISR) gestellt werden. Bei dem Einsatz geht es keineswegs nur darum, von einigen Kriegsschiffen aus eine Art »schwimmenden Iron Dome« zu errichten, um Handelsschiffe vor anfliegenden Raketen zu schützen, sondern auch – je nach nationalem Mandat – die entsprechenden militärischen Kapazitäten der Huthi schon an Land zu zerstören. Dazu braucht man belastbare und präzise Erkenntnisse zu militärischer Infrastruktur und Einsatzbereitschaft der örtlichen jemenitischen Kräfte, die fortlaufend erhoben und aktualisiert werden müssen. Die nachrichtendienstliche Aufklärung des Gegners – in dem Fall der Huthi – beschränkt sich sachlogisch auch nicht allein auf das Geschehen im Jemen, sondern bezieht, ähnlich wie in Libanon und Syrien, die Logistik der Miliz und ihre Verbindungen in den Iran mit ein. Dieser sorgt ja mit einem elaborierten System des grenzüberschreitenden maritimen Waffenschmuggels für den Nachschub, darüber hinaus aber wohl mit eigenen Kräften der fernmelde- und internetgestützten Satellitenaufklärung auch für die erforderlichen Informationen zu den passierenden und potenziell anzugreifenden Schiffen. In Israel ist inzwischen die Überzeugung gewachsen, dass erhebliche nachrichtendienstliche Anstrengungen zur besseren Aufklärung der Risiken und Bedrohungen erforderlich sein werden. Am 20. Juli 2024 hat Israel erstmals zur Vergeltung und Abschreckung mit einer ambitionierten Operation der Luftwaffe über 2000 Kilometer hinweg Ziele im Jemen bombardiert; Ende September folgten angesichts unveränderter jemenitischer Angriffe weitere, schwere Luftschläge auf militärisch relevante Ziele.
All den Tragödien der vergangenen Jahre ist gemein, dass sie von den meisten Regierungen erst einmal als strategische Überraschungen qualifiziert worden sind. Zumindest in einem Punkt trifft das unstreitig zu: Niemand war ausreichend darauf vorbereitet.
Als ehemaligem Nachrichtendienstler stellt sich mir allerdings die Frage: Kamen die Ereignisse wirklich aus dem Nichts? Haben hier die Dienste versagt, oder liegen die Probleme an anderer Stelle? Derartige Fragestellungen lassen sich methodisch belastbar nur im Rahmen von sogenannten post mortems bearbeiten, also Analysen nach dem jeweiligen Ereignis, die ihrerseits ein wichtiges Verfahren der intelligence studies sind. Auch in der Betrachtung der Ereignisse des 7. Oktober 2023 in Gaza und Israel wird man nicht umhinkommen, immer wieder auf die Erkenntnisse der intelligence studies zu den Rahmenbedingungen für nachrichtendienstliche Arbeit und ihre Methoden zurückzugreifen. Es gibt im Deutschen bekanntlich keine passgenaue Übersetzung für intelligence im nachrichtendienstlichen Zusammenhang. Im Englischen dagegen ist es ein geläufiger Begriff, der in seiner weitesten Auslegung als assessed information, als bewertete Information jeglicher Herkunft, verstanden werden könnte. Intelligence ist der Fundus an bewertetem Wissen, auf dessen Grundlage Entscheidungen zu fällen sind. Es handelt sich um Wissenserwerb mit nachrichtendienstlichen, aber auch allgemein zugänglichen Mitteln, der sowohl die Methoden – technische Aufklärung, menschliche Quellen, Analyse und so weiter – wie auch das Endprodukt – das erworbene Wissen – meint. Diese so gewonnenen Erkenntnisse werden dann Teil der politischen und militärischen Entscheidungsprozesse – oder eben auch nicht. Unter intelligence studies wiederum ist die multidisziplinäre wissenschaftliche Betrachtung von Nachrichten- und Geheimdiensten samt ihrer Relevanz für Politik und Gesellschaft zu verstehen. Wer Nachrichtendienste, ihre Aufgaben und Möglichkeiten verstehen will, ist daher gut beraten, sich mit diesen Aspekten auseinanderzusetzen.
Wie also konnte die Tragödie des 7. Oktober geschehen? Israel besitzt mit dem Mossad, dem Shin Beth und dem Aman jeweils einen Auslands-, Inlands- und Militärgeheimdienst, die zu den besten im internationalen Vergleich gehören. Sie sind sowohl technisch wie personell hervorragend ausgestattet und haben mit einigen inzwischen weltweit bekannten Operationen Geschichte geschrieben. Kann es wirklich sein, dass niemand im Vorfeld etwas bemerkt hat? Hier kann und möchte ich nicht mit einem abschließenden Urteil der offiziellen Aufarbeitung der Ereignisse vorgreifen. Doch nach allem, was bisher bekannt und unwidersprochen ist, hat es sehr wohl entsprechende Anzeichen, nachrichtendienstlich beschaffte Hinweise und Erkenntnisse zu einem geplanten beispiellosen Großangriff der Hamas gegeben. Sie haben nur die politischen, eventuell auch höchste militärische Entscheidungsträger nicht erreicht – oder wurden von ihnen nicht in ihre Entscheidungen einbezogen. Daran zeigt sich, dass selbst optimal informierte Nachrichtendienste allein keine ausreichende Gewähr vor schwerwiegenden kognitiven oder politisch-operativen Fehlleistungen bieten. Zugleich verdeutlicht die Tragödie den Titel dieses Buches: Wissen ist Macht, Nichtwissen ist tödlich!
Eine historische Nachzeichnung des Nahostkonflikts kann und soll dieses Buch nicht leisten, geschweige denn eine weitere vertiefte Diskussion von politischer Schuld, Verantwortung und der vielfältigen Tatbeiträge zu dem vielfachen Leid, das diese Tragödie seit Jahrzehnten über alle Menschen in der Region gebracht hat. Die diesbezüglichen, meist unvereinbaren Realitätswahrnehmungen, Selbstgerechtigkeiten und Schuldzuweisungen sind allerdings ihrerseits immer wieder eine analytische Betrachtung aus nachrichtendienstlicher Sicht wert, unter den Aspekten ihrer konkreten Ausprägung und Wirkungsmacht auf die tatsächliche Welt.
Der 7. Oktober 2023 ist gerade unter dem Aspekt der Leistungsfähigkeit von Nachrichtendiensten und ihrer Interaktion mit politischen und militärischen Entscheidungsträgern ein weiterer Weckruf, eine eindringliche Mahnung besonders für alle, die sicherheitspolitische Verantwortung tragen. Bereits der Schock des Abzugs aus Afghanistan im Sommer 2021, mehr aber noch der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 haben einen Paradigmenwechsel westlicher, insbesondere auch deutscher Sicherheitspolitik angestoßen, der auch nicht vor einer Selbstreflexion zu unseren Nachrichtendiensten haltmachen darf. Die Dimensionen des aktuellen Konflikts in und um Gaza fordern diesen Analyse- und Reformprozess ein weiteres Mal in ganz besonderer Weise, und so möchte ich anhand der dort auf offener Informationsgrundlage fassbaren Ereignisse und Entwicklungen noch einmal auf wesentliche Aspekte der Aufgabenstellungen, Fallstricke und Bedingtheiten für nachrichtendienstliche Arbeit aufmerksam machen. Oder anders ausgedrückt: Ich möchte, in freier Umformulierung von Schillers geschichtlicher Antrittsvorlesung in Jena von 1789, die Frage erörtern: »Was heißt und zu welchem Ende praktiziert man intelligence?« Einiges davon habe ich bereits in meiner Autobiografie »Keine Lizenz zum Töten« auch an Beispielen ansprechen und erläutern können; hier halten wir aber nun mit dem am 7. Oktober 2023 ausgelösten Krieg ein schreckliches Lehrstück in Händen, wie Intelligence an sich selbst und an den nachfolgenden Entscheidungsprozessen scheitern, umgekehrt aber auch, angemessen ausgestattet und mandatiert sowie richtig eingesetzt, nicht nur wichtige Beiträge zur Vermeidung von verhängnisvollen Fehlentscheidungen, sondern auch zur erfolgreichen Bewältigung von Herausforderungen leisten kann.