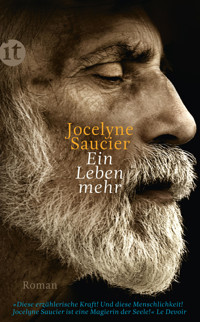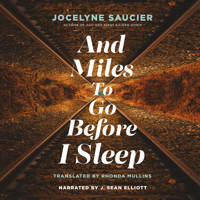10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Cardinals sind keine gewöhnliche Familie. Sie haben den Schneid und die Wildheit von Helden, sie haben Angst vor nichts und niemandem. Und sie sind ganze dreiundzwanzig. Als der Vater in der stillgelegten Mine eines kanadischen Dorfes Zink entdeckt, rechnet der Clan fest mit einem Anteil am Gewinn – und dem Ende eines kargen Daseins. Aber beides wird den Cardinals verwehrt, und so schmieden sie einen explosiven Plan, der, wenn schon nicht die Mine, so wenigstens die Ehre der Familie retten soll. Doch der Befreiungsschlag scheitert und zwingt die Geschwister zu einem Pakt des Schweigens, der zu einer Zerreißprobe für die ganze Familie wird.
»Saucier gelingt es, dem Leser erst ein freches, freies Leben vorzugaukeln und ihn dann schrittweise in dessen finsteres Herz zu führen – ein grandioser Höllenritt.«, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In Niemals ohne sie schafft Jocelyne Saucier eine Welt, die aller Rauheit zum Trotz den Glauben an ein selbstbestimmtes, freies und gemeinschaftliches Leben feiert. So belebend und gewagt wie eine Utopie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jocelyne Saucier
Niemals ohne sie
Roman
Aus dem Französischen von Sonja Finck und Frank Weigand
Insel Verlag
Für Gilles
Als der alte Zausel
Als der alte Zausel mit den nikotinglänzenden Zähnen die Frage stellte, dachte ich, jetzt ginge das übliche Theater los.
Ich habe nichts dagegen. Ich liebe den Moment, wenn sich unsere Familie in das Gespräch einschleicht und ich merke, dass mir mein Gegenüber gleich die Frage stellen wird.
Unsere Familie ist das Glück meines Lebens und ein Thema, mit dem ich immer punkten kann. Wir sind wie niemand sonst, wir haben uns selbst erschaffen, wir sind einander unentbehrlich, unvergleichlich und unangepasst, die Einzigen unserer Art. All die Wichte, die wie Schmetterlinge um uns herumgeflattert sind, haben sich an uns die Flügel verbrannt. Wir sind nicht bösartig, aber wir zeigen unsere Zähne. Wenn die Cardinals ihren Auftritt hatten, nahmen alle Reißaus.
»Und wie viele wart ihr genau?«
Die Frage beschwört das Wunder herauf, und davon gibt es in meinem Leben viele. Ich kann meinen Stolz kaum verbergen, wenn sie im Chor wiederholen, fassungslos, perplex:
»Einundzwanzig? Einundzwanzig Kinder?«
Sofort kommen weitere Fragen, immer dieselben, oder jedenfalls fast: wie wir das mit den Mahlzeiten gemacht haben (immer will irgendeine Frau wissen, wie groß der Tisch war), wie wir es geschafft haben, alle unterzubringen (wie viele Schlafzimmer?), wie das an Weihnachten war, zu Schulanfang, bei einem neuen Baby; und eure Mutter, war die nicht erschöpft von den vielen Geburten?
Also erzähle ich. Von dem Haus, das unser Vater, nachdem er die Mine entdeckt hatte, von Perron nach Norcoville umgezogen hat. Von den vier Küchen, den vier Wohnzimmern, den vier winzigen Badezimmern (wir nannten sie »Kabuffs«, weil keines von ihnen eine Badewanne oder ein Waschbecken hatte); ursprünglich hatte das Haus aus vier Wohnungen bestanden, und unser Vater hatte einfach die Wände durchbrochen. Ich tische ihnen ordentlich was auf, keiner soll hungrig aus dem Gespräch herausgehen. Zwei Dutzend Eier zum Frühstück, hundert Pfund Kartoffeln im Keller, Prügeleien um die Stiefel morgens vor der Schule, Prügeleien am Abend um einen Platz vor dem Fernseher, Prügeleien die ganze Zeit, ohne Grund, aus Spaß, aus Gewohnheit. Das übliche Theater eben.
Alles, was ich erzähle, weiß ich von den anderen, über die Zeit, als wir die Kings waren, als wir fast alle noch zu Hause lebten, als wir uns begeistert fragten, was uns erwarten würde, wenn wir einer nach dem anderen Norco verlassen und die Welt erobern würden. Die Zeit von Geronimo, Gelber Riese, Tommy und El Toro. Die Sechzigerjahre. Die Mine war geschlossen, Norco zerfiel, die Häuser verschwanden (die Leute zogen sie um oder wir brannten sie nieder), Gestrüpp überwucherte die Betonplatten, Unkraut nagte an den kaputten Straßen: Wir waren die Herrscher von Norco. Norco hätte eigentlich Cardinal heißen müssen, schließlich hatte unser Vater das Zinkvorkommen entdeckt, bevor man es ihm geklaut hatte.
Ich war noch nicht geboren, als die Mine dichtgemacht hat. Heulen und Zähneklappern in den armseligen Hütten, aber nicht bei uns. Wir hatten unseren großen Tag. Die Northern Consolidated hatte auf dem internationalen Finanzmarkt zu hoch gepokert, war vom Fall des Zinkpreises mitgerissen worden, fulminant gescheitert und hatte den Schwanz eingekniffen. Für uns war das kein Grund zum Heulen: Endlich bekamen wir unsere Mine zurück.
Ich wurde ein Jahr später geboren, schwach auf der Brust und mit spitzem Schädel, weshalb ich das letzte Kind bleiben sollte, das einundzwanzigste, und den Spitznamen »Matz« bekam. Als er das krakeelende Knochenbündel in der Wiege sah, beschloss unser Vater (wegen der Geburtszangen?, weil ich der Sippe Schande machte?), dass Schluss war mit dem Kinderkriegen.
Der Nachzügler also, das Nesthäkchen, das man auf der Hüfte oder auf den Schultern trug, das man von Hand zu Hand weiterreichte, das hinter den anderen herstolperte, das brüllte, schrie und weinte, aus Angst, irgendwo vergessen zu werden. Gott, was habe ich geheult! Wenn ich daran denke, spüre ich heute noch, wie sich mein Kehlkopf anspannt, wie er sich öffnen will, wie die Luft in meinem Hals brennt, wie der Schrei anschwillt, sich ausdehnt, unbedingt die höchste Note erreichen will und unbeirrt weiterplärrt, wenn mich schon längst einer am Kragen oder Ärmel gepackt und mich weggezerrt hat, dorthin, wo sie alle zusammen hinmarschieren, die ganze bunte Truppe der kleinen und großen Cardinals, dem nächsten Abenteuer entgegen.
Eigentlich weinte ich gar nicht. Ich protestierte. Weil ich so zart und hilflos war. So wenig Cardinal. Die anderen gingen bei minus dreißig Grad einkaufen, barfuß durch den Schnee, während man mir eine Wollmütze überstülpte, sobald es im Herbst zum ersten Mal kühl wurde, wegen der Mittelohrentzündungen, die ich mir ständig einfing. Am nächsten Tag verglichen sie ihre Erfrierungen und forderten mich auf, die geschwollenen Fußsohlen abzutasten und zu entscheiden, wer den Preis für die schönste Frostbeule verdient hatte. Dann humpelten sie tagelang durch die Gegend, und wenn einer von ihnen vor Schmerz das Gesicht verzog, lachten sich die anderen scheckig.
Mager, aber mit angespannten Muskeln und Nerven, immer sprungbereit, wachsam, lauernd, kurz davor, loszusprinten, um sich auf eine Beute zu stürzen, mit der sie kurzen Prozess machen würden.
Wir sind Gewinner. Wir gehören zu denen, die sich weder verbiegen noch brechen lassen, zu denen, die nur ihrem Instinkt folgen, die ihre Flügel ausbreiten und vor nichts zurückschrecken. In Norco waren wir die Kings.
Ich stand unter ihrem Schutz und hatte vor nichts Angst, außer davor, in dem Durcheinander vergessen zu werden. Wir waren so furchtbar viele.
Manchmal zogen wir zu acht oder zehnt los. Wir gingen ein leerstehendes Haus abfackeln, das Ungeheuer mit dem langen Schwanz jagen oder sonst irgendwas anstellen, sie sagten mir nie, was. Und dann, ganz plötzlich, liefen sie auseinander, ohne dass ich verstand, warum. Drei bis vier folgten El Toro oder Tim oder Gelber Riese, die anderen verschwanden im Gestrüpp, und ich stand plötzlich ganz allein da, zwischen den Häuserruinen, diesen Beulen auf einer endlosen Freifläche, und spürte, wie sich der Raum bedrohlich ausdehnte, wie Panik in mir aufstieg und ein Schrei in meiner Kehle kratzte. Häufig hatte ich noch nicht einmal losgebrüllt, da rief jemand: »Sammel Matz ein!« Meistens Tim. Er bekam mit, dass ich den Anschluss an die Expedition verloren hatte, und schickte Wapiti oder einen der anderen Knirpse zu meiner Rettung.
Ich war fünf oder sechs Jahre alt, und die Stadt kam mir riesengroß vor. Dabei musste ich nur auf den Dynamitschuppen klettern, dessen Wellblechdach wir im Sommer als Rutsche und im Winter als Rodelbahn benutzten, um sie zu überblicken. Zwischen der leerstehenden Feuerwache mit ihren in der Sonne gleißenden Mauern (sie war erst kurz vor Schließung der Mine gebaut worden) und den Bruchbuden am Waldrand verliefen zwei parallele Straßen vorbei an grasüberwucherten Parzellen, trostlosen Ruinen und Häusern, die auf dem besten Weg dorthin waren. In der anderen Richtung sah es nicht besser aus: Brachen, hohes Gras, graue Straßen aus pockennarbigem Asphalt, ein paar einsame Gebäude und überall die kleinen Hügel, die die abtransportierten Häuser hinterlassen hatten: überwucherte Betonfundamente, eingestürzte Schuppen, ein Autowrack, das nicht mit hatte umziehen wollen. Und hier und da, o Wunder, ein adrettes kleines Haus, das unverfroren seine Blumen zur Schau stellte. Wie das der Poitvins, in dem früher das Rathaus untergebracht gewesen war. Zwei Kinder, mehr nicht. Der Sohn ging auf die Oberschule, die Tochter zu den Nonnen, die Mutter spielte in der Kirche Orgel. Reiche Leute, die wir leidenschaftlich verachteten.
Norco war seit der Schließung der Mine ziemlich geschrumpft. Früher hatte es ein Kino, zwei Autowerkstätten, Restaurants, Lebensmittelläden gegeben. Jetzt blieb uns nur noch die Feuerwache, die Schlittschuhbahn mit dem Unterstand für die Eishockeyspieler, die Kirche und das Pfarrhaus, ein Schnellimbiss, der gleichzeitig Kiosk und Postamt war, und, was meine Zuhörer immer besonders überrascht, zwei Hotels und drei Schulen.
Die Schulen zeigen, welche Hoffnungen man einst in Norco gesetzt hatte. Eine Minenstadt, in der Wohlstand, Gesundheit und glückliche Enkelkinder gedeihen würden. Der Traum war von kurzer Dauer, und man musste mit der Enttäuschung und der Existenz dieser drei schönen großen Schulen aus rotem Backstein zurechtkommen. Deshalb karrten jeden Morgen ein knappes Dutzend Schulbusse Kinder aus den Nachbardörfern heran. Die Söhne und Töchter von Siedlern, Landeier, zum Kühemelken und Ställeausmisten verdammt, keine Ahnung vom Faulenzen, keine Lust an der Freiheit, sie beugten sich dem Halfter und der Peitsche, und tagsüber gehörten sie uns.
An dieser Stelle der Geschichte zögere ich meist, denn allzu oft besteht mein Publikum aus Leuten, die eine ähnliche Kindheit wie unsere Landeier hatten.
Wir waren nicht die Großmäuler des Dorfs. Wir waren keine fanatischen Anhänger von Beschimpfungen, Beinchenstellen oder blutigen Nasen. Natürlich hatten wir nichts gegen eine anständige Prügelei einzuwenden. Ein ehrlicher Zweikampf mit bloßen Fäusten. Auge in Auge, brennende Muskeln, gut ausgeteilte und gut eingesteckte Schläge, Schmerz, der die Wut hochkochen lässt. Herrlich.
Es war nicht unsere Art, kleinen Mädchen den Schlüpfer runterzuziehen oder ihnen die Murmeln zu klauen. Wir waren Kings. Echte Kings. Wir erwarteten so viel von uns selbst und vom Leben, dass wir alles andere albern fanden.
An den Landeiern mit ihrem lahmen Verstand, die eifrig bemüht waren, rein gar nichts zu kapieren, hatten wir unseren Spaß. Wir ergötzten uns an ihrer Dummheit und unserer Klugheit.
Geronimo war der Klügste von uns allen. Ein waschechter Cardinal. Angeblich war er es, der sich die Anti-Landei-Kommandos, die Bärendynamitfalle und die Katzenparade ausgedacht hatte. Wenn ich die anderen überreden kann, Geschichten von früher zu erzählen (außer mir ist niemand in der Familie besonders redselig, ich bin der Einzige, der ständig versucht, das Gespräch auf unser Leben in Norco zu lenken), taucht bei jedem dramatischen Höhepunkt unweigerlich Geronimo auf, und ganz gleich, wer erzählt, immer dieselbe Schlussfolgerung, in demselben bewundernden Ton: »Er war der Klügste von uns allen.«
Er war erst dreizehn oder vierzehn, als er unseren Vater auf die Claims zu begleiten begann. Er zog frühmorgens los, seine Schürfausrüstung in einer gelben Leinentasche über der Schulter, und verabschiedete sich mit einer Handbewegung von der versammelten Mannschaft am Frühstückstisch, eine Geste, die vor allem an die Großen gerichtet war und den Abstand unterstreichen sollte, der sie jetzt, wo er mit unserem Vater durch die Wälder zog, voneinander trennte. Spätabends kam er wieder, schmutzig, müde, ausgehungert, und wenn er am nächsten Morgen seinen Schulranzen aufsetzen musste, verbarrikadierte er sich hinter wütendem Schweigen. Er verließ die Schule nach der neunten Klasse.
Niemanden störte es, dass Vater ihn zum Gehilfen erkor. Er war der Klügste von uns allen, aber auch, wie Mustang mir einmal erzählt hat, derjenige, der sich am meisten für die Erzsuche interessierte. »Schon lange bevor Vater ihn auserwählte, beschäftigte er sich mit Steinen. Sobald Vater in den Keller ging, folgte er ihm, blieb stundenlang unten und sah ihm dabei zu, wie er seine Proben begutachtete und an ihnen herumkratzte. Wir hörten die beiden reden. Geronimo stellte Fragen, Vater erklärte.«
Ich stieg oft runter in den Keller und träumte davon, wie unser Vater dank eines dieser Gesteinsbrocken eine sagenhafte Mine entdeckte. Da unten gab es Hunderte und Aberhunderte von Felsbrocken, beschriftet und nach Herkunft geordnet in Körben auf schiefen Regalbrettern. Ich interessierte mich nicht ernsthaft für die Steine, auch wenn ich bei ihrem Anblick eine noch größere Bewunderung für unseren Vater empfand. Ich verstand nichts von Rhyolith, Galenit, Chalkopyrit, von all diesen kostbaren Wörtern, die Vater eigenhändig auf kleine Zettel geschrieben hatte, aber ich las sie gerne und stellte mir dabei vor, wie er mich in seine Geheimnisse einweihte.
Ich hätte mich niemals getraut, es Geronimo gleichzutun. Ich wäre niemals in den Keller gegangen, wenn unser Vater unten war, und hätte ihn gebeten, mir etwas zu erklären. Er war allein, und wir waren so furchtbar viele, ich konnte mir nicht vorstellen, dass er Zeit für mich hätte.
Ich zitterte vor Aufregung, wenn er mir manchmal im Vorbeigehen eine Hand auf die Schulter legte. Undenkbar, dass er ein persönliches Gespräch mit mir führen könnte …
An den einzigen intimen Moment, den ich je mit unserem Vater hatte, erinnere ich mich allerdings nicht gern. Wobei, intim ist vielleicht etwas übertrieben. Wir waren ungefähr zu fünfzehnt. Es war mein Geburtstag. Ich wurde sieben Jahre alt, war also kein Kleinkind mehr, sondern hatte das Alter erreicht, in dem unser Vater uns beibrachte, wie man mit Dynamit umgeht.
Alle Knirpse waren da, die Zwillinge und Tim, El Toro, Gelber Riese, Zorro, Mustang, also eigentlich alle, die von den Großen die Mittleren genannt wurden und die seit deren Auszug für die Knirpse die Großen waren. Jeanne d’Arc und Geronimo auch. Beide wohnten noch zu Hause, angesichts ihres Alters eigentlich absurd, vor allem in Jeanne d’Arcs Fall, denn sie war, wenn ich nachrechne, damals schon dreiundzwanzig und spielte für uns die Mutter, statt einen Ehemann und zwei, drei eigene Gören zu versorgen, weil unsere richtige Mutter zu beschäftigt mit ihren Kochtöpfen war, übrigens auch zu beschäftigt, um bei der Geburtstagsfeier dabei zu sein. Und natürlich unser Vater.
Die Einweisung ins Dynamit fand in der Sandgrube statt. Das Fest begann in dem Moment, als wir das Haus verließen. Wir quetschten uns in den Lieferwagen unseres Vaters, einen alten Ford aus den Fünfzigern, aber weil sich darin bereits seine Bohrer, Spitzhacken, Schaufeln und Säcke für die Felsbrocken befanden, gab es nicht genug Platz für alle, und so stritten wir darum, wer während der Fahrt auf der Kühlerhaube sitzen, auf der hinteren Stoßstange stehen oder sich an die Fahrertür klammern durfte, einen Fuß auf dem Trittbrett, den anderen in der Schwebe, ein echter Nervenkitzel. Auf der gesamten Fahrt schrien wir uns die Seele aus dem Leib, sangen und skandierten irgendwas, und unser Vater fiel mit der Hupe in das Tohuwabohu ein, ein seltener und absolut köstlicher Moment, in dem er aus seinen Tagträumen auftauchte und bei unserem Schabernack mitmachte.
Ich saß rechts von ihm auf dem Beifahrersitz, ein Ehrenplatz, der mir an diesem besonderen Tag zustand, und die Nervosität krampfte mir das Herz zusammen. Angst machte mir nicht so sehr das Dynamit, sondern vor allem die Nähe zu unserem Vater, während die anderen zuschauten.
Ich kannte das Ritual. Es wiederholte sich jedes Mal, wenn einer von uns Geburtstag hatte. Der Herbst war die Jahreszeit mit den meisten Dynamitsprengungen, weil da Tootsie, Mustang, Wapiti und die Zwillinge Geburtstag hatten, während es im Winter nur zwei gab (meine Lieblingsexplosionen: wenn der Schnee in die Luft schoss und in glitzernden Garben zu Boden fiel, fühlte ich mich wie im Märchen). Ich hatte während der Schneeschmelze Geburtstag, kurz vor der Katzenparade.
Ich wusste längst, wie man mit Dynamit umging, wir alle wussten das. Auch ohne persönliche Einführung, auch ohne eine Sprengung aus nächster Nähe erlebt zu haben. Unser Vater beschrieb mit dem Arm einen Kreis, der uns andere ein paar Meter auf Abstand hielt, während er selbst und das Geburtstagskind in der Mitte blieben, sodass wir während der Initiation nur ihre gebeugten Rücken sahen. Erst nach unserer Rückkehr nach Hause erfuhren wir die Details, und so lernten wir. Der Eingeweihte musste alles haarklein berichten. Wie er die Stange angebohrt und den Zünder hineingeschoben hatte, auf welche Länge er die Zündschnur geschnitten hatte, und vor allem, der schwierigste und beängstigendste Teil der Operation, wie es ihm gelungen war, bis zur Sprengkapsel vorzudringen, ohne sie zu beschädigen. Doch über die gemurmelten Worte unseres Vaters, über das, was er gesagt hatte, als ihre Körper sich in der Mitte des magischen Kreises berührt hatten, verlor der Glückspilz kein Wort. Alle behielten das exklusive Gespräch, das sie zum Geburtstag geschenkt bekommen hatten, für sich.
Ich werde die ersten Worte, die mein Vater zu mir sagte, als wir nebeneinander in dem Kreis standen, nie vergessen.
»Hast du Angst?«
Er grinste schief, und ich war noch zu jung, um seinen Gesichtsausdruck als verschwörerisches Grinsen unter Männern zu interpretieren. Ich glaubte, mich wie ein echter Mann verhalten zu müssen, und sagte nein.
»Solltest du aber. Wenn du keine Angst vor dem Dynamit hast, bist du tot. Ich habe mehr Angst vor Dynamit als vor Anwälten. Das hat mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Angst ist überlebenswichtig.«
Angst. Angst, auf einer Felsplatte zu stehen, wenn der Blitz einschlägt. Angst, seine Anteile an der Mine zu früh zu verkaufen. Angst, dass die Zündschnur feucht geworden ist. Angst aus Vorsicht, Angst aus Misstrauen, Angst aus Intuition. »Angst ist überlebenswichtig, man muss gut auf sie hören.« Er vertraute mir seine Ängste an, um mir meine zu nehmen.
Eigentlich hätte ich beruhigt sein sollen, aber ich führte zum ersten Mal in meinem Leben ein Gespräch mit unserem Vater. In diesem Augenblick wurde er zu meinem Vater, und das war eine zu große Ehre für meine sieben Jahre. Ich platzte vor Stolz und war wie erstarrt vor Demut, verhedderte mich in meinen Gefühlen und meinen Worten, und auf einmal wusste ich nicht mehr, was eine Patrone, ein Zünder und eine Zündschnur waren. Er hatte unendliche Geduld mit mir, wiederholte die Erklärungen, wiederholte die Handgriffe und immer wieder denselben Rat: »Lass dir Zeit, wenn das Dynamit eins hasst, dann Eile.« Und Feuchtigkeit. Und Erschütterungen. »Dynamit ist sehr schreckhaft, man muss es mit Samthandschuhen anfassen.« Währenddessen entdeckte ich, wie sein Atem roch, wie seine Haut aus der Nähe aussah, wie sich seine schwieligen Hände anfühlten und wie angenehm es war, ihn zu berühren.
Ich glaube, ich machte trotz allem keine schwerwiegenden Fehler, außer bei der Zündschnur. Man muss sie schräg anschneiden, und mein Schnitt war gerade und sauber. Das war die letzte Etappe vor dem Anzünden, und ich hatte mich von all den Blicken, die auf uns gerichtet waren, ablenken lassen.
Meine Explosion gehörte nicht zu den spektakulärsten. Zu viel Gefrorenes war dem Zündstoff beigemischt. Wir hatten hinter ein paar Fichten Zuflucht gesucht, und von dort aus sahen wir zwischen den Eisbrocken Sand emporschießen und schmutzigen Schnee aufspritzen. Die Sprengung war chaotisch, dilletantisch, sogar unfreiwillig komisch. Kein Vergleich zu denen im Sommer oder Winter, die sich als große Blüte über den Boden ausbreiteten, ebenmäßig und wunderschön, als Wolke in den Himmel stiegen und als feiner Regen zu Boden sanken.
Während das Echo der Detonation in der Stille des Waldes verklang, begann unser Vater zu singen: »Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Denis, zum Geburtstag viel Glück«, wobei seine hohe Stimme im Chor der anderen unterging, die in das Lied mit einstimmten: »Zum Geburtstag, lieber Denis, zum Geburtstag viel Glück.« Unser Vater sprach uns immer mit unseren Taufnamen an, nie mit den Spitznamen, die wir einander gaben. Ich zuckte zusammen, als meine Geschwister diesen Namen sangen, der in unserer Familie keine Gültigkeit mehr hatte.
Es sollte meine einzige Explosion in der Sandgrube bleiben. Danach passierte das Unglück in der Mine, und wir führten keine Sprengungen mehr durch. Meine Einführung ins Dynamit ist in jedem Gespräch ein durchschlagender Erfolg. Wenn ich davon erzähle, rufen die Leute: »Schon als Siebenjährigen ließ er dich mit Dynamit spielen!«, sie protestieren: »Also wirklich! Das kann man doch nicht machen!«, sie regen sich auf, entrüsten sich, aber sie wollen trotzdem einen Nachschlag: »Und wer steckte die Dynamitstange in den Sand, du oder dein Vater?« Vor allem die Vollzeitmütter mit zwei, drei eigenen Kindern versuchen ihre Missbilligung zu verbergen und halten sich für unglaublich taktvoll, wenn sie fragen: »Und deine Mutter? Was hat die dazu gesagt?«
Unsere Mutter hatte keine Zeit. Sie hatte alle Hände voll damit zu tun, uns ein Festessen zu kochen, und überhaupt verschwand sie fast völlig hinter unserem riesigen Esstisch, so erschöpft war sie vom Leben. Aber da die Abwesenheit unserer Mutter die Damen vor den Kopf stoßen würde, da sie es nicht verstehen würden, antworte ich jedes Mal, dass unsere Mutter es geschehen ließ, was mehr oder minder der Wahrheit entsprach.
Es gibt ein paar solcher Dinge, die ich nicht erzähle. Meine bornierten Gesprächspartner kommen einfach nicht zurecht mit so viel Lebenslust. Wir gehören zu einer anderen Spezies, wir wollen nicht mit ihnen tauschen, und ich sehe an ihrem Blick, dass sie vor unserem Übermut zurückzucken und sich in ihrer Hundehütte verkriechen wie träge Köter, sobald eine der typisch Cardinal’schen Episoden zur Sprache kommt. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, was man besser nicht erwähnt, und das tue ich ihnen nicht mehr in den Fressnapf. Ich bleibe bei dem, was akzeptabel ist.
Die Geschichte von Geronimo und der Dynamitstange vor seinem Herzen erzähle ich zum Beispiel nicht mehr. Ich könnte es nicht noch einmal ertragen, in ihren scheelen Augen, den Triefaugen eines fetten, kastrierten Hundes, unseren Geronimo grausam und wild vor dem Schulbus stehen zu sehen, der die Landeier zurück nach Hurault brachte. Zu sehen, wie er dieses Mädchen herausforderte (sie hieß Caroline), indem er die Zündschnur der Dynamitstange, die aus der Brusttasche seiner Windjacke ragte, glattstrich.
Er war in ein anderes Mädchen verliebt, und diese Caroline versuchte die junge Liebe zu sabotieren, indem sie drei Tage lang überall herumerzählte, er hätte versucht, sie zu küssen. Er war zwölf Jahre alt, ein Experte im Umgang mit Dynamit, aber ein Anfänger in Sachen Liebe. Und furchtbar unglücklich.
Geronimo war nicht die blutrünstige Bestie, die ich in dem jämmerlichen Köterblick meiner Gesprächspartner sah. Er wollte dieses Landei-Gör lediglich dazu bringen, vor allen zuzugeben, dass es log. Und er hätte sich Tag für Tag vor den Bus nach Hurault gestellt, mit der demonstrativ aus der Brusttasche seiner Windjacke ragenden Dynamitstange, wäre die Sache nicht der Direktorin zu Ohren gekommen. Sie zitierte Geronimo und die Pausenaufsicht, die, wie es der unglücklichste aller Zufälle wollte, Jeanne d’Arc war, in ihr Büro und gab ihnen deutlich zu verstehen, dass eine Pausenaufsicht ein derartiges Verhalten nicht dulden durfte.
Geronimo hätte niemals klein beigegeben, das wusste die Direktorin, wenn nicht Jeanne d’Arcs Stelle auf dem Spiel gestanden hätte.
»Mir war dieser Job als Pausenaufsicht furchtbar wichtig. Das wusste Geronimo. Von dem Lohn kaufte ich mir Kleider und steckte Mutter Geld zu, wenn ihres nicht zum Einkaufen reichte. Du weißt ja, wie stolz sie auf ihre Kochkünste war.«
Jeanne d’Arc verriet mir mehr Details der Geschichte, als sie gewollt hatte. Nur den Namen des Mädchens, das Geronimos Herz entflammt hatte, spuckte sie nicht aus. Ein Mädchen, das nicht einmal hübsch war, in dessen Augen aber eine teuflische Schönheit funkelte, das war das Einzige, was ich aus ihr herausbekam.
Hätte er es wirklich getan? Auf diese Frage gab sie mir keine Antwort, und um mich von der Dynamitstange abzulenken, erzählte sie mir einen Haufen Dinge, nach denen ich gar nicht gefragt hatte.
Er hätte es getan, aber was genau, wusste er wahrscheinlich selbst nicht.
Ein junger Krieger, das war er für mich, ein junger Krieger, der nicht weiß, wo er mit dem Schwert zuschlagen soll, der aber fest entschlossen ist, eine große Liebesgeschichte zu erleben.
Bei dem Vergleich musste Jeanne d’Arc lächeln.
»Nur dass der junge Krieger das Duell der Liebe in diesem Fall nicht gewonnen hat. Seine Angebetete verließ Norco wenig später. Ihr Vater hatte Arbeit gefunden, woanders natürlich, und die Familie war ihm gefolgt.«
Jeanne d’Arc ist unsere zweite Mutter. Sie nahm uns als Babys unter ihre Fittiche und wacht seitdem über uns. Wir beide stehen an entgegengesetzten Enden der Familie, sie ganz vorne, die Älteste der Mädchen, ich ganz hinten. Wir hätten zulassen können, dass die Jahre uns noch weiter voneinander entfernen, aber nein, jedes Mal wenn ich beruflich in Val-d’Or zu tun habe, treffen wir uns im Tim Hortons auf einen Kaffee und zwei Donuts und beschwören die Odyssee unserer Familie herauf, ich als begeisterter Zuhörer in der ersten Reihe, sie als Erzählerin, die sich dem Vergnügen zu entziehen versucht.
Ich spüre ihren Widerstand, einen Knoten, der sich immer fester zuzieht und mich davon abhält, dort herumzuschnüffeln, wo ich will. Sie hält mich an der kurzen Leine, das merke ich genau. Ich komme immer nur so weit, wie ihr Schweigen und ihr Unwille es mir erlauben. Es gibt da einen geheimen Ort, von dem sie mich hartnäckig fernhält.
Trotzdem ist es immer ein Glück, ein euphorisierendes Gefühl, sich in Gegenwart eines anderen Cardinal wiederzufinden. Mittlerweile haben wir nur selten die Gelegenheit dazu. Das Leben hat uns in alle Himmelsrichtungen verstreut.
Émilien lebt in Australien. Er hatte verschiedene Jobs, die ihn reich gemacht haben. Er ist der Älteste von uns, »der Patriarch«, wie wir ihn manchmal nennen. Früher nannten wir ihn auch Stan, Stanley oder Siscoe, wegen einer alten Geschichte über Stanley Siscoes Schatz. Aber keiner der Spitznamen, die wir ihm gaben, blieb an ihm haften: Er war zu weit von uns entfernt, zu alt, eher eine Art Onkel.
Gelber Riese kämpft in Südamerika gegen den Faschismus, den Imperialismus und jede Form von Unterdrückung. Zum letzten Mal gesehen habe ich ihn vor fünf Jahren, da war er auf dem Weg zu einer Entwicklungshilfekonferenz in Frankfurt und legte hier einen Zwischenstopp ein. Ich glaubte ihm kein Wort. Waffenschmuggel, denke ich. Jeanne d’Arc auch.
Mustang ist seit seiner ersten Scheidung untergetaucht, Tommy hat sich irgendwo im Norden verkrochen, in Ungava glaube ich, Nofretete lebt ausschließlich auf ihrem Handy, und Tim kriegt man aus der Armut nicht heraus. Wir sehen uns nur noch zu zweit oder dritt, nie alle zusammen. Seit Norco gab es kein richtiges Familientreffen mehr.
Als wir einer nach dem anderen das Foyer des Quatre-Temps betraten, habe ich geglaubt, jetzt fände es endlich statt, unser großes Familientreffen, das Fest der Cardinals, nach dem ich mich seit dreißig Jahren sehne.
Das Quatre-Temps ist dieses triste längliche Gebäude am südlichen Ende von Val-d’Or, das seine Tentakel in den Fichtenwald ausstreckt. Im Inneren: falsches Leder, falsche Eiche, falsches Lächeln. Man spielt Luxushotel. Hier, in diesem Gewirr aus Fluren und enttäuschten Hoffnungen, findet alljährlich der Kongress der Erzsucher statt. Und hier, so hoffe ich, werde ich mein Familienglück wiederfinden.
Sie sind alle gekommen. Ich weiß nicht, wie sich die Neuigkeit herumgesprochen hat. Ich habe es von Jeanne d’Arc erfahren. Letzten Monat im Tim Hortons. Es war übrigens das Erste, was sie mir erzählte, so aufgeregt war sie über die Neuigkeit.
»Erzsucher des Jahres? Sie verleihen ihm die Medaille für den besten Erzsucher?«
Ich kapierte es nicht. Sicher, Vater sucht noch immer nach Erz, auch wenn er mit seinen einundachtzig Jahren nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Wenn ich ihn in seinem kleinen Bungalow besuche (ein Unding, ich werde mich nie daran gewöhnen) und in seinen ausgebauten Keller runtergehe (ein weiteres Unding), wo er sich den ganzen Tag über die Karten, Bücher und Gesteinsproben beugt, die er aus Norco mitgebracht hat, ist und bleibt er für mich trotzdem der einzig wahre Erzsucher der Welt. Auch wenn er sozusagen nicht mehr im Außendienst ist, auch wenn er Spitzhacke und Kompass gegen ein Telefon eingetauscht hat, selbst in Pantoffeln und Strickjacke in seinem spießigen Keller ist er für mich immer noch derselbe Mann wie der, der spätabends von seinen Claims zurückkam, stumm vor Erschöpfung, nach Wildnis riechend und mit dem metallischen Glitzern der Goldader in den Augen, die in den Tiefen der Erde auf ihn wartete.
Aber Erzsucher des Jahres 1995? Das verstehe ich immer noch nicht. Seit 1944 hat er nichts Bedeutendes mehr entdeckt, seit dem gigantischen Zinkvorkommen, das ihm die Northern Consolidated sofort geklaut hat.
Und ich verstehe auch nicht, was hier beim Kongress der Erzsucher passiert.
Ich war vor allen anderen da, im Foyer des Quatre-Temps, weil ich sie hereinkommen sehen wollte und weil ich wissen wollte, wer von uns erscheinen würde. Ich hatte mehreren Geschwistern von der Sache erzählt, in der Hoffnung, sie würden sie weitertragen, aber ich hätte nie gedacht, dass die Nachricht um die Welt gehen würde.
Manche von uns habe ich seit Norco nicht mehr gesehen. Geronimo zum Beispiel. Nach seinem Weggang hat er das Abitur nachgemacht, studiert und beharrlich das Ziel verfolgt, das er sich gesetzt hatte. Mittlerweile hat er einen Doktor in Medizin, einen Facharzt in Gefäßchirurgie und einen weiteren in Orthopädie, all das, obwohl er nach neun Jahren von der Schule abgegangen war. Mit neununddreißig begann er eine Karriere als Kriegschirurg. Tschad, Äthiopien, Tschetschenien, er lässt keinen Krisenherd der Welt aus. Ein moderner Normand Berthune sozusagen. Jedenfalls hat er noch nie irgendwem die Mandeln rausgenommen. Vor ein paar Jahren habe ich ihn im Fernsehen gesehen. Ein Interview zu Afghanistan. Mit dem rabenschwarzen Haar, dem aschfarbenen Teint und den Jaguaraugen hätte ich ihn überall wiedererkannt. Er ist die reinste Verkörperung eines Cardinal.
Die Zwillinge habe ich nicht wiedererkannt. Sie sind mit den Jahren unscheinbar geworden. Carmelle und Angèle. Tommy und Zwilling, wie wir sie nannten. Tommy, weil sie Forellen fangen konnte wie kein anderer, weil sie beim Eishockey unser bester rechter Flügelspieler war und beim Jiu-Jitsu unser ganzer Stolz, ein echter Wildfang, ein Tomboy, wie die Nachbarn sagten. Also nannten wir sie Tommy, aus Trotz und um den Nachbarn zu zeigen, dass sie zu uns gehörte. Und Zwilling? Tja … Wir waren so viele, da gingen ein paar in der Menge unter.
Die beiden sind von innen her gealtert, vertrocknet, sie haben sich zurückgezogen, man bemerkt sie kaum. Sie könnten irgendwelche Frauen sein, die auf die fünfzig zugehen. Ich hatte sie seit Norco nicht mehr gesehen, und erst als ich El Toro sagen hörte: »Seht mal, da ist Tommy«, begriff ich, dass diese mürrische Frau meine Schwester war.
Sieht man die eine, sieht man die andere, die beiden sind sich zum Verwechseln ähnlich. Trotzdem habe ich sie während des ganzen Kongresses nicht ein einziges Mal zusammen gesehen. Als würden sie einander aus dem Weg gehen.
Im Übrigen habe ich seit Beginn des Kongresses den Eindruck, als würde sich meine Familie vor mir verstecken. Schon im Foyer, als sie einer nach dem anderen eintrafen und es an der Hotelrezeption ein richtiges Gedränge gab, hatte ich ein komisches Gefühl, nahm ich gewisse Fluchtbewegungen wahr. Ich sah, wie sich Gelber Riese und Jahu davonschlichen, in Richtung der Zimmer.
Das komische Gefühl verstärkte sich, je mehr Geschwister eintrafen. Zwar waren die Freude, das Geschrei und das Schulterklopfen groß, es war ein schönes Wiedersehen, ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Allerdings blitzte in den Augen jedes Neuankömmlings Panik auf, wenn er oder sie sah, wie zahlreich wir an der Rezeption versammelt waren. Inmitten des Geschreis und des Schulterklopfens gab es weitere Fahnenfluchten in Richtung der Zimmer, weiteres Davonstehlen in Richtung Bar oder Restaurant. Wir waren nur noch zu fünft an der Rezeption, als unsere Eltern durch die Tür traten.
Es ist, als würde ich Schatten hinterherjagen. Ich laufe von einem zum anderen, renne hin und her, suche nach irgendwas, aber die Schatten huschen davon, die Grüppchen lösen sich auf, und plötzlich hängt das Gespräch in der Luft und ich stehe allein da, mein Herz in den Händen.
Es ist, als würden wir uns gegenseitig abstoßen. Als würde ein gewaltiger, außer Kontrolle geratener Magnet über dem Quatre-Temps schweben und sein Unwesen mit uns treiben. Als könnten wir nach so vielen Jahren nicht ertragen, wieder vereint zu sein.
Trotzdem gab es einen Moment puren Glücks, der den Bann brach. Ein großartiges Bild, dem niemand widerstehen konnte. Wir alle wurden von dieser unglaublichen Szene im großen Saal des Quatre-Temps angezogen. Unser Vater saß an einem ultramodernen Computer, unterhielt sich mit einem jungen Softwareexperten über den Abgleich geophysikalischer Daten mit Satellitenbildern und übersetzte die Geheimsprache des Jungen für zwei alte Erzsucherfreunde, die neben ihm hockten und aus dem Staunen nicht mehr herauskamen. Der Anblick war zum Totlachen.
Hinter mir hörte ich El Toro sagen: »Er hat in seinem ganzen Leben noch keinen Computer angefasst!«
Wir waren so begeistert wie fassungslos.
Der junge Techniker, der genauso verblüfft war wie wir, gab Anweisungen, die unser Vater ausführte, indem er mit ungelenken Fingern auf der Tastatur herumhackte, und auf dem Bildschirm erschien das, was die beiden wollten. Es war ein Wunder, und das Staunen breitete sich bis zu den Messeständen aus und zog Schaulustige an.
Ich stand in der ersten Reihe, zwischen Gelber Riese und Magnum.
Gleich hinter uns, neben El Toro, stand Jeanne d’Arc. Ich hörte, wie sie zu ihm sagte: »Er hat sich das angelesen. Du hast ja keine Ahnung, wie viele Computerbücher in seinem Keller herumliegen.«
Wapiti, ein bisschen weiter hinten, widersprach: »Das ist modernste Technologie. Das kann er sich nicht angelesen haben.«
In diesem Moment wusste ich noch nicht, dass wir vollzählig waren.
Der Halbkreis, den wir um den Computer bildeten, verengte sich unter dem Andrang der Leute. Irgendwann wurde ich herauskatapultiert und gegen den Stuhl eines der alten Erzsucher gedrängt, des alten Zausels mit den nikotinverklebten Zähnen. Er beugte sich zu unserem Vater und sagte: »Albert, schau mal, wer da ist.«
Unser Vater drehte sich zu uns um, die Augen aufgerissen, weil er so lange angestrengt auf den Bildschirm gestarrt hatte. Ich folgte seinem Blick, und erst in diesem Moment wurde mir klar, dass die ganze Familie versammelt war.