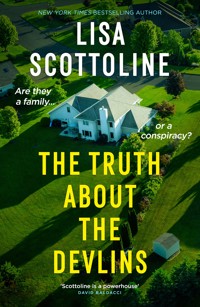Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Ich bin ein Soziopath. Ich halte dich zum Narren. Ich halte jeden zum Narren.“
Doktor Eric Parrish ist Chef der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Philadelphia. Seit er sich von seiner Frau getrennt hat, kümmert er sich umso intensiver um seine Tochter Hannah. Erstaunt muss er feststellen, dass seine Frau ihr gemeinsames Haus verkaufen will und auch schon einen neuen Lebenspartner hat. Endgültig aus den Fugen gerät die Welt des Psychiaters, als er den siebzehnjährigen Max als Patienten annimmt. Die Großmutter des Jungen ist sterbenskrank, und er gesteht Eric, ein Mädchen zu stalken. Wenig später wird dieses Mädchen ermordet, und ausgerechnet Eric ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Als eine überaus attraktive Medizinstudentin, die ihn seit längerem mit ihren Avancen verfolgt, ihn bei der Klinikleitung der sexuellen Belästigung anklagt, begreift Eric, dass es jemand auf ihn abgesehen hat und ihn vernichten will ...
“In diesem fesselnden Roman mit atemberaubenden Wendungen packt Scottoline den Leser an der Halsschlagader und lässt ihn nicht mehr los.“ Library Journal.
Der Mega-Bestseller aus den USA – von einer Meisterin des Thrillers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Ich bin ein Soziopath. Ich halte dich zum Narren. Ich halte jeden zum Narren.«
Doktor Eric Parrish, der Chef einer psychiatrischen Klinik, hat schon bessere Tage gesehen. Seine Frau will sich von ihm trennen und droht, ihm seine siebenjährige Tochter Hannah wegzunehmen. Eine krebskranke Patientin legt ihm ihren Enkel Max ans Herz, der dringend Hilfe braucht, weil er als Stalker unterwegs ist, und die Medizinstudentin Kristine macht ihm Avancen – und klagt ihn der sexuellen Belästigung an, nachdem er sie abgewiesen hat. Als man ihn auch noch eines Mordes verdächtigt, begreift Eric, dass ihn jemand vernichten will.
Der Mega-Bestseller aus den USA – von einer Meisterin des Thrillers.
Doktor Eric Parrish ist Chef der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses in Philadelphia. Seit er sich von seiner Frau getrennt hat, kümmert er sich umso intensiver um seine Tochter Hannah. Erstaunt muss er feststellen, dass seine Frau ihr gemeinsames Haus verkaufen will und auch schon einen neuen Lebenspartner hat. Endgültig aus den Fugen gerät die Welt des Psychiaters, als er den siebzehnjährigen Max als Patienten annimmt. Die Großmutter des Jungen ist sterbenskrank, und er gesteht Eric, ein Mädchen zu stalken. Wenig später wird dieses Mädchen ermordet, und ausgerechnet Eric ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat. Als eine überaus attraktive Medizinstudentin, die ihn seit längerem mit ihren Avancen verfolgt, ihn bei der Klinikleitung der sexuellen Belästigung anklagt, begreift Eric, dass es jemand auf ihn abgesehen hat und ihn vernichten will.
»In diesem fesselnden Roman mit atemberaubenden Wendungen packt Scottoline den Leser an der Halsschlagader und lässt ihn nicht mehr los.« Library Journal
Lisa Scottoline
Niemand sieht mich kommen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Kapitel Achtundzwanzig
Kapitel Neunundzwanzig
Kapitel Dreißig
Kapitel Einunddreißig
Kapitel Zweiunddreißig
Kapitel Dreiunddreißig
Kapitel Vierunddreißig
Kapitel Fünfunddreißig
Kapitel Sechsunddreißig
Kapitel Siebenunddreißig
Kapitel Achtunddreißig
Kapitel Neununddreißig
Kapitel Vierzig
Kapitel Einundvierzig
Kapitel Zweiundvierzig
Kapitel Dreiundvierzig
Kapitel Vierundvierzig
Kapitel Fünfundvierzig
Kapitel Sechsundvierzig
Kapitel Siebenundvierzig
Kapitel Achtundvierzig
Kapitel Neunundvierzig
Kapitel Fünfzig
Kapitel Einundfünfzig
Kapitel Zweiundfünfzig
Kapitel Dreiundfünfzig
Kapitel Vierundfünfzig
Kapitel Fünfundfünzig
Kapitel Sechsundfünfzig
Kapitel Siebenundfünfzig
Kapitel Achtundfünfzig
Kapitel Neunundfünfzig
Kapitel Sechzig
Kapitel Einundsechzig
Kapitel Zweiundsechzig
Kapitel Dreiundsechzig
Kapitel Vierundsechzig
Kapitel Fünfundsechzig
Kapitel Sechsundsechzig
Kapitel Siebenundsechzig
Kapitel Achtundsechzig
Danksagungen
Über Lisa Scottoline
Impressum
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
Gefühle, die nicht ausgesprochen werden,
verschwinden nicht einfach. Sie liegen gewissermaßen
lebendig begraben unter der Oberfläche und kommen später
in hässlicher Form wieder zum Vorschein.
Sigmund Freud
Kapitel Eins
Ich bin ein Soziopath. Ich sehe ganz normal aus, bin es aber nicht. Ich bin intelligenter, besser und freier, denn ich werde weder von Regeln, Gesetzen oder Gefühlen beschränkt, noch von Respekt vor dir.
Ich durchschaue dich mehr oder minder direkt, lese in dir wie in einem Buch und weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, damit du nach meiner Pfeife tanzt. Ich mag dich nicht so richtig, kann die Zuneigung aber so gut vortäuschen, dass es fast dasselbe ist. Für dich.
Ich halte dich zum Narren.
Ich halte jeden zum Narren.
Ich habe einmal gelesen, dass jeder Vierundzwanzigste ein Soziopath ist, und wenn ihr mich fragt, sollten die restlichen Dreiundzwanzig sich ernsthaft Sorgen machen. Jeder Vierundzwanzigste, das sind vier Prozent der Bevölkerung – und eine Menge Soziopathen. Drei Prozent sind magersüchtig, und alle reden darüber. Es gibt nur ein Prozent Schizophrene, aber sie sind ständig in den Medien. Niemand achtet auf die Soziopathen, oder sie halten uns alle für Killer, was ein Irrglaube ist.
Es ist nicht paranoid, sich unseretwegen Sorgen zu machen. Ihr solltet paranoider sein, als ihr seid. Eure typische Vorstadtmutti macht sich ständig Sorgen, allerdings aus den falschen Gründen.
Weil sie sich meinetwegen keine Sorgen macht.
Die Leute glauben, das Böse existiere in Form von Terroristen, Mördern und skrupellosen Diktatoren, jedoch nicht in Form von scheinbar normalen Leuten wie mir. Ihnen ist nicht klar, dass das Böse in ihrer Straße wohnt. In der Bürozelle neben ihnen arbeitet. Sich mit ihnen im Supermarkt in der Kassenschlange unterhält. Neben ihnen im Zug ein Taschenbuch liest. In ihrem Fitnesscenter auf einem Laufband läuft.
Oder ihre Tochter heiratet.
Wir sind hier, und wir lauern euch auf.
Wir haben euch im Visier.
Wir verführen euch.
Ich habe einen Soziopathen-Test gemacht, natürlich keinen offiziellen. Nur gelernte Fachleute können den richtigen Test, den Hare-Test, durchführen, aber ich habe im Netz eine Fassung davon gefunden. Die ersten beiden Fragen lauten:
1. Ich bin anderen überlegen.
Kreuzen Sie eine Antwort an: Trifft auf mich nicht zu. Trifft teilweise zu. Trifft voll zu.
Und:
2. Es täte mir nicht leid, wenn jemand die Schuld für etwas bekäme, was ich getan habe.
Kreuzen Sie eine Antwort an: Trifft auf mich nicht zu. Trifft teilweise zu. Trifft voll zu.
Es waren zwanzig Fragen, und die höchste Punktzahl war vierzig. Ich hatte achtunddreißig, was bedeutet, ich würde den Abschluss mit Auszeichnung machen, wenn es darum ginge, Soziopath zu sein.
Aber ich brauchte sowieso keinen Test, der mir sagte, was ich bin. Das wusste ich bereits.
Habe es immer gewusst.
Ich habe keine Gefühle, weder Liebe noch Hass, weder Zu- noch Abneigungen, noch nicht einmal ein Daumen-hoch, Daumen-runter wie bei Facebook.
Allerdings habe ich einen Facebook-Account und eine ansehnliche Anzahl von Freunden.
Als würde mich das interessieren.
Genau genommen finde ich es lustig, dass sie meine Freunde sind, denn sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Mein Gesicht ist eine Maske. Ich verberge meine Gedanken. Meine Worte sind genau kalkuliert, um zu gefallen, zu entzücken oder zu untergraben. Ich kann mich intelligenter oder dümmer stellen, kommt ganz darauf an, was man erwartet. Meine Handlungen dienen meinem Eigeninteresse.
Ich bin weder dein richtiger noch dein falscher Freund, außer du hast etwas, was ich haben will.
In diesem Fall bin ich nicht nur dein Feind, ich bin dein Albtraum.
Mir wird schnell langweilig.
Ich hasse es, auf irgendetwas zu warten.
Warten macht mich so rastlos, und ich bin seit Stunden in diesem Zimmer, selbst dieses Videospiel ist langweilig. Gott weiß was für Idioten momentan gerade online spielen, ihre pickeligen Teams bilden, sich Aufgaben stellen, Drachen töten, Nutten und Nazis, die alle eine Rolle spielen.
Ich frage mich, ob dem Erfinder von World of Warcraft klar ist, dass er ein Übungsgelände für Soziopathen erschaffen hat.
Die Gamer, mit denen ich online spiele, nennen sich KillerCobra, SwordofDeath und Slice&Dice, doch ich wette, sie sind noch in der Mittelstufe.
Oder studieren Jura.
Wenn einer von vierundzwanzig Leuten ein Soziopath ist, bin ich nicht der einzige Gamer, der versucht, das Haus abzufackeln.
Der Name meines Charakters lautet WorthyAdversary – würdiger Gegner.
Im echten Leben spiele ich jeden Tag eine Rolle, daher bin ich ein ziemlich guter Gamer.
Ich bin immer einen Schritt voraus, vielleicht auch zwei.
Ich plane alles. Ich setze alles in Bewegung, und wenn der Augenblick gekommen ist, schlage ich zu.
Am Ende gewinne immer ich.
Niemand sieht mich kommen.
Weißt du, warum?
Weil ich bereits da bin.
Kapitel Zwei
Dr. Eric Parrish war auf dem Weg nach draußen gewesen, als sein Pager ihn in die Notaufnahme gerufen hatte. Obwohl er seit fünf Jahren der Leiter der Psychiatrischen Abteilung des Havemeyer General Hospitals war, krampfte sich sein Magen zusammen, als er sich ihr näherte. Es gab bei einer Notfallberatung immer die Möglichkeit von Gewalt. Letztes Jahr wurde im nahegelegenen Delaware County ein Psychiater in der Notaufnahme von einem psychotischen Patienten angeschossen und ein Sozialarbeiter getötet. Die Tragödie fand ein Ende, als der Psychiater, der eine versteckte Waffe bei sich trug, das Feuer erwiderte und den Patienten erschoss.
Eric eilte den Krankenhausflur hinunter, gefolgt von zwei Medizinstudenten im Psychologiepraktikum, einer Frau und einem Mann, die sich unterhielten. Er war zuversichtlich, dass er sie und sich selbst auch ohne Waffe beschützen könnte. Sein Arbeitgeber, PhilaHealth Partnership, war nach der Schießerei in Delaware County sensibilisiert, was das Thema Sicherheit anging, und hatte ihn in Verteidigungsstrategien und Fluchtmethoden ausgebildet. Eric würde im Krankenhaus niemals eine Waffe bei sich tragen. Er war aus tiefster Überzeugung Arzt – und vermutlich auch ein schlechter Schütze.
Das Lautsprechersystem schaltete sich abrupt ein. Von einem Tonband trieb ein Wiegenlied durch die Flure. Jedes Mal, wenn ein Baby in der Entbindungsstation des Krankenhauses geboren wurde, spielte das Krankenhaus dieses Lied. Eric zuckte jedoch bei dem Klang zusammen, in dem Wissen, dass es oben, auf seiner Station, für Kummer sorgte. Eine seiner Patientinnen war eine junge Mutter, die nach einer Totgeburt unter Depressionen litt, und das periodisch auftretende Wiegenlied setzte bei ihr stets eine emotionale Abwärtsspirale in Gang. Eric hatte die Verwaltung gebeten, auf seiner Station das Lied nicht zu spielen, doch sie meinten, das Lautsprechersystem zu ändern sei zu kostspielig.
Das Glockenläuten des Wiegenliedes hallte in seinen Ohren nach, und es nervte ihn, dass die Krankenhausbürokratie nicht auf ihn hörte. Psychische Erkrankungen wurden nicht so ernst genommen wie physische Erkrankungen. Eric versuchte als Einzelkämpfer, das zu ändern. Er war der lebende Beweis, dass es Hoffnung gab. Damals, an der medizinischen Fakultät, hatte er eine Angststörung entwickelt, doch er hatte die Symptome durch seine Übungen komplett unter Kontrolle bekommen. Danach hatte er seine Gesprächstherapie beendet und die Medikamente abgesetzt. Er war frei von Symptomen. Geheilt.
Er drückte die Flügeltüren auf, die in die Notaufnahme führten, in der an einem Freitagabend Hochbetrieb herrschte. Krankenschwestern eilten aus vollen Untersuchungszimmern, ein Assistenzarzt schob einen rollbaren Computertisch vor sich her, und eine Gruppe schwarz uniformierter Rettungssanitäter unterhielten sich neben einer leeren Trage mit orangefarbenen Polstern.
Eric näherte sich der Schwesternstation. Eine blonde Krankenschwester sah von ihrem Computermonitor auf, lächelte und zeigte auf das Untersuchungszimmer D. Jeder erkannte die Seelenklempner des Krankenhauses am leuchtend roten W auf ihrem Schlüsselbandausweis. Das W stand für Wright, den Flügel, in dem sich die geschlossene psychiatrische Abteilung befand, doch die Belegschaft frotzelte, das W stünde für Wackos, Spinner. Eric hatte all diese Witze schon x-mal gehört. Wie kann man im Krankenhaus den Psychiater von den Patienten unterscheiden? Die Patienten erholen sich und gehen wieder.
Die Medizinstudenten verstummten, als er auf das Untersuchungszimmer zusteuerte, zu den geöffneten Vorhängen ging und stehenblieb, erleichtert darüber, dass seine Patientin eine reizende alte Dame mit kurzen, silbrig weißen Haaren war, die ein Krankenhausnachthemd trug und entspannt in ihrem Bett lag. Neben ihr saß ein junger Mann, der ihre Hand hielt und sehr besorgt aussah. Hinter ihm stand Dr. Laurie Fortunato, eine kleine Gestalt in einem frisch gebügelten, weißen Laborkittel. Ihren Kinderpatienten zuliebe zierten Blumenaufkleber die schwarzen Gummistängel ihres Stethoskops. Sie und Eric waren seit dem Medizinstudium befreundet, und sie joggten zusammen, allerdings war sie schneller, was nervte.
»Hi, Laurie, schön, dich zu sehen.« Eric betrat den Raum, gefolgt von den Medizinstudenten, die er kurz vorstellte, bevor sie sich hinten an die Wand stellten.
»Eric, danke, dass du so schnell gekommen bist.« Laurie lächelte. Sie wirkte intelligent und lebhaft, was an ihren warmen braunen Augen lag, der etwas langen Nase, rosigen Wangen und einem üppigen Mund, der nie stillstand, weil sie entweder quasselte, witzelte oder Grimassen zog. Auch ohne Make-up, mit dem sich fast niemand des weiblichen Krankenhauspersonals aufhielt, war sie anziehend. Doch Lauries bodenständiges Fehlen jeglicher Eitelkeit war das, was ihren Charakter auszeichnete; sie drehte ihre braunen Locken immer zu einem Knoten auf, den sie im Nacken mit dem befestigte, was sie gerade zur Hand hatte – Bleistift, Kugelschreiber oder Zungenspatel.
»Wie kann ich helfen?«
Laurie deutete auf die Patientin. »Das sind Virginia Teichner und ihr Enkel Max Jakubowski.«
»Ich bin Eric Parrish. Freut mich, Sie beide kennenzulernen.« Eric trat einen Schritt ans Bett heran. Die betagte Patientin blickte mit einem Lächeln zu ihm hoch, ihre braunen Augen unter den Schlupflidern nahmen direkt Blickkontakt auf, ein gutes Zeichen. Sie hatte keine offensichtlichen Verletzungen, hing jedoch an einem Tropf mit Kochsalzlösung, und ihre Vitalwerte wurden mit einem Fingerclip überwacht. Eric warf einen Blick auf den leuchtenden Bildschirm; die Werte waren normal.
»Oh, meine Güte, was für ein hübscher Mann«, sagte Mrs. Teichner mit krächzender Stimme. Sie begutachtete ihn auf eine gespielt übertriebene Weise. »Sie dürfen mich Virginia nennen oder Schatzi.«
»Das hört sich schon besser an.« Eric griff nach einem Rollhocker, zog ihn zu sich heran und setzte sich neben das Bett. Er arbeitete gern mit geriatrischen Patienten. Er lächelte sie an. »Wenn Sie der Ansicht sind, ich sähe gut aus, ist mit Ihrem Sehvermögen offensichtlich alles in Ordnung.«
»Stimmt nicht, ich habe Makuladegeneration.« Mrs. Teichner zwinkerte ihm zu. »Oder vielleicht bin ich auch nur degeneriert!«
Eric lachte.
Mrs. Teichner deutete auf Laurie. »Dr. Parrish, wie kommt es, dass Sie keinen weißen Kittel tragen wie sie?«
»Ein Kittel macht mich dick.« Eric erwähnte nicht, dass viele Krankenhauspsychiater keine weißen Kittel trugen, damit die Patienten einfacher eine Beziehung zu ihnen aufbauen konnten. Er trug ein blaues Oxfordhemd, keine Krawatte, Khakihosen und Slipper. Der Look, den er anstrebte, war »Freundlicher Vorstadtpapa«, doch vermutlich schaffte er es höchstens bis zum freundlichen Typen aus der Pharmawerbung.
»Ha!« Mrs. Teichner lachte. »Sie haben Humor!«
Laurie rollte die Augen. »Mrs. Teichner, bitte animieren Sie ihn nicht auch noch. Dr. Parrish braucht keine weiteren Fans in diesem Krankenhaus.«
Mrs. Teichner zwinkerte erneut. »Sie sind nur eifersüchtig.«
»Genau.« Eric lächelte Laurie an. »Eifersüchtig.«
Mrs. Teichner gackerte. »Das ist ihr jetzt peinlich.«
»Bingo.« Wann immer Eric einen Patienten traf, ging er im Stillen verschiedene Punkte durch: sein Auftreten und Verhalten, Sprachvermögen und motorische Fähigkeiten, Stimmung und Reaktionsvermögen, Logik und Auffassungsgabe. Mrs. Teichner schnitt in fast allen Punkten gut ab. »Also, wie kann ich Ihnen helfen, Virginia?«
»Eric«, unterbrach Laurie. Ihr Ausdruck änderte sich. »Unglücklicherweise leidet Mrs. Teichner unter kongestiver Herzinsuffizienz und Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Vor zwei Monaten war sie oben hospitalisiert worden, hatte drei Tage in der Kardiologie verbracht und stand kurz davor, häusliche Palliativpflege zu erhalten.«
Eric hörte zu. Es war die schlimmste aller möglichen Prognosen, und als Laurie fortfuhr, konnte er nicht anders, als Mitleid für Mrs. Teichner zu empfinden.
»Sie kam heute Abend wegen Schluckstörungen herein. Ich habe neue Röntgenaufnahmen angeordnet, und wir haben eine neue Geschwulst in ihrem Rachen gefunden.«
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte Eric. Angesichts von Mrs. Teichners Gesundheitszustand überraschte ihn ihre ruhige Ausstrahlung. Sie schien nicht verzweifelt zu sein, nicht einmal niedergeschlagen.
»Danke, Doc, aber ich weiß, dass ich Krebs habe, das ist nichts Neues.« Mrs. Teichners Stimme wurde sachlich. »Max, mein Enkel hier, wollte, dass wir Sie rufen. Er ist siebzehn Jahre alt, also weiß er Bescheid. Er erzählt mir immer wieder, ich sei verrückt und …«
Max unterbrach. »Nicht verrückt, Gum. Depressiv. Ich denke, du bist depressiv, und der Arzt kann dir dabei helfen. Er kann dir Antidepressiva geben oder so etwas.«
Eric schaute Max an, der klein und schlank war, vielleicht eins achtundfünfzig, fünfundfünzig Kilo, was ihn jünger aussehen ließ. Sein Gesicht war rundlich, er hatte eine kleine, gerade Nase, hellblaue Augen und ein scheues Lächeln mit einem einzelnen Grübchen. Sein halblanges Haar war hellbraun und zottelig, er trug ausgebeulte Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Seine Arme sahen aus, als würde er nie etwas Schwereres heben als ein iPhone.
Mrs. Teichner wischte seine Worte mit einer von Arthritis steifen Hand fort. »Er nennt mich Gum, Gummy, Gumbo, all solche Namen, weil er als kleines Kind Großmutter nicht aussprechen konnte. Er spielt gern mit Worten. Er ist ein richtig kluger Kopf, National Merit Stipendiat, hat beste Noten im SAT, die besten seiner Klasse, weswegen er auch so ein Klugscheißer …«
»Gummy, bitte«, unterbrach sie Max wieder liebevoll. »Wir müssen über dich reden, nicht mich, und warum du nicht isst.« Max wandte sich an Eric und schaute ihn mit dem gleichen direkten Blick an wie seine Großmutter. »Dr. Parrish, der Kardiologe hat gesagt, dass sie bei Kräften bleibt, wenn sie isst. Er sagte, er könnte ihr eine Magensonde legen, wenn sie nicht isst, aber sie will weder die Magensonde, noch will sie essen. Das spricht meiner Meinung nach eindeutig für eine Depression. Ich finde, sie sollte eine Magensonde bekommen.«
Eric wurde klar, warum Laurie ihn gerufen hatte. Sterbebegleitung stellte die Patienten und ihre Angehörigen vor eine Reihe von emotionalen Herausforderungen. »Max, danke für die Information, das ist sehr hilfreich. Wenn du einen Moment hinausgehen könntest, ich möchte deine Großmutter untersuchen.«
»Klar, prima.« Max stand auf, ließ die Hand seiner Großmutter los und lächelte sie an. »Benimm dich, Gummy.«
»Du hast mir gar nichts zu sagen«, erwiderte sie kichernd. Max schlurfte aus dem Zimmer, und Eric warf Laurie einen Blick zu.
»Lass uns reden, nachdem ich mir ein Bild von Mrs. Teichner gemacht habe.«
»Gut. Komm vorbei, wenn du fertig bist.« Laurie klopfte Mrs. Teichner auf die Schulter. »Sie sind in exzellenten Händen, meine Liebe.«
»Was Sie nicht sagen. Und jetzt raus mit Ihnen, wir möchten allein sein.« Mrs. Teichner kicherte wieder und zeigte dann auf die Medizinstudenten, die an der Wand standen. »Könnten die auch gehen, Doc? Ich muss Zuschauer auf den billigen Plätzen genauso wenig haben wie ein Loch im Kopf.«
»Die beiden müssen bleiben«, antwortete Eric amüsiert. »Versuchen Sie einfach, sie zu ignorieren.«
»Wie soll ich das anstellen? Sie sehen mich an.«
»Es ist ganz leicht, ich mache das jeden Tag. Also, ernsthaft, wie fühlen Sie sich? Sind Sie deprimiert? Melancholisch? Ohne Energie?«
»Nein, ich fühle mich bestens.« Mrs. Teichner schüttelte ihre kurze, weiße Mähne, die sich um ihren Nacken drehte wie bei einer kleinen Schneeeule.
»Sind Sie sich dessen sicher? Es wäre angesichts Ihrer Krankheit nur natürlich.«
»Ich sage Ihnen, es geht mir gut«, schnaubte Mrs. Teichner. »Ich brauche meinen Kopf nicht untersuchen zu lassen, aber wo waren Sie, als ich meinen zweiten Ehemann geheiratet habe? Also, ehrlich!«
Eric lächelte. »Okay, lassen Sie mich Ihnen ein paar Fragen stellen. Was für ein Tag ist heute?«
»Welchen Unterschied macht das?«
»Wir benötigen eine Einschätzung, und dazu müssen Sie einige Fragen beantworten. Wer ist der Präsident der Vereinigten Staaten?«
»Wen interessiert das? Alle Politiker sind Heuchler.«
Eric lächelte wieder. »Hören Sie gut zu, ich werde drei Worte sagen.«
»Ich liebe dich?«
Eric lachte. »Die drei Worte sind Banane, Erdbeere, Milchshake. Können Sie diese Worte wiederholen?«
»Natürlich! Banane, Erdbeere, Milchshake! Dr. Parrish, mit meinem Gehirn ist alles in Ordnung!« Mrs. Teichners Lächeln verschwand in ihren tiefen Falten. »Ich bin nicht deprimiert, ich mache mir Sorgen.«
»Weswegen?«
»Ich mache mir Sorgen um meinen Enkel Max. Er lebt bei mir, ich habe ihn großgezogen. Er ist derjenige, der deprimiert ist, und ich weiß nicht, was mit ihm geschehen wird, wenn ich gestorben bin.« Mrs. Teichners Stirn legte sich in Falten. »Max ist anders. Er hat keine Freunde, ist immer allein.«
»Ich verstehe, aber Sie sind heute Abend meine Patientin. Sie sind hier, weil Sie eine Behandlung brauchen, und ich würde mir gern ein Bild machen und Sie, wenn nötig, behandeln.«
»Ich habe um keine Behandlung gebeten. Max wollte anrufen, nicht ich. Ich habe ihn gelassen, weil ich denke, dass er die Hilfe nötig hat. Anders bekomme ich ihn nicht zu einem Psychologen – er weigert sich.«
»Sie meinen, er ist der wahre Grund, warum ich gerufen wurde?«
»Ja. Er weiß, dass ich sterben werde, aber er kann es nicht richtig akzeptieren, und wenn ich fort bin, ist er ganz allein. Könnten Sie ihm nicht helfen?« Mrs. Teichner griff nach Erics Hemdsärmel. »Bitte, helfen Sie ihm.«
»Erklären Sie mir, warum Sie glauben, dass er Hilfe braucht.«
»Er meint, dass es mir wieder besser ginge, wenn ich essen würde, ich länger lebte oder was auch immer. Aber das werde ich nicht. Ich werde sterben, und er kann nicht damit umgehen.« Mrs. Teichner blinzelte nicht, ihr Blick war ruhig und wissend. »Ich will keine Magensonde. Ich bin neunzig, habe ein langes Leben hinter mir, und wenn die Wirkung der Tabletten nachlässt, habe ich überall Schmerzen. Ich möchte, dass die Natur ihren Lauf nimmt, zu Hause.«
»Ich verstehe. Wo sind die Eltern von Max? Was sagen sie dazu?«
»Er ist das Kind meiner Tochter, und es ist mir unangenehm, das zu sagen, aber sie ist ein Nichtsnutz. Sie trinkt zu viel und fliegt aus jedem Job. Sie hat für eine Telefonfirma gearbeitet, doch man hat sie wegen ständigen Fehlens gefeuert. Jetzt hat sie wohl einen neuen Job.«
»Und was ist mit seinem Vater?«
»Sein Vater hat sich aus dem Staub gemacht, als Max erst zwei war. Er hat auch getrunken.«
»Das ist hart.« Eric spürte für einen Moment Groll. Sein Vater war Alkoholiker gewesen, ein Automechaniker, der betrunken am Steuer saß, als er von der Straße abkam, gegen einen Baum fuhr und Erics Mutter mit sich in den Tod riss. Eric war gerade erst ausgezogen und hatte in Amherst mit seinem Studium begonnen. »Hat Max irgendwelche Geschwister?«
»Nein, er ist Einzelkind. Zu Hause verlässt er nie sein Zimmer, außer zum Essen oder wenn er sich um mich kümmert. Die ganze Nacht spielt er diese Computerspiele. Ich bin alles, was er hat.« Mrs. Teichner blinzelte die Tränen fort. »Was wird mit ihm passieren? Er könnte sich etwas antun, wenn ich nicht mehr da bin.«
»Hier, bitte.« Eric zog ein Kleenex aus einer Schachtel, die auf dem Nachttisch stand, und gab es ihr. Als Psychiater verbrachte er viel Zeit damit, Leuten Papiertaschentücher zu reichen, doch es brach ihm immer noch das Herz, wenn Frauen weinten, besonders ältere. Sie erinnerten ihn an seine Mutter, an die er immer noch jeden Tag dachte.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich mache mir solche Sorgen.«
»Glauben Sie wirklich, dass er sich etwas antun würde?«
»Ja, das glaube ich.« Mrs. Teichner tupfte sich die Nase. »Er ist ein merkwürdiges Kerlchen, aber ein lieber Junge mit einem guten Herzen.«
»Hat er je versucht, sich etwas anzutun? Oder etwas in dieser Richtung gesagt?«
»Nein, er spricht nicht über sich selbst oder seine Gefühle. Sein Vater war genauso, dieser Versager.«
»Hat Max eine Therapie gemacht, oder war er in der Schule bei einem Psychologen?«
»Nein, das ist ihm peinlich. Er sagt, er würde geärgert werden, wenn die anderen es herausfänden.« Mrs. Teichner schniefte. »Ich bin ganz außer mir. Ich bete die ganze Zeit für ihn. Es ist so schwierig. Ich habe mich umgehört, aber niemand kommt an ihn heran. Bitte, helfen Sie ihm.«
»Nun, ich habe eine Privatpraxis«, hörte sich Eric selbst sagen, obwohl er wirklich keinen neuen Patienten brauchen konnte. »Ich könnte ihn dazwischenschieben, wenn er möchte.«
»Wirklich?« Mrs. Teichners Augen weiteten sich hoffnungsvoll. »Das würden Sie tun?«
»Würde ich, wenn er kommen möchte.«
»Vielen, vielen Dank!«
»Gern geschehen. Aber Sie müssen verstehen, dass eine Psychotherapie ein ernsthaftes Unterfangen ist. Ich werde Max eine Therapie anbieten, aber letztendlich liegt es an ihm.«
»Er wird kommen, das weiß ich. Sie haben mir eine solche Last von den Schultern genommen.« Mrs. Teichner klatschte in die Hände. »Es gibt wirklich nichts auf der Welt, was mir mehr bedeutet als der Junge. Ich bin mit mir im Reinen, wenn ich weiß, dass es ihm gutgeht. Das versteht man nur, wenn man Kinder hat.«
Eric dachte an Hannah. Seine Tochter war erst sieben Jahre alt, und er machte sich Gedanken darüber, was mit ihr passieren würde, wenn er einmal nicht mehr da wäre. Seit der Trennung von seiner Frau waren diese Sorgen mehr als nur blanke Theorie.
»Und, Doc, ich kann Sie bezahlen, keine Sorge. Was kostet eine Sitzung bei Ihnen, fünfzig oder sechzig Dollar die Stunde?«
»Ja, so ungefähr«, antwortete Eric. Sein Honorar belief sich auf dreihundert Dollar die Stunde, und für Patienten, die sich das nicht leisten konnten, ging er runter bis zweihundertfünfzig – außer für weinende alte Damen, die vermutlich bald sterben würden.
»Dann also abgemacht. Ich danke Ihnen vielmals!«
»Freut mich, wenn ich helfen kann.« Eric stand auf. »Bevor ich gehe: Sind Sie sicher, dass Sie mit mir nicht über sich selbst sprechen möchten? Ich habe schon Patienten mit ähnlichen Diagnosen behandelt, und es ist vollkommen verständlich, wenn Sie sich etwas Hilfe wünschen.«
»Nein. Ich bin hart im Nehmen. Abgesehen vom Krebs geht’s mir prima.« Mrs. Teichner scheuchte ihn mit einem ironischen Lächeln fort.
»Virginia, es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen.« Eric holte sein Portemonnaie aus der Tasche, zog eine Visitenkarte heraus und legte sie auf den Nachttisch. »Sollten Sie Ihre Meinung ändern, können Sie mich jederzeit anrufen. Zögern Sie nicht – gerade weil Sie hart im Nehmen sind.«
»Darauf können Sie wetten«, erwiderte Mrs. Teichner.
Eric lächelte und versuchte, sich nicht zu fragen, ob er sie wohl je lebend wiedersehen würde. Er winkte ihr zum Abschied zu und bedeutete den Medizinstudenten, zu gehen. »Machen Sie’s gut, Mrs. Teichner. Ich werde Dr. Fortunato hereinschicken. Alles Gute für Sie.«
Eric folgte den Medizinstudenten aus dem Zimmer, sah Laurie an der Schwesternstation stehen und Max, der auf die Getränkeautomaten zusteuerte. Eric wollte zu ihm gehen, als er spürte, wie jemand seinen Ellenbogen berührte. Als er sich umdrehte, sah er, dass es die Medizinstudentin war. »Ja, Kristine?«
»Das war so nett von Ihnen, was Sie da gerade gemacht haben, Dr. Parrish«, sagte Kristine Malin, ihre Hand auf seinem Arm. Sie hatte ein wunderschönes Gesicht, große blaue Augen, langes dunkles Haar und ein umwerfendes Lächeln, wie ein Zahnpasta-Model.
»Danke«, sagte Eric überrascht. Er wusste nicht, warum sie so dicht bei ihm stand und ihn berührte, doch er hatte keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Er dachte an Max, der in dem kleinen gläsernen Raum neben dem Wartebereich stand. »Entschuldigung, ich habe zu tun.«
Kapitel Drei
»Hi, Max.« Eric ging zu dem Jungen, der vor einem der Automaten stand und ihn mit leerem Ausdruck anstarrte, ein benommener Geist, der sich im Glas spiegelte. Außer ihnen war der Raum leer. Dahinter lag der Wartebereich für Kinder, der mit bunten Wänden und Kisten voller Spielzeug einen unpassend fröhlichen Hintergrund abgab.
Max drehte sich um. »Was denken Sie? Können Sie ihr helfen? Ihr etwas geben, das ihre Stimmung hebt?«
»Ich verstehe, dass du glaubst, deine Großmutter habe Depressionen, aber ich bin anderer Ansicht. Ich habe mir ein Bild von ihr gemacht, und meiner Meinung nach geht es ihr den Umständen entsprechend gut. Sie ist ein ganz besonderer Mensch …«
»Was ist mit der Magensonde?« Max schaute ihn trotzig an. »Warum würde sie sich einer Magensonde widersetzen, wenn sie nicht depressiv ist? Das ist doch praktisch wie … Selbstmord zu begehen. Als würde man sagen, es sei einem völlig egal, wenn man stirbt.«
»Es ist keine irrationale Entscheidung, Max. Viele Patienten in ihrem Zustand lehnen eine Magensonde ab.« Eric sprach bewusst sanft. »Weißt du, es gibt zwei Arten Sonde: einen Schlauch, der durch die Nase führt, oder einen Schlauch durch den Bauch. Beide Arten sind sehr unangenehm.«
»Aber sie stirbt, wenn sie nicht isst. Sie verhungert.« In Max’ Augen stand ein Funkeln. Eric hatte Mitleid mit dem Jungen, der noch nicht alt genug war, um mit dem Tod seiner Großmutter allein fertigzuwerden.
»Das weiß ich, und sie weiß es auch. Ich habe ihr trotzdem meine Karte gegeben und ihr gesagt, dass sie mich anrufen soll, wenn sie Hilfe braucht. Sie hat sich mit ihrer Diagnose abgefunden …«
»Ich kann sie nicht verhungern lassen. Sie muss eine Magensonde bekommen. Kann ich sie nicht dazu zwingen?«
»Max, ich weiß, es klingt hart, aber das ist nicht deine Entscheidung, sondern ihre.«
»Aber ihre Entscheidung ist falsch.«
»Das musst du ihr überlassen. Es ist ihr Leben.« Eric sah, wie der Junge versuchte, sich zusammenzureißen.
»Was, wenn sie ihre Meinung ändert? Kann sie eine Magensonde im Hospiz bekommen oder sogar zu Hause?«
»Ja, kann sie.« Eric atmete tief ein. »Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Wenn sie erst einmal im Hospiz ist, bekommt sie eine erstklassige Sozialarbeiterin, die ihr hilft.«
»Wirklich?«
»Ja, und sie haben im Hospiz reichlich Erfahrung.« Eric legte dem Jungen eine Hand auf die Schulter. Seltsamerweise fragte er sich dabei, wie es wäre, einen Sohn zu haben. Das hatte er seit Ewigkeiten nicht mehr gedacht, nicht, seit Hannahs Geburt. »Max, dies wird eine schwierige Zeit für euch beide. Deine Großmutter glaubt, dass dir eine Therapie guttun würde, und ich biete dir an, in meine Privatpraxis zu kommen, abends oder am Wochenende.« Eric gab dem Jungen seine Visitenkarte. »Du kannst anrufen und einen Termin vereinbaren, wenn dir danach ist.«
Max nahm die Karte entgegen, warf einen Blick darauf und blinzelte. »Okay, danke. Das ist nett von Ihnen.«
»Ich werde nicht versuchen, dich zu überzeugen, denn das ist allein deine Entscheidung. Aber wenn du mich nicht anrufst, dann mach Gebrauch von den Selbsthilfegruppen, die das Hospiz anbietet. Eines der besten Dinge, die du für deine Großmutter tun kannst, ist, auf dich aufzupassen.«
»Ja, das sagt sie auch immer.«
»Ich hoffe, du hörst auf sie.« Eric nahm seine Hand von der Schulter des Jungen. »Ich wünsche dir alles Gute.«
Max brachte ein zitterndes Lächeln hervor. »Danke.«
»Pass auf dich auf.« Eric wandte sich ab und ging zurück zu Laurie, die bereits auf ihn wartete.
Laurie lächelte traurig. »Ich wusste, dass du zu ihm durchdringen würdest. Der arme Kerl! Ich bin dir etwas schuldig.«
»Also hast du mit ihm unter einer Decke gesteckt?«
»Ja. Ich habe gesehen, dass der Junge ihr eigentliches Problem war. Danke für die Beratung.«
»Kein Problem.« Eric sah sich nach den Medizinstudenten um. »Wo …«
»Sie sind nach oben gegangen. Das Mädel wurde angepiept. Wie heißt sie noch, Kristine? Himmel, ist die scharf auf dich!«
»Nein, ist sie nicht.« Eric hatte vergessen, wie unverblümt Laurie manchmal sein konnte. Sie waren die letzten Monate nicht mehr zusammen joggen gewesen, seit er sich im tiefen Tal seiner Trennung befand.
»Als du mit Max geredet hast, schwärmte sie davon, wie nett du seist. Abgesehen davon nervt sie mich. Immer gibt es eine von denen.«
»Von wem?«
»Sie ist Das Mädel, das sich zur Arbeit zu heiß anzieht. Auf jeder Schicht gibt es eine davon, wahrscheinlich in jedem Job.«
Eric war noch nicht einmal aufgefallen, wie Kristine gekleidet war.
»Und hast du Sandy auf der Schwesternstation gesehen? Sie war ganz aufgeregt, als ich dich gerufen habe. Sie können es kaum erwarten, jetzt, wo du geschieden bist.«
»Ich bin noch nicht geschieden.«
»Ach, ich bitte dich. Ist doch alles eingereicht, oder?«
»Ja, aber noch ist nichts endgültig.«
»Also gibt es noch eine Wartezeit. Wie auch immer.«
Eric verstand nicht, warum er so auf diesen sinnlosen Unterschied bestand. »Gestehe mir zu, dass ich das abstreite. Schließlich bin ich Fachmann.«
»Nun, in der Abteilung für die Verbreitung guter Nachrichten existiert keine Wartezeit für alleinstehende Ärzte.«
Eric warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Kann ich jetzt gehen? Ich bin spät dran.«
»Wo gehst du hin?«
»Nach Hause.«
»Du meinst zum Haus deiner zukünftigen Exfrau?«, spottete Laurie. »Warum?«
»Ich muss einen Scheck abgeben.«
»Schon mal von der Post gehört?« Laurie zog eine Augenbraue hoch. »Man steckt seinen Scheck in etwas, das Umschlag genannt wird, und die Post bringt es bis vor ihre Tür.«
»Ich habe ihr versprochen, etwas im Garten zu helfen. Den Rasen zu mähen.«
»In der Nacht?«
»Es wird erst gegen neun Uhr dunkel.« Eric hatte festgestellt, dass Ärzte in Krankenhäusern dazu neigten, sich besondere Eigenarten anzugewöhnen. Er war als Psychiater kopflastiger geworden, und Laurie hatte sich voll und ganz in eine Notärztin verwandelt. Sie steuerte direkt auf die Wunde zu, legte sie frei und spülte sie aus, egal, wie weh es tat.
»Kann sie nicht ihren eigenen verdammten Rasen mähen? Oder jemanden dafür bezahlen?«
»Ich mähe gern Rasen, und wenn ich hingehe, sehe ich Hannah, obwohl es nicht mein Abend ist. Warum kümmert dich das?«
»Ich sehe es nicht gern, wenn man dich ausnutzt.«
»Sie nutzt mich nicht aus.«
Eric hörte nicht gern Schlechtes über Caitlin. Er versuchte immer noch herauszufinden, warum sie die Scheidung wollte. Sie hatten sich in Amherst kennengelernt und hatten nach dem Abschluss geheiratet, doch als er eine Angststörung entwickelte, merkte er, wie sie sich von ihm entfernte. Sie wollte, dass er selbstsicher das Kommando übernahm, dass er der Alpha-Mann war, der er zu sein schien; der Typ, der das College mit summa cum laude durchzog. Sie hatte sich in das Abbild eines Mannes verliebt, mehr in einen Lebenslauf als in einen Menschen, und als sich eine Schwäche zeigte, besiegelte das sein Schicksal bei ihr. Selbst als seine Ängste überwunden waren und sie ein gemeinsames Kind hatten, sah Caitlin ihn nie mehr im selben Licht. Und das Kind machte die Sache nur noch schlimmer.
»In Ordnung, ich höre auf, tut mir leid«, seufzte Laurie. »Es muss schwer für dich sein, Hannah nicht zu sehen. Du bist ein großartiger Vater.«
»Danke.« Eric erlaubte sich nie, solche Dinge zu denken, vom Aussprechen ganz zu schweigen, aber es stimmte. Er wollte das Thema wechseln. »Also, was gibt es Neues bei dir?«
»Nichts.« Laurie zuckte ihre Schultern. »Ich bin die ganze Zeit hier. Wir haben zwei Ärzte verloren, und ich übernehme Extraschichten.«
»Das ist heftig.« Eric bewunderte Lauries Arbeitsmoral. Sie war eine absolut engagierte Notärztin. »Und was ist mit dem Typen, mit dem du ausgegangen bist, dem neuen?«
»Welchem?«
»Der, mit dem du verkuppelt wurdest.«
»Der, der zu häufig geschrieben hat, oder der, der zu selten geschrieben hat?«
Eric lächelte. Lauries Dating-Geschichten waren in der Notaufnahme bereits legendär. »Ich bin nicht auf dem Laufenden, was dein Liebesleben angeht. Ich meinte diesen Ethik-Professor.«
»Da fragst du noch? Ethik-Professor? Das sagt doch wohl wirklich alles.«
»Was? Ich finde, das klingt gut.«
»Für dich vielleicht.«
»Another one bites the dust, mhm?« Eric spürte ein bisschen Mitleid für sie. Sie war zu attraktiv, um Single zu sein: intelligent, witzig und ein guter Kamerad. »Ach, du wirst irgendwann jemanden finden. Du bist großartig.«
»Ich bin ja so großartig.« Laurie lächelte. »Aber, was soll ich sagen, die Männer haben Angst vor mir.«
»Sie halten gar nicht lange genug durch, um Angst vor dir zu bekommen.«
»Ich bin auf Anhieb angsteinflößend. Ich will auch gar nicht anders sein. So können sich die Typen noch stärker fühlen. Capisce?«
Eric lächelte. »Und wie läuft das für dich?«
»Frag nicht.« Laurie lachte. »Egal, genug davon. Ich finde, wir sollten wieder anfangen zu joggen.«
Eric stöhnte. »Ich bin nicht joggen gewesen, seit ich ausgezogen bin.«
»Wir fangen langsam an. Was ist mit nächster Woche nach der Arbeit? Montag kann ich nicht, aber wie sieht es bei dir Dienstag aus?« Laurie warf einen Blick hinüber ins Untersuchungszimmer. Auch Eric drehte sich um und sah Max mit seiner Großmutter reden.
»Armer Junge.« Eric sah, wie Max die Hand seiner Großmutter nahm. »Wie viel Zeit hat sie noch?«
»Kann man nicht genau sagen. Es ist drei Tage her, seit sie gegessen hat. Ältere Menschen brauchen keine Kalorien, aber sie ist dehydriert. Wir geben ihr zwei Beutel Kochsalzlösung, doch die hat sie in ein bis zwei Tagen wieder verloren.«
Eric erkannte die Antwort, die keine Antwort war. Auch er redete um den heißen Brei herum, wenn er die Fragen der aufgeregten Familien beantwortete. Wird sie wieder gesund? Wird er wieder versuchen sich umzubringen? Wird sie sich weiter ritzen? Wird das Rivotril wirken? Er wiederholte seine Frage: »Wie lange hat sie noch?«
»Höchstens zwei Wochen.«
Kapitel Vier
An der Ecke seiner alten Straße bog Eric ein und ließ den Feierabendverkehr hinter sich. Er verringerte die Geschwindigkeit und hörte das beruhigende Knirschen von Kies unter den Reifen. Er freute sich auf Hannah, und Caitlin hatte ihn sogar eingeladen, bei ihnen zu Abend zu essen, was er als ein gutes Zeichen ansah.
Eric sah seinen Nachbarn Bob Jeffries aus dessen weißen Acura steigen und winkte ihm zu. Bob winkte zurück und lächelte überrascht. Dann trat Eric überrascht auf die Bremse. Ein Schild stand in seinem Vorgarten. Zu Verkaufen, las er in leuchtend roten Buchstaben, und darunter: RESERVIERT. Eric begriff nicht, was er da sah. Das Haus stand nicht zum Verkauf. Es musste sich um einen Irrtum handeln.
Eric schaltete den Motor aus und stieg aus dem Wagen. Plötzlich öffnete sich die Haustür, und Caitlin eilte heraus, gekleidet in Jeans und ein weißes T-Shirt. Sie trug einige Einkaufstaschen zu ihrem silbernen Lexus, der in der Einfahrt stand. Sie bemerkte ihn nicht, rauschte zum Wagen, öffnete die Heckklappe und warf die Plastiktaschen hinein.
»Caitlin!«, rief Eric, während sie an der Tür anhielt, sich mit wippendem Pferdeschwanz umdrehte, ihn sah und überrascht die Augenbrauen hob.
»Eric. O nein, ich hatte ganz vergessen, dass du heute kommst. Entschuldige, wir müssen gleich los.«
»Was geht hier vor?« Eric wurde klar, dass er das Schild eigentlich nicht hätte sehen sollen. »Du verkaufst das Haus?«
»Ja.« Caitlin schürzte die Lippen. Sie war eine starke, intelligente Anwältin und stellvertretende Staatsanwältin im Büro des Chester County District Attorney.
»Das kannst du nicht machen.«
»Doch, kann ich.«
»Nein, kannst du nicht.« Eric hatte den Wunsch laut zu werden, hielt sich jedoch zurück.
»Es gehört mir, erinnerst du dich?« Caitlins Augen verengten sich. »Ich habe dich ausbezahlt. Du hast es mir verkauft.«
»Ich habe es dich kaufen lassen, weil wir vereinbart hatten, dass Hannah hier wohnen bleibt.« Eric konnte nicht glauben, dass er das genau der Person erklärte, deren Idee es ursprünglich gewesen war. »Wir waren der Ansicht, es sei für Hannah am besten, in dem Haus zu leben, in dem sie aufgewachsen ist.«
»Nichts davon steht im Scheidungsvertrag.«
»Muss es das?« Eric konnte nicht glauben, was er da hörte. »Wir waren uns im Klaren darüber, was wir tun und warum. Wir haben uns mit den Rechtsanwälten zusammengesetzt. Wir waren uns über den Grund einig. Wir sind noch nicht einmal geschieden.«
»Na und?«
»Du kannst dich doch nicht umdrehen und einfach so das Haus verkaufen.« Eric konnte sich nicht eingestehen, dass der Verkauf des Hauses Fakten schuf. Dass sie nicht wieder zusammenkämen. Dass ihre Ehe wirklich vorbei war.
»Es gehört mir, und ich verkaufe es. Das heißt: Ich habe es schon verkauft.« Caitlin stemmte die Hände in die Hüften. »Und jetzt rede leiser. Sonst hören uns noch die Nachbarn.«
»Caitlin, warum denn verkaufen?« Eric verstand es nicht. »Es ist ein tolles Haus, und Hannah liebt es. Es ist ihr Zuhause. Was sagt sie denn dazu?«
»Sie weiß es nicht.«
»Sie hat doch das Schild gesehen, oder? Sie kann lesen.«
»Sie hat es nicht gesehen. Sie ist auf dem Rückweg vom Einkaufszentrum im Wagen eingeschlafen.«
»Dem Einkaufszentrum?«
»Wir waren im Einkaufszentrum. Ich habe mir einen Tag freigenommen. Sie hat das Schild nicht gesehen. Es war schon verkauft, noch bevor es auf den Markt gekommen ist, und sie haben das Schild nur aufgestellt, um Werbung für sich zu machen.«
»Wann wolltest du es ihr denn sagen? Oder mir?« Eric konnte sich nicht an das letzte Mal erinnern, an dem sich Caitlin einen Tag freigenommen hatte.
»Hör zu, es ist alles erst heute passiert. Der Makler hatte direkt einen Kunden für mich.«
»Warum hast du Hannah nichts davon gesagt?«
»Ich wusste nicht, wann ich es verkaufen würde und ob überhaupt«, sagte Caitlin verächtlich. »Was hätte ich ihr sagen sollen? Irgendwann verkauft Mommy das Haus?«
»Warum hast du es mir nicht gesagt?«
»Weil ich wusste, dass du damit nicht einverstanden sein würdest. Ich habe entschieden, dass ich nicht hier leben will, mit den ganzen Erinnerungen. Es ist nicht gut für Hannah.«
»Ich bin nicht tot, Caitlin. Ich bin ihr Vater. Nimmst du sie auch aus ihrer Schule? Das kannst du nicht machen, sie ist erst in der zweiten Klasse. Sie hat gerade erst angefangen …«
»Nein, tue ich nicht.«
»Wohin ziehst du? Wann ist die Übergabe?«
»Das muss ich dir nicht erzählen.«
»Was? Warum solltest du nicht?«
»Ich sage es dir, wenn es endgültig ist. Hier geht es um sie, nicht um dich.«
»Aber ich mache mir Sorgen um Hannah. Das alles auf einmal ist zu viel für sie. Sie verarbeitet immer noch, dass wir uns getrennt haben.«
»Sie schafft das.«
»Sie ist ein empfindliches Kind.« Eric befürchtete, dass Hannah seine Angststörung geerbt haben könnte. Caitlin hingegen wollte nie glauben, dass Hannah nicht genauso perfekt war wie sie selbst.
»Wir fangen noch mal an. Ganz von vorn.«
Eric änderte seine Taktik. »Kann ich dir das Haus abkaufen? Ich kaufe es zurück. Mein eigenes Haus.«
»Nein. Der Kauf ist durch, Cash, der volle Preis.«
Eric wusste nicht, wann Caitlin angefangen hatte, wie ein Makler zu reden. »Wie viel haben sie gezahlt? Ich zahle mehr.«
»Nein, das Thema ist durch.« Caitlin warf die Hände in die Luft. »Lass es auf sich beruhen! Du kannst nie irgendetwas loslassen.«
In Eric flammte Wut auf. »Wo ist Hannah? Wir wollten doch heute zusammen zu Abend essen.«
»Das geht nicht. Wir müssen zum Softballtraining.«
»Seit wann spielt sie Softball?« Hannah mochte keinen Sport. Das Kind hatte keinerlei athletisches Talent. Sie schrieb, malte und las gern. Sie war ein Bücherwurm wie er.
»Es ist der erste Abend, ein Training für die Sommerliga auf dem Sportplatz.«
»Du darfst sie nicht zum Softball anmelden, ohne vorher mit mir darüber zu sprechen. Wir müssen uns darin einig sein.«
»Wir gehen zu einem Probetraining. Um etwas auszuprobieren, brauche ich deine Zustimmung nicht.« Caitlin machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Doch, die brauchst du. Wir haben das geteilte Sorgerecht.« Eric spürte, wie ihm alles entglitt. Sein Leben. Seine Frau, seine Tochter. Die Kontrolle.
»Was könntest du denn dagegen haben?«
»Du weißt, was ich dagegen habe. Du drängst sie. Du willst, dass sie eine Sportlerin wird, weil du eine warst. Dich kümmert gar nicht, ob sie das überhaupt will.«
»Warum machst du so eine große Sache daraus? Lass Hannah doch ein ganz normales Kind sein! Normale Kinder lieben Sport. Willst du nicht, dass sie normal ist?«
»Ich möchte, dass sie die ist, die sie ist …«
»Nein«, blaffte Caitlin. »Du willst, dass sie so wird wie du.«
»Und du willst, dass sie so wird wie du«, feuerte Eric zurück.
»Geh, Eric. Du hast nicht das Recht, hier zu sein.«
»Wo ist sie? Ich möchte sie sehen.«
»Nein, das geht nicht. Sie muss sich umziehen. Wir sind schon spät dran.«
»Ich darf sie nicht sehen? Wirklich?« Eric trat auf die Tür zu, doch Caitlin versperrte mit verschränkten Armen den Eingang.
»Wir haben Stollenschuhe und ein Trikot gekauft. Sie ist aufgeregt. Mach es ihr nicht kaputt.«
»Ich werde es ihr nicht kaputt machen, ich möchte nur hallo sagen. Sie erwartet mich doch …«
»Du darfst nicht zu ihr.« Caitlins Augen blitzten eiskalt auf. »Es ist nicht dein Abend.«
»Sie ist meinKind.«
»Ich rufe Daniel an.« Caitlin zog ihr iPhone aus der Hosentasche. »Und du rufst besser Susan an.«
»Damit unsere Rechtsanwälte sich streiten? Nein, danke. Bitte geh zur Seite.«
»Tu, was du nicht lassen kannst.« Caitlin trat beiseite, das Telefon am Ohr, und sagte dann: »Daniel, ich habe hier ein Problem …«
Eric ging an ihr vorbei, eilte durch den Hausflur und lief dann die Treppe hoch. Er versuchte ein fröhliches Gesicht zu machen.
»Daddy, bist du das?«, rief Hannah aus ihrem Kinderzimmer.
Kapitel Fünf
»Daddy!« Hannah rannte auf ihn zu. Eric fing sie auf, schwang sie durch die Luft und drückte sie an sich. Der fruchtige Duft ihres Shampoos mischte sich auf eigenartige Weise mit dem synthetischen Geruch des gelben Polyestertrikots, auf dem David’s Dental For Kids stand.
»Woher wusstest du, dass ich hier bin?« Um Haaresbreite hätte Eric zu Hause gesagt.
»Ich habe es an den Stufen gehört. Du hast große Füße.« Hannah legte ihre nackten Arme fest um seinen Hals und klammerte sich an ihn wie ein junges Kätzchen. Ihre geraden, kinnlangen Haare umrahmten ihr rundes Gesicht.
»Ich habe dich lieb, meine Süße.« Eric küsste sie auf die Wange.
»Ich habe dich auch lieb.«
»Wie hat Mrs. Williams dein Diorama gefallen?« Eric setzte sie auf dem Teppich ab. Sie sah niedlich aus mit ihrer Softballausrüstung und der pinkfarbenen Kunststoffbrille. Sie war weitsichtig, und die geschliffenen Gläser vergrößerten ihre himmelblauen Augen.
»Sie fand es großartig!« Hannah strahlte, zeigte fast gleichmäßige Zähne, abgesehen von dem fehlenden, oben links. »Sie sagte, es wäre eines der besten der Klasse.«
»Das ist ja toll! Ich wusste es doch.«
»Drei andere Kinder haben ein Diorama über James and the Giant Peach gebastelt, aber meines war das Einzige, bei dem man die magischen Kristalle gesehen hat.«
»Ihr müsst jetzt los.« Eric kniete sich hin und berührte ihr Trikot. »Hey, mir gefällt dieser coole Sportdress. Ich habe gehört, du gehst heute Abend Softball spielen. Das hört sich nach jeder Menge Spaß an.«
Plötzlich verfiel Hannah in Schweigen und zog die Stirn kraus.
»Ich habe gehört, du trägst sogar Stollenschuhe. Das ist ja richtig cool.«
»Nein. Ich hasse sie. Sie sind merkwürdig. Man kann nicht in ihnen laufen, außer auf Gras. Wir waren im Einkaufszentrum und haben sie gekauft.« Hannah rümpfte ihre Stupsnase. »Mommy hat solche getragen, als sie Hockey gespielt hat.«
Eric schmunzelte in sich hinein. Caitlin hatte in der Unimannschaft Feldhockey gespielt.
»Wir haben Eis gegessen, und Mommy hat mir auch meinen eigenen Handschuh gekauft. Man muss seine Hand hineinstecken, und es hilft einem, den Ball zu fangen.« Hannah wischte sich ihren Pony aus der Stirn. »Und wir haben ein Brillenband gekauft, damit sie nicht runterfällt. In Gelb, passend zu meinem Trikot.«
»Wow, das hört sich toll an.« Eric wurde klar, dass Caitlin eine Umgarnungsoffensive gestartet hatte, mit Einkaufen gehen und Eiscreme. »Sieht aus, als wärst du bereit für Softball.«
»Nein.« Hannah lugte gequält unter ihrem Pony hervor. Sie erinnerte Eric so sehr an sich selbst. Nicht ihr Aussehen, denn ihr helles Haar und die klaren blauen Augen hatte sie von Caitlin. Doch Hannahs Art, ihr Verhalten, ihre Gestalt – das war alles er.
»Warum nicht? Für mich hört sich das gut an.«
»Ich kann das nicht. Es ist so schwer.«
»Was ist daran denn so schwer?« Eric bemühte sich um einen leichten Tonfall.
»Es ist einfach nur schwer.« Hannah zuckte die Achseln und wich seinem Blick aus.
»Aber, auf welche Weise denn?«
»Man hat nur drei Chancen, den Ball zu treffen. Wenn man es dreimal nicht schafft, muss man sich hinsetzen.«
»Hab doch einfach nur Spaß, Süße. Es ist bloß ein Training, um zu sehen, ob es dir gefällt. Gib dem Ganzen eine Chance.«
»Sie werden wütend auf mich sein. Sie können mich schon in der Schule nicht leiden.« Hannah sah ihn direkt an, die Augenbrauen zusammengezogen. »Ich bin nicht gut genug, um in die Mannschaft zu kommen. Ich habe noch nie den Ball getroffen und weiß nicht, wie man ihn fängt. Ich habe den Ball nur einmal in der Pause gefangen, doch dann ist Sarah T. gegen mich gerannt, und ich habe ihn fallen gelassen. Was, wenn ich den Ball fallen lasse und sie lachen? Was, wenn sie sich über mich lustig machen?«
Eric hörte ihre Angst. Hannahs Anzeichen einer Angststörung waren schon im Kleinkindalter zu erkennen gewesen, ihre Schüchternheit zwischen den anderen Kindern in der Vorschule und ihre allgemeinen Phobien: Angst vor Bienen, Fliegen, Dunkelheit, den Fenstern in der Nacht und selbst Schmetterlingen. Als sie älter wurde, war sie noch zaghafter geworden, vorsichtiger und hatte Ängste geäußert, die vollkommen unbegründet waren. Eric drückte sanft ihre Schulter. »Das Beste ist, wenn du versuchst, ein bisschen Spaß zu haben.«
»Wie denn?«
»Sag dir einfach, es ist schön, draußen in der Natur zu sein. Wie James mit Miss Spider und der Raupe.«
Hannah blinzelte ihn ungläubig an. »Mommy sagt, ich soll es bis zum Sommer versuchen, dann kann ich aufhören.«
»Ich verstehe.« Eric behielt seine Gedanken für sich. Soviel dazu, dass Hannah es nur einmal ausprobieren sollte. »Deine Mom möchte, dass du dich draußen ein bisschen amüsierst, das ist alles.«
»Was, wenn ich die Regeln nicht kenne?«
»Dann lernst du sie.«
»Ms. Pinto muss sie mir in der Schule erklären.« Hannah nahm ein paar Strähnen zwischen Daumen und Zeigefinger und begann an ihrem Haar herumzuspielen, eine nervöse Angewohnheit.
»Hannah, hör mir zu. Sie werden dir dabei helfen, die Regeln zu verstehen. Es ist nicht so, dass sie von dir erwarten, alles zu wissen. Deswegen geht man zum Training. Um zu lernen.«
»Alle anderen kennen die Regeln schon.« Hannah zwirbelte ihre Haarsträhne auf. »Ich bin die Einzige, die sie nicht kennt. Emily ist der Kapitän, und sie sagt, ich sei ein Loser.«
»Oh, nein, Süße, du bist kein Loser.« Eric nahm sie in die Arme und gab ihr einen Kuss. »Emily ist ein Tyrann, und was wissen wir über Tyrannen?«
»Sie haben Minderwertigkeitsgefühle.«
»Genau.« Eric lächelte. »Sie haben Minderwertigkeitsgefühle. Weißt du, was sie sind? Blödbommel.«
Hannah kicherte, und beide drehten sich zu Caitlin um, die die Stufen hochkam.
»Hannah, bist du fertig?«, rief Caitlin mit gekünstelt locker klingendem Tonfall. »Wir wollen nicht zu spät kommen.«
»Mommy, weißt du was?«, rief Hannah zurück und grinste. »Daddy hat gesagt, Emily ist ein Blödbommel.«
Caitlin kam mit zusammengekniffenem Mund auf sie zu. »Keine Schimpfwörter, Hannah. Emily ist ein nettes Mädchen.«
Eric stand auf, legte Hannah die Hand auf den Kopf und strich ihr über das Haar. »Emily hört sich ziemlich gemein an. Sie hat Hannah beschimpft.«
»Ein Unrecht hebt das andere nicht auf«, sagte Caitlin kalt und reichte Eric ihr iPhone. »Daniel ist in der Leitung. Du solltest mit ihm reden.«
»Super, danke.« Eric nahm das Smartphone, beendete mit einem Daumendruck das Gespräch und gab es ihr zurück. »Hier. Grüß Daniel von mir.«
»Gut.« Caitlin warf ihm einen warnenden Blick zu, tonlos, denn sie standen vor Hannah.
Hannah blickte zu Eric hoch, ihr Kichern war verstummt. »Daddy, kannst du mit zum Softballtraining kommen?«
»Klar«, sagte Erich. »Ich würde mir gern …«
»Nein, kann er nicht«, unterbrach Caitlin immer noch aufgesetzt höflich. »Heute ist kein richtiges Spiel, es ist nur Training, und Daddy muss noch den Rasen mähen und den Zaun reparieren. Ich werde dafür sorgen, dass er deinen Spielplan hat, damit er kommen und zusehen kann, wie du spielst.« Caitlin zeigte auf Hannahs nackte Füße. »Warum hast du deine Socken und Stollenschuhe noch nicht an, Liebling? Wir müssen los.«
Hannah schob die Brille hoch. »Sie sind in meinem Zimmer. Die Schnürsenkel sind zu lang, und sie haben sie nicht in die Löcher gemacht, und ich habe es probiert, aber ich weiß nicht, wie das geht.«
Caitlin schickte sie mit einem Winken den Flur hinunter. »Hol sie, und wir ziehen sie im Auto an. Jetzt beeil dich!«
»Okay.« Hannah rannte in ihr Zimmer.
Eric wartete, bis seine Tochter außer Hörweite war, und drehte sich dann zu Caitlin um. »Sie ist nicht besonders wild darauf, Softball zu spielen, aber ich habe kein Problem damit, wenn du es sie ausprobieren lässt. Ich hätte gern beim Training zugesehen, und ich habe auch jedes Recht, das zu tun.«
»Wenn du Daniels Anruf angenommen hättest, wüsstest du, dass du gar kein Recht dazu hast.«
»Wenn Softball so großartig ist, warum darf ich dann nicht zusehen, wie meine Tochter Spaß hat?«
»Weil sie keinen Spaß daran hätte, wenn du zusiehst. Sie würde so tun, als würde sie es nicht mögen, damit du Mitleid mit ihr hast.«
»Nein, das würde sie nicht.« Eric fühlte sich in Hannahs Namen getroffen. »Sie ist nur ein kleines Mädchen, das versucht, mit Gefühlen umzugehen. Wir sind verpflichtet, ihr dabei zu helfen, selbst wenn es uns nicht gefällt, dass sie diese Gefühle hat. Selbst wenn solche Gefühle unbequem für uns sind.«
»Lass gut sein, Freud. Warum musst du alles so überfrachten? Warum ist alles so schwerwiegend?«
»Handlungen haben Konsequenzen, Caitlin. Menschen ist es erlaubt, auf Entscheidungen emotional zu reagieren, besonders Kindern.«
»Jetzt hör auf damit!« Caitlin funkelte ihn wütend an. »Kinder spielen Softball. Es passieren gute Dinge und schlechte Dinge. Leute lassen sich scheiden, und alle müssen lernen, irgendwie weiterzumachen. Du, ich und Hannah.« Caitlin senkte die Stimme, denn Hannah kam mit den Socken und Stollenschuhen auf sie zu, deren überlange Schnürsenkel hinter ihr herschleiften.
»Mommy, ich habe meine Schuhe!«
»Geht’s ein bisschen schneller?« Caitlin eilte auf Hannah zu und scheuchte sie den Flur und dann die Treppe hinunter. In Erics Tasche klingelte sein Telefon. Er zog es schnell heraus und schaute auf den Bildschirm. Susan Grimes, seine Anwältin. Er steckte das Telefon wieder in die Tasche, ging Caitlin und Hannah hinterher und folgte ihnen nach unten, wo Caitlin ihm den Job aufdrückte, Einkaufstüten zum Wagen zu tragen, während sie die Schnürsenkel in Hannahs Stollenschuhe zog. Als es Zeit war zu fahren, verschloss Caitlin die Haustür und stieg mit Hannah in den Wagen.
Eric winkte ihnen hinterher, als sie rückwärts aus der Einfahrt fuhren. Er bemerkte, dass das Zu-verkaufen-Schild entfernt worden war. Wahrscheinlich hatte Caitlin es herausgezogen. Er ging zur Garage, wo er das Schild hinter alten Gartenstühlen entdeckte. Er schob die Stühle beiseite, holte das Schild hervor und warf es im Garten in die Mülltonne.
Kapitel Sechs
Eric öffnete die Haustür, legte Schlüssel und Post auf der Konsole ab und zog dann das iPhone aus seiner Tasche. Auf dem Display leuchtete eine Nachricht, die er nicht bemerkt haben musste. Er hatte beim Rasenmähen nicht gespürt, wie das Smartphone vibrierte, und während er ins Auto gestiegen war, hatte er angefangen zu telefonieren. Zuerst mit seiner Rechtsanwältin, die er nicht erreicht hatte, danach mit dem Makler von Remax Realtors, den er auch nicht erreichte. Danach hatte er einige Patienten angerufen.
Er fühlte sich müde und hungrig, seine Jeans und Turnschuhe waren voller Grasschnitt. Er berührte das SMS-Icon, und eine Nachricht ging auf. Er kannte die Telefonnummer nicht, doch die Nachricht lautete:
Sie wollten über Jacobs reden, waren aber schon weg.
Könnten uns heute Abend treffen. Kristine.
Eric blinzelte überrascht. Die SMS war von seiner Medizinstudentin Kristine Malin. Er hatte noch nie eine SMS von ihr oder von irgendeinem anderen Studenten erhalten. Er wusste nicht, wie sie an seine Mobilnummer gekommen war, doch dann wurde ihm klar, dass sie Zugang zum Online-Verzeichnis des Krankenhauses hatte. Es stimmte, er hatte mit ihr über Armand Jacobs reden wollen, einen Patienten um die siebzig mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung
Die ist scharf auf dich.
Eric fragte sich, ob sich Kristine mit ihm verabreden wollte und den Fall als Ausrede nutzte. Er würde niemals mit jemandem ausgehen, der unter seiner Aufsicht stand, auch wenn sein neues Haus immer noch leer war und die Stille regelrecht von den Wänden widerhallte. Das letzte Mal, dass er Sex gehabt hatte, war ungefähr acht Monate her. Trotzdem brauchte er jetzt kein Date, sondern einen Rechtsanwalt.
Eric blätterte durch die Kontakte seines Smartphones, drückte dann auf Anruf. »Susan?«, sagte er, als jemand an den Apparat ging. »Hi, hast du meine Nachricht bekommen?«
»Ja, hallo.« Susans Stimme war kaum zu verstehen. »Ich bin beim Basketballspiel meines Sohnes. Entschuldige, aber ich hatte noch keine Möglichkeit, dich zurückzurufen.«
Eric dachte daran, was Caitlin gesagt hatte: Normale Kinder lieben Sport. »Hast du einen Moment Zeit? Es ist wichtig, und ich bin jetzt einer dieser Mandanten, die zu jeder Uhrzeit anrufen.«
Susan lachte. »Ich habe von Daniel gehört, dass ihr heute am Haus eine Auseinandersetzung hattet. Was war los?«
Eric brachte sie so schnell, wie es ging, auf den aktuellen Stand. »Kann sie das Haus verkaufen, ohne mich zu fragen?«
»Leider ja. Wir haben uns geeinigt, dass du ihr das Haus überlässt, weil es das Beste für Hannah ist, haben das im Vertrag aber so nicht formuliert. Zu meiner Verteidigung kann ich nur sagen, dass solche Sachen nie in einem Scheidungsvertrag stehen.«
»Verdammt.« Eric ging zum Kühlschrank und öffnete die Tür.
»Das Einzige, was ich hätte tun können, wäre gewesen, dir das Vorkaufsrecht zu sichern.«
»Können wir den Scheidungsvertrag nicht noch ändern und das Vorkaufsrecht einfügen?« Eric schaute in den Kühlschrank, in dem sich abgelaufene Milch, ein Sixpack Bud Light und Reste eines Salats befanden.
»Nein. Wir können es nicht abändern, weil sie nicht einverstanden sein würde.«
»Verstehe. Aber gibt es nicht irgendetwas, womit wir sie aufhalten können?«
»Nein. Tut mir leid.«
»Kann ich das Haus nicht zurückkaufen? Ich habe beim Makler angerufen, doch der hat sich noch nicht bei mir gemeldet.«
»Davon muss ich dir abraten, Eric.«
»Warum? Wenn ich verrückt genug bin, mein eigenes Haus zu kaufen? Warum sollte mich jemand daran hindern?«
»Wenn schon ein Kaufvertrag geschlossen wurde und du anfängst herumzutelefonieren und damit die Transaktion behinderst, kann sie dich verklagen.«
»Weswegen? Weil ich versuche, ein Haus zu kaufen, das mir gehört hat?«, spottete Eric ungläubig.
»Man nennt es unerlaubte Einflussnahme auf einen Vertrag.«
»Aber, was, wenn es ein höherer Preis ist? Sie hat gesagt, sie hat den vollen Preis bekommen, den sie haben wollte, aber was immer es ist, ich kann es überbieten. Wieso nimmt das Einfluss auf einen Vertrag?«
»Nicht so schnell. Ich bezweifle, dass du ihn überbieten kannst. Nachdem ich mit Daniel geredet hatte, habe ich meinen Cousin angerufen, der Makler in Berkshire Hathaway ist, und er hat sich ein bisschen für mich umgehört. Caitlin hat 510000 Dollar für das Haus bekommen.«
»Was?« Eric griff sich ein Bud Light und schloss den Kühlschrank. »Das ist unmöglich. Der Sachverständige hat es auf 450000 Dollar geschätzt. Wie hat sie so viel bekommen?«
»Mein Cousin glaubt, dass es ein ausländischer Käufer ist.«
»Was für ein ausländischer Käufer? Wir befinden uns am Rand von Philadelphia, nicht in London.«
»Er sagt, dass die Häuser in eurer Gegend für obere Führungskräfte aufgekauft werden, seit Centennial Tech sich mit dieser japanischen Firma zusammengeschlossen hat. Sie haben viel zu viel bezahlt.«
Eric spürte, wie sein Herz sich verkrampfte. »Nun gut. Damit ist das Thema durch. Wir wissen beide, dass ich keine fünfhundertzehntausend Dollar herumliegen habe.«
»Besonders, seit du dich mit hunderttausend hast abspeisen lassen. Sie verdient gutes Geld, und bei allem was Recht ist, hätte sie die ganze Hälfte bezahlen sollen«, tadelte ihn Susan. »Ich habe dich gewarnt. Undank ist der Welten Lohn, Eric.«
»Es war das Haus meines Kindes.« Eric klemmte sich das Telefon zwischen Ohr und Schulter, nahm einen Öffner heraus und entfernte damit den Kronkorken der Bierflasche.
»Ja, war es. Caitlin hat damit einen Haufen Kohle gemacht.«
Eric verstand nicht, wie Caitlin es über sich brachte, das Haus zu verkaufen, selbst für so viel Geld. Er liebte sie immer noch, doch sie war fort, und irgendwie hatte sie am Ende alles bekommen – Hannah, einen Haufen Geld, ihre Freiheit. Er nahm einen Schluck Bier, der bitter schmeckte.
»Eric, bist du noch da?«
»Ja, aber ich bin selbstmordgefährdet. Gott sei Dank kenne ich einen guten Seelenklempner.«
Susan kicherte.
»Okay, lass uns das Thema wechseln. Softball. Caitlin sagte, ich dürfte nicht zu Hannahs Training gehen. Hat sie damit recht?«
»Nein, sie wollte nur, dass du einen Rückzieher machst, genau wie Daniel. Ich bin froh, dass du nicht mit ihm gesprochen hast. Er hätte gar nicht mit dir reden dürfen. Er weiß, dass du durch mich vertreten wirst. Softball ist eine öffentliche Angelegenheit, und da darfst du hingehen.«
»Muss sie mich fragen, bevor sie Hannah für ein Sommerprogramm anmeldet? Bedeutet geteiltes Sorgerecht nicht genau das? Dass wir wichtige Entscheidungen gemeinsam fällen?«
»Der Ausdruck geteilte Rechtsentscheidung betrifft alle wichtigen Dinge, wie die Wahl einer Religion oder den Wechsel auf eine andere Schule.«
»Und was ist jetzt mit dem Softball?«
»Wenn ich zu einem Richter gehe und ihn bitte, Caitlin davon abzuhalten, Hannah bei einer Softballmannschaft anzumelden, würden wir verlieren. Es sähe aus, als würdest du übertreiben.«
»Bei dir hört es sich an wie eine Lappalie, aber das ist es für Hannah nicht. Ich habe dir doch schon gesagt, dass sie Angst davor hat und kein Softball spielen will. Sie ist nicht besonders gut darin, und die anderen Kinder schikanieren sie. Könnten wir das nicht vor Gericht verwenden?«
»Nein. Ein Gericht will sich nicht damit befassen, den Eltern zu sagen, ob ihr Kind Softball spielen soll oder nicht. Ich weiß, dass du denkst, deine Tochter hätte eine Angststörung, doch es wurde noch keine bei ihr diagnostiziert.«
»Ich diagnostiziere sie bei ihr.«
»Das Gericht wird einwenden, dass du befangen bist. Wenn du möchtest, dass ich ihren emotionalen Zustand begutachten lasse, dann können wir das machen.«
»Ich will sie nicht noch mehr stressen, nur um vor einem Richter zu beweisen, dass ich recht habe.« Eric hasste diesen ganzen rechtlichen Kram – einen Richter zu fragen, was gut für sein Kind war, das er besser kannte und mehr liebte als sein eigenes Leben. »Sie hat immer noch an der Trennung zu knacken, und jetzt auch noch ein Umzug.«
»Kinder sind robust, Eric.«
»So robust nun auch wieder nicht.« Eric gefiel die Skepsis in Susans Tonfall nicht. Kinder mit einer Angststörung litten psychische Qualen, niemand konnte das besser beurteilen als er.