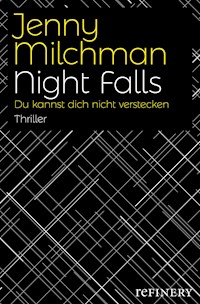
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Denk nicht, du hast alles hinter dir gelassen Sandra hat alles. Ein Traumhaus mitten in der Natur. Einen Mann, der sie auf Händen trägt. Eine 15-jährige Tochter, ihr großes Glück. Bis aus dem Traum ein Alptraum wird: Zwei Fremde dringen in ihr Haus ein, schlagen ihren Mann brutal nieder und nehmen Mutter und Tochter als Geiseln. Draußen tobt ein Sturm. Es gibt keinen Ausweg. Schon gar nicht für Sandra. Denn sie kennt einen der Männer — und wollte ihn um jeden Preis vergessen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Autorin
Jenny Milchman lebt mit ihrer Familie im Staat New York. Wenn sie nicht selbst schreibt, vermittelt sie anderen Autoren die Kunst des Thrillers.
Das Buch
Denk nicht, du hast alles hinter dir gelassen.
JENNY MILCHMAN
NIGHT FALLS
DU KANNST DICH NICHT VERSTECKEN
THRILLER
Aus dem Amerikanischen
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Februar 2019 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019
© für die deutsche Ausgabe
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016
© 2015 by Jenny Milchman
Titel der amerikanischen Originalausgabe: As Night Falls
(Ballantine Books, Penguin Random House, New York)
Umschlaggestaltung: © Simone Mellar, Berlin
Autorenfoto: © privat
ISBN 978-3-96048-234-5
E-Book-Konvertierung: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Widmung
Diesen Roman widme ich drei wunderbaren Frauen, ohne die es diese Geschichte nicht gäbe. Als Erstes meiner Lektorin Linda Marrow, deren scharfer Verstand, deren Weisheit und Warmherzigkeit mich in die Lage versetzten, ein Buch zu schreiben, von dem ich immer geträumt habe. Dann meiner Agentin Julia Kenny, die genug Hingabe, Leidenschaft und Weitsicht für hundert weitere gemeinsame Bücher besitzt. Und schließlich Nancy Pickard, die eine meisterhafte Schriftstellerin ist, ein Engel der Literatur und eines der größten Geschenke in meinem Leben.
Kapitel eins
Sandy Tremont stand an ihrer Kücheninsel, starrte auf die gezackte Bergkette vor ihrem Fenster und rührte in einem Topf. Sie wusste gar nicht mehr, was sie da kochte. Erst als die Sauce zu blubbern begann und Sandy Tomaten roch, fiel ihr wieder ein, dass sie sich heute für Spaghetti zum Abendessen entschieden hatte. Sie schüttelte den Kopf und blinzelte, um sich wieder auf das zu konzentrieren, was direkt vor ihr lag. Manchmal ertappte sie sich dabei, dass sie in eine Schublade griff, ohne zu wissen, warum sie sie aufgezogen hatte. Sie sollte wirklich selbst mal ein paar der Achtsamkeitstechniken üben, die sie bei ihren Patienten benutzte.
Das Fenster ging über die ganze Wand hinter der Kücheninsel. Hier war ihr Lieblingsplatz in diesem Raum. Zu einer bestimmten Zeit im Jahr hatten die Berge dasselbe Blau wie der Himmel. Und selbst jetzt, in den tristesten Wochen des schwindenden Jahres, gab es immer noch Schönes zu entdecken. Quer durch den hinteren Teil ihres Grundstücks schlängelte sich ein Bach und hüpfte munter über die Felsen. Offenbar war es kälter geworden, denn das Wasser war fast schwarz und floss zäh wie eine schlammige, teerartige Brühe. Sandy löste nur ganz kurz den Blick davon, um die Gasflamme unter ihrer Sauce niedriger zu stellen.
Als ihr Mann eine beträchtliche Summe von seinem Großvater geerbt hatte, beschloss er, ihr Traumhaus zu bauen. Eigentlich war es eher Bens Traum gewesen als ihrer; denn Sandy hatte sich Sorgen gemacht, ihre Nachbarn, die Leute aus dem Ort oder ihre Patienten könnten das neue Haus vielleicht zu protzig finden. Sandy wollte nicht auffallen. Aber um dem entgegenzuwirken, hatte Ben ein Grundstück gefunden, das so abgeschieden lag, dass es schon fast an Einsiedelei grenzte. Aber Sandy gefiel es, so viel Privatsphäre zu haben. Am Fuß des langgezogenen Hügels stand das nächstgelegene Haus, von dem lediglich das Dach zu sehen war, und das auch nur, wenn die Bäume ihre Blätter verloren hatten. Außerdem gab es zur Linken eine verlassene hochherrschaftliche Adirondack-Ferienvilla auf einem Stück Land, das um Sandys und Bens Grundstück zunehmend verfiel. Das weitverzweigte Holzrahmenhaus stand noch, hielt sich aber nur mit einer gelegentlichen Zementspritze und einem frischen Anstrich auf dem splittrigen Holz aufrecht.
Die einsame Lage machte Sandy keine Angst. Bei ihrer Arbeit drohte stets der Würgegriff von Menschen, die ihre Bedürfnisse nicht nur innerhalb ihrer Termine an den Mann bringen wollten. Da war es gut, nach Hause zu kommen und eine reale Distanz dazu zu schaffen und das Gefühl zu bekommen, wirklich alles hinter sich zu lassen.
Sandy erlaubte sich ein leichtes Lächeln. Meist konnte sie es kaum glauben, dass sie tatsächlich an diesem friedlichen, heiteren Ort wohnen durfte. Sie wünschte, Ben würde sofort nach Hause kommen, damit sie ihm sagen konnte, wie froh sie war, dass er sie zu dem Umzug gedrängt hatte. Sie rührte noch einmal in dem Topf und atmete tief ein. Die Sauce roch würzig und pikant. Als sie sie von der Platte zog, warf sie einen Blick zur Uhr, die ein Signal von sich gab. Ivy hatte noch fünfzehn Minuten, bis sie von der Schule zu Hause sein musste. Und weniger als eine Stunde, bis Ben es erfahren würde, falls sie nicht heimgekommen war.
Als Sandy etwas Pelziges an ihren Knien spürte, griff sie nach unten. »Hey, Mac, guter Junge.«
Der Hund gab mit einem kurzen Bellen seine Zustimmung kund und stemmte sich gegen Sandys Hand. Von ihrem Nachmittagsspaziergang hatte er noch ein paar Kletten im Fell. Sandy zupfte und kämmte das Fell mit den Fingern und entfernte erst die filigrane, winzige Kugel und dann die Pollenkrone von einer Wolfsmilchpflanze. Mac war ein Mischling, und einer seiner Vorfahren musste ein Husky gewesen sein, denn er hatte spitze Ohren und ein durchdringend blaues Auge, während das andere braun war. Aber nicht nur an diesen Äußerlichkeiten erkannte man den Husky, es lag auch ein wölfischer Zug in seinem Wesen, etwas Wildes, das allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr zum Vorschein gekommen war.
»Ich muss dich wohl mal baden«, sagte Sandy, und diesmal gab es kein zustimmendes Bellen.
Stattdessen signalisierte Macs pelziges Gesicht Missfallen. Er wandte sich ab und trottete zur Sitzgruppe der Küche, so weit weg, wie er sich allein wagte. Dort legte er sich auf den Teppich vor ein kleines Sofa. Es gab auch ein paar Sessel, aber Mac hasste sie und wich immer davor zurück.
Hinter dem Sitzbereich gingen Glastüren nach Westen hinaus. Sie umrahmten einen bleichen Himmel, der sich über ödes Land spannte. Nackte Bäume und Wiesen mit Stoppelgras: eine Landschaft in der Farbe von Kartoffelschalen. Das Jahr ging zu Ende, und vor ihnen erstreckte sich eine scheinbar unendliche Zeitspanne der Tristesse, aber Sandy liebte auch dieses Erscheinungsbild der Natur.
Sie ging den Herd ausschalten. Die Sauce war fertig, und ein Deckel auf dem Topf würde die Pasta warm halten. Der Salat stand mit einem Küchentuch abgedeckt im Kühlschrank. Sie hatte sogar schon Brot geschnitten. Aufgaben drohten Sandy immer zu entgleiten, daher fing sie gerne früh mit der Zubereitung des Abendessens an und machte die einzelnen Teile wie Düsenjets auf einem Flugzeugträger startklar, anstatt alles gleichzeitig zu kochen.
Da sie nun nichts mehr zu tun hatte, ging sie zum Telefon, um auf der Arbeit anzurufen, und warf dabei einen Blick auf die türkisfarbenen Ziffern der Uhr.
Drei Uhr vierzig.
Trotz unzähliger Ermahnungen und Vorhaltungen, an einem Wochentag pünktlich von der Schule nach Hause zu kommen oder bei Planänderungen zumindest anzurufen, kam Ivy neuerdings unweigerlich zu spät.
Als Sandy seufzte, stand Mac auf und trottete zurück zu ihr. Er fühlte sich unwohl, wenn jemand in seiner Familie besorgt, verärgert oder aufgebracht war. Darin ähnelte er ihr, dachte Sandy und sah zu, wie der Hund quer durch den Raum auf sie zustakste. Mit leichtem Erschrecken wurde ihr bewusst, dass er nicht mehr so geschmeidig lief wie früher. Unfassbar, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem Mac nicht mehr hier wäre. Er war zusammen mit Ivy groß geworden.
Das Wedeskyull Community Hospital hatte vor kurzem ein Telefonsystem installiert, welches nur – zumindest behauptete das jeder – die Patienten befremdete und die Angestellten entnervte. Die automatisch abgespulte Begrüßung ertönte, als Sandy sich das schnurlose Telefon ans Ohr presste. Wenn Sie mit jemandem aus der Notaufnahme sprechen möchten, drücken Sie die 1, möchten Sie mit jemandem aus der … Sandy hörte sich den Rest der Ansage gar nicht mehr an, sondern drückte die 4.
»Psychiatrische Abteilung, hier spricht Gloria, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ganz ruhig«, antwortete Sandy als Reaktion auf den aufgesetzt munteren Ton. »War was?«
»Oh, Mrs Tremont, hi«, antwortete Gloria mit ihrer normalen, nüchternen Stimme. »Eigentlich nicht, bis jetzt ist es ziemlich Sie-wissen-schon.« Es brachte Unheil, das Wort ruhig auszusprechen. Das wusste jeder, der in einem Krankenhaus arbeitete.
Sandy hörte im Hintergrund Papier rascheln. Obwohl das WCH ein Großunternehmen war, arbeitete es größtenteils wie noch vor hundert Jahren und vermied papierlose Behandlungspläne, Krankenakten und Notizen.
»Madeline Jennings hat angerufen«, meldete Gloria. »Aber nur einmal. Ich würde sagen, wir schlagen uns tapfer.«
Sandy erlaubte sich ein kurzes, wenn auch unsichtbares anerkennendes Nicken. »Was hat sie gesagt?«
»Sie fragte, ob ich Sie zu Hause anrufen könnte«, erwiderte Gloria. »Ich bot an, Sie anzupiepen, doch dann meinte sie, es sei schon gut.«
Es war eine Art List, dass Patienten im Krankenhaus anrufen und dort ihre Therapeuten anpiepen lassen mussten. Die Therapeuten sollten auch immer ihre Rufnummer unterdrücken, bevor sie sie zurückriefen, aber in diesem entlegenen Landstrich war die Technik noch nicht auf dem neuesten Stand, dass man sich darauf hätte verlassen können. Oft konnte man von Glück sagen, wenn überhaupt ein Anruf durchkam.
»Was auch immer das bei dieser speziellen Patientin bedeuten mag«, fuhr Gloria fort.
Sandy stimmte nicht in das leise Glucksen der Sekretärin ein. Galgenhumor war in ihrem Berufsfeld ziemlich weit verbreitet, um mit der Konfrontation mit psychischen Störungen von Menschen zurechtzukommen, die hier in dürftigen und oft abenteuerlichen Verhältnissen lebten. Doch Sandy konnte nicht einmal heimlich auf diese Menschen herabsehen, die ihr Leben am Rande der Wildnis führten. Und Madeline war eine Patientin, die sie besonders mochte: eine junge Mutter, die sich mit einer Dreifachbelastung aus Trauer, posttraumatischem Stress und einer offenbar höchst bizarren Kindheit herumschlagen musste.
Gloria ruderte zurück. »Ist nur Spaß. Wenn irgendjemand diesem Mädel helfen kann, dann Sie, Mrs Tremont.«
»Danke, Gloria«, sagte Sandy. »Ich schicke Ihnen Sie-wissen-schon-was-Gedanken für heute Abend.«
»Kein Wort mehr«, erwiderte Gloria düster.
Sandy legte auf und vergewisserte sich, dass sie keinen Anruf verpasst hatte. Madeline befand sich in einer Reha-Maßnahme auf einem Biobauernhof, wo Technik eher misstrauisch betrachtet wurde. Mehr als einen Festnetzanschluss gab es dort nicht.
Sie legte das Telefon auf die Station zurück und ging mit Mac im Schlepptau zur Haustür, um dort aus einem schmalen, hohen Fenster zu spähen. Der Hund war ein Fundtier und konnte nicht allein bleiben, weil sein erstes Lebensjahr unfassbar schrecklich verlaufen war. Dennoch war er das sanfteste und fügsamste Wesen, das man sich vorstellen konnte. Solange er Gesellschaft hatte.
Von diesem Aussichtspunkt aus war jeder Meter ihrer knapp eine Meile langen Auffahrt sichtbar. Hier konnte Sandy weder den Wagen übersehen, mit dem Ivy gebracht wurde, noch Bens Ankunft verpassen. Sie kam sich vor wie bei einem verrückten Rennen: Welche Scheinwerfer würden zuerst auftauchen? Unbekannte oder die vertrauten Lichter ihres Jeeps?
Wenn Ben vor ihrer Tochter eintraf, würde Sandy nicht in der Lage sein, eine weitere Verspätung zu vertuschen, die sie Ivy normalerweise zugestand. Sie zeigte in letzter Zeit zwar typisches Teenagerverhalten, war aber im Grunde ein liebes Kind. Ben geriet öfter mit Ivy aneinander als Sandy, und sie hatte keine Lust, an diesem Abend wieder Zeuge von Vorwürfen und Wutausbrüchen zu werden. Um das zu verhindern, würde sie einiges auf sich nehmen.
Sie ließ die Gardine zurückfallen, so dass sie die Auffahrt nicht mehr sehen konnte.
Mac winselte.
»Ist schon gut, Mackie«, sagte Sandy beruhigend. Aber sie strich sich über die schneckenhausförmige Narbe an ihrem Handgelenk, während sie sich gleichzeitig für ihre Nervosität schalt. Ein Teenager, der zu spät nach Hause kam? Du meine Güte!
Jetzt hörte sie draußen Motorengebrumm, ruhiger und weicher als von ihrem Jeep.
Sandy verspürte einen Anflug von Erleichterung – oder etwas Ähnlichem –, während Mac entzückt jappte. Sandy zog am Schnappschloss ihrer Haustür und ermahnte sich, nicht zu schimpfen.
Die Tür eines riesigen SUV schwang auf.
Verdient
Es war so still draußen, dass man das Rascheln der Blätter hören konnte, aber kaum fiel die Gefängnistür hallend hinter ihm ins Schloss, kam Nick sich vor wie auf einem Jahrmarkt. Die Sonne blendete, die Farben waren grell und die Luft so klar, dass sie sich anfühlte wie Glas auf seiner Haut. Er musste erst blinzeln und die Augen mit der Hand abschirmen, bevor er die Szene vor sich erfassen konnte: Asphalt und grauer Beton, weiter hinten ein Kreis von bereits winterlich braunen Bäumen und ein einsamer, ausgemusterter Schulbus, der weiß lackiert worden war.
Sie strebten zum Bus, Nick als Letzter, auf seiner Lieblingsposition der letzten zweiundzwanzig Jahre. Ob beim Essenfassen, beim Duschen oder Hofgang: Er war gerne der Letzte. So bekam man mehr zu sehen.
Er blickte sich um.
Fast drei Uhr und immer noch bedeckte federförmiger Raureif den Boden. Sie hatten Jacken bekommen: dicke, hässliche braune Dinger, die sie über ihre Uniform anziehen sollten. Das Gefühl war so merkwürdig, als hätte sich Nick in eine klobige außerirdische Lebensform verwandelt.
So viele Dinge gab es hier draußen zu beobachten und so viele, die nicht die übliche Aufmerksamkeit erforderten. Unterdrückte Wut, Antanzen zum Essenfassen, Schichtwechsel, Medikamentenausgabe, Ruhezeit. Drinnen wurde die Aufforderung nach Ruhe durch größeren Lärm signalisiert. Und Ruhe bekam man nie, nicht wirklich. Ständig hörte man das Pissen von einem der Männer, die sich zu viert ein Klo teilen mussten. Dann den Klicker während der endlosen Zählungen, bei denen jeder Mann wie eine Kiste auf einer Palette registriert wurde. Und Stimmen natürlich. Ewiges Gemurmel, Gelächter, Geschrei. Schreie nach der Mama, selbst mitten in der Nacht.
Das Gefängnis stand auf einem völlig freigeräumten Gelände. Bäume waren gefällt, der Boden gemäht und für Besucherparkplätze asphaltiert worden. So hatten die Wachen einen ungehinderten Blick auf die gesamte Umgebung. Sie waren weit genug vom nächsten Ort entfernt, dass man nirgendwohin rennen konnte, und die einzigen Wagen, die vorbeifuhren, hatten eine ziemliche Geschwindigkeit drauf, weil Straßenschilder sie vor dem Anhalten warnten. Seit 1961 hatte es keinen erfolgreichen Ausbruch mehr gegeben, obwohl eine Geschichte über einen späteren Versuch kursierte, bei der der Ausbrecher es nicht mal vom Gelände geschafft hatte, sondern Stunden später im angrenzenden Wald gefasst worden war. Das sollte als Warnung dienen oder als Abschreckung.
Aber heute war es ganz egal, wie abgelegen es war und wie unwahrscheinlich eine Flucht.
Denn Nick hatte ein Fluchtfahrzeug besorgt.
Harlan besetzte den größten Teil einer der hinteren Bänke im Bus, daher entschied sich Nick für einen Platz auf der gegenüberliegenden Seite des Gangs. Die beiden anderen Insassen hatten die Plätze direkt vor ihnen, und der Wachmann war vorne.
Hintere Position. Das gefiel Nick. Er fragte sich, ob Harlan von seiner Vorliebe wusste oder sich ebenfalls gerne hinten hielt. Wahrscheinlich Letzteres. Harlan war nicht schlau genug, um durch reine Beobachtung Informationen über andere zu gewinnen.
Sie waren Zellengenossen, seit Nick eingefahren war, was hieß, dass Harlan ihm vollkommen ausgeliefert war. Nick wusste, was Harlan im Schlaf murmelte, wie er sich nach dem Pissen schüttelte und dass er während seiner gesamten Haft nur ein einziges Mal Besuch bekommen hatte. Aber dennoch kannte Nick ihn überhaupt nicht, wusste nicht, wie alt er war oder weswegen er saß – so was wurde hier nicht gefragt – oder auch nur, wer ihn damals besuchen gekommen war.
Nick befühlte den grünen Kunststoffbezug unter sich. Es war Jahre her, dass er diesen körnigen Stoff gespürt hatte.
»Hört zu«, befahl der Wachmann. Er berührte das Gewehr, das ihm mit einem Riemen über der Schulter hing.
Die Stimme des Wachmanns hatte einen ganz besonderen Unterton. Harlans Gesicht auf der anderen Seite des Gangs war ausdruckslos und leer, seine Züge grob. Harlan hatte nicht mitbekommen, was Nick gehört hatte, doch das hieß nicht viel. Harlan war loyal, besser als jeder andere da drinnen, dennoch hatte er nur Brei im Kopf, und das konnte nicht mit gutem Willen aufgewogen werden.
Die Stimme des Wachmanns klang leicht schrill. Er war es nicht gewohnt, ganz allein mit vier Mann draußen zu sein. Nick spürte einen Anflug von Befriedigung.
»Es geht um die Asphaltierung einer Brücke«, erklärte der Mann. »Gearbeitet wird in Zweierteams.«
Drinnen gab es immer nur so viele Informationen wie nötig. Ein zwischen den Gittern durchgeschobener Tagesplan hatte Nick verraten, dass er heute rauskam, doch ein paar Tage früher hatte es ihn zwei Päckchen und vier Flaschen gekostet, um Einzelheiten über ihren Job zu erfahren. Normalerweise hatte er genug Vorräte, doch bei diesem Tausch waren alle draufgegangen. Wenn er wieder reinkäme, würde er einen höllischen Flattermann und gemeine Kopfschmerzen bekommen, weil er eine Woche nichts zu rauchen und zu trinken hätte.
Aber er würde nicht wieder reinkommen.
»Geht ganz schnell. Einfach nur die Pylone aufstellen«, fuhr der Wachmann fort. »Wenn ihr’s gut macht, kommt ihr vielleicht mal länger raus.«
Nick sah, wie Harlans Stirn sich furchte. Er hatte es nicht so mit komplexeren Anweisungen.
Der Fahrer legte den ersten Gang ein, rollte vom Parkplatz und danach durchs Tor. Dann waren sie auf der Straße, einer richtigen Straße, so glatt wie ein Frauenarsch, und fuhren Richtung Norden.
Sie kamen zur alten Route 9. Das Ganze sah genauso aus, wie er es sich vorgestellt hatte. Erleichtert seufzte Nick auf. Der Informant, für den er seine Vorräte geleert hatte, hatte sich nicht geirrt.
Der Bus fuhr schwankend an den Straßenrand. Direkt vor ihnen führte eine kleine Anhöhe zu einer Brücke, auf der nur eine Fahrspur frei war. Die andere war frisch asphaltiert und glänzte wie Robbenhaut. Eine mobile Ampel glühte rot im Nachmittagslicht und sorgte dafür, dass sich entgegenkommende Fahrzeuge nicht auf der einzigen Spur der Brücke trafen. Die Budgets mussten knapp sein, wenn Häftlinge einen fast fertigen Job vollenden sollten. Es hatte sich einiges geändert, seit Nick reingekommen war. Andererseits war das nichts Neues.
Durch die Busfenster sah man einen Pick-up, der fast quer zur Fahrbahn parkte. Die Ladefläche war voll mit übereinandergestapelten orangefarbenen Pylonen.
Harlan neigte sich vor, um etwas zu sehen, und atmete Nick ins Gesicht.
»Lass das«, sagte Nick, worauf Harlan seinen massigen Körper wieder auf den Sitz sinken ließ und die Unterlippe zwischen seine Zahnlücken zog.
»Holt die Pylone und stellt sie auf, im Abstand von etwa einem Meter«, sagte der Wachmann laut, um sein Unbehagen zu überspielen. »Fangt an entgegengesetzten Enden an und trefft euch in der Mitte.«
Der Häftling vor Nick stand auf. Klein – jedenfalls für Knastmaßstäbe – und dunkelhäutig mit drahtigen weißen Locken und zurückweichendem Haaransatz.
Er blickte durchs Fenster und starrte auf die Straße.
Dieser Häftling war noch einer von der ganz alten Schule. Er hatte schon gesessen, als Nick nicht mal geboren war. Old-School, wie er genannt wurde, war ein Schutzwall, eine Säule des Gefängnisses, denn der half dabei, achthundert Männer davon abzuhalten, es in Stücke zu hauen. Die Kunde besagte, dass er derjenige war, der beim Fluchtversuch vor über fünfzig Jahren geholfen hatte, doch das hatte Nick nie glauben können. Die Geschichte war ihm schon immer unglaubwürdig vorgekommen. Wieso wäre Old-School damals nicht selbst geflohen?
Die neueren Insassen nutzten die endlose Zeit ihrer Haft, um Gewichte zu stemmen, aber Old-School hatte das längst hinter sich und erlaubte sich im Laufe der Jahre, zu schrumpfen und zu schrumpeln. Dennoch umgab ihn Autorität und Würde. Die nervöse Wachsamkeit der Neuen, die immer auf der Hut waren, immer Ausschau hielten, hatte sich abgenutzt, war verwischt wie das Dunkelgrau seiner Haut. Er bekam alles mit – man überlebte drinnen nicht lange, wenn man nicht aufpasste –, aber das mit einer gewissen Akzeptanz. Selbst das hat ein Ende, sagte er mit jedem langsamen Blinzeln seiner Augen. Alles hat ein Ende.
»Kriegen wir Probleme mit dieser Ampel?«, fragte Old-School, die Augen immer noch auf die Straße gerichtet. »Wenn Autos durchrasen und unsere Pylone überfahren?«
»Wir kriegen keine Probleme, es sei denn, ihr macht welche«, erwiderte der Wachmann.
Nick überflog das Terrain und suchte nach Anzeichen etwaiger Störungen. Er hatte das hier seit einem Jahr geplant, hatte sich gut benommen und bemüht, einen Job draußen zu ergattern. Obwohl er auf alle anderen wahrscheinlich wirkte wie ein ganz normaler Knastbekehrter, der endlich das Licht gesehen hatte und seine Missetaten bereute, hätte die gute Führung ihn fast umgebracht. Wann immer jemand ihm krumm kam oder ihn provozieren wollte, musste er sich beherrschen. Für Harlan war gute Führung ganz leicht; er war von Natur aus fügsam und wollte gefallen. Aber Nick hatte sich jeden sauerstoffreichen Atemzug hier draußen schwer verdient, und da würde kein weiser alter Knastbruder ihm die Tour vermasseln.
Der blinzelte. »Ich mach keine Probleme«, sagte Old-School.
Nick entspannte seine Fäuste und atmete noch mal tief die berauschende Luft ein.
Der Wachmann teilte Warnwesten mit orangefarbenen Leuchtstreifen aus. »Dann raus aus dem Bus.«
Harlan war so bullig, dass auf jeden Schritt eine Pause folgte, als Nick hinter ihm aus dem Bus stieg. Durch die nackten Äste der Bäume schien die kühle Sonne. Gemeinsam, fast synchron, näherten er und Harlan sich dem Pick-up. Harlan hob einen Stapel Pylone hoch und nahm den sperrigen Plastikturm auf den Arm wie ein Kleinkind. Old-School und der andere Häftling zogen mühsam ihre eigenen Stapel von der Ladefläche.
Als das Licht auf einmal kränklich fahl wurde, blickte Nick auf und sah, dass die mobile Ampel auf Grün geschaltet hatte. Eine alte Limousine schoss über die Brücke, der Fahrer sichtlich entnervt von der Warterei.
Timing war hier das A und O.
Old-School und der andere Häftling hatten schon das andere Ende der Brücke erreicht, wahrscheinlich weil sie dachten, dadurch die Spitzenposition möglichst weit weg von Wachmann und Bus zu gewinnen. Aber Nick war gerne der Letzte.
Der Wachmann blickte zu Nick und Harlan und ruckte mit dem Kinn, damit sie einen Zahn zulegten. Sein Blick wanderte unkonzentriert über die Szenerie: zum Wald, den angrenzenden Feldern, dem Fluss. Erst ganz zuletzt überflog er die lange, leere Straße, die nur ein Narr zur Flucht nutzen würde, da er sofort gesehen würde.
Auf der anderen Seite der Brücke setzte Old-School einen Pylon ab, so präzise, als wäre die Stelle von einem Instrument bestimmt worden.
Ein Wagen raste vorbei, und sein Auspuff hinterließ den Duft von Freiheit, dann schaltete die Ampel auf Rot. Nick blickte auf. Zwei Wagen ließen beim Warten die Reifen abkühlen.
Er beobachtete sie und merkte, dass Harlan dasselbe machte. Also hatte Harlan nicht vergessen, was sie hier draußen wollten. Das hieß schon was: Normalerweise hatte Harlan ein Gedächtnis wie ein Sieb. Also wollte er es wohl wirklich. Eine Sekunde lang fragte sich Nick, wieso eigentlich. Wollte Harlan wirklich raus? Oder ertrug er es nur nicht, ohne Nick drinzubleiben? Nick brauchte Harlan aus naheliegenden Gründen: Er war groß und konnte andere einschüchtern. Aber in gewisser Weise schien Harlan auch ihn zu brauchen. Bei dieser Erkenntnis wurde Nick ganz seltsam zumute, und er nickte Harlan kurz und anerkennend zu.
Harlans breites Gesicht glühte auf.
Dann blickte Nick genauer hin und runzelte die Stirn.
Nick hatte genau darauf geachtet, wie lange die Ampel rot blieb, und zu einem stetigen Takt im Kopf die Sekunden gezählt. Aber Harlan bewegte deutlich sichtbar die Lippen und stieß kleine Wölkchen in die eiskalte Luft. Wenn der Wachmann näher bei ihnen stünde – oder Lippen lesen könnte –, könnte er auch sehen, dass Harlan zählte.
»Lass das!«, befahl Nick leise.
Der Pylon, den Harlan gerade platzieren wollte, kippte um und fiel auf den Asphalt.
Nick bückte sich, um ihn richtig hinzustellen, und schlug Harlan leicht gegen den Arm.
Es war, als schlüge man auf einen Stahlträger.
Als die Ampel umschaltete, fuhren beide Wagen über die Brücke. Dabei hielten sie großen Abstand zu Old-School und dem anderen Häftling auf der Gegenfahrbahn.
Harlan verstummte, genau wie das Zählen in Nicks Kopf.
Er war auf neunzig gekommen. Eineinhalb Minuten.
Bei fünfundsiebzig Sekunden würden sie reinspringen. Dann hatten sie noch fünfzehn Sekunden für das Überraschungsmoment, die unvermeidliche Gegenwehr und die Übernahme.
Nick trat auf die rechte Seite der mobilen Ampel, einem Metallkasten auf Stelzen, der aussah wie ein riesiger Reiher oder Storch. Harlan stapfte zu ihm und wirbelte Steinchen mit seinen Schuhen auf.
Der Wachmann machte sich auf den Weg zu ihnen.
»Mein Gott«, sagte er, »draußen sieht er noch größer aus, was?«
Harlans Wangen wurden rot, eine breite Schneise auf dem flächigen Gesicht.
Ein weiterer Wagen – ein großer, schicker SUV – erschien auf der Anhöhe. Nick konnte direkt durch die Windschutzscheibe sehen und erkennen, dass der Fahrer allein im Auto saß.
Nach Nicks innerer Zähluhr würde die Ampel jeden Moment rot werden. Also war das ihr Wagen.
»Ja, Sir«, sagte Nick.
Der Wachmann wandte seine hellen, ausdruckslosen Augen zu Nick. »Ich will hier kein Sir hören«, sagte er mit immer noch leicht schriller Stimme.
Fünfzig Sekunden.
Die Ampel glühte wie eine rötliche Brandwunde, der SUV wartete im Leerlauf davor.
Nick öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder, bevor er was sagen konnte. Er hatte keine Ahnung, was dieser neue Typ Wachmann hören wollte.
Old-School kam wieder über die Brücke zurück und trat zu ihnen. »Wir sind fertig mit unserer Seite. Sollen wir die auch noch übernehmen?«
Der Wachmann drehte sich langsam um. »Werden hier etwa meine Anweisungen in Frage gestellt?«
»Aber nein«, sagte Old-School und blieb auf seine würdevolle Art stehen.
Der andere Häftling trottete über die Brücke und gesellte sich zu ihnen.
Der Wachmann schnaubte leicht. »Zurück in den Bus.«
Old-School ließ den anderen vorgehen.
Zentimeter für Zentimeter schob sich der SUV vor und machte sich zum Start bereit.
Kapitel zwei
Sandy kannte den SUV nicht, der vor ihrem Haus stand. Sie versuchte, einen Blick hineinzuwerfen, aber die Scheiben waren getönt. Sie wusste nicht mal, ob ein Mädchen am Steuer saß oder ein Junge. Sie nahm sich vor, Ivy später danach zu fragen.
Die Beifahrertür ging auf, allerdings nur einen Spaltbreit – neuerdings waren die Türen so schwer und fielen außerdem automatisch zu –, und dann sah Sandy ihre Tochter aussteigen.
Ivy hatte im August Geburtstag und war folglich die Jüngste in ihrer Klasse. Die meisten ihrer Klassenkameraden hatten schon einen Führerschein. Sandy und Ben hatten überlegt, ob sie Ivy verbieten sollten, mit ihnen zu fahren, waren jedoch zu keinem Entschluss gekommen. Die Kinder wurden immer größer und kamen in die Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenendasein. Hielte man Ivy zurück, würde sie nur rebellisch. Es war nicht ihre Schuld, dass sie die einzige Fünfzehnjährige unter Sechzehn- und Siebzehnjährigen war.
Wer auch immer den Wagen fuhr, trat jetzt vorsichtig den Rückzug an, manövrierte den SUV über die halbmondförmige Kiesfläche und rollte in mäßigem Tempo die Auffahrt hinunter.
Sandy sah zu, wie ihre Tochter die breiten Steinstufen hinaufstolzierte und dabei mit den Hüften wippte, die sich gerade zu runden anfingen. Also wahrscheinlich doch ein Junge im Wagen. Als Mac zu ihr trottete, begrüßte ihn Ivy mit einem Tätscheln und kniff sich die winzige Nase zu, da Mac mit heraushängender Zunge hechelte. Wie hübsch ihre Tochter geworden war – und das über Nacht! Eben noch war sie doch einfach nur niedlich gewesen.
»Du stinkst aus dem Maul, Mackie«, sagte Ivy.
Der Hund ließ die mächtigen Schultern sinken, drehte sich einmal um sich selbst und hielt sich dann dicht an Ivy. Sandy streckte die Hand aus und berührte Ivys Arm, als sie vorbeiging. Ivy warf ihr einen Blick zu.
»Keine Begrüßung?«, fragte Sandy leichthin.
»Hallo«, erwiderte Ivy.
In letzter Zeit schaffte Ivy es, selbst Gehorsam rebellisch wirken zu lassen.
Sandy vergewisserte sich, dass die Außenlampe an war, denn es dämmerte bereits. Wie war der Nachmittag nur so schnell vorbeigegangen? Nicht nur Ivy, auch Ben war heute zu spät.
Sandy drückte die Haustür zu und achtete darauf, dass das Schloss einrastete – mit einem satten, beruhigenden Klacken, obwohl hier draußen natürlich niemand abschloss. Sie warf einen Blick über ihre Schulter. Ivy war schon im Haus verschwunden.
In der Küche schepperte etwas. Sandy folgte den Geräuschen und entdeckte, dass Ivy auf der Kücheninsel eine Auswahl an Sandwichzutaten aufreihte.
»Ich habe gekocht«, erklärte Sandy. »Spaghetti mit Tomatensauce. Ohne Fleisch.«
Ivy knallte zwei Brotscheiben direkt auf die Anrichte.
Hier solltest du sagen: Aber du magst doch lieber Bolognese, Mom, worauf ich antworte: Kein Problem, ich passe mich gerne an, führte Sandy im Geiste die Unterhaltung mit Ivy fort. Das waren in letzter Zeit die besten Gespräche zwischen ihnen. Dann fiel ihr ein Blatt Papier auf, das mayonnaiseverschmiert auf der Anrichte lag.
Sandy sah es sich an, während Ivy ihr schlaffes Sandwich zum Mund führte und hineinbiss.
Das Blatt war offenbar ein Geschichtstest, obwohl das wegen der vielen roten Striche schwer zu sagen war. Allerdings war die Ziffer darunter eindeutig.
»Eine Sechs, Ivy?«, fragte Sandy schockiert.
Ivy zuckte die Achseln und biss noch mal von ihrem Sandwich ab.
Mac legte sich zu Ivys Füßen hin und ignorierte die Brotkrumen, die auf ihn herabregneten. Sie hatten ihn sorgfältig darauf dressiert, nichts vom Boden zu fressen, obwohl Mac ihnen keinen großen Widerstand entgegengesetzt hatte. Er fügte sich eigentlich in alles, was sie wollten. Jetzt sah Sandy, wie ihre Tochter ein Stückchen Kruste von ihrem Sandwich abriss, es ihm vor die Nase hielt und dann absichtlich fallen ließ. Nach kurzem Zögern leckte Mac es auf und schluckte es mit einem dankbaren Schmatzen.
Nicht schlimm, dachte Sandy, als er schuldbewusst zu ihr aufblickte. In einem Duell mit einem Teenager kann nicht mal ein Hund gewinnen.
Sie unterschrieb Ivys Test und löste dann eine von Ivys Händen von deren Sandwich, um ihr das Blatt hineinzudrücken. Selbst in diesen Zeiten genoss sie es, ihre Tochter zu berühren. »Steck das doch weg, ja?«, sagte sie zu ihr. »Wir können Dad ja ein andermal davon erzählen.«
Ivy verstaute den Test in ihrem Rucksack. Als sie sich aufrichtete, blickte sie Sandy direkt an. »Das war’s?«
»Wie meinst du das?«, fragte Sandy zurück.
Ivy starrte sie finster an.
Sandy blinzelte. »Hör mal, Ivy. Ich habe den Test unterschrieben. Du kriegst keine Strafe. Ich bestehe nicht mal darauf, dass wir es Dad jetzt erzählen, und du –«
Ivy unterbrach sie. »Werden wir es ihm überhaupt sagen?«
»Was?«
Ivy schob sich den Rest des Sandwichs in den Mund und sagte undeutlich: »Du hast mich schon verstanden. Werden wir Dad je etwas von dem Test sagen?«
Sandy seufzte. »Warum tust du das? Es ist ja fast, als suchtest du Streit.« Kurz fuhr ihr durch den Sinn, dass dies den Sachverhalt nicht ganz traf. Aber es war, als wollte man im Dunkeln einen Gegenstand ertasten. Sie kam einfach nicht darauf, was es war.
Ivy wischte sich an der Jeans die Hände ab. Früher hatte es so enge Jeans gar nicht gegeben.
»Du weißt, wieso«, sagte sie.
Sandy schüttelte den Kopf. »Nein, ehrlich nicht.«
Ivy starrte sie an.
Sandy wusste, dass es sinnlos war, sich mit einer Fünfzehnjährigen auf ein Blickduell einzulassen. Also drehte sie sich um, machte sich an der Anrichte zu schaffen und sprach über die Schulter hinweg.
»Hör mal, Schatz, mach doch erst mal deine Hausaufgaben, ja? Dann bist du fertig und kannst dich zu uns an den Tisch setzen, auch wenn du keinen Hunger hast.«
Ivy griff nach ihrem Rucksack. Als sie die Küche verließ, drehte sie sich noch einmal um und fragte: »Wer sagt denn, dass ich keinen Hunger habe?«
Sandy fasste das als Friedensangebot auf und nahm es an. »Na, dann ist ja gut. Ich habe auch Salat gemacht. Heute Abend gibt’s so viel Gemüse, wie du nur willst.«
»Hast du auch das Dressing, das ich so mag? Das richtig gute mit Basilikum?«
Sandy nickte. »Mmm, und mit Sesam. Ich mag das auch sehr.«
Einen Augenblick lächelten sie sich an.
Sandy unterdrückte den Drang, sie noch mal an die Hausaufgaben zu erinnern. Sie wollte die zarte Bindung zwischen ihnen nicht gefährden, die so leicht reißen konnte wie die frische Haut auf einem Pudding. Doch sie wusste, dass Ben verärgert sein würde, wenn die Hausaufgaben bei seiner Ankunft nicht zumindest schon angefangen waren. Ihr Mann war das ultimative Arbeitstier und glaubte fest an den Grundsatz Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. »Ich bin ziemlich sicher, dass wir noch eine Flasche davon haben«, sagte sie. »Aber fang mit den Hausaufgaben an, ja?«
»Ich habe nichts auf.«
Sandy hatte sich darangemacht, in den Tiefen ihres überdimensionalen Kühlschranks nach der Salatsauce zu suchen; jetzt hob sie den Kopf. »Bist du sicher? Denn das wäre das erste Mal seit der Mittelschule, dass du keine Hausaufgaben hast.«
»Ich hab sie schon mit Cory gemacht«, erklärte Ivy. »Dem Jungen, der mich gebracht hat.«
»Ivy«, setzte Sandy an. Sie wusste, dass Ivy log, hatte aber keine Ahnung, warum. Zuerst der Test und jetzt das hier. Obwohl ihre Tochter in diesem Jahr schulisch etwas nachgelassen hatte, war das kein Problem, weil sie mit sehr guten Noten – einem Einserdurchschnitt in fast allen Haupt- und Nebenfächern – begonnen hatte. Doch dies war eine ganz neue Ivy.
»Was ist?«, fragte ihre Tochter trotzig. »Willst du das nachprüfen? Meine Sachen durchwühlen?«
Neuerdings war ein Streit mit Ivy nie vollkommen beigelegt, sondern konnte wie ein Feuer jederzeit wiederaufflackern. Sandy wusste von den Geschichten, die ihre Patienten ihr von deren Teenagern erzählten, und ihr war klar, dass das Verhalten vollkommen normal war. Doch das machte es noch lange nicht angenehmer, vor allem für jemanden, der sich immer nach Ruhe und Frieden gesehnt und seine Familie darauf gegründet hatte.
»Was ich will«, sagte Sandy und trat näher zu ihrer Tochter, »ist, dass du nach oben gehst, deine Hausaufgaben erledigst und dann nach unten kommst und mit Dad und mir zu Abend isst. Was ich will, ist ein schönes gemeinsames Essen. Was ich will –«
Ivys zusammengepresste Lippen zitterten kurz. »Behauptest du etwa, ich würde lügen?«, unterbrach sie sie.
»Nein«, sagte Sandy. »Das behaupte ich nicht. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass du noch Hausaufgaben hast. Und ich habe keine Ahnung, wieso du das Gegenteil behauptest.«
»Gut«, erwiderte Ivy, und diese sinnlos wirkende Antwort brachte Sandy kurz aus dem Konzept. »Denn du bist die Lügnerin.«
Das haute Sandy um. »Wie bitte?« Sie trat einen Schritt vor und war überrascht, als Ivy zurückwich. »Wovon redest du? Wann habe ich dich je angelogen?«
Schockierenderweise fing Ivy an zu weinen. Sie wischte sich übers Gesicht und schmierte sich dabei etwas Senf von der Hand auf ihre Wange, so dass sie einen Augenblick lang wieder aussah wie das kleine Mädchen, das sie doch vor höchstens ein paar Tagen noch gewesen war.
»Ich weiß nicht, Mom«, schniefte sie.
Sandy wollte sie trösten und trat noch einen Schritt auf sie zu, doch da wandte Ivy sich ab. Aller Trotz und jedwedes pubertäre Gehabe waren von ihr abgefallen. Mit hängenden Schultern schlurfte sie davon. Mac tat es ihr nach.
Auf dem Flur blieben sie stehen.
Sandy blickte zu Mac. Der starrte sie mit einem leuchtend blauen und einem dunklen, halbgeschlossenen Auge an.
»Ich weiß nicht, wann, warum oder inwiefern du lügst, Mom.« Ivy holte so tief Luft, dass sich ihr Brustkorb hob. »Aber ich weiß, du tust es.«
Flucht
Nick schob seine Füße in Zeitlupe über ein paar trockene Blätter. Ihr Rascheln war kaum hörbar, konnte jedoch alles zum Einstürzen bringen. Er sah, wie die Straße sich bis in die Ferne erstreckte.
Verwirrung huschte über Harlans Miene. Offenbar versagte mal wieder sein Gedächtnis, und jetzt merkte er, wie sein einziger Freund von ihm abrückte, ohne zu wissen, warum. Sekunden verstrichen, in denen Nick abwog, was riskanter war: ihm eine Erinnerung ins Ohr zu zischen, die bei ihm vielleicht gar nicht ankam, oder zu warten, dass Harlan sich von selbst wieder an den Plan erinnerte.
Da dämmerte es Harlan, und er bewegte sich kaum merklich zu Nick. Jetzt standen sie neben ein paar Bäumen an der Straße.
Der Blick des Wachmanns war auf den anderen Häftling gerichtet, der langsam zum Bus schlenderte und seine letzten Sekunden in Freiheit auskostete. Old-School hatte wohl jede Hoffnung auf Flucht aufgegeben. Nick konnte sich lebhaft vorstellen, wie er sich resigniert einen Platz suchte und schweigend hinsetzte.
Es war Zeit. Noch fünfzehn Sekunden, dann würde die Ampel umschalten und der SUV starten.
Nick langte nach dem Griff der hinteren Tür. Die würde bestimmt nicht verriegelt sein, das waren die Autos hier nie. Weder beim Fahren noch beim Parken, noch in Scheunen oder Garagen. Ganz anders als im Bau, wo Argwohn und Misstrauen die Luft vergifteten, die sie einatmeten. Bis er eingefahren war, hatte er solches Misstrauen nie erlebt.
Ein freundliches Klopfen am Fenster hätte denselben Zweck erfüllt, doch das hätte auch die Aufmerksamkeit des Wachmanns auf sie gezogen. Unauffälliges Einsteigen war entscheidend. Und dieses Fahrzeug lud geradezu dazu ein. Selbst die schön getönten Fensterscheiben, die Standard geworden waren, seit er einsaß. Diese Entwicklung hatte Nick bei Krimis und der TV-Werbung mitverfolgen können.
Harlan drängte sich gegen ihn, so dass ihr Einsteigen alles andere als unauffällig war.
Die Fahrerin fuhr herum. Beim Anblick von Harlan, der fast die gesamte Rückbank in Anspruch nahm und mit dem Kopf gegen die Decke drückte, schnappte sie nach Luft – es klickte hörbar in ihrer Kehle.
Harlan hatte kaum seine Beine aus dem Weg geräumt, da zog Nick schon die Tür zu. Darauf folgte ein zweiter gedämpfter Schlag, den er nicht einordnen konnte.
Drei, vielleicht auch vier Sekunden waren vergangen.
»Fahren Sie«, sagte Nick im Plauderton. »Dann lassen wir Sie am Leben.«
Er erhaschte einen Blick vom Wachmann, der stirnrunzelnd seinen plötzlich dezimierten Arbeitstrupp musterte.
Eine Kugel schoss knallend in den diesigen, grauen Himmel. Ein Warnschuss, ein Alarm oder vielleicht auch nur ein sinnloser Wutausbruch des Wachmanns.
»Fahren!«, brüllte Nick.
Harlan zuckte so heftig zusammen, dass der große Wagen ins Schaukeln geriet.
Da wurde es grün, und der SUV schoss los.
Das Wageninnere war so komfortabel wie ein Wohnzimmer – oder noch komfortabler –, allerdings wie ein Wohnzimmer, in dem ein halbes Dutzend Teenager lebte. Der ganze Boden war mit Fastfoodpapier, Schminksachen und Essensresten zugemüllt, und auf den Sitzen klebte etwas Weißliches, Pulvriges, das Nick an Schuppen erinnerte. Als im gedämpften Licht etwas silbern aufblinkte, erkannte Nick, dass es Reste vom Nägelfeilen waren. Seine Hand schoss so schnell vor wie die Zunge einer Schlange und schloss sich um eine schmale, aufgeraute Nagelfeile, die zwischen Tür und Sitz steckte.
Er konzentrierte sich wieder auf die Fahrerin. Ihre Hände am Steuer zitterten, und der große Wagen schlingerte beim Fahren.
»Geben Sie mir Ihr Handy«, sagte Nick, immer noch im Plauderton. Hier draußen hatte man ohnehin keinen Empfang, aber er wollte kein Risiko eingehen. Er hatte Monate damit verbracht, jede der Veränderungen in den letzten zweiundzwanzig Jahren zu berücksichtigen und über mögliche Auswirkungen nachzudenken. Sein Plan würde nicht scheitern, weil mittlerweile jeder Computer nutzte oder Polizei in der Gegend auftauchte.
Ihm wurde bewusst, dass Harlan neben ihm schwer atmete und in der Wärme des Wagens wahre Hitzewellen verströmte.
Als die Frau an etwas neben ihrem Sitz fummelte, stockte Nick kurz das Herz. Sie hatte ein Funkgerät oder kannte jemanden bei der Polizei; vielleicht war sie selbst ein Cop. Doch dann warf die Frau ihre Handtasche über den Sitz, und eine Ansammlung nutzloser Gegenstände nebst Handy und Brieftasche purzelte heraus.
Nick nahm das Geld aus der Brieftasche und untersuchte dann das Telefon. Am Gehäuse war eine Klappe; als er daran zupfte, sprang sie auf. Darin steckte das, was dem Gerät den Strom gab. Nick entfernte es. Jetzt konnte man die Frau nicht mehr über das Mobiltelefon orten. Das hatte er unter anderem im Bau gelernt: Jeder hatte mittlerweile eines von diesen elektronischen kleinen Dingern, mit denen man eine Menge mehr anstellen konnte als nur telefonieren.
»Was wollen Sie?«, fragte die Frau, jedoch ohne Nachdruck und ohne eine Antwort zu erwarten. Ihr Ton war schwach und weinerlich.
Nick drückte auf den Knopf, um die Scheibe herunterzulassen, doch nichts geschah. Er drückte etwas heftiger darauf.
»Was zum Teufel«, fragte er Harlan leise.
Harlan streckte die Hand aus. Sie blockierte die gesamte Seitenlänge des Fensters.
Kindersicherungen, begriff Nick. Als er sich umdrehte, entdeckte er eine dritte Rückbank, die meilenweit entfernt schien und Sitze mit besonderen Gurten hatte. Darauf türmten sich mehrere Haufen, vielleicht Kisten mit Kleidern, aber das war unmöglich auszumachen.
»Lassen Sie das Fenster herunter«, knurrte Nick.
Die Frau fuhr auf und stieß einen leisen Schrei aus. Dann fing sie an, auf mehrere Knöpfe einzuhauen. Nick hätte fast gelacht, so viele waren es.
»Soll ich nach vorne kommen und helfen?«, fragte er und hob sich halb vom Sitz.
Harlan legte Nick eine Hand auf den Arm, die Nick mit einiger Mühe abschüttelte.
»Nein, nein«, rief die Frau. Sie schlug weiter auf die Knöpfe ein. Man hörte Klatschen und Surren, bis seine Fensterscheibe endlich nach unten fuhr.
Nick warf die Einzelteile des Handys hinaus in die kalte Luft des anbrechenden Abends.
»Und jetzt«, sagte er, wieder freundlich, »möchte ich, dass Sie die 9 verlassen und Richtung Wedeskyull fahren. Wissen Sie, wo das ist?«
»Ja«, flüsterte die Frau. »Ich wohne dort.«
»Ah«, sagte Nick. »Umso besser. Aber wir wollen nicht in die Innenstadt, sondern zu einer Straße etwas außerhalb. Die Long Hill Road. Kennen Sie die?«
»Ja, die kenne ich«, antwortete die Frau und klang merkwürdigerweise erfreut, als hätten sie eine Gemeinsamkeit entdeckt.
Nick blickte auf die vorbeifliegenden Bäume, die ihre nackten Äste nach ihnen ausstreckten.
»Gut«, sagte er. »Dann mal schnell.«
Am Ende erwies sich die Frau als gute Fluchtwagenfahrerin. Sie gab Gas und drosselte nicht mal in den Kurven das Tempo.
Aber ein Stoppschild neben einem langgezogenen Feld zwang sie schließlich anzuhalten.
Nick spürte die Gelegenheit, bevor sie der Frau in den Sinn kam. Er besaß eine instinktive Schläue. Das hatte auch seine Mutter immer gesagt. Und Nick hatte sich daran gewöhnt, seinem Instinkt zu vertrauen, vor allem im Gefängnis. Jetzt wollte er nach vorn klettern. Von seiner Position aus konnte er sehen, wie hübsch die Frau war, wenn auch nicht mehr ganz jung. Ihre braunen Haare hatten schon silberne Strähnen, und ihre Augen hinter der Brille waren flaschengrün. Wegen der Bullenhitze im Wagen hatte sie den Mantel ausgezogen, so dass man ihren Busen unter dem enganliegenden Oberteil sehen konnte.
Harlan ließ seine Hand auf seine Schulter fallen – dazu musste er nicht mal den Arm ausstrecken – und zog Nick zurück. Die Hand war wie ein Sandsack und hielt Nick für eine entscheidende Sekunde auf.
Nick drehte sich nach hinten. Er hörte mühsames Atmen, das selbst für Harlan zu laut war. Da hinten konnte unmöglich noch einer sitzen. Keuchte die Frau derartig?
»Lass mich los«, befahl Nick und huschte mit dem Blick über die Ecken und Nischen.
Harlan blickte auf seine Hand, als gehörte sie ihm nicht.
Die Frau schnallte sich ab und drückte den Türgriff. Die Tür sprang auf, fiel direkt darauf aber fast wieder zu und warf die Frau auf den Sitz zurück. Doch konnte sie im letzten Moment noch entwischen, bevor die Tür endgültig zufiel. Dann rannte sie los und setzte mit ihren hochhackigen Stiefeln ungelenk übers Feld.
Da hob Harlan endlich die Hand, worauf Nick ihm die Nagelfeile in die Hand drückte und einen Befehl ausstieß. Die Feile war nur zur Sicherheit; Harlan würde außer seinen Fäusten, Füßen oder Fingern keine Waffe brauchen.
»Nein«, sagte Harlan und schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht.«
Nick kniff die Augen zusammen und blickte ins Dämmerlicht. Die Frau hatte schon ein gutes Stück geschafft – obwohl es nichts gab, wohin sie sich hätte retten können. Daher konnte Harlan sie leicht einholen, nicht weil er so schnell oder athletisch war, sondern weil er durch seine schiere Größe mühelos die Strecke überwinden konnte, die zwischen der Frau und der Straße lag.
»Nick«, sagte Harlan und legte seine Stirn in Falten. »Bitte. Sie haut doch ab.«
Nick schlug aufs Armaturenbrett. »Und du glaubst, sie wird uns einfach dieses Baby hier überlassen?«
Harlan fing an, an seiner Unterlippe zu nagen.
»Außerdem weiß sie, wohin wir wollen.«
Harlans Augenbrauen wirkten wie eine Raupe auf seiner Stirn, als er sie gleichzeitig hob, um Nick direkt anzusehen. Harlan war nicht schlau, hatte aber von Beginn an Nicks Körpersprache lesen können. Das hatte sie zusammengeschweißt. Jetzt wusste Harlan, dass Nick nicht lockerlassen würde, bis er seinen Willen hatte.
»Du willst doch frei sein, Harlan, oder nicht?«
Harlans mächtiger Schädel nickte und schickte einen Luftzug zu Nick.
»Tja, im Leben ist nichts umsonst. Man muss auch was dafür tun.«
Diese Universalregel galt auch im Knast, und Harlan hatte sie sich gut eingeprägt.
Doch dieses eine Mal tat er nicht bereitwillig das, was man ihm aufgetragen hatte. Normalerweise hatte Nick Geduld mit ihm, aber langsam nervte ihn, dass die Frau immer weiter weghastete.
»Ich habe dir gesagt, was du tun sollst«, erklärte Nick, ohne die Stimme zu heben. »Und jetzt tu es.«
Harlan fuhr auf, als hätte man an ihm gerissen. Mit überraschend geschickten Fingern schnappte er sich die Nagelfeile. Dann stieg er wie ferngesteuert aus dem Wagen, allerdings auf der falschen Seite, worauf ein vorbeirasender Wagen ausscherte und vorwurfsvoll hupte. Das schien Harlan gar nicht zu merken, als er schwerfällig übers Feld lief.
Die Frau gab jetzt Gas und steuerte auf ein Wäldchen am Feldrand in der Ferne zu. Wenn sie das erreichte, konnte sie im Dämmerlicht zwischen den Bäumen verschwinden.
Aber Harlan holte sie ein, packte sie von hinten und wirbelte sie mit einer Hand herum. Nick war mittlerweile so weit weg, dass Harlan brüllen musste, um gehört zu werden.
»Sie hat nicht mal einen Mantel an! Ich muss gar nichts machen, sie erfriert hier sowieso!« Er wandte seinen riesigen Schädel in Nicks Richtung.
Mit großen Schritten kam Nick näher. Die Botschaft in seinem Blick war unverändert. Als er in Laufschritt verfiel, bildeten sich weiße Wölkchen vor seinem Mund und überzogen den Befehl an Harlan mit einem Schleier.
»Nein«, flehte die Frau. »Bitte nicht. Ich verrate es auch niemandem. Sie können den Wagen haben!«
Harlan hob den Arm, so dass weder Frau noch Himmel mehr zu sehen waren. Die körperlose Stimme schrie so schrill auf, dass sich ein Schwarm Vögel in die Lüfte erhob.
»Bitte, nein! Nein! Ich habe Kinder!«
Harlan riss die Feile nach unten und stieß sie der Frau in die Halsschlagader. Es hörte sich an, als würde er durch ein Steak schneiden.
Die Frau ging weiter, als wäre nichts passiert. Nach ein, zwei Sekunden hüpfte sie einmal, so als würde sie über einen Stein springen. Dann fiel sie mit dem Gesicht nach unten auf den flachen Feldboden.
Nick trat zu ihr. Jetzt war Zeit der entscheidende Faktor, und sie mussten weg von der Leiche. Dennoch stand er da, gebannt von dem Anblick, den er seit über zwanzig Jahren nicht mehr zu sehen bekommen hatte. Der Blutstrom aus dem Hals der Frau war vor dem Hintergrund der kargen Landschaft fast schön. Abgelenkt, nahm er nur halb bewusst wahr, dass Harlan davonstampfte.
Als er sich endlich umdrehte, schrak er zusammen. Harlan war zurückgekommen und ragte so hoch vor ihm auf, dass er das verbleibende Licht vollkommen abschirmte. Er hatte sich gegen Nicks Befehl gesperrt, und plötzlich blitzte das Bild vor Nicks innerem Auge auf, wie sie miteinander kämpften. Mit Gedankenkontrolle würde er nicht gegen die Kraft ankommen, die Harlan, ohne sich groß anzustrengen, aufbringen konnte.
Aber Harlan beugte sich nur vor und legte den Mantel, den er geholt hatte, über die am Boden liegende Gestalt.
Als sie wieder im Wagen saßen, starrte Nick auf das Armaturenbrett. Es sah aus wie in einem Cockpit. Er fand nicht mal einen Zündschlüssel oder den Schlitz, in den er gesteckt werden musste. Ständig warf er prüfende Blicke auf die Straße, weil er jeden Moment damit rechnete, einen Streifenwagen in der zunehmenden Dunkelheit auftauchen zu sehen. Er redete sich ein, sie wären schon ziemlich weit gefahren und der Wachmann hätte nicht mitbekommen, in welchen Wagen sie gestiegen waren. Also gab es keinen Grund, warum ein teurer SUV am Straßenrand Verdacht erregen sollte. Man würde nur denken, die reiche Schlampe im Wagen verteilte ein paar Safttüten an ihre Gören, die auf raffinierten Kindersitzen thronten, als reichte eine fettgepolsterte Rückbank für Fünfjährige nicht aus.
Nach ein, zwei Minuten ging Nick auf, dass der Wagen immer noch lief. Als er probeweise aufs Gaspedal trat, was ein leises Brummen zur Folge hatte, kämpfte der Motor gegen das Getriebe, das auf Park stand. Aber er war so leise, dass Nick nicht mal gemerkt hatte, dass er lief. Erst jetzt fiel ihm auch ein runder, rot leuchtender Knopf auf. Also sprangen Autos heutzutage ohne Zündschlüssel an. Fuhren sie auch allein?
Er schaltete auf Drive. Der Wagen schoss los wie ein Pfeil – und nicht wie etwas, das aus zwei Tonnen Stahl gebaut war.
»Wieso eigentlich?«, fragte Harlan missmutig, als Nick sich mit der leichten, flüssigen Handhabung des Lenkrads anfreundete. »Wieso müssen wir eigentlich dahin – zu dieser Long Hill Road?«
Überrascht warf Nick ihm einen Blick zu. Normalerweise stellte Harlan keine Fragen.
Er ließ sich Zeit, bevor er den Blick wieder zur Straße wandte. Diese Kiste fuhr sich praktisch von selbst. »Da hat jemand ein paar Sachen, die wir brauchen.«
Harlans Gesicht verzog sich vor Verwirrung.
»Ein Gefängnisausbruch hat zwei Phasen«, fuhr Nick fort. »Zuerst musst du rauskommen. Und dann musst du draußen bleiben.«
Harlan schien immer noch nicht zu begreifen, doch die Erwähnung ihrer ehemaligen Unterkunft ließ ihn derart in sich zusammensinken, dass er auf dem breiten Ledersitz fast zwergenhaft wirkte.
Nick bog nach rechts auf eine schmale, gewundene Straße. Es ging rauf und runter, um enge Kurven, durch Bodensenken, in einen dichten Wald. Die Bäume hier sahen aus wie eine Million Bratspieße.
»Nick?«, sagte Harlan und holte schnaufend Luft.
»Ja?«
»Nie mehr, ja?«
Der SUV nahm eine Kurve, als klebte er an der Straße. »Na klar, Harlan.«
Harlan streckte die Hand aus und umfasste Nicks Oberarm. Dabei berührte sein Daumen die Fingerspitzen. Nick versuchte, ihn abzuschütteln, hatte aber keine Chance. Der Wagen scherte leicht aus, weil es schwer war, so zu lenken. Erde und Laub unter den Reifen brachten den Wagen zum Schlittern, so dass er gefährlich nah an einen Abgrund geriet.
Nick bremste. Er kippte den Kopf nach hinten und sah Harlan direkt an.
»Okay, ist gut«, sagte er. Er wusste genau, was Harlan meinte. »Versprochen. Nie mehr.«
Da ließ Harlan ihn los und machte es sich auf seinem Sitz bequem, was den ganzen Wagen zum Schaukeln brachte.
»Aber jetzt los«, sagte Nick. »Hilf mir beim Suchen.«
Harlan wandte ihm den Kopf zu. »Was denn?«
Da entdeckte Nick verschwommene Lichtpunkte in einem Haus, das hoch auf einer Anhöhe stand. Er bremste erneut, ließ den SUV zurückrollen und hielt hinter ein paar überhängenden Ästen. Kurz spähte er durch sie hindurch zum Haus, das zurückzublicken schien.
»Das«, sagte er.
Kapitel drei
Sandy schenkte sich eine Tasse Kaffee aus der Kanne ein, die sie vor einer Weile gekocht hatte, und merkte, dass ihre Hand zitterte. Der Kaffee war schwarz und dickflüssig vom langen Stehen. Wahrscheinlich würde sie dadurch nur noch nervöser werden. Also schob sie die Tasse weg und verspritzte dabei ein paar schwarze Tropfen auf der Anrichte.
Woher nahm Ivy nur diese Anschuldigung? Es war, als hätte man an einem tropischen Strand gelegen und würde plötzlich von einem Tsunami getroffen. Wenn es eines gab, worauf Sandy sich immer voller Stolz hatte verlassen können, dann war es die Harmonie in ihrer Familie. Selbst die Stürme der Pubertät bestanden größtenteils darin, dass Ivy sich unter einer Gewitterwolke, die nie zu platzen schien, in ihrem Zimmer verbarrikadierte.
Eine ziemlich unsichere Existenz, erkannte Sandy. Denn irgendwann brachen Unwetter immer los.
Doch Ivys Anschuldigung war einfach absurd. Sandy hatte ihre Tochter von dem Moment an, da sie geboren wurde, heiß und innig geliebt und hart daran gearbeitet, eine enge Bindung zu ihr aufzubauen und zu erhalten. Sie hatte Ivy niemals angelogen, nicht mal auf Tricks zurückgegriffen, die alle Eltern nutzten: vielleicht zu sagen, wenn die Antwort eindeutig nein war, und zu versprechen, dass der Goldfisch wieder lebendig würde.
Jetzt war Sandy froh, dass Ben noch nicht zu Hause war, weil er wohl eine Last-Minute-Buchung hereinbekommen hatte. Nach dieser Szene hätte sie ihn nicht gerne hier gehabt.
Sandy rutschte von dem Hocker, auf dem sie gesessen hatte, und blickte zur Decke. Oben war es still, man hörte nur den ruhigen Atem eines bewohnten Hauses. Sandy sah Ivy vor sich, wie sie mit Kopfhörern in den Ohren auf ihrem Bett lag. Mac lag sicher daneben auf dem Teppich, weil er nicht mehr in der Lage war, aufs Bett zu springen. Sandy wandte sich zu den breiten Glastüren. Eine kreisrunde, orangefarbene Sonne brachte den Horizont zum Glühen.
Allmählich beruhigte sich Sandy wieder. Unwetter kamen, in der Tat, aber sie gingen auch wieder vorbei.
Da hörte sie Räder in der Kiesauffahrt knirschen und ging zur Tür, um Ben zu begrüßen.
Ins Freie zu treten war wie ein Sprung in kaltes Wasser. Sandy schlang sich die Arme um den Leib. »Die Temperatur ist heute mindestens um zehn Grad gefallen«, rief sie Ben zu.
Selbst nach zwanzig Jahren entlockte ihr der Anblick ihres Mannes noch ein Lächeln. Einen Moment lang wurde alles warm, und sie ging auf ihn zu.
Ben knallte die Tür des Jeeps zu und blickte zum Himmel. »Ich hatte gerade die ersten Buchungen für Skitouren. Morgen werden mindestens sechzig Zentimeter Schnee liegen.«
Ben leitete ein Unternehmen namens Off Road Adventures, das sich um Wochenendurlauber kümmerte, die in den Adirondacks Abenteuer mit einem wohl abgemessenen Spritzer Risiko suchten. Hin und wieder spöttelte Ben über seine Kunden – wenn dein Leben langweilig ist, hey, warum dann nicht eine Klippe hochklettern und ein bisschen Gefahr schnuppern? –, aber das war ein bisschen heuchlerisch, denn auch durch seine Adern strömte ein Überschuss an Adrenalin. Ben hatte jahrzehntelang Risikosportarten betrieben und künstlich das Gefahrenlevel seines Lebens gesteigert, bis er so gut darin war, dass er Neulinge in dieser Kunst unterweisen konnte.
Früher hatte Sandy ihn auf seinen Touren begleitet: Free-Climbing, Biking und Skifahren abseits der Pisten. Aber nach Ivys Geburt waren solche Aktivitäten nur noch schwer mit den Bedürfnissen ihrer Tochter in Einklang zu bringen, außerdem konnte Sandy das Risiko nicht mehr vor sich selbst rechtfertigen. Ben sehnte sich nach Herausforderungen, das hatte Sandy akzeptiert, als sie ihn heiratete. Doch Ivy brauchte zumindest einen Elternteil, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden blieb.
Sie folgte Bens Blick zum wolkenverhangenen Himmel. »Sieht ganz so aus.«
Ben kam zu ihr und stieg die Treppe hinauf. Er streckte die Hand aus, dann verschränkten sich ihre kalten Finger zur Begrüßung. »Wie läuft’s auf der Ranch?«
»Musste ein bisschen ausmisten, Cowboy«, erwiderte Sandy.
»War’s schlimm?«, fragte Ben mit einer Grimasse, die auch ein Grinsen sein konnte.
Sandy zuckte die Achseln. »Ivy hat mal wieder eine ihrer Launen.« Sie war überrascht, als ihre Augen zu brennen anfingen. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal geweint hatte, und man brauchte keinen Abschluss in Psychologie, um zu wissen, dass man sich von den Stimmungsschwankungen eines Teenagers nicht aus der Bahn werfen lassen sollte. Sie wandte den Kopf ab in der Hoffnung, Ben würde nur annehmen, die Kälte triebe ihr die Tränen in die Augen. »Komm jetzt«, sagte sie und schauderte leicht übertrieben. »Gehen wir rein.«
Doch Ben blickte zur Auffahrt zurück.
»Schatz?«, sagte Sandy.
»Sind die Macmillans zum Wochenende rausgekommen?«
»Was?«, fragte Sandy. Sie blickte in Richtung des großen Holzrahmenhauses, das Ben nur Villa Abbruchreif nannte. »Hmmm, ich weiß nicht. Jedenfalls hat niemand vorbeigeschaut.«
»Egal.« Ben umfasste mit einem Arm ihre Taille. »Ich dachte, da hätte sich was bewegt.«
»Wahrscheinlich nur der Wind«, sagte Sandy und erschauerte wieder, diesmal jedoch wirklich.
In der Küche schaltete Sandy den Herd an, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Sie wärmte kurz ihre Hände an der Flamme und ging dann die Heizung aufdrehen.
»Gib mir kurz Zeit, dann mache ich Feuer im Ofen«, bemerkte Ben.
Er holte eine Dose Red Bull aus dem Kühlschrank und knackte den Verschluss. Auch wenn er drei davon trank oder eine ganze Kanne Kaffee, schlief er noch wie ein Baby. Sandy war überzeugt, dass das mit seiner Berufswahl zu tun hatte. Ihr Mann konnte mehr Stimulation vertragen als die meisten Menschen. Genauer gesagt schien er das sogar zu brauchen.
Er trat auf die seitliche Veranda, und kurz darauf hörte Sandy, wie die Axt Holz spaltete. Ben liebte es, Holz zu hacken, und weigerte sich, zu Beginn der Saison Brennholz anliefern zu lassen. Zwar stammte er nicht von hier, doch in vielerlei Hinsicht war er wie die Alteingesessenen der Adirondacks, deren oberstes Gebot »Eigenständigkeit« lautete.
Kurz darauf kam Ben schwer mit Holz beladen in die Küche zurück und hockte sich vor den Ofen. »Glaubst du, Ivy würde mir ein bisschen Anzündholz holen?«
Sandy schnaubte. »Ich mach’s schon.«
Ben blickte auf. »Hey, San!«
Sie wandte sich von dem Schrank ab, in dem sie nach warmen Sachen gesucht hatte. Die nächsten fünf, sechs Monate würde man nicht mehr ohne Jacke oder Mantel vor die Tür gehen können. »Was ist?«, fragte sie und streifte ein paar Handschuhe über.
»Sag Ivy, sie soll es holen, ja?«
»Schatz …«, sagte sie hin- und hergerissen. Wenn sie jetzt erklärte, Ivy würde sich wahrscheinlich weigern, gab sie damit preis, wie aufsässig ihre Tochter geworden war. Bisher hatte sie das Ausmaß vor Ben geheim gehalten. Doch wenn sie Ivy bat, diese Aufgabe zu erledigen, würde es offensichtlich werden, und dann gab es mit Sicherheit großen Ärger.
Ben ließ ein Streichholz zwischen die aufgeschichteten Scheite fallen und knallte die Metallklappe zu. »Auch egal. Im Moment haben wir noch genug. Lass uns jetzt doch einfach essen.«
Sandy warf ihm einen dankbaren Blick zu. Sie fragte sich, ob er ihre Gedanken gelesen hatte. Während Ben den Tisch deckte, ging sie nach oben, um Ivy zu holen.
Genau wie sie es sich gedacht hatte, lag Ivy bäuchlings auf dem Bett, und ihre Unterschenkel in den Skinny Jeans ragten im rechten Winkel in die Höhe. Um ihren Hals schlängelte sich ein rotes Kabel, und ihr Kopf wippte zu einem unhörbaren Takt.
Als Sandy laut genug ihren Namen rief, um die Musik zu übertönen, wandte Ivy sich um. Mac lag auf dem Regenbogenteppich neben dem Bett und öffnete nur ein Auge.
»Dad ist gerade nach Hause gekommen«, erklärte Sandy. »Kommst du zum Essen runter?«
Ivy riss sich die Stöpsel aus den Ohren, woraufhin blecherne Musik ertönte. »Das kann doch nicht wahr sein!«
Stimmt, und kann ich dir irgendwie helfen?, hörte Sandy im Geiste. Früher wäre das Ivys Antwort darauf gewesen. Und das war noch nicht mal so lange her.
»Ja«, sagte Sandy. »Ich weiß. Es ist wirklich ein bisschen spät für ihn.«
Ivy unterdrückte ein Lächeln.
Derart ermutigt, ließ sich Sandy aufs Bett sinken.
»Steh auf, Mom«, befahl Ivy. »So gut war der Witz auch nicht.«
Sandy lachte. »Rutsch rüber«, sagte sie, und tatsächlich machte Ivy ihr Platz.
Kurz darauf fragte Sandy: »Papier oder Plastik?« Dieses Spiel spielten sie praktisch, seit Ivy sprechen konnte. Einer von ihnen nannte zwei Dinge zur Auswahl, und der andere musste sich entscheiden und dafür einen Grund nennen, so irrational er auch sein mochte. Manchmal führte dieses Spiel zu Diskussionen, manchmal auch zu heftigeren Debatten und hin und wieder zu Lachanfällen. Sandy dachte sich, jetzt könnte es gleichzeitig Eisbrecher und Friedensangebot sein.
»Papier«, antwortete Ivy. »Ist grüner.«
Sandy nickte. »Selbstverständlich.«
Macs pelzige Flanke hob und senkte sich im Rhythmus seines Hechelns. Ivy hatte recht: Sein Atem stank wirklich. Nach alt, müde und zu wenig Frischluft. Wenn sie das nächste Mal im Ort war, würde sie vom Bäcker ein paar der steinharten Plätzchen kaufen, auf die die Hundebesitzer unter ihren Patienten schworen.
»Heiß oder eiskalt?«, fragte Ivy.
»Heiß«, erwiderte Sandy und zeigte auf das Fenster, das in Ivys Zimmer immer gekippt bleiben musste, obwohl jetzt schneidend kalte Luft eindrang. »Erklärt sich von selbst.«
Jetzt nickte Ivy.
»Oben oder unten?«, fragte Sandy schließlich.
Schweigen. »Essen wir nur zu Abend und tun so, als wäre nichts?« Ivy atmete geräuschvoll aus. »So, als hätte ich nichts gesagt?«





























